Internationale Kommunikationskulturen


mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - >: Internationale Kommunikationskulturen. -- 9. Kulturelle Faktoren: Essen, Trinken, Geselligkeit. -- 3. Teil III: Beispiele. -- Fassung vom 2001-04-16. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur093.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2001-04-16
Überarbeitungen:
Anlass: Lehrveranstaltung, HBI Stuttgart, 2000/2001
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Länder und Kulturen von Tüpfli's Global Village Library
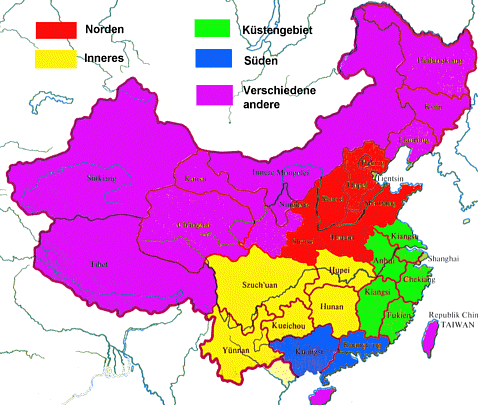
Abb.: Die großen Regionen chinesischer Küche
"Wie im gesamten Morgenland gilt auch in China die Gastfreundschaft als hohe Pflicht und Tugend. Zwar leben die meisten Chinesen sehr sparsam, doch selbst die Ärmsten schlachten für einen Gast ihr letztes Huhn und opfern die letzte Schale Reis. Gegenseitige Besuche und Verabredungen mit Verwandten, Freunden und Bekannten schließen in der Regel Bewirtung mit Speis' und Trank ein. Findet das Essen mit Freunden oder Verwandten zu Hause statt, trudeln die Gäste meist schon vorzeitig ein und helfen in der Küche mit.
Zum Auftakt kredenzt man dem Gast eine Schale Tee oder im Sommer ein kühles, erfrischendes Getränk. Wollte jemand nur »kurz vorbeischauen«, wird er dennoch, sobald die Zeit zum Mittag- oder Abendessen naht, zum Bleiben und Essen aufgefordert. Der Eingeladene wird unweigerlich ablehnen und auf die Mühe verweisen, die sein Verweilen verursachen würde. Nach mehrmaligem Hin und Her fällt schließlich die Entscheidung. Ein solches spontan arrangiertes gemeinsames Mahl fällt selbstverständlich bescheidener aus als ein geplantes.
Die Einladung zum Essen gilt als Ausdruck freundschaftlichen Empfindens. Reist man an einen anderen Ort und wird von dortigen Freunden und Bekannten nicht zum Essen eingeladen, gleicht dies einer Beleidigung und zeigt deutlich Verachtung. Nur auf ein Glas Wein oder Bier vor oder nach der Essenszeit eingeladen zu werden, dies widerfährt Ihnen kaum, weil man Alkohol üblicherweise nur zum Essen trinkt.
Das gemeinsame Essen dient auch dem schieren Vergnügen. Es findet nie in schweigsamer Runde statt. Je nach Anlas wird geplaudert, diskutiert, gelacht und in angeheiterter Runde auch gelärmt. In chinesischen Restaurants herrscht keine gedämpfte Atmosphäre, im Gegenteil wähnt man sich manchmal auf einem Fußballplatz in der Südkurve.
Auch finden wichtige Besprechungen beim Essen statt. Es heißt, die besten Geschäfte entstünden nicht am Konferenz-, sondern am Esstisch, denn ein gemeinsames Essen sei ein verführerisches Mittel, Beziehungen anzuknüpfen, zu pflegen und zu verbessern. Dies gilt sowohl für China und Taiwan wie (auch und vor allem) Hongkong. Manchmal treibt diese Art der Gastfreundschaft seltsame Blüten. So lädt man in China häufig Gäste zu einem üppigen Essen ein, um schnöde und gezielt eigene Interessen durchzusetzen. Auf der Kehrseite versagen notwendige Partner schlichtweg ihren Dienst. Eine Universität zum Beispiel wartete wochenlang auf den Anschluss ihrer neuen Gebäude an die Gasversorgung. Es fehlten zwei Meter Rohrleitung. Schließlich lud man einige Vertreter der Handwerkseinheit zu einem Essen ein -- und zwei Tage später hatte sich das Problem in Wohlgefallen aufgelöst. Oder nehmen wir das Beispiel der Devisenbewilligung: Die hierfür Verantwortlichen werden von den zahlreichen »bedürftigen« Firmen und Organisationen zu Festessen eingeladen, um sich ihrer Gunst zu versichern.
Chinesen feiern gern und bei jeder nur möglichen Gelegenheit. Zu einem großen Fest gehört immer ein ausladendes Mahl. Es setzt sich aus zahllosen Gängen zusammen, von denen in Europa drei oder vier ein festliches Menü bestreiten könnten. Es werden jedoch nicht nur die Gäste üppig bewirtet, sondern auch die Geister. In vielen Teilen innerhalb und außerhalb Chinas ist es üblich, den Ahnen leckere Speisen darzubieten, die, nachdem die Ahnengeister gesättigt sind, von den Lebenden verzehrt werden.
Deutsche Gastfreundschaft kann sich von der chinesischen durchaus und beträchtlich unterscheiden. Auch Yu Chien machte diese Erfahrung. Hier sein Bericht:
«Ich lebte erst kurze Zeit in Deutschland, als mich eines Tages ein Institutsleiter zum Abendessen einlud. In freudiger Erwartung traf ich pünktlich ein und machte mich mit den anderen Gästen bekannt. Die Dame des Hauses zog die Schiebetür zum Esszimmer auf; und zum Vorschein kam ein mit edlem Porzellan gedeckter Tisch. Kerzen verliehen dem Anblick einen feierlichen Glanz, obwohl, wie mir plötzlich durch den Kopf schoss, man bei Neonlicht sicher besser und lustvoller hätte entdecken können, was es zu essen gab. Auf dem Tisch standen einige Platten mit belegten kleinen Brotscheiben, die man mit der Hebelkraft eines Zahnstochers auf den eigenen Teller zu bugsieren hatte. Dies seien »Häppchen«, so informierte man mich. Ich fand diese Art der Vorspeise sehr originell und vor allem auch reichlich. Gerade deswegen hielt ich mich in Erwartung der folgenden Speisen zurück. Der erste Gang währte appetitanregend lange. Ich wurde schon leicht ungeduldig. Vor allem war ich sehr durstig. Als nämlich die Dame des Hauses Tee nachschenken wollte und ich ihr dafür dankte, goss sie keineswegs nach, sondern bediente die anderen, die sich erst nach dem Nachschenken bedankten. Dann wurden wir wieder ins Wohnzimmer gebeten. Die Deutschen sind wirklich vornehm, dachte ich in der Annahme, man bereite nun den Tisch für den nächsten Gang vor. Dieser ließ jedoch sehr auf' sich warten, und schließlich musste ich erkennen, dass das feierliche Abendessen sich auf die »Häppchen« beschränkt hatte. Unglaublich, flüsterte ich mir zu, wie geizig müssen diese Leute sein, und kehrte beleidigt heim. Erst viel später erkannte ich, dass dieses Abendessen nach deutschen Maßstäben recht kulinarisch ausgefallen war. Doch vergessen konnte ich jenen Abend nie.»
In China trägt man stets reichlich, wenn nicht gar üppig auf. Der Gast muss großzügig versorgt werden, damit er zufrieden nach Hause geht.
Unangemeldeter Besuch
In China gilt es als Selbstverständlichkeit, unangemeldet »hereinschneien« zu dürfen. Unter Freunden und Verwandten ohnehin üblich, schauen auch Nachbarn vorbei, die vielleicht nur neugierig erspähen wollen, was es nebenan zu essen gibt. Vor allem in den Regionen südlich des Yangzi, wo klimatische Bedingungen zu einem Wohnen bei geöffneter Haustür geführt haben, sind solche nachbarschaftlichen Besuche sehr verbreitet. Wenn jemand im Ausland studiert oder arbeitet, ist es durchaus üblich, dass die Freunde bei seiner Familie anklopfen und »nach dem Rechten sehen«.
Häufig führt Bekannte auch ein (un)bescheidenes Anliegen vorbei. Meist bringen sie dann ein kleines Geschenk als Entree mit. Kleine Geschenke überreichen auch Schüler, wenn sie ihre Lehrer aufsuchen.
Das unangemeldete »Vorbeischauen« kann einen ganzen Nachmittag oder Abend beanspruchen. Ob sich diese spontane Art der Freundschaftspflege mit wachsender Verbreitung des Telefons erhält, bleibt abzuwarten.
Kommt ein Besucher ungelegen, etwa weil man soeben andere Gäste empfängt, so muss man ihn dennoch hereinbitten und ihm einen Platz sowie eine kleine Erfrischung anbieten. Meist wird er sich bald verabschieden, vor allem wenn man ihn nicht mit Nachdruck zum Bleiben auffordert. Steht man unter Zeitdruck, sollte man dem Gast, nachdem er Platz genommen hat, »durch die Blume« mitteilen, wie beschäftigt man ist und wie viele Dinge auf Erledigung warten. Er wird diesen Hinweis verstehen und sich verabschieden. Schaltet der Besucher auf stur, kann man ihn höflich bitten, sich erst einmal auszuruhen, während man an die Arbeit zurückkehrt. Keinesfalls jedoch dürfen unangemeldete Besucher an der Tür abgewimmelt werden.
Gastgeschenke
Wer in China einen Besuch unternimmt, kommt nicht mit leeren Händen, sondern überlegt recht genau, was er wem zu welchem Anlass und in welchem Wert schenkt. Dabei spielt instinkthaft oder gar unverblümt die Überlegung mit, welchen Nutzen der Gebende aus der beschenkten Person ziehen kann.
Verwandte und Freunde schenken sich meist Kulinarisches, gehen private Besuche doch ohnehin nahezu immer mit Schlemmerei einher. Beliebte Mitbringsel sind leckeres Obst, ein fertiges Gericht, etwa eine Fleischspeise, oder ein großer frischer Fisch, eine Torte o.ä. Jemandem, der gerne zecht, schenkt man einen guten Schnaps, dem hobbybegeisterten Freund etwas zu seinem Interessensgebiet.
Geschenke sollen Großzügigkeit ausdrücken, doch zugleich dem relativen Stellenwert der Einladung entsprechen. Kommt der Gast nur für ein kurzes Gespräch vorbei, fällt seine Gabe selbstverständlich bescheidener aus als bei einer Einladung zum Essen oder gar einer Hochzeit. Ein zu billiges Geschenk kann den Gastgeber beleidigen, ein zu teures hingegen in erhebliche Verlegenheit versetzen. Der materielle Wert besitzt immer hohe Bedeutung.
Zu bestimmten festlichen Anlässen wird auch Geld verschenkt, so an Kinder anlässlich des Neujahrsfestes. Man übergibt das Geld in kleinen roten Papiertüten. Auch bei alltäglichen Besuchen erhöht man das Taschengeld der Kinder seiner Freunde und steckt ihnen die Spende in einem Augenblick zu, in dem die Argusaugen der Eltern sich abwenden.
Hochzeitsgeschenke dienen der Ausstattung des sogenannten »Brautzimmers«, mit dem die Wohnung gemeint ist. Die Geschenkwahl stimmt man mit den Angehörigen des Brautpaares ab. Fehlt das Brautzimmer, weil das Brautpaar zum Beispiel an getrennten Orten wohnen wird, schenkt man ebenfalls Geld -- und dies nicht zu knapp. Je nachdem, welche freundschaftlichen oder verwandtschaftlichen Bande den Gast an das Brautpaar knüpfen, kann seine Gabe ihn bis zu einem halben Monatsgehalt (nicht selten mehr) kosten. Manche Drückeberger haben ihre Einladung zu einer Hochzeitsfeier aufgrund der ihnen Alpträume bereitenden Kosten unter Vorwand abgesagt. Geachteten und/oder ranghöheren Personen beschert man bei Besuchen häufig Leckereien. So bringt mancher Student seinem Lehrer zur Zeit des Mondfestes »Mondkuchen« vorbei oder -- wenn er aus einer anderen Provinz stammt -- eine lokale Spezialität. Hohe Beamte erfreut man mit begehrten Raritäten, beispielsweise mit Tee der allerbesten Güte, der für »Otto Normalverbraucher« kaum erschwinglich und zudem in den Geschäften Chinas nicht zu erhalten ist, da die gesamte Produktion im Export oder (über Beziehungen) in den Geschenkschubladen einflussreicher Persönlichkeiten landet.
Wer sich auf Reisen begibt, bringt nicht nur seinen Familienangehörigen, sondern auch den Kollegen und engsten Freunde kleine Andenken mit. Vielen Auslandschinesen vergeht beim Gedanken an die zahllosen Geschenke, die die Zurückgebliebenen von ihnen erwarten, allerdings nahezu die Lust auf die Heimreise.
Nach China reisende Ausländer werden möglicherweise auch Geschenke machen wollen oder müssen. Selbstverständlich zählen auch hier Motivation und Anlass. Unter Freunden sollten Geschenke von einer phantasiereichen, persönlichen Auswahl zeugen. Dolmetscher, Experten und Wissenschaftler, oder anders ausgedrückt: Intellektuelle mit Fremdsprachenkenntnissen, zeigen vielfach starkes Interesse an Fachliteratur. Bei Aufmerksamkeiten für Geschäftsleute oder Reisebegleiter sei vorgewarnt, dass die Zeit der Wegwerffeuerzeuge und Kugelschreiber längst verstrichen ist. Jederlei technische und elektronische Bedarfsgeräte kämen hier gelegen. Bei Geschenken an Geschäftsleute spielt auch der materielle Wert eine Rolle; er lässt den Beschenkten auf die Achtung schließen, die er in den Augen seines Partners genießt.
Geschenke können verpackt oder unverpackt übergeben werden. Verpackte
Geschenke dürfen nicht in Anwesenheit des Schenkenden geöffnet werden, um
nicht als gierig zu erscheinen. Um dem Gastgeber ein sofortiges Ermessen der ihm
erwiesenen Ehre zu ermöglichen, überbringen daher manche Gäste ihre Geschenke
unverpackt. Ein verpacktes Geschenk darf man nur dann unverzüglich öffnen,
wenn der Schenkende darauf besteht. Üblicherweise nimmt der Gastgeber das
verpackte Geschenk in Empfang und stellt es beiseite, wobei er wiederholt
anmerkt, dass ein solcher Aufwand nicht nötig gewesen wäre.
Beim Abschied des Gastes versuchen besonders höfliche Gastgeber, ihm sein
Geschenk wieder mitzugeben, da es dieser Aufmerksamkeit schließlich nicht
bedurft hätte. Selbstverständlich weist der Gast dies von sich und drängt
seinem Gegenüber das Geschenk geradezu auf. Er darf aber großzügig anbieten,
dass der Beschenkte es ohne Bedenken weiterreichen mag, falls er dafür keine
Verwendung findet. Geschenke weiterverschenken beleidigt den Geber nicht.
Tischsitten
Essen am runden Tisch

Abb.: Chinesische gedeckte Tafel mit "fauler Susanne" (©Corbis)
Chinesen speisen ungern an langen, unübersichtlichen Tafeln. Gemeinsam essen bedeutet geselliges Beisammensein, und so sitzen sie mit Vorliebe Auge in Auge um einen runden Esstisch herum. Bei größeren Gesellschaften nehmen bis zu fünfzehn Personen an einem Tisch Platz. In der Mitte eines großen Esstisches steht meistens ein Drehtablett, die sogenannte »faule Susanne«, auf der die Speisen allen sichtbar und leicht zugänglich angerichtet sind. Durch leichtes Drehen kann sich so jeder Gast von jedem Gericht bedienen.
Mein Essen, dein Essen, unser Essen
Chinesen bestellen im Restaurant gemeinsam und genießen gemeinsam alle Speisen. Nichts amüsiert sie mehr, als eine europäische Gesellschaft im Chinalokal zu beobachten, bei der jeder getrennt bestellt, um sich -- wie langweilig -- brav ausschließlich seinem eigenen Gericht zuzuwenden, statt den Genuss zu teilen. Und anders als eine chinesische bestellt eine europäische Runde mitunter auch noch mehrmals ein und dasselbe Gericht.
Meist werden alle Speisen gleichzeitig aufgetragen und in die Mitte des
Tisches gestellt. Man rechnet in der Regel ein Gericht mehr, als Personen am
Tisch sitzen. Bei einem großen Essen dagegen serviert man die Gänge
nacheinander. Es kann gut und gern mehr als zwölf Gänge zählen. Allein zwei
davon könnten den Hauptgang eines westlichen Menüs bestreiten.
Die Hauptgänge bestehen meist aus Fleisch, Geflügel oder Meeresfrüchten.
Reine Gemüse- oder Doufu-Gerichte, die den Anschein von Ärmlichkeit oder Geiz
erwecken könnten, tischt man nur auf Wunsch eines Gastes auf oder wenn es sich
um sehr edles Gemüse, wie ausgefallene Pilze, handelt. Man arrangiert die
Speisen stets in gerader Zahl, so etwa vier, sechs oder acht kalte Vorspeisen,
die man meistens auf einer großen Platte anrichtet. Ihnen folgen vier, sechs,
acht oder mehr heiße Speisen und abschließend vielleicht zwei Süßspeisen.
Der Reis wird erst zum Schluss gereicht, um den Eindruck zu vermeiden, der
Gastgeber wolle seine Gäste mit Reis sättigen und beim Speisenangebot geizen.
Wie isst man?
Ein Gedeck besteht aus einer Reisschale, einem kleinen Teller und einem Paar Essstäbchen. Die Schale ist für den Reis bestimmt, der Teller für die Speisen.
Bei einem zwanglosen Essen im vertrauten Kreis serviert man den Reis zusammen mit den verschiedenen Gerichten. Viele füllen die Speisen gleich auf den Reis in ihrer Essschale statt auf den Teller. Die Schale hebt man mit der linken Hand an. Bei einem größeren Essen wird der Reis erst zum Schluss gereicht. In diesem Fall legen Sie kleine Portionen der angebotenen Speisen zunächst auf Ihren Teller. Dazu verwenden Sie, sofern vorhanden, das Vorlegebesteck, ansonsten Ihre Stäbchen. Wenn Sie sich mit den Stäbchen von der Platte bedienen, sollten Sie darauf achten, dass der Bissen nicht geradewegs in Ihren Mund wandert, sondern zunächst auf dem Teller abgelegt wird oder diesen zumindest kurz berührt. Wenn Sie Reis essen, so sollten Sie Ihre Schale zum Mund heben und sich mit den Stäbchen den Reis zuschäufeln. Die Sitte, seine Schale nicht anzuheben, sondern auf dem Tisch stehenzulassen, ist zwar sehr verbreitet, entspricht jedoch keineswegs den Höflichkeitsregeln.
Sitzordnung
Die beiden Ehrenplätze befinden sich zu Seiten des Gastgebers. Der Hauptgast sitzt rechts vom Gastgeber und möglichst mit dem Gesicht zur Tür. Dieser Brauch ist ein Relikt aus vergangenen gefährlichen Zeiten, in denen der Hausherr so seinem Gast die Sicherheit verleihen wollte, nicht hinterrücks überfallen zu werden. Dem Gastgeber zur Linken sitzt der zweitwichtigste Gast. Hat man Sie gegenüber vom Gastgeber platziert, so dürfen Sie sich in der Gewissheit sonnen, innerhalb der Runde auf der untersten Stufe der Rangleiter zu stehen. Ist ein Nebengastgeber anwesend, so sitzt dieser dem Gastgeber gegenüber, mit dem zweitwichtigsten Gast zu seiner Rechten. In großer Runde nimmt man in gemischter Folge Platz, d.h. in abwechselnder Ordnung von Gästen und Gastgebenden bzw. Männern und Frauen. Erst wenn sich der Ehrengast niedergelassen hat, setzen sich auch die anderen Gäste.
Kinder werden zu offiziellen Essenseinladungen nicht mitgenommen. Anders verhält es sich bei einem Essen im Familien- und Bekanntenkreis. Nehmen mehrere Kinder daran teil, so setzt man sie meist zusammen an einen »Kindertisch«.
Aufforderung zum Essen
Der Gastgeber gibt mit einem höflichen Qing! (ausgesprochen: tjing = »bitte!«)
seinen Gästen das Zeichen, mit dem Essen zu beginnen.
Wundern Sie sich nicht, wenn er einleitend kleinlaut, doch vernehmlich gesteht, es gäbe nichts zu essen, während vor Ihren Augen die Tischplatte unter der Last der Speisen nahezu zusammenbricht. Hat der Ehepartner des Gastgebers gekocht, wird er entschuldigend darauf hinweisen, dass das Essen nicht besonders gut gelungen ist, selbst wenn es Ihnen besser mundet als in jedem 4-Sterne-Restaurant. Hat der Gastgeber den Kochlöffel geschwungen, so wird er vor den Gästen seine Unfähigkeit herausstellen. Derlei Bescheidenheitsfloskeln, auf die Sie als Gast mit freundlichem Protest antworten sollten, entspringen der chinesischen Höflichkeit. Sich selbst bescheiden geben und dem anderen Respekt zollen, dies ist eine Grundregel im Umgang unter Chinesen. Der Gastgeber will damit ausdrücken, dass das angebotene Essen, so vorzüglich und aufwendig es auch sein mag, nicht der Ehre entspricht, die ihm der Gast durch seinen Besuch zuteil werden lässt. Stets begleitet ihn die Sorge, seinen Gast nicht zufriedenzustellen.
Bewirtet man Gäste in der Wohnung, so beginnen diese mit dem Essen, auch wenn der Ehepartner des Gastgebers bzw. der Gastgeberin noch am Küchenherd steht. Denn die meisten Gerichte der chinesischen Küche lassen sich nicht vorbereiten und warmhalten, sondern erst dann fertigstellen, wenn die Gäste schon am Tisch sitzen.
Dem Gast und dem Nachbarn dienen
Der Gastgeber fordert zuerst den Ehrengast auf, zuzugreifen und sich zu bedienen. Dieser hält sich in der Regel jedoch höflich zurück, und so übernimmt es der Gastgeber, ihm die ersten Leckerbissen aufzutragen. Ein Gast, der sich flugs die nächste Platte schnappt und eine stattliche Portion auf den Teller schaufelt, gilt als überaus unhöflich und gierig.
Auch bei großen Runden und einer verschwenderischen Auswahl sollten Sie
stets auf den Anteil der anderen achten. Wenn Sie nicht wissen, wieviel Ihnen
zusteht, sollten Sie im Geiste die Menge des Gerichts durch die Anzahl der
Anwesenden teilen.
Der Gastgeber greift zum Schluss zu. Für alle anderen am Tisch ist es ebenfalls
eine höfliche Geste, zunächst die seitlichen Nachbarn und erst dann sich
selbst zu bedienen. In den besseren Restaurants, vor allem in Hongkong, stellt
der Kellner jedes Gericht in die Mitte, verteilt die Speisen auf frische Teller
und reicht diese dann den Gästen bzw. lässt sie auf der »faulen Susanne«
stehen, so dass sich jeder selbst nehmen kann.
Kunstfertigkeiten der chinesischen Zunge
Die chinesische Zunge ist nicht allein feinsinniges Instrument des kulinarischen Genusses, sie vollbringt darüber hinaus wahre Kunststücke der Akrobatik, die sie insbesondere beim Verzehr von Schalentieren unter Beweis stellt. Während ein Europäer mit viel List und Tücke sich das köstliche Fleisch eines Scampis oder Krebses einzuverleiben versucht, beißt ein Chinese kurzerhand ein Stück ab, lässt es genüsslich im Mund verschwinden und spuckt wenig später die blanken Schalen auf den Teller. Auch Gräten stehen der Esslust nicht im Wege. Statt sie umständlich vor dem Verzehr zu entfernen, werden sie im Mund mit der Zunge vom Fleisch gelöst und dann ausgespuckt oder mit den Stäbchen auf dem Teller abgelegt.
Ohne Schlürfen schmecken Nudeln nicht
Mit Ausnahme lautstarken Schneuzens ist heutzutage am chinesischen Esstisch fast alles erlaubt. Vor der Revolution zählte in den gebildeten Familien eine Vielzahl von Tischmanieren zum guten Ton, die in den letzten Jahrzehnten als »bourgeois« abgestempelt wurden.
Wenn Sie sich an das geräuschvolle Essen gewöhnt haben und inzwischen selbst mit genussvoll-kennerischem Schmatzen Ihre Zufriedenheit ausdrücken, sollten Sie bei Einladungen vorsorglich darauf achten, wie es Ihr Gastgeber hält. Denn bei genügend Chinesen erregen Schmatzen, Aufstoßen und Spucken ebensolchen Anstoß wie bei den meisten Europäern.
Zum Schlürfen sei jedoch gesagt: Eine Suppe »trinken«, wie es im Chinesischen heißt, oder Nudeln essen, ohne dabei zu schlürfen, dies ist schier unmöglich. Dabei lässt sich das Schlürfen sowenig ersetzen wie einst das Salz in Omas Suppe. Hier erhebt das Schlürfen die platte Befriedigung eines leiblichen Bedürfnisses zum genussvollen sinnlichen Erlebnis. Auch der Tee wird, wenn er zu heiß ist, geschlürft -- und viele Chinesen erweisen sich im Gegenzug als unerfahrene Kaffeetrinker, wenn sie den Kaffee genüsslich aus dem kleinen Löffel schlürfen.
Auf das Wohl der anderen
In Gesellschaft ist es nicht üblich, Hochprozentiges einsam und allein in sich hineinzukippen. Nach dem ersten Einschenken richtet der Gastgeber einige Worte an seinen Gast, heißt ihn noch einmal willkommen und trinkt mit ihm auf sein Wohl, auf die Zusammenarbeit u.ä. Auch von dem Gast wird ein Toast erwartet, der jedoch nicht unmittelbar an jenen des Gastgebers anschließen muss. Im weiteren Verlauf prostet man immer wieder einander zu und leert das Glas. Es gilt als unhöflich und gierig, hochprozentigen Getränken wortlos im Alleingang zuzusprechen. Das stetige Auffordern zum Trinken zählt zu den Aufgaben des Gastgebers. Da er mithalten muss, sollte er wohlweislich nicht Antialkoholiker sein. Sobald man Ihnen (ob harte oder weiche Getränke) nachschenken will, d.h. ehe Ihr Mundschenk das Glas aufgefüllt hat, sollten Sie sich bedanken. Und seien Sie gewarnt: Chinesen schenken spätestens beim halbvollen Glas nach. Sie können sich vor dem Nachschenken retten, indem Sie schlicht und einfach, doch bevor Sie vom Stuhl fallen, nicht weitertrinken. In China gießt man die Gläser bis zum Rand voll, denn dies zeugt von Großzügigkeit und Überfluss.
Eine Zigarette zwischendurch
Wenn Sie dem Nikotin verfallen sind, werden Sie erleichtert zur Kenntnis nehmen, dass während eines chinesischen Essens ohne weiteres eine kleine Rauchpause eingelegt werden kann. Ihre (chinesischen) nichtrauchenden Tischnachbarn nehmen daran keinen Anstoß.
»Zigaretten und Alkohol gehören allen« (Chinesisches Sprichwort)
In Deutschland deckt sich jeder Raucher mit einer Packung Zigaretten ein und bedient sich davon, meist ohne seinem Nachbarn oder der Runde ebenfalls eine Zigarette anzubieten. Die Flasche Bier steht unverrückbar und wie von einem unsichtbaren Zaun umgeben neben dem dazugehörigen Glas.
In China wäre es sehr unhöflich, nicht zu teilen. Dort bedient man die anderen, ehe man sich selbst einschenkt. Dies gilt für alkoholische wie alkoholfreie Getränke. Zigaretten werden großzügig angeboten (starke Raucher sollten also für genügend Vorrat sorgen). Man reicht nicht die Schachtel, sondern entnimmt ihr eine einzelne Zigarette und überreicht diese seinem Nachbarn.
Der Tisch als Ablageplatz
In den Familien und einfachen Restaurants wird das Geschirr auf die blanke Tischplatte gestellt. Diese Sitte ist sehr praktisch, denn viele legen ihre Tischabfälle, Gräten, Schalen, Knochen usw., neben der Essschale auf dem Tisch ab. Nach dem Essen sind diese Reste schnell vom Tisch gewischt. Bessere Restaurants breiten eine Tischdecke aus. Dort gehört zum Gedeck eine Reisschale sowie ein kleiner Teller, auf den man sich kleine Portionen der Gerichte legt oder auf dem sich der Abfall zwischenlagern lässt. Viele lassen sich jedoch auch von der Tischdecke nicht abhalten und verwenden sie als Mülldeponie. Nach dem Mahl wickelt der Kellner dann die Tischdecke samt Abfall zusammen und gibt sie in die Wäsche. Bei abfallreichen Speisen wie Schalentieren oder Rippen wechselt man in guten Restaurants nach jedem Gang den Ablageteller.
Die ausländischen Krümelmonster
Die Angewohnheit, Abfälle auf die Tischplatte zu legen, hat es mit sich gebracht, dass die Tischplatte als unsauber gilt. Speist man außer Haus, so ist es nicht üblich, Essen vom Tisch aufzunehmen, das einem beim Zugreifen vielleicht von den Stäbchen oder vom Löffel gerutscht ist. Selbst vom blitzblanken Tischtuch hebt man nichts auf.
Um so mehr erstaunt es Chinesen, wenn Ausländer vom Tisch Krümel aufsammeln und im Mund verschwinden lassen. Man empfindet dies nicht bloß als unhygienisch, sondern stellt sich bei diesem Anblick unweigerlich die Frage, wie gierig und/oder verhungert der Ärmste wohl sein muss. Welchen Grund besäße er sonst, selbst den letzten Krümel noch verspeisen zu wollen?
Der Anstandshappen
Ein chinesischer Gastgeber fühlt sich beschämt, wenn alle Gerichte aufgegessen werden. Leergeputzte Schalen und Platten liefern den eindeutigen Beweis, dass er mit dem Essen gegeizt hat. Selbst wenn es allen noch so vorzüglich mundet, müssen stets Reste von der geschlagenen Schlacht und der Großzügigkeit des Gastgebers zeugen. Von vornherein wird der Gastgeber im Restaurant so viel bestellen oder zu Hause so viel vorbereiten, dass er beruhigt mit einer angemessenen Menge von Resten rechnen kann. Erst dann hat er seine Großzügigkeit bewiesen. Deutet sich im Laufe der Mahlzeit an, dass das Essen knapp werden könnte, bestellt er -- meist Gemüsegerichte -- nach.
Nicht aufessen bedeutet keine Sünde
Den Drill der Kinderstube noch in Erinnerung, fühlen sich viele Europäer
unter Zwang, ihren Teller bzw. ihre Schale blitzblank zu essen. Dies führt
unweigerlich dazu, dass der Gastgeber nachlegt; täte er es nicht, gälte er als
unhöflich und geizig. Wer dieser freundlichen Nötigung entgehen möchte,
bremst seine Kaumuskeln und lässt die Reste auf dem Teller liegen.
Zwei Studentinnen, die einmal mit uns in Hongkong weilten, wussten nichts von
dieser Möglichkeit. Als wir bereits das fünfte Mal zu einem großen Mahl
eingeladen wurden, flossen beiden die Tränen. Sie fürchteten, Hongkong als
Stopfenten verlassen zu müssen, denn sie aßen stets brav auf, was ihnen
aufgelegt wurde - mit dem Erfolg, dass unverdrossen nachgereicht wurde und die
Chinesen sich wunderten, welche Berge an Essen zwei solch junge Mädchen
vertilgen konnten.
Niemand empfindet es als unhöflich, Reste liegen zu lassen. Eine Ausnahme jedoch erfordert Fingerspitzengefühl. Wird man in ärmere Familien eingeladen und bemerkt, dass das Essen zur Neige geht, sollte man zügig seine Schale mit dem Hinweis leeren, nichts verschwenden zu wollen. Eine derartige Reaktion löst Respekt aus.
Zahnstocher
Nach dem Essen werden Zahnstocher auf den Tisch gestellt, die vor allem ältere Personen gern benutzen. Obwohl sich viele nicht daran halten, verlangt es die Höflichkeit, beim Zahnstochern die linke Hand vor den Mund zu halten. Man sollte sich nicht wundern, wenn einige Gäste ihre Speisereste nach dem Stochern auf den Boden spucken, selbst wenn er mit einem Teppich ausgelegt ist.
Der Abschluss
Trifft man sich im Restaurant, wird unmittelbar nach dem letzten Gang und einem abschließenden Tee das Treffen beendet. Die Unterhaltung wird weder am abgedeckten noch am unabgedeckten Tisch fortgesetzt. Auch reicht man keinen Alkohol mehr. Der Gastgeber erhebt sich und bedankt sich bei seinen Gästen für den Besuch. Auf unerfahrene Ausländer wirkt solch ein Ende der Gastlichkeit meist sehr brüsk. So wie der Gastgeber als erster gekommen ist, geht er auch als letzter. Er begleitet seine Gäste hinaus und sorgt dafür, dass sie gut auf den Weg kommen.
Findet das Essen zu Hause statt und verfügt der Gastgeber über ein Esszimmer, erhebt man sich abschließend und nimmt den Tee im Wohnzimmer ein. In vertrauter Runde helfen die Gäste beim Abräumen und Abwaschen. Beliebig und zwanglos wird der Abend dann fortgesetzt. Manche plaudern, andere spielen Karten oder majiang. Das Majiang-Spiel war lange Zeit verpönt, da vorzugsweise um Geld gespielt wird und so mancher in einer einzigen Nacht Haus und Hof verloren hat. Erst in den letzten Jahren tauchte das Spiel in der Volksrepublik zaghaft wieder auf, während es in Hongkong, Taiwan und Südostasien seit jeher als beliebtestes Gesellschaftsspiel gilt.
Der Kampf um die Rechnung
Wenn Chinesen miteinander essen gehen, findet zum Schluss meist ein Kampf um die Rechnung statt, außer es wurde zuvor entschieden, wer wen einlädt. Wer bezahlen möchte, steht meist kurz vor Abschluss des Essens unter einem Vorwand auf und begleicht die Rechnung am Tresen, möglichst ohne die anderen dies merken zu lassen. Wird seine Finte aufgedeckt, folgt ihm der eine oder andere und zankt um die Rechnung. Häufig geschieht dies auch am Tisch, wenn der Kellner die Rechnung auf einem Teller überreicht. Ist der Kampf entschieden, legt der »Sieger« das Geld oder die Kreditkarte unter die Rechnung. Wetteifern um das Begleichen der Rechnung gehört zu den Ritualen der Höflichkeit.
Es ist jedoch nicht so, dass immer derselbe mit Siegernaturell zahlt. Hinter dem Wettbewerbsbrauch verbirgt sich eine genaue »Buchhaltung«. Alle wissen, wer beim letztenmal bezahlt hat und jetzt die Börse zücken muss. Es ist sehr schwierig für einen Ausländer, dieses Spiel zu durchschauen. Man beginge einen gewichtigen Fehler, achselzuckend stets den anderen zähen Kämpfern das Feld zu überlassen. Wer einmal »verloren« hat, sollte beim nächsten Mal von vornherein klarstellen, dass er bezahlt. Und dann muss er seinen Willen durchsetzen. Sehr unverständlich erscheint es Chinesen, wenn jeder getrennt zahlt.
Trinkgelder
Lange Zeit war es in China verpönt, Trinkgelder zu überreichen. Diese Einstellung hat sich in den letzten Jahren gerade im Umgang mit Ausländern radikal geändert, auch wenn es offiziell nach wie vor nicht gestattet ist, Trinkgeld anzunehmen. In vielen Bereichen der Touristik und des Geschäftslebens läuft nichts mehr ohne ein fettes Schmier- bzw. Trinkgeld, dessen Höhe sich nicht unbedingt an chinesischen Verhältnissen orientiert, sondern durchaus ungeniert an westlichen. Auch in den internationalen Hotels und den teuren Restaurants der Großstädte nimmt das Personal Trinkgelder an, sofern dies nicht vor den Augen anderer geschieht. In Hongkong und auf Taiwan hingegen erwartet man Trinkgelder.
Verabschiedung von Gästen
Das Verabschieden von Gästen gerät in China stets zu einer längerwierigen Prozedur. Nichts erscheint beleidigender, als den Gast nur bis zur Wohnungstür zu begleiten und hinter ihm sogleich die Tür zu schließen.
Chinesen geleiten ihre Gäste hinaus, häufig (vor allem bei älteren Gästen) nicht lediglich bis vor die Tür, sondern auch bis zur Straße, zum Auto oder zur nächsten Straßenecke. Man bedankt sich nochmals für den Besuch und ruft ihnen ein Man man zou! (»Gehen Sie langsam!«) nach, das einem »Kommen Sie gut nach Hause!« gleichkommt. Der chinesische Gast wird seinerseits beim Verlassen der Wohnung und des Hauses wiederholt betonen, dass der Gastgeber ihn nicht hinausbegleiten muss. Der Standardsatz hierfür lautet: Bu yao song! Seine Abwehr wird den höflichen Gastgeber jedoch nicht beirren. Wer in einem mehrstöckigen Haus wohnt und mit dem Gast eng vertraut ist, muss ihn nicht unbedingt hinunterbegleiten, sondern kann am Fahrstuhl oder an der Treppe Abschied nehmen. Doch auch dann gilt es zu warten, bis die Gäste außer Sichtweite sind. Erst danach darf man die Wohnungstür zuziehen."
[Kuan, Yu-Chien , Häring-Kuan, Petra: Reisegast in China. -- 3. Aufl. -- Dormagen : Iwanowski, ©1999. -- (Reisegast). -- ISBN 3923975716. -- S. 143 - 156. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
In Indien findet man so viele Tabus bezüglich dessen, was man essen darf, mit wem man essen darf, und so viele Vorschriften, wann man fasten soll, wie kaum sonst wo. Trotzdem muss man sich vor Verallgemeinerungen hüten. Auch im Bereich des Essens gilt für Indien, dass die Vielfalt unüberschaubar ist. Die folgenden Zitate sollen einen kleinen Eindruck von dieser Vielfalt geben und dazu anleiten, in Indien selbst die Situationen zu erfassen und sich entsprechend zu verhalten.
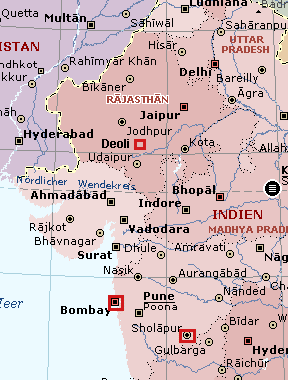
Abb.: Lage von Sholapur, Deoli, Bombay (Mumbai) (©MS-Encarta)
Einladung für Ausländer bei Herrn Moraji, Brahmane und Besitzer einer Spinnerei mit mehreren Tausend Arbeitern, Sholapur, Maharasthra, um 1930:
In seinem hochinteressanten Buch
Fürtwängler, Franz Josef: Indien : das Brahmanenland im Frühlicht. -- Berlin : Büchergilde Gutenberg, ©1931. -- 255 S. : Ill.
schildert der Autor eine Einladung bei einem brahmanischen Fabrikdirektor:
"Oft genug begegneten uns gebildete Inder, die den Übergang vom Alten zu Neuem durch teilweise Angleichung an den Westen vollzogen hatten. Nicht selten beginnen sie dies damit, dass sie ihren weißen Überwurf ablegen, sich dafür Oxfordhemden und gebügelte Hosen anziehen und eine Schreiberstelle bei einer englischen Exportfirma annehmen oder selbst ein Einfuhrgeschäft mit Rattengift, Regenschirmen oder Papierwaren betreiben. Andere wieder behalten die tropische Toga und das riesige gestickte Halstuch des »Eingeborenen« bei und reden von Konstitution und Parlament, als wären dies philosophische Lehren aus den heiligen Vedas, bleiben dabei Orientalen und bringen es weder zu der Disziplin noch zu der Energie, die sie von den Engländern lernen könnten und die sie brauchten, um ihr Land und sich selbst frei zu machen. Das sind die Gestalten, über die Rudyard Kipling [englischer Schriftsteller, geboren inÿBombay 1865, gestorben in London 1936] seinen Spott ergießt. Ihre Zahl ist nicht klein, wenn es auch ungerecht wäre, sie die Mehrheit unter den europäisch gebildeten Indern zu nennen. Nichts ist eben für die Kinder der beschaulichen Hindukultur und indischen Naturverbundenheit schwerer, als vom Europäer die positive Seite, die Aktivität im Ringen mit Natur und menschlicher Umwelt zu übernehmen.
Herr Moradschi, der Schiwa-Brahmane, hat gerade das gelernt, und was das imponierend Seltene an ihm ist -- er hat sich dazu weder Oxfordhemden noch Bügelhosen angezogen, sondern ist ein indischer Brahmane geblieben -- in seiner persönlichen Lebensführung, wohlverstanden!
Auf seiner Stirne steht, mit grellen Farben aufgetragen, das Kastenzeichen des Schiwapriesters, die fingerbreiten drei Querstriche, welche die ganze Schädelfront überziehen. Er geht barfuss, und seine Kleidung ist der Dhoti, das Untertuch, welches Unterzeug und Hose ersetzt, und der weiße Tschadcar oder Überwurf.
In einer für seine Besucher und Gäste erbauten Villa erhielten wir Wohnung. Und an seiner Gasttafel fehlte nichts, was ein erstklassiges Hotel zwischen Kairo und London zu bieten hat. Er selbst -- der Stinnes [Hugo Stinnes, deutscher Unternehmer, 1870 - 1924] des modernen Indien, der seine Hände nach den mannigfachsten Wirtschaftszweigen ausstreckt, außer der hiesigen Fabrik noch andere in Bombay besitzt, in indischen Gewässern Schiffe laufen hat, an Eisenbahngesellschaften beteiligt ist und Geldsummen in die Tata-Werke des »indischen Krupp« steckte -- sitzt am oberen Tischende vor einem Napf voll grobkörnigen Reises, den er mit der rechten Hand isst und Wasser dazu trinkt. Drei solche Mahlzeiten genießt er täglich und sechs Schoppen des dünnen prosaischen Getränks.
Und doch nimmt er sich vor uns, den fürstlich bewirteten Gästen, einen Vorzug heraus, den unsere grobmaterialistischen Europäeraugen, die nur an Zimmerprunk, Schlemmertafel, Whisky- und Likörflaschen haften, gar nicht bemerken -- ihm reicht seine dürftige Reisschüssel ein Brahmane, ein Hoher, ein Gleichgestellter. Unser üppiger Schmaus aber wird von gewöhnlichen Parias serviert, von Ausgestoßenen der Menschheit, die ausschließlich den unreinen Fleischfressern aus dem Westen dienen, ob diese Tippfräulein sind in Thacker's Library in Kalkutta oder Lord Irwin, der Vizekönig in Delhi. Ob Herr Moradschi bei aller Etikette der Gastfreundschaft das süße heiße Lustgefühl der Erniedrigung und Rache empfand, die er uns dergestalt antat? Ich weiß es nicht -- glaube es nicht. Er und ich sind jedenfalls bald gute Freunde geworden. Mir gefiel sein leidenschaftlicher Hass gegen die Fremdherrschaft und die Schmach, unter der sein Land jeden Tag, jede Stunde, jede Minute leidet, und gegen diejenigen seiner Landsleute, welche dieser Schmach sich dienstbar machen. Und dem klugen Brahmanen konnte meine Empfindung sicherlich nicht verborgen bleiben." [S. 109 - 110]
Bewohner von Deoli, Rajasthan, 1951/52
Der englische Psychiater G. Morris Carstairs, der selbst in Indien geboren wurde und dort aufwuchs, schildert Ansichten in einem Dorf in Rajasthan:
"Zölibat war das erste Erfordernis zu wirklicher Gesundheit, weil jeder Orgasmus den Verlust von Samen bedeutete, der ja so mühsam gebildet wurde. Hier gab es ein weiteres Dilemma, da man Söhne zeugen und seine Frau befriedigen musste. Deshalb ist ein Kompromiss unumgänglich; man muss den Geschlechtsverkehr auf eine bestimmte Anzahl von Gelegenheiten beschränken. Um den Raubbau durch Geschlechtsverkehr wieder auszugleichen, müssen gewisse Regeln beachtet werden. Man sollte »kalte Nahrung« essen, darunter Milch, Butter, Weizenmehl, Reis, Zucker und fast alles Obst. »Heißer Nahrung« wie etwa Gemüse, Öl, Mais- und Hirsemehl, unraffinierten Zuckers sowie scharfer Gewürze sollte man sich enthalten. Mir fiel auf, dass die »kalten« Nahrungsmittel die teureren waren, wogegen die »heißen« von der Mehrheit der Bevölkerung, den unteren Kasten, gegessen wurden.

Abb.: Traditionelles indisches Essen (©Corbis)
Über Fleisch, Eier und Wein waren die Meinungen geteilt. Alle Brahmanen und Banias [Angehörige des Händlerstandes] (mit Ausnahme von Rajmal und Daulmal) und einige fromme Rajputs [Angehörige des Adels] erklärten, Alkohol sei »heiß«, und man müsse sich seiner enthalten, aber die meisten Rajputs glaubten, Alkohol, regelmäßig und in kleinen Mengen genössen, mache stark. Rajputs empfahlen den Genuss von Eiern und Fleisch, Speisen, die die anderen nicht anrührten. Nur Rajmal bildete hier wieder eine Ausnahme. Da er seiner Meinung nach auf sexuellem Gebiet der aktivste Mann am Ort war, hatte er viel über diese Angelegenheit nachgedacht. Er war zu dem Schluss gekommen, der schnellste Weg, verlorenen Samen zu ersetzen, sei, rohe Eier und Honig, in Milch geschlagen, zu trinken.
Es genügte jedoch nicht, nur die richtige Nahrung zu sich zu nehmen, um Samen wiederzugewinnen, noch war der sexuelle Akt die einzige Möglichkeit, Samen zu verlieren. «Zwei Dinge führen zum Verlust des Samens», sagte Aman Singh, «Badparhez und Badpheli -- das heißt, essen, was falsch ist, und tun, was falsch. ist.» Zu-falschem Tun zählte er nicht nur sexuelle Promiskuität, sondern auch jeden Verstoß gegen den Hindu-Dharma, wie etwa, wenn man mit Angehörigen unterer Kasten verkehrt und mit ihnen zusammen isst, oder wenn man den Älteren nicht die gebührende Achtung erweist, wenn man übermäßig trinkt und sich gegen Zorn, lüsterne Gedanken, Angst oder übertriebene Sorge nachgiebig zeigt. In all diesen Fällen wird der Samen gerinnen und schlecht werden, so dass er nicht mehr länger behalten werden kann. Er wird dann als dünne, übelriechende Flüssigkeit ausgeschieden. Folglich galt jede eitrige Ausscheidung, die aus dem Innern des Körpers zu kommen schien, als »verdorbener Samen«, ob sie nun aus den Augen, Ohren oder der Nase kam oder im Auswurf oder Stuhl auftrat."
[Carstairs, G. Morris: Die Zweimal Geborenen. -- München : Szczesny, ©1963. -- Originaltitel: The Twice-Born. -- S. 110 - 111]
Ein Brahmane sagte zum Autor: "Wir Brahmanen können keine Nahrung aus der Hand eines anderen essen. Auch andere Kasten haben gewisse Beschränkungen. Wir können Wasser von Mitgliedern anderer Kasten annehmen, nicht aber Nahrung." [a.a.O., S. 317]
Bewohner von Bombay, 1980er Jahre
Die folgenden Zitate sind entnommen aus:
Menschen in Bombay : Lebensgeschichten einer Stadt / [hrsg. von] Barbara Malchow ; Keyumars Tayebi. -- Reibeck : Rowohlt, ©1986. -- 249 S. : Ill. -- (rororo aktuell ; 5918). -- ISBN 349915918X
Dieses Buch ist eine Sammlung der Wiedergabe von Gesprächen mit Bewohnern von Bombay (Mumbai) aus verschiedensten sozialen Schichten.
Pandit Bhagwat, Brahmane, Hindu-Priester, 67 Jahre alt: "Jetzt, sogar wenn ich in der Nacht erst um 10 oder 11 Uhr zurückkomme, nehme ich mir eine Stunde Zeit für meine Puja [Andacht]. Wenn ich damit fertig bin, dann ist es schon ca. 12 oder halb eins, dann erst nehme ich mein Abendessen zu mir. Milch, Roti [Fladenbrot] und eine Sorte Gemüse. Nichts weiter, meine Mahlzeiten sind sehr dürftig. Was ich esse, kann ich an meinen Fingern aufzählen! Morgens meistens Reis, Dal [Linsenmus] und ein Gemüse und Tee. Niemals esse ich Zwiebeln oder Knoblauch! Und die Gemüse dürfen nicht scharf gewürzt sein. In meinem Haus wird niemand scharf gewürztes Essen nehmen, aber Salz essen wir natürlich. Das ist eine Medizin und gut fürs Lachen! Früchte essen wir auch, aber wir kaufen sie nicht, sondern, was immer wir als Yajamanya [Opferlohn] oder während der Puja bekommen, das essen wir. Sonst interessiert mich nichts in der Welt! Es können Süßigkeiten sein oder alles, was Sie sich nur denken können. Das ist alles nutzlos für mich, außer vielleicht Supari [Betelnuss], das tue ich ins Pan [Betel], damit ich frisch bleibe. Weintrinken -- nein, nein, überhaupt nicht, das wird als schlecht betrachtet --, als Verbrechen, als Mord, obwohl die Götter früher immer getrunken haben. Aber später ist es dann aus bestimmten Gründen verboten worden.

Abb.: Teezubereitung in indischem Teehaus (©Corbis)
Jetzt hören Sie mir mal zu: Ich bin 67 Jahre alt. Und Sie sehen im Moment vielleicht stark aus, aber wenn ich ihre Hand nehme und drücke, dann werden Sie den Schmerz nicht aushalten können! Das sind die Sachen, die ich in den alten Zeiten gegessen habe, die man heute gar nicht mehr kriegen kann, das hat mir Kraft gegeben! Und so, wie ich jetzt in meinem Alter von 2 Uhr bis 8 Uhr an einem Platz sitze und schreibe . . .? Wenn Sie da einen jungen Burschen schicken, der mit mir sitzen soll, wenn ich ihm diktiere, dann wird er dazu nicht imstande sein. Zwanzigmal wird er seine Stellung ändern und seine Beine bewegen! Und das ist deshalb, weil man heute solche Sachen nicht mehr kriegt! Wir waren 3 Brüder, und meine beiden Onkel hatten auch jeder einen Sohn, also waren wir 5 zusammen. 5 Büffel hatten wir bei uns, die uns immer mindestens auch 5 Liter Milch gegeben haben. Die Milch haben wir niemals weggegeben, nicht verkauft, sondern für unser Haus behalten! Daraus wurde Ghee [Butterschmalz] gemacht, das haben wir gegessen und sind stark geworden! Aber heutzutage ist das Verhältnis von Büffeln zu Menschen nicht mal 1 zu 5! Die Tiere werden ja jetzt getötet!" [S. 61f.]
Seetabai Miralal Rathod, Angehörige des Lamani-Stammes, Bauarbeiterin, ca. 45 Jahre alt: "Wir sind keine Hindus. Wir sind Lamani. Wir glauben an Tuljapur Ambabai. Und wir glauben auch an den heiligen Schrein von den Muslims. In Bombay gehen wir zu keinem Tempel. Wir besuchen nur die Tempel in unserem Heimatort. Wir gehen nach Tuljapur und machen das Lammopfer. Das Lamm wird zu Hause geschlachtet, dann gehen wir zum Tempel, machen die Puja [Andacht], kommen nach Hause und dann machen wir das Lammopfer, d. h. wir hacken das Lamm. Wenn jemand stirbt, machen wir Shraddha [Totenopfer], brechen eine Kokosnuss, zünden Agarbattis [Räucherstäbchen] an, tanzen und das alles!
Hier in Bombay machen wir Pujas zu Hause. Und an Dienstagen faste ich. Dann esse ich nichts, trinke nur Tee. Nicht wie die anderen, die essen Bananen, oder Erdnüsse und Chutney. Aber ich glaube daran, dass ich nur einmal morgens essen muss. Sonst trinke ich nur Wasser. Auch wenn ich schwer arbeiten muss. Was kann man machen? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht! Aber jetzt ist das Baby im Haus. Es schreit. Deshalb habe ich jetzt das Fasten am Dienstag gelassen, nur für eine Zeit. Sonst essen wir meistens Reis, manchmal Chappati [Fladenbrot], wenn es schnell gehen muss. Natürlich essen wir viel Gemüse, Dal [Linsenmus], Tomaten, Kartoffeln. Fleisch essen wir auch, Hammel, Huhn, Fisch. Aber kein Rindfleisch. Nein, nein, wir beten ja zu der Kuh! Andere mögen das essen, wir nicht. Wir essen nur Ziegenfleisch. Das kann man die ganze Woche essen. Wenn man arm ist, nur an 1 oder 2 Tagen. Aber jetzt, wo er einen Verkaufsstand hat, will mein Mann nicht mehr Dal [Linsenmus] und Gemüse essen. Er will Fleisch und Fisch, jeden Tag!

Abb.: Chapati-Zubereitung (Bildquelle: http://kobe.cool.ne.jp/rikamama/omake2.html.
-- Zugriff am 2001-03-09)
Alkohol trinken wir nicht, auch nicht mein Mann und mein Schwager. Deshalb gibt's auch kein Schlagen, aber Streit gibt es natürlich. Wenn man in einem Haus zusammen ist, dann tue mal ich was, oder er tut was, und da sind auch die Kinder. Bei uns sind so viele Leute, die trinken und dann prügeln. Warum soll ich mich darum kümmern. Ich und mein Haus, das ist alles!" [S. 110]
Pandurang Budha Tandel, Mangalaya-Kaste, Hindu, Fischer, 50 Jahre alt: "Wir glauben nicht nur an einen bestimmten Gott, nein, wir haben ja so viele Götter und Göttinnen, so viele Tempel, 10 - 12 Götter habe ich zu Hause! Aber am meisten verehre ich Hanuman Bajrang Bali [Affengott], und ziemlich oft, immer, wenn ich Lust habe, gehe ich in den Tempel. Und jeden Tag mache ich Puja [Andacht] zu Hause, sehen Sie doch das Zeichen auf meiner Stirn! Zweimal in der Woche faste ich. Donnerstag und Samstag. Das heißt, an diesen Tagen esse ich nur keinen Fisch. Sonst schon was, doch, doch, ich brauch das Essen! Aber normalerweise essen wir zweimal täglich Fisch, was sonst? Fisch und Reis, manchmal Chappati [Fladenbrot]. Vielleicht können wir uns auch mal Fleisch leisten, einmal im Monat oder so." [S.114]
Indubai Balwant Vayshampayan, Brahmanin, Hausfrau,75 Jahre alt (Ihr Vater starb 1942, ihre folgende Erzählung bezieht sich auf die Zeit davor): "Wir hatten [in meiner Kindheit9 sonst nicht viele Freunde, sehr wenige, und wenn wir sie besuchten, dann haben wir niemals etwas in deren Haus gegessen, es sei denn Trockenfrüchte oder frische Früchte.
Es war uns nicht erlaubt, Essen zu uns zu nehmen, das nicht von Brahmanen nach Sowle, d. h. nach dem Bad, nach dem Anziehen von frischen Kleidern und ohne dass man irgend etwas oder jemand danach berührt hatte, gekocht wurde. Unsere Köche zu Hause waren natürlich Brahmanen und kochten nur nach Sowle. In unserer Küche war ein Brunnen, denn ein guter Brahmane würde niemals Wasser von jemand anders aus dem Brunnen holen lassen! Die Quelle des Wassers muss unverschmutzt bleiben!
Wenn wir mit dem Zug nach Karachi fuhren -- die Reise dauerte 3 Tage --, war es uns nicht erlaubt, irgendwas von draußen zu essen. Man hat uns Pakete mit Puris [Weizenfladen] und Laddus [Süßigkeit] mitgegeben, und manchmal sind wir auch an einer Station in das Haus des Bahnhofsvorstehers gegangen, haben ein Bad genommen, frische Kleider angezogen und haben dann etwas Reis für uns gekocht. Aber wenn das nicht möglich war, haben wir nichts von draußen zu uns genommen, nicht mal Eiskrem. Wir fuhren immer in einem Erster-Klasse-Abteil, das nur für uns reserviert war. Mein Vater pflegte seine Abendgebete immer unmittelbar nach Sonnenuntergang zu sagen. Deshalb bat er regelmäßig den Zugführer darum, dass er den Zug an der Station, die wir zu dieser bestimmten Zeit erreicht hatten, anhielt, und der Zug wurde immer auf Verlangen meines Vaters für 15 Minuten gestoppt. Mein Vater pflegte dann bei der Station auszusteigen, sich unter einem Wasserhahn zu waschen und seine Abendgebete zu verrichten!
Mit dem Essen war mein Vater sehr streng. In unser Haus kamen schon Leute aus anderen Kasten, sogar ziemlich oft, besonders, wenn es ein Hochzeitsfest oder etwas Ähnliches gab, aber dann durften sie niemals in der Nähe von meinem Vater sitzen. Beim Essen saßen immer alle zusammen, auf dem Boden, auf Holzschemeln, gegessen wurde von Silberplatten und -schüsseln. Aber mein Vater saß niemals in der gleichen Reihe wie Leute aus anderen Kasten, er saß nur neben Brahmanen! Alle wussten das schon, und sogar meine Brüder durften nur Seidendhotis [Beinbekleidung aus langem Tuch] tragen und mussten vorher Sowle [Bad] machen, wenn sie neben meinem Vater sitzen wollten. Deshalb wurden immer extra dafür 8 - 10 Seidendhotis für die Jungen aufbewahrt.
Mein Vater hat sehr viel Wohltätiges getan. Er pflegte einmal im Jahr 1250 [!] Brahmanen innerhalb von 7 Tagen zu speisen. Unser Haus war ja so groß, und über 150 Leute konnten zur gleichen Zeit zum Essen sitzen. Mein Vater dachte, dass Essen zu geben die beste Art von Wohltätigkeit sei. Auch wenn ein Gast vor 11 Uhr morgens zu unserem Haus kam und nach Essen fragte, hat man ihm niemals das Essen verweigert. Wenn er nach 11 Uhr kam, dann bat mein Vater ihn, am nächsten Tag wiederzukommen, weil wir unser Mittagessen schon um 11 Uhr eingenommen hatten. Eigentlich hatten wir fast jeden Tag 5 - 6 Leute, die nach Essen fragten. Und wenn jemand kam, der zu einer anderen Kaste gehörte, dann bat man ihn, in einem anderen Zimmer zu sitzen und nicht mit dem Rest der Familie. Aber verweigert wurde das Essen niemandem!
Meine Familie hat auch die Briten nach Hause gebeten, aber sie haben uns niemals in ihre Häuser eingeladen. Mein Vater ging manchmal auf ihre offiziellen Partys, aber er aß nichts, er hat dort nicht einmal Wasser getrunken! Als der Gouverneur einmal eine Party gab, hat er meinem Vater mitteilen lassen, dass er ihm nicht erlauben würde, teilzunehmen, wenn er seine Pagota [Turban] trug. Er verlangte, dass mein Vater die traditionelle britische Bekleidung tragen sollte, und auf keinen Fall die Pagota! Dann hat mein Vater den Gouverneur gebeten, dass er ihm das schriftlich geben soll, und da gab er nach und erlaubte meinem Vater, auch auf der Party seine Pagota zu tragen! Mein Vater trug immer eine Pagota auf dem Kopf. Sein Kopf war kahlgeschoren, mit einem Haarbüschel an seinem Hinterkopf, lang genug, um es in einen Knoten zu binden. Normalerweise trug er einen Dhoti [Beinbekleidung aus langem Tuch], aber wenn er ins Büro ging, Hemd und Hose. Er hätte es niemandem erlaubt, seine Art, sich zu kleiden und herzurichten, zu ändern!" [S. 122 - 124]
Ganesh, Madiga-Harijan, Müllsammler, ca. 28 Jahre alt: "Wir wohnen auch nicht im Dorf, wir wohnen in unserer Gruppe, am Rand. Im Dorf haben wir das Problem, daß wir den Brunnen nicht benutzen dürfen, wir bringen das Wasser aus dem Tank. Die anderen waschen da nur ihre Wäsche und die Tiere. Mit den Hindus im Dorf haben wir nicht viel zu tun, und wir wollen auch nicht, das heißt, für uns ist es ein Unglück, ein Zeichen, daß schlechte Zeiten kommen, besonders Armut, wenn einer von denen in unser Haus kommt. Wir dürfen sowieso nicht in ihre Häuser reingehen! Einmal hat der Patil [Dorfchef], also seine Leute haben einen von unserer Gruppe umgebracht. Er war jung, und er hat nett gesprochen mit den Frauen aus dem Patilhaus. Das ist nicht erlaubt, weil wir Harijans [Outcasts] sind. In den Tempel dürfen wir gehen, meistens sagen sie nichts, aber lieber machen wir unser darshan [Sehen des Gottesbildes] draußen -- unser Gott ist draußen vor dem Tempel!
Nein, in Bombay ist es nicht so, sie wissen nicht immer, sie fragen hier nicht, was wir sind."
"Am Tag esse ich nicht, weil ich kein Geld habe. Ich kriege mein Essen erst in der Nacht, wenn ich das Gesammelte vom Tag verkauft habe. Dann hole ich mein Essen von einem Stand -- wo kann ich kochen? Ich bin Vegetarier, esse nur Dal [Linsenmus] und Reis und manchmal Gemüse. Für mein Essen gebe ich ungefähr 12 Rs. aus und 2 Rs. für Bidis [Zigaretten] und Streichhölzer. Trinken tue ich nicht, aber mit dem Rauchen habe ich angefangen, als ich 12 war, nachdem ich nach Bombay gekommen bin. Meine Freunde hier haben mir beigebracht zu rauchen.
Mit dem Essen hier in Bombay gibt es keine Probleme, sie geben uns alles, auch Wasser, aber im Dorf kriegen wir extra Gläser und Teller in den Teestuben, und drinnen dürfen wir nicht sitzen, weil wir Harijans sind. Wir müssen auf der Straße stehen und essen und trinken. Auch im Bus oder Zug, in Bombay gibt es da fast keine Probleme. Ich fahre nur sehr wenig, aber wenn neben mir ein Hindu sitzt und er weiß, dass ich Harijan bin, dann wird er weggehen und woanders sitzen. Aber rausgeschickt hat man mich noch nie!" [S. 133 - 135]
Athmanandagiri, Sadhu (selbsternannter Hindu-Heiliger), ca. 46 Jahre alt: "Hier sitze ich im Namen von Gurumaharaj [Heiligenboss]. Mein Leben ist nicht mehr das gleiche wie vorher. Nachdem ich ein Sadhu geworden bin, hat sich mein Lebensstil verändert, Gedanken, Werte, alles hat sich verändert. Das Essen ist nicht das gleiche wie vorher, das Trinken auch nicht . . . Normalerweise essen wir eine Mahlzeit am Tag, aber wenn wir was kriegen können, dann nehmen wir auch zweimal. Eine spezielle Diät haben wir nicht, ich esse Dal [Linsenmus] und Reis, oder ich esse Chapatti [Brotfladen] aus Weizen, und manchmal auch Khichdi [Reis-mit-Linsen], Dal und Reis zusammengekocht. Wenn wir fasten, dann essen wir Früchte, ab und zu. Sonst bin ich nicht sehr wählerisch beim Essen. Manchmal rauchte ich Pfeife, Chilam [Wasserpfeife] oder auch Ganja [Haschisch]. Ich kann über andere nichts sagen, ich rauche das, aber jeder hat seinen eigenen Lebensstil, seine Gewohnheiten beim Essen, Trinken, und jeder raucht, was er will. Kochen tun wir nicht selbst, gekochtes Essen kommt jeden Tag vom Baba, von unserem Hauptpriester. Ich esse Babas Essen. Ich mache den Ofen nicht an, seitdem ich Sadhu bin, weil ich frei bin, auch von jeder Arbeit." [S. 150]
Bajrang Lal Sharma, Suddhar-Kaste, Hindu, Tischler, 26 Jahre alt: "Das alles habe ich von meinen Eltern gelernt, besonders von meiner Mutter. Sie betet viel, geht immer in den Tempel, isst nur vegetarisch, und sie fastet jeden Dienstag, auch am Chouth {vierter Tag des abnehmenden und zunehmenden Mondes in jedem Monat] und Aakadashi [=Ekadashi = elfter Tag des Mondmonats], im Ganzen bestimmt 8 Tage im Monat. Meine Frau auch, aber ich faste nur jeden Dienstag, weil der Pandit [Gelehrter] mir gesagt hat, dass ich am Dienstag Fasten halten soll. Ich habe auch schon mal Fleisch und Ei gegessen, aber meiner Mutter habe ich nichts davon erzählt." [S. 169]
Sadashiv Sakharam Kader, Hindu, Dabbawalla (Essensträger, der im Haus der Angestellten gefüllte Essensdosen zu deren Arbeitsstätten bringt], 33 Jahre alt: "Was die Kunden essen, weiß ich nicht, wir machen die Dosen nie auf. Das passiert bei den Dabbawallas nicht, dass man Essen aus der Dose nimmt, nur bei Leuten aus den untersten Schichten könnte das vorkommen! Vielleicht, nur einmal angenommen, ein Kunde isst nichts, dann können wir die Dose aufmachen und sehen, warum er nichts gegessen hat. Wir selbst essen nur vegetarisch, kein Fleisch, das ist so in unserer Kaste. Christen essen Fleisch, also können wir in ihrem Haus nicht mal Wasser trinken! Nur wenn wir bei Leuten aus unserer Gemeinschaft sind, und das Geschirr ist auch gut gewaschen, dann essen wir bei ihnen." [S. 182]

Abb.: In solchen Henkelmännern bringt ein Dabbawalla das Essen von zu
Hause an die Arbeitsstelle
Lakkarajula Munaswami, Hindu, Angestellter beim Zollamt, ca. 35 Jahre alt: "In Bombay gehe ich in den Tempel in Matunga, da ist ein südindischer Tempel, regelmäßig, einmal in der Woche ist das ein Muss, Muss, Muss mit der Frau und den Kindern... Und wenn bestimmte Tage kommen, dann faste ich auch, den ganzen Tag esse ich nichts, meine Gattin auch nicht, und dann, wenn wir das Essen fertig gemacht haben, dann stellen wir es zuerst vor den Gott und warten, und dann machen wir alle diese Dinge, brechen die Kokosnuss usw. -- und danach essen wir. Sonst vergisst man Gott, nicht? Wenn man dieses Fasten nicht hat, dann vergisst man Gott, und was ist dann der Sinn?" [S. 207]
Basanti Bholeshankar, Bettlerkind, ca. 14 Jahre alt: "Mit meiner großen Schwester gibt es auch Streit. Sie schimpft auf mich, und sie schlägt mich auch. Wenn wir Krabben fangen, am Chowpatty. Sie sagt, das ist meins, und ich sage auch, das ist meins. Dann streiten wir uns. Auch mit den anderen Kindern gibt es manchmal Streit, und wir schlagen uns. Essen tun wir die Krabben nicht, wir spielen nur damit. Wir essen nur Fisch, Dal [Linsenmus], Reis, und Roti [Fladenbrot] essen wir auch. Manchmal essen wir auch Süßigkeiten, Laddus. Meine Mutter kauft die. Aber ich möchte sehr gerne mal Schokolade essen, Cadbury!" [S. 237]

Abb.: Am Küchentisch, Moskau, 1996
[Photo: Sergei Traven. -- http://www.mgls.com/publications/from_russia_with_love/chapter_1.html. -- Zugriff am 2001-03-09]
"Wir stellten auch fest, dass wirklich willkommene Gäste in russischen Wohnungen normalerweise sofort an den bescheidensten und trotzdem gemütlichsten aller Plätze geführt werden -- an den Küchentisch, wenn die Küche groß genug ist. Dieser Tisch, ob in der Küche oder im Wohnzimmer, bildet nach uralter ländlicher Tradition den Mittelpunkt des russischen Heims. Im Gegensatz zu Europäern und Amerikanern mit ihren Cocktailstunden und ihren Salons setzen die Russen sich gleich an den Tisch, wenn Freunde zu Besuch kommen. Meistens ist es ein kleiner Tisch, der kaum allen Platz bietet, aber dadurch um so intimer wirkt, weil die Russen, die ständig nahe beieinander wohnen, die physische Nähe lieben.
Eines Sonntags waren wir bei den Pasternaks zum Mittagessen -- zehn Personen an einem Tisch von der Größe, wie er in amerikanischen Häusern in der Frühstücksnische steht, Kinder, der Großvater und die übrigen Erwachsenen in bunter Reihe durcheinander. Beim Essen stießen wir unabsichtlich mit den Knien zusammen, wie die Russen zusammenstoßen, wenn sie einkaufen oder in der Kirche stehen. Wären wir besondere Gäste gewesen, wäre vielleicht ein anderer Tisch gedeckt worden, aber wir waren en famille, und der Tisch war entsprechend gedeckt -- mit verschieden großen Tellern, die aus mehreren Servicen stammten, und billigem Stahlbesteck. Das Essen war einfach, aber schmackhaft, die Portionen waren bescheiden, aber ausreichend: Sauerkohl mit Essig und Öl, Roggenbrot, eine dünne Fleischbrühe mit Gemüse, Kalbfleischpastetchen, Kartoffeln und Erbsen und als Nachspeise eine süße Zitronenkaltschale mit Apfelschnitzeln. Das war jedoch ein Sonntagsmahl. Gewöhnliche Mahlzeiten können recht mager sein; sie bestehen oft aus Buchweizengrütze, etwas Käse und gesalzenem oder geräuchertem Fisch, viel Schwarzbrot, vielleicht etwas Wurst -- und Tee.
Der Tisch ist viel mehr als nur der Platz, an dem die Russen ihre Mahlzeiten einnehmen: Er ist ein Treffpunkt. Ann und ich haben stundenlang mit Russen an einem Tisch gesessen, starken Tee getrunken -- immer rötlichbraun, denn die Russen trinken ihren Tee am liebsten glühend heiß, gut gesüßt und sehr stark, manchmal sogar schwarz --, harten Toast, Käse oder ähnliche Kleinigkeiten geknabbert und den ganzen Nachmittag, Abend und bis in die Nacht hinein über tausenderlei Dinge gesprochen. Für die Russen ersetzt der Tisch einen Partykeller, ein Wohnzimmer und einen Platz am offenen Kamin; er ist eine Brücke zwischen den Menschen und ein Ort, der Gelegenheit zur Kommunikation, zur Gemeinsamkeit bietet."
[Smith, Hedrick: Die Russen : wie die russishen Menschen wirklich leben, wovon sie träumen, was sie lieben und wie ihr Alltag wirklich aussieht. -- Bern [u.a.] : Scherz, ©1976. -- ISBN 3-502-16681-1. -- Originaltitel: The Russians (1976). -- S. 152f.]
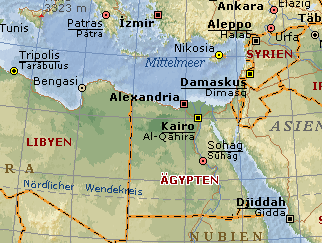
Abb.: Karte von Ägypten (©MS-Encarta)
"»O du mein Gast, der du gekommen bist, uns zu besuchen und unser Zelt zu ehren! Wahrlich, ich sage dir: Die Gäste sind eigentlich wir und du der Herr des Zeltes!«
Wenn irgendwo der Gast König ist, dann in Ägypten. Selten noch werden Sie wohl Gelegenheit haben, die Spannseile eines Beduinenzeltes zu ergreifen und die hier zitierte Grußformel zu vernehmen. Aber auch wenn Sie eine biedere Stadtwohnung oder ein Fellachenhaus betreten, erklären Sie sich selbst zum Monarchen. Für den Gast rollt ein Pflichtprogramm ab, das den Gastgeber mitunter hohe Opfer kostet. Selbst wenn der Gastgeber eine Woche lang kein Fleisch gegessen hat: Für den Gast räumt er den Kühlschrank, schlachtet das letzte Huhn, metzgert das einzige Schaf. Essen gehört zur Gastlichkeit ebenso wie aufmerksames Zuhören. Der Hausherr oder die Gastgeberin lassen jede noch so wichtige Arbeit liegen, wenn Besuch eintrifft. Dem Gast wird gut verborgen, dass der Gastgeber eigentlich unter Zeitdruck steht, eine dringende Verabredung hätte oder eine Verpflichtung einhalten müsste. Der Gast muss den Eindruck gewinnen, nicht im Geringsten zu stören und unbedingt willkommen zu sein.
Die Aussage »Schön, dass du kommst, aber heute habe ich leider überhaupt keine Zeit« ist als unhöflich noch viel zu mild bezeichnet. Eine solche Haltung gilt in Ägypten als barbarisch. Und wenn morgen mein Staatsexamen droht, kann der Gast das Recht in Anspruch nehmen, bis ein Uhr nachts zu verweilen und zu plaudern. Die Glutwellen der heißen Kohlen, auf denen ich sitze, darf er nicht ahnen.
Kategorischer Imperativ gilt auch für die Speisenzubereitung, und wer sich Geld leihen muss, um angemessen bewirten zu können, dem bleibt keine andere Wahl -- der soziale Zwang beherrscht ihn.
Arabische Gastfreundschaft, ein Vermächtnis der Beduinen, das uns immer wieder beeindruckt, ist nicht unbedingt als überschwängliche Geste dem lieben Mitmenschen gegenüber gemeint. Ihr liegt nur manchmal ein tiefes menschliches Mitgefühl zugrunde. Die Gastlichkeit zieht ihre Wurzeln eher aus den wüstengerechten Spielregeln des vor-islamischen Nomadentums, aus der strikten Schutzpflicht der dakhala. Sie besaß ebenso wie die Blutrache ihre klare soziale Funktion. Wer gegen sie verstieß, verlor mehr als sein Leben, er verlor die Achtung. Das Sozialwesen der Wüstenbewohner brauchte nur wenige, aber unverbrüchliche Regeln. Dazu gehörte die Garantie, in jedem Zelt Schutz vor Verfolgern, Durst und Hunger zu finden. Dies führte so weit, dass auch ein Räuber, wurde er ertappt, an die Schutzpflicht des Hausherrn appellieren und damit seine Haut retten konnte.
Gastlichkeit gilt somit als hoher moralischer Wert, der nichts mit Liebe und Verehrung Ihnen gegenüber zu tun haben muss. Nur Ihr eigenes Taktgefühl wird Ihnen empfehlen können, wann Sie wieder aufbrechen sollten.
Das Verabschieden fällt mittlerweile allerdings leichter als zu den legendären Zeiten des glücklichen Arabien. Blieb der Gast damals nicht wenigstens drei Tage, so schickte ihm der Gastfreund seine bewaffneten Söhne nach, um ihn zurückzuholen. Dies war einmal und ist nicht mehr. Heute werden Sie zuweilen einen erleichterten Seufzer vermerken, wenn Sie zum Mantel greifen.
Weil wir an unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen hängen, folglich die herzliche Aufnahme in Ägypten in vollen Zügen genießen, entgeht uns oft, dass wir unser Gegenüber geradezu nötigen. Dazu ein Beispiel: Eine aus Syrern, Ägyptern und Deutschen gemischte Gruppe sollte die Ausgangslage für ein Entwicklungsprojekt in einem Delta-Dorf studieren. Die Deutschen suchten Kontakt mit der Bevölkerung, versuchten mit Händen und Füßen, sich den Bauern verständlich zu machen. Da die Ausländer sich bereits an der Schwelle des Hauses befanden, breitete der Landmann eine Schilfmatte aus, holte Fladenbrot, würzigen Käse, Tomaten und nach und nach den Inhalt seiner Vorratskammer herbei, um die Gäste zu bewirten. Die syrischen und ägyptischen Kollegen verschwanden derweil im Auto und taten, als hätten sie mit den Deutschen nichts zu schaffen. Sie waren nicht »hochnäsig«, wie die deutschen Kollegen ihnen später vorwarfen, sondern schämten sich zu sehen, wie wohlgenährte Fremde einen armen Familienvater seines Wochenvorrats beraubten.
Eingeladen sind Sie nur, wenn die Aufforderung mit Uhrzeit und Hausnummer besiegelt wird. Eine Einladung zum Besuch ohne genaue Zeitangabe bedeutet nichts weiter als eine unverbindliche Freundlichkeit.
Viele ägyptische Geschäftspartner wähnen ihre Häuslichkeit unseren Maßstäben nicht gewachsen. Sie laden den Ausländer deshalb gern in einen Freizeitclub oder das Restaurant eines Hotels ein. Um den tatsächlich oft sehr großen Unterschied zwischen den Wohnverhältnissen zu verbergen, kann sich der Ausländer ebenfalls auf neutralem Boden, in einem schön gelegenen Lokal am Nil zum Beispiel, mit seinen Gästen treffen. Dass die Regelung »jeder zahlt für sich« tabu ist, versteht sich von selbst. Wer das Restaurant vorschlägt, kommt für die Rechnung auf.
Sollten ägyptische Freunde Sie später in Ihrer Heimat besuchen, so sind sie sicher klug genug, von Ihnen kein arabisches Verhalten zu erwarten. Aber enttäuscht wären sie wohl doch, wenn Sie nicht üppig für sie kochten, ein wenig Aufwand trieben und sich Zeit für sie nähmen."
"Gäste-ABC
|
"Gemeinsam futtern, essen, speisen, tafeln, dies verbindet. Essen gehört in Ägypten zur sozialen Kommunikation.
Eine Einladung nur zu Knabberzeug und Wein? Welch ein Vergehen! Für Frauen bedeutet das Kochen stundenlange Gemeinschaftsarbeit in einer meist geräumigen Küche. Für einige Gäste oder gar Feste bereiten sie -- oder professionelle Köche -- riesige Berge winziger Kohlrouladen, gefüllter Mini-Zucchini und Gürkchen vor. Je kleiner, desto feiner. »Fast-food« blieb bislang ein Fremdwort. Nur zu besonderen Anlässen gibt es Truthähne, ganze Gebirge von Lammfleisch, saftige Rindersteaks und jenen üppigen beladenen Tisch, der Ausländer zu der irrigen Meinung verleitet, so berstend wäre er alle Tage.
Oh nein. Im Alltag essen Ägypter vorwiegend vegetarisch. Selbst Kostliebhaber, die sich mehr leisten könnten, nehmen bis zum späten Nachmittag nur Tee und Fladenbrot und abends einen Gemüseeintopf zu sich. Leckereien wie basbusa, mit Honig und Butter beträufelter Grießkuchen, kunafa, hauchfeine überbackene Nudeln, oder halwa, Konfekt aus rohen Sesamkörnern, zieren nur den Festtagstisch, auch wenn Konditoreien sie ganzjährig anbieten.
Kochkunst erlernt man von älteren Familienmitgliedern, die streng auf exakter Nachahmung bestehen. Improvisieren oder »mal was Neues ausprobieren«, wie unsere Hausfrauen oder Hobbyköche es gerne tun, erntet wenig Beifall. Wenn Sie also nicht sicher sind, ob Ihre molokhiya, Ihre grüne spinatartige Soße wirklich originalgetreu gelungen ist, setzen Sie sie ägyptischen Gästen besser nicht vor!
Insgesamt mag Ihnen so manches ägyptische Gericht aus der griechischen oder türkischen Küche bekannt vorkommen. Gefüllte Weinblätter zum Beispiel kennen Sie schon als Dolmadaki, lisan-al-as fur vielleicht als griechisches Youvetzi. Bamia mit Namen Okra gibt es im ganzen Nahen Osten. Urägyptische Pflanzen und Gewürze, wie sie in reicher Zahl in alten Papyri erwähnt werden, sind entweder ausgestorben, oder ihre Namen lassen sich nicht mehr zuordnen. Einzig der Kreuzkümmel al kammun, das gilt als verbürgt, hatte seine Ur-Heimat in Ägypten.
In dörflichen Haushalten setzt die Hausfrau alle Speisen auf ein Metalltablett. Fladenbrotstücke dienen als Löffelersatz.
Wenn Sie die Schuhe abgelegt haben, dürfen Sie die Matte des Essplatzes betreten. Sie setzen sich, die Beine nach hinten untergeschlagen, um das Tablett und beginnen zu essen, sobald der Älteste dazu aufgefordert hat. Oft essen Frauen und Kinder in einem anderen Raum, wenn Gäste beim Hausherrn sitzen. Wo mit den Fingern gegessen wird, sollte man die rechte Hand benutzen. Der Köchin dankt man während und nach der Mahl zeit mit einem herzlichen Tislam ideki!, »Deine Hand sei gesegnet«.
In städtischen Esszimmern erhält jeder Gast Teller, Schale oder Besteck auf tuchbedecktem Tisch.
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Vorspeisen, mezze genannt. Kleine Schalen mit würziger Geflügelleber, mit homos, einem Brei aus Kichererbsen, Knoblauch und Joghurt, die Hackfleischröllchen kufta und natürlich tahina und babaganu aus Sesampaste reizen den Appetit. An den Geschmack von sauer eingelegten Rübchen, Limonen, Gurken und Oliven müssen Sie sich wahrscheinlich erst gewöhnen. Ebenso fremdartig wird Ihnen das hauchdünn geschnittene Trockenfleisch basterma in Kräuterkruste erscheinen.
Schawerma dagegen erobert auf Anhieb fast alle Gaumen. Schawerma hat sich mittlerweile als türkisches Döner Kebab in vielen europäischen Großstädten durchgesetzt. Wenn Sie es in Ägypten auf der Straße kaufen, achten Sie darauf, dass der Standbesitzer genügend Umsatz macht, um stets frische Ware anbieten zu können.
Nun, nachdem Ihr Mund schon wässrig ist, Ihr Magen grummelt, wollen Sie endlich einmal richtig ägyptisch essen gehen und stürmen die Lokale in Kairo und Alexandria -- und bekommen Schnitzel mit Pommes frites und einen undefinierbaren gemischten Salat vorgesetzt, welch letzteren Sie schon aus Vorsicht gar nicht kosten. Auch verführerische Namen wie Arabesque und Semiramis schützen vor Enttäuschung nicht. Die ägyptische Gastronomie ziert sich gern mit importierten »Delikatessen«.
Wenn ägyptische Freunde Sie ausführen wollen, können Sie fast wetten, dass Sie zu Exotika wie Pizza oder Lachs eingeladen werden, nicht aber zu lahm-fil-furn, den in Papier gegarten Fleisch-Kartoffelpasteten, oder zu fitir, jenen dicken, von Fett triefenden Pfannkuchen.
Dank der ägyptischen Aufgeschlossenheit ausländischen Essgewohnheiten gegenüber müssen Sie andererseits weder auf Pralinen, Vollkornbrot, Eisbecher oder Schweizer Röschti noch auf Schwarzwälder Kirschtorte und den erwähnten Lachs verzichten. Flugfracht und europäische Hotelketten machen's möglich."
"Tischmanieren
|
[Brunn, Reinhild von: KulturSchlüssel Ägypten. -- Ismaning : Hueber, ©1999. -- (KulturSchlüssel). -- ISBN 3190052956. -- S. 26 - 28, 86f., 93. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Im anonym erschienenen Buch
Wir klagen an : zwanzig römische Prälaten über die dunklen Seiten des Vatikans / I Millenari. - 2. Aufl.. - Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verlag, 2001. - 342 S. -- (AtV ; 7030). -- ISBN 3746670306. -- Originaltitel: Via col vento in Vaticano (1999). -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
beklagen sich zwanzig Prälaten des Vatikan, die bei der Pfründenverteilung zu kurz gekommen sind. Das Buch ist im Stil vatikanischer Verlautbarungen geschrieben, d.h. über weite Strecken unerträgliches Gesabber und Gelabber. Trotzdem enthält das Buch einige nützliche Tipps für strebsame unverheiratete katholische Männer (ohne legitimierte Kinder), die Wert auf farbenprächtige Kleidung legen:

Abb: Deutsche Bischofskonferenz: Eröffnung der Frühjahrs-Vollversammlung im
Augsburger Dom, 2001 (Quelle: Pressedienst)
"Ein Monsignore war sich darüber im klaren, dass ihn die Bischöfe seines Landes wegen gewisser amouröser Abenteuer systematisch vom Episkopat ausschlossen: Da er selbst der römischen Kurie angehörte, kannte er sich aus. Mit großem Geschick setzte er nun dreist und skrupellos alle Hebel in Bewegung: Kardinäle, Botschafter, Politiker - alles, was Rang und Namen hatte, lud er zum Essen in sein Haus ein. Um seinen Tisch versammelten sich die höchsten Autoritäten des Vatikans, um ihre ausländischen Kollegen zu treffen. Beim Abschied reichte er ihnen das Gästebuch, in das sie sich eintragen sollten und aus dem sie entnehmen konnten, welche illustren Persönlichkeiten ihnen vorangegangen waren. So rückte der entscheidende Tag langsam näher." [S. 106]
"Die Festessen und Gastmähler gewisser Prälaten sind in die Geschichte eingegangen. Diejenigen unserer heutigen Zeit stehen ihnen nicht nach. Es sei nur an das fürstliche Gelage erinnert, das auf Betreiben des damaligen Sekretärs der Kongregation für den Klerus, Monsignore Crescenzio Sepe, anlässlich des fünfzigsten Jahrestages der Priesterweihe Papst Johannes Pauls II. für alle Welt sichtbar abgehalten wurde. Das köstliche Mahl perfekt bis ins kleinste Detail, der Papst am Tisch mit zweitausend heiteren, geweihten Zeitgenossen, versorgt mit Speisen, Wein und Zahnstochern.
Von guten Zeiten zu üppigen Gastmahlen ist es nur ein kleiner Schritt. Wie oft kommt es vor, dass man das, was man nicht mit dem Kopf zu lösen vermag, ganz einfach mit dem Topf und einem guten Glas Wein löst! Eine echte Kongregation für die Gaumenlehre.
Beim Essen und am Buffet wird Geschichte gemacht, bei schmackhaften Häppchen, hervorragendem Wein und in der Gesellschaft von braven Leuten, und Josua selbst scheint die Zeit anzuhalten, bis der nächste Kandidat oder die richtige Meinung siegreich aus der Zusammenkunft hervorgeht. An solch einer Tafel wird gerne über alles gesprochen, über Reformen und Fortschritte, die gleich nach dem Essen in die Tat umzusetzen sind; da geht die Geschichte im Gleichschritt mit der Verdauung, und ihre Geschicke werden nach dem Zeitplan dieser gefräßigen Brigade geregelt. Alle scheinen einhellig für eine gemeinsame Sache einzutreten, und im Vorgefühl des Triumphes ergießt sich der Rebensaft ins blitzende Glas.
Bis auf wenige Ausnahmen sind die Monsignori wahre Feinschmecker, vor allem, wenn es stets die anderen sind, die zu Tische laden. Gastgeber und Gäste wissen, dass sich hinter diesem Ritual eine Rechnung verbirgt, die wenig später zu begleichen sein wird. Inzwischen spricht man den Speisen zu und kaut ohne Eile mit vollen Backen, um einmal den Hunger zu vergessen und das Wohlgefühl der Sattheit auszukosten.
Die Essen zu Ehren der Oberen ersetzen oft die internen Ausschreibungen. Wem es gelingt, die Zustimmung eines dicken Fisches zu bekommen, der darf je nachdem mit einer Anstellung, einer Beförderung oder einem Doktortitel rechnen. Am zentralen Tisch darf der Prüfling, also der Anwärter, nicht fehlen, wie zufällig neben dem Prüfer platziert, welcher derjenige ist, der entscheiden wird. Ersterer, der Prüfling, muss seinen Verstand ebenso geschickt einzusetzen wissen wie seinen Appetit, genau im richtigen Maße, um bescheiden zu verstehen zu geben, dass er die Beförderung verdient. Der Zweite, der Prüfer, tut seinerseits so, als sei er selbst nur Beauftragter eines Auftraggebers, welcher wiederum das letzte Wort habe. Doch wenn die Verköstigung ausgezeichnet ist, so gilt die Sache als beschlossen.
Viele Prälaten treffen sich gerne zu Arbeitsessen, bei denen kulinarisch so manches erledigt wird. Bei solchen Zusammenkünften lässt sich die Beförderung der Günstlinge beschleunigen. Die altgedienten und treuesten unter den Kellnern bemerken verstohlen, dass sich auch die Laune der zurückhaltensten Prälaten würdevoll hebt, je tiefer sie ins Glas schauen. Erfahrene Stimmungsdeuter wetten auf den Sieg: Das wäre also geschafft!
An entlegenen Orten, in Sälen, weit entfernt von neugierigen Ohren, im garantiert engsten Kreis und bedient von absolut diskretem und zuverlässigem Personal - dort verbinden sich das Spirituelle und das Materielle am besten, zu heiligen Possen, Vergnügungen und Machenschaften: Mission erfüllt! Nach den ersten Vertraulichkeiten dringen langsam die interessanteren Informationen durch; unter größter Zurückhaltung werden Versprechen gegeben; das Vorgehen wird festgelegt, die Namen der Günstlinge werden genannt und die der Prälaten, die in das Projekt einzubeziehen sind, das es da zu einem guten Abschluss zu bringen gilt. Und die Namen der Personen, von welchen absolut verlässliche Informationen zu erhalten sind. Wenn erst der Papst seine Zustimmung gibt, so ist auch der Herrgott auf ihrer Seite, und sei es nur, um seinen Statthalter auf Erden nicht Lügen zu strafen.
Am Schluss serviert der Kellner auf einem Teller die Rechnung für das Mahl. Wer sie begleicht, darf zufrieden sein, auch wenn sie gesalzen ist: Paris ist eine Messe wert!" [S. 155 - 157]
"Außerhalb seines Hauses, in einer Sackgasse jenseits eines schmalen Durchgangs wird ein reiches Mahl abgehalten. Fünf namhafte Prälaten, zwei von ihnen aus Brisighella, sitzen in einem separaten Raum. Das übliche Arbeitsessen, bei dem über den vorzuschlagenden Kandidaten entschieden werden soll. Bei den besagten Vorgaben kann die Wahl nur auf den einzig Unfähigen und Untauglichen fallen. Man setzte auf den Ukrainer, schlau wie ein Fuchs und listig wie eine Schlange, den die russische Regierung so sehr schätzte, dass sie ihm freie Ein- und Ausreise in sein Vaterland gestattete: eine hilflose Kreatur, die der scheidende Gönner seinerzeit in bischöfliche Gewänder gekleidet hat." [S. 171f.]

Abb.: "Freitag abend brach man aus der Zimmer-Kuchl-Kabinett-Wohnung aus:
Familienrunde beim » Döltl« Anfang der 1960er Jahre"
"Ein nostalgischer Rückblick
Der 10. Juni 1957 war ein Pfingstmontag, doch beim »Döltl« auf der Wiedner Hauptstraße [in Wien] war trotzdem nicht Ruhetag. Und als das Telefon klingelte, nahm der Herr Döltl den Hörer ab und konnte, nachdem er wieder eingehängt hatte, seinen bang wartenden Gästen die Geburt der Autorin dieses Buches verkünden: »Ein Madl ist's!« Dass damals Geburten im Wirtshaus verlautbart wurden, hat einen ganz banalen Grund: die »kleinen Leute« hatten Ende der 50er Jahre noch kein Telefon Stammgäste konnten sich's erlauben, in ihrem Wirtshaus anrufen zu lassen.
Auch sonst war das Wirtshaus damals noch viel mehr als ein Speise-, Bier- und Weinhaus -- es war das Wohnzimmer der kleinen Leute. Weil in den Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnungen nicht genug Raum war für Geselligkeit -- und weil es sich's beim Wirten am Eck soviel gemütlicher beisammensitzen ließ.
Wobei Wirtshaus natürlich nicht gleich Wirtshaus war.
Der » Döltl« war ein »gutes« Wirtshaus, wo auch »bessere« Leute verkehrten. Der Herr Ingenieur Baumgartner saß dem Sparverein vor, und zu den Stammgästen zählte sogar ein Opernsänger.
Auf der anderen Straßenseite, etwas weiter stadteinwärts, befand sich der »Weinwurm« -- der Besitzer des Gasthauses hieß tatsächlich so, und das Sprichwort »nomen est omen« traf voll auf ihn, seine Gaststätte und seine Gäste zu. Der »Weinwurm« war ein »böses« Wirtshaus, dort ging's mehr ums Saufen als um die Geselligkeit, und dementsprechend war auch die Klientel.
Schräg gegenüber vom »Weinwurm« gab's schließlich eine mittlerweile nahezu ausgestorbene Sonderform des Wirtshauses, den » Branntweiner«. »Likörstuben« heißen solche Etablissements heute beschönigend, doch damals gab's eigentlich keinen Grund für solche Schönfärberei. Denn der Branntweiner verstand sich als »Schnellimbiss« für Durstige, keineswegs als Endstation für Alkoholiker und andere Hoffnungslose, als die er heute gesehen wird. Mann (für Frauen war der Branntweiner allerdings doch kein geeigneter Aufenthaltsort) kehrte ein, kurz, zwischendurch, auf einen Tee mit Rum, einen Kaffee mit »Schuss«, ein Schnapserl zum Aufwärmen.
Beim Branntweiner gab's keine Küche, dort ging man hin, um zu trinken. Der » Döltl« hingegen war berühmt für seine Hausmannskost. In der Küche waltete ein Zwiegestirn: Mimi, die spätere Frau Döltl, und die Frau Fürst verwöhnten Stammgäste und Laufkundschaft mit Wiener Schnitzeln, Bauernschmaus und Krautfleisch. Eigentlich hätte ja die Frau Fürst Frau Döltl werden sollen, doch dann besuchte sie ihren nach Amerika ausgewanderten Bruder und nach ihrer Rückkehr hatte Mimi das Rennen gemacht.
Im Sommer bediente der Kellner Mischko im Schanigarten vor dem Haus, und verborgen im Hinterhof gab's beim » Döltl« den wunderbar kühlen Gastgarten mit den alten Kastanienbäumen. Der Stammtisch befand sich gleich neben der Tür zu Küche, und für jedem Stammgast stand das ganz spezielle »Stammglas« an einem Bord über der Theke bereit.
Im Extrazimmer -- es wurde wirklich nur für ganz spezielle Gelegenheiten aufgesperrt, stand ein Klavier und später dann der Fernseher. Der sorgte anfangs für Belebung -- wenn Ländermatch war, ging's hoch her im Extrazimmer vom »Döltl«. Doch letztlich hat das Fernsehen dem Wirtshaus vielleicht doch den Todesstoß versetzt -- und nicht nur diesem einen.
Denn ab den Jahren '63, '64 hatten immer mehr von den »kleinen Leuten« einen Fernseher zu Hause -- der brachte ihnen die weite Welt in die Zimmer-Küche-Wohnung und machte jeden Abend zu einem »bunten Abend«. Und um die gleiche Zeit bekamen immer mehr von den »kleinen Leuten« auch ein Telefon ins Haus das »Ferngespräch« ersetzte die Plauderei am Wirtshaustisch. »Sich unterhalten« bedeutete immer seltener »miteinander reden«.
Und ein paar Jahre später waren zumindest die Jüngeren fortgezogen von der Wiedner Hauptstraße, hatten die engen Bassena-Wohnungen [Bassena = gemeinsamer Wasserhahn für mehrere Wohnungen im Stiegenhaus] gegen komfortable Apartments im Gemeindebau am Stadtrand eingetauscht.
Das Wirtshaus hatte seine Funktion als »Kleine-Leute-Wohnzimmer« verloren -- und konnte deshalb auch gleich zusperren.
Mitte der 60er Jahre ging der Herr Döltl in Pension, sein Nachfolger hat erst die Toilettenanlage modernisiert und dann doch dichtgemacht. Den »Weinwurm« und den Branntweiner gab's um diese Zeit längst nicht mehr. Seit Anfang der 70er Jahre ist dort, wo der » Döltl« war, ein China-Restaurant. Es könnte auch ein Italiener sein. Oder eine Videothek.
»Wirtshaussterben« lautet der Fachausdruck für die große Sperrstund', die seit den Wirtschaftswunderjahren der 60er Jahre immer mehr Gastwirtschaften betrifft. Höchste Zeit, dem Wirtshaus ein Denkmal zu setzen und zu retten, was noch zu retten ist: Den Rollbalken hoch, aufg'sperrt ist, bei uns gibt's Bier vom Fass, frische Speisen dauern etwas länger!"
[Dee, Andrea <1957 - > ; Seidl, Conrad <1958 - >: Ins Wirtshaus! : von Gästen, Wirten, Stammtischrunden. -- Wien : Ueberreuter, ©1997. -- ISBN 3-8000-3659-2. -- S. 10 - 12]
| "»Im Wirtshaus bin i wia z'haus« heißt es im österreichisch-bajuwarischen Raum, und die ganz fanatischen Stammtischbrüder setzen noch hinzu: »Bei mia z'haus bin i nia z'haus.« Das Wirtshaus kann zur zweiten Heimat werden, und für manche ist es sogar die erste. Warum auch nicht? Schließlich gibt's dort alles, was der Mensch zum Leben braucht: Essen, Trinken, Ansprach'- und wenn's sein muss, auch das Gegenteil. Die ganze Welt hat Platz im Wirtshaus -- das laute Glück, das stille Unglück und der Alltag dazwischen." |

Abb.: Stammtischbrüder (Bildquelle: a.a.O., S. 106)
"Wehe dem unbedarften Reisenden, der ein Gasthaus betritt und sich -- in Unkenntnis der Lage -- an den Stammtisch setzten will. Ein größeres Vergehen ist gar nicht denkbar, auch dann, wenn die Stammgäste gar nicht anwesend sind.
Der Stammtisch ist immer »besetzt« - entweder im wahrsten Sinn des Wortes, wenn die Stammgäste ihre angestammten Sitze eingenommen haben. Oder symbolisch, wenn man im übrigen Lokal isst und trinkt und dieser eine, besondere Tisch unbesetzt bleibt, weil er sich im Besitz einer besonderen Gemeinschaft befindet. Raum ist Macht, und wer Raum für sich beanspruchen kann - und sei's nur eben ein Tisch, eine Eckbank und ein paar Sesseln in einer Schankstube - steht über denen, die sich mit irgendeinem kurzfristigen Sitz- und Essplatz begnügen müssen.
Das Wirtshaus ist ein Ort vieler menschlicher Bedürfnisse, und vieles lässt sich studieren zwischen Schank und Pissoir. Auch humanes Revierverhalten, das menschliche, allzu menschliche Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit und Abgrenzung.
Der deutsche Humor zeichnet sich angeblich dadurch aus, dass es ihn nicht gibt. Wenn es ihn doch gibt, dann am Stammtisch. Das ist jedenfalls der Platz, an dem allerhand zweideutige und noch mehr eindeutige Witze schenkelklopfend erzählt werden. Mann braucht sich keinen Zwang anzutun, Mann ist ja unter sich: Stammtischrunden sind überwiegend männlich, in viele verirrt sich nie eine Frau. Aus einer 1993 veröffentlichten Umfrage der Tübinger Wickert-Institute geht hervor, dass 16 Prozent der Männer, aber nur 4 Prozent der Frauen zum Stammtisch gehen.
Dass der Stammtisch aber nur der Weiterverbreitung sexistischer Sprüche diene, wäre allerdings eine maßlose Übertreibung - so wie wohl auch nicht wahr ist, dass die Maulhelden von ihrer Stammtischrunde aufstehen, um sich anschließend daheim unter den Pantoffel zu begeben. Oder womöglich gar beim Heimkommen von einer Xanthippe mit der Bratpfanne oder dem Nudelholz eine übergezogen zu bekommen. Das gibt es nur im Witzblatt.
Die Wahrheit über den Stammtisch ist viel komplizierter.
Sein Ur-Urahn ist das griechische Symposion, was eigentlich » gemeinschaftliches Trinken« heißt und eine Runde philosophierender und politisierender Männer darstellte. Immer wieder wurde diese Tradition in der Form eines »akademischen Wirtshauses« oder eines »Philosophenstammtisches« neu aufgegriffen. Im »La Victoire« auf dem gleichnamigen Boulevard in Straßburg trifft jeden Montagabend eine Runde von Hobby-Philosophen zusammen, die bei Bier und Wein ganz ernsthaft nach dem Sinn des Lebens suchen. Wobei diese Runde den Fortschritt von 3000 Jahren Philosophie anschaulich macht: Installiert hat den Stammtisch eine Frau, Eugenie Vegleris, die die Philosophie aus dem Ghetto Schule und Universität herausholen wollte. Die Erfahrungen geben ihr recht: Die Leute kommen so zahlreich, dass viele in der kleinen Wirtsstube keinen Sessel mehr finden und im Stehen philosophieren müssen.
Und auch im Internet kursiert der Spruch: »Lieber einen wackligen Stammtisch als einen festen Arbeitsplatz.« Ganz so schlimm scheint es um den Stammtisch-Humor also doch nicht zu stehen.
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt allerdings, dass all die Vorzüge des Stammtisches nur mehr bei einer schwindenden Gruppe Anklang finden: Bei 90 Prozent der erwachsenen Bundesbürger hat der Stammtisch keinen Stammplatz mehr im Freizeitbudget. Anfang der 60er Jahre hatten noch 32 Prozent das regelmäßige Trinken und Plaudern im Stammgasthaus gepflegt.
Meinungsforscher haben ermittelt, dass sich vor allem die 30- bis 49jährigen an den Stammtisch begeben, am häufigsten in Bayern, am seltensten in Hessen. Mit dem Nachwuchs sieht es trist aus: Gehen in der mittleren Altersgruppe immerhin 15 Prozent der Deutschen an »ihren« Stammtisch, so sind es bei den unter 30jährigen nur mehr 6 Prozent, die »regelmäßig mit einem Kreis von Personen zusammenzukommen«, wie es im Soziologen-Jargon heißt. Tendenz: sinkend.
Wie gesagt: Der Stammtisch ist ein selten gewordenes Möbel -- aber es ist immer noch eines, mit dem man in die Medien kommt, wenn daran außergewöhnliches passiert: Dass die Stadt Bad Blankenburg in Ostthüringen 1992 725 Jahre alt geworden ist, hat man wohl nur in der engsten Umgebung wahrgenommen. Ganz Deutschland aber applaudierte, als zu diesem Anlass der längste Stammtisch der Welt aufgestellt wurde: Auf Betreiben des Kulturamtes (!) wurde am 5. Juli 1992 eine 3.500 Meter lange Tafel aufgestellt, an der jeweils 2.000 Durstige gleichzeitig Platz finden konnten. An dem Riesenstammtisch wurden alle 50 Meter Zapfstellen für den Nachschub eingerichtet."
[Dee, Andrea <1957 - > ; Seidl, Conrad <1958 - >: Ins Wirtshaus! : von Gästen, Wirten, Stammtischrunden. -- Wien : Ueberreuter, ©1997. -- ISBN 3-8000-3659-2. -- S. 13, 103 - 107]
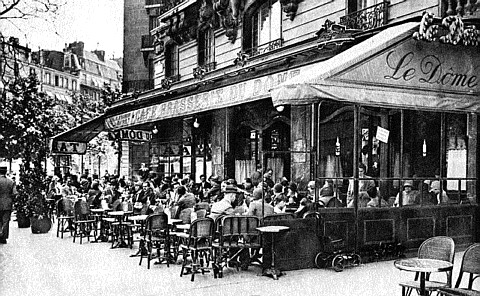
Abb.: Café Le Dôme, Paris (©Corbis)
"Aussichtsposten für das Treiben auf' der Straße sind die Cafes -- die zweitbilligste Möglichkeit, sich unterhalten zu lassen. Stundenlang kann man auf der Terrasse sitzen und sich an einem Kaffee festhalten, gucken, lesen, anbändeln, die Vorbeischlendernden betrachten, die sich ihrerseits die aufgereihten Cafégäste anschauen. Das Cafe ist eine Verlängerung der Straße, der Unterschied zwischen drinnen und draußen verschwimmt: Oft befindet sich ein Teil des Cafés, die «Terrasse», auf dem Trottoir, außerdem sind die Türen meist weit geöffnet, und die Straßenfront ist voll verglast. Auffallend auch die großen Spiegel: Sie werfen «das bewegte Draußen, die Straße, in das Interieur eines Caféhauses» (Walter Benjamin). Und nicht nur das: Sie spiegeln auch die Eitelkeit des Pariser Publikums. Bereits in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bemerkte der Parisbesucher Ludwig Börne «hohe Spiegel ringsumher an den Wänden, denn diese kann der Franzose nicht missen, und er zahlt gern doppelt für sich und für sein Bild im Spiegel, das mit ihm isst und trinkt».
Auch für das politische und kulturelle Leben von Paris ist das Café seit mehreren Jahrhunderten eine zentrale Einrichtung. 1672 gab es den ersten Kaffee-Ausschank in einer Bude des Marché St. Germain, wenig später waren die Caféhäuser eine feste Institution des öffentlichen Lebens. Im 18. Jahrhundert wurden sie von Aristokraten und gehobenen Bürgern aufgesucht, waren gepflegte, salonähnliche Orte des Gedankenaustauschs, Treffpunkte der Geistesgrößen und somit auch Brutstätten für kritische, aufklärerische Ideen. Eine besondere Rolle spielte das «Procope». Es existiert immer noch in der rue de l'Ancienne Comédie, beherbergt heute allerdings ein Restaurant. Hier traf sich lange Zeit die Elite der französischen Denker: Voltaire, Diderot, Rousseau zählten zu seinen Gästen, später dann die Stars der Französischen Revolution. Die politische Bedeutung der Cafés wurde bald behördlicherseits erkannt. Die Regierung durchsetzte die Kundschaft mit ihren Spitzeln, da sie mit Recht vermutete, dass von diesen Orten aus gefährliche revolutionäre Gedanken verbreitet würden. Haupttreffpunkt der oppositionellen Öffentlichkeit war das Palais Royal mit den unter seinen Arkaden eingerichteten Cafés. Hier durfte die Polizei keine Verhaftungen vornehmen. Sie hatte offiziell keinen Zutritt, denn das Palais und der von ihm eingeschlossene Garten waren Privatbesitz.
Dass die Caféhäuser zu Treffpunkten der Intellektuellen wurden, lag an den beiden neuen Giften, die es hier gab: Kaffee und Tabak. Die
Cafés waren so ziemlich die einzigen Örtlichkeiten, wo geraucht werden durfte. Kaffee und Tabak gingen hier eine enge Beziehung ein: Noch heute befinden sich fast alle Tabakverkaufsstellen in
Cafés -- sie sind mit einem roten Rhombus gekennzeichnet.
Bürgerpaläste und Proletarierhohlen
Mit der Entfaltung des industriellen Kapitalismus wurden die Cafés zur Domäne der auftrumpfenden Bourgeoisie. Was dem Adligen sein Salon war, wurde jetzt für den Emporkömmling das palastähnlich ausgestattete
Caféhaus. Der Vergnügungsbetrieb verlagerte sich vom Palais Royal auf die Grands Boulevards, die Einführung der Gasbeleuchtung brachte das abendliche Flanieren in Mode. Die
Boulevard-Cafés wurden zu Stätten des Sehens und Gesehenwerdens. Sie ähnelten im Inneren pompüberladenen kleinen Schlössern, die Prachtentfaltung war immens: Stuckfiguren,
Goldlamé und Seidentapeten prägten das Ambiente, in dem sich junge, reiche Nichtstuer, Spekulanten und die jeweils in Mode gekommenen Künstler vergnügten. Die Krönung war das «Grand
Café Parisien», ein Etablissement von den Ausmaßen einer mittleren Kirche, mit vergoldetem Stuck dekoriert und durch modernes Gaslicht strahlend erhellt. Dreißig Billardtische standen zur Verfügung, eine Armee von Kellnern rotierte um die Gäste, 4000 Besucher konnten zur gleichen Zeit abgespeist werden.
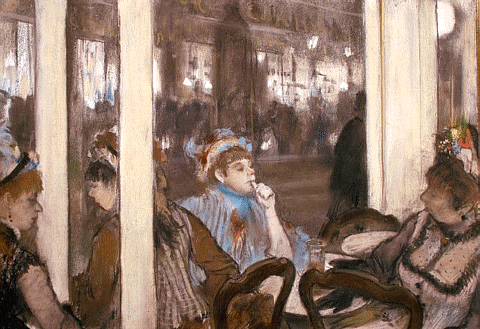
Abb.: Degas, Edgar Germaine Hilaire <1834 - 1917>: Damen auf
Caféhausterrasse
So gut wie keine Gemeinsamkeit gab es zwischen diesen bombastischen Café-Palästen der Bourgeoisie und den Bistros der Arbeiterviertel. Das waren enge, niedrige, meist schäbige Höhlen. Hier schätzte man laute und deftige Unterhaltung und vor allem den Alkoholkonsum, gegen den allerlei wohlmeinende Reformer anzukämpfen versuchten. Eine besondere Spezies unter den Alkoholikern waren die Absinthtrinker. Auf Bildern von Picasso und anderen sind sie uns überliefert: Stumpf, wie abwesend, sitzen sie am Kneipentisch mit sich und ihrem grünlichen Schnaps allein. Das Zeug machte süchtig, wurde schließlich verboten und durch den ähnlich aussehenden und schmeckenden Pastis ersetzt.

Abb.: Degas, Edgar Germaine Hilaire <1834 - 1917>: Der Absint, 1876
Apropos Picasso: Manche Cafés spielten (und spielen) eine wichtige Rolle als «Kulturstätten», wurden zeitweilig zum Stammsitz von Künstlergruppen, zum zweiten Wohnsitz von Schriftstellern oder zum Treffpunkt von Musikern. Sie gewannen oder verloren an Bedeutung, je nachdem, welche Gegend gerade bei der Pariser Avantgarde in Mode war. Legendär wurde zum Beispiel St. Germain-des-Prés, wo in den fünfziger Jahren um Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Boris Vian in einigen wenigen Cafés ein großer Teil des intellektuellen Betriebs von Paris stattfand. Literarische und künstlerische Moden wurden häufig in Cafés begründet, in Cafés wurden und werden Romane geschrieben, Umstürze geplant, konspirative Treffs abgehalten. Bei vielen Größen des geistigen Lebens darf man annehmen, dass sie sich öfter in Cafés aufhielten als bei sich zu Hause. In Pariser Cafés, vor allem im «Tournon» am Palais du Luxembourg, soff sich der österreichische Schriftsteller Joseph Roth zu Tode, in einem Café der rue Montmartre, dem «Croissant», wurde der französische Sozialistenführer Jean Jaurès von einem Attentäter erschossen.
Stuck, Kacheln, Neon und Plastikmarmor
Die Verschiedenartigkeit im Dekor lässt die Cafés zu Repräsentanten der jeweiligen Stilepochen werden. Noch immer finden sich einige Reste großzügig verzierter Bürger-Cafés, mit Stuck und Fresken. Auch ein paar altertümliche Bistros mit vergilbten Wänden, trüben Spiegeln, alten Holzstühlen und bemalten Kacheln hinter der Theke haben sich über die Zeiten gerettet, in abgelegenen Straßen gibt es sogar noch letzte Exemplare des früher mal sehr verbreiteten Mehrzweck-Cafés, das zugleich Holz- und Kohlehandlung ist. Die meisten sind freilich den verschiedenen Modernisierungswellen zum Opfer gefallen. Bei manchen ist die «Modernität» schon wieder historisch -- so bei den Stromlinien-Cafés der frühen fünfziger Jahre, mit der Ästhetik der Nierentischzeit, geschwungenen Linien und Neonkringeln an der Decke. Meist überlagern sich die verschiedenen Stilrichtungen, wenn nicht das Café, wie es immer häufiger geschieht, gänzlich den neuesten Innenausstattungs-Verbrechern in die Hände fällt: Das komplett vorgestanzte Einheitsdesign aus der Gaststätteneinrichtungs-Spezialfabrik -- Ausdruck pflegeleichter Trostlosigkeit -- breitet sich aus wie die Pest.
Trotz dieser traurigen Entwicklung aber bleibt der regelmäßige Cafébesuch ein fester Bestandteil des Pariser Alltagslebens. Das Café bietet einen Ruhepol im wuselnden Großstadtbetrieb, mit Merkmalen, die trotz aller Unterschiede, was Dekor, Kundschaft und Lage betrifft, gleich bleiben und den Gästen ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit vermitteln. Gewisse Details finden sich, sozusagen als Grundausstattung, in fast allen Cafés wieder: der Plastikbehälter mit frischen Croissants neben der großen glänzenden Zuckerdose und dem runden Eierständer mit dem Salzfässchen in der Mitte, hinter der Theke meist ein erstaunlich flink arbeitender und dabei gewöhnlich ungeduldig raunzender «Garçon», ihm gegenüber die übliche Ansammlung laut debattierender, witzereißender Stammkunden. Irgendwo im Saal führt eine enge Wendeltreppe runter zu Telefon und Klo. An der Kasse sitzt der zur Korpulenz neigende Wirt und liest den «Parisien» (alle Wirte lesen dieses Blatt). Das Ganze wird beschützt von einem deutschen Schäferhund ungemütlichen Aussehens.
«à la tienne!»
Cafés waren stets auch traditionelle Spielstätten. Diese Eigenschaft haben sie -- den aktuellen Verhältnissen angepasst -- beibehalten. Manche sind gleichzeitig Annahmestellen für Lottoscheine, andere für Pferdewetten -- sie tragen die Bezeichnung «PML»: Wenn die Rennen in Longchamp, Auteuil oder Vincennes stattfinden, drängen sich hier die Fanatiker der «Tierce», der Dreierwette, während ein kleiner Fernschreiber die letzten Ergebnisse durchtickert. Gewisse Cafés sind ausschließlich von Kartenspielern bevölkert, wieder andere sind Tempel für Billardfreunde. Ansonsten rattern und klimpern wie überall die Flipper und Elektronikgeräte, und seit neuestem sind auch wieder Jukeboxes in Mode geraten, allerdings in zeitgemäßer Ausstattung mit Lasergraph-Video.
Tragende Säule des französischen Caféwesens ist weniger, wie man vielleicht meinen könnte, der Kaffee als vielmehr das alkoholische Getränk. Das Café ist eine Institution, die sicherstellt, dass Frankreich seinen einsamen Spitzenplatz im internationalen Wettbewerb um Alkoholismus und Leberzirrhose nicht einbüßt. Der Alkoholkonsum vollzieht sich allerdings fast unsichtbar. Selten sind Betrunkene zu sehen, das systematische Saufen der nördlichen und östlichen Nachbarn ist hierzulande unüblich. Statt dessen werden dem Körper in stetigen Abständen kleinere Dosen zugeführt: morgens ein Schluck auf dem Weg zur Arbeit, zwischendurch mal eine Pause für ein Gläschen, dann wird's bald Zeit für den «Apero», und nach dem Essen, zu dem selbstverständlich Wein getrunken wird, noch einen Calvados, um den bitteren Kaffee runterzuspülen. Auf bessere Weine spezialisiert haben sich die sogenannten «Bistrots ä vin». Dort kann man sich glas- oder flaschenweise mit Fleurie, Chinon, Sancerre bekannt machen und dazu Kleinigkeiten essen. Die Wirte sind in der Regel jovial, können aber manchmal muffig werden, wenn sich jemand als Banause entpuppt und einfach, wie in irgendeinem Eck-Café, «ein Glas Rotwein» verlangt. Ein bisschen Kultur wird vorausgesetzt. Ansonsten aber ist die Atmosphäre heiter bis angeheitert. In allen Stadtteilen gibt es solche Weinkneipen. ...
So wie es spezielle Wein-Bistrots gibt, existieren auch Lokale, die sich in exklusiver Weise dem Biergenuss gewidmet haben."
[Liehr, Günter: Paris : ein Reisebuch in den Alltag. -- Überarbeitete Neuausg. -- Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1994. -- (rororo ; 9060 : Anders reisen). -- ISBN 3499190605. -- S. 212 - 217. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
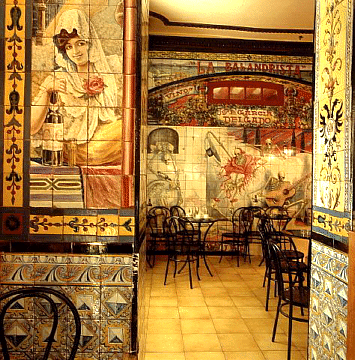
Abb.: Cafehaus, Madrid, Spanien (©Corbis)
"In Spanien allerdings geschieht das [Frühstück] nur selten in der eigenen Küche. Frühstücken ist ein sozialer Akt, und der kann je nach Ort und sozialer Klasse unterschiedlich ausfallen. Zuerst kommt ganz einfach eine hastig auf dem Weg zur Arbeit geschlürfte Tasse schwarzer oder mit ein wenig Milch gebleichter Kaffee. Wer zum Wachwerden einen echten Schock braucht, kippt sich in der Eckbar ein Glas Anis-Schnaps hinter die Binde. Mit Alkoholismus hat das nicht unbedingt etwas zu tun: Es gibt Menschen mit dieser Gewohnheit, die sonst abstinent sind.
Will man den ersten kleinen Hunger des Tages stillen, geschieht dies meist auf süße Art. In der cafeteria lockt am Morgen Gebäck aller Art unter der Glasscheibe am Tresen. Churros und porras, die beim Churro-Bäcker bestellt werden, sind längst nicht mehr die einzigen im Angebot. Auch der croissant ist in Spanien heimisch geworden. Sehr beliebt ist auch die tostada, eine Scheibe auf der plancha (dem Brateisen) geröstetes, weißes Formbrot mit Butter und Marmelade. Schweizer brauchen sich nicht zu fürchten, wenn sie auf der Karte suizo a la plancha lesen, denn gemeint ist nur ein andalusisches Brötchen. Die enmimadas, Hefeteigschnecken aus Mallorca, gehören schon im ganzen Land zum Frühstück, und magdalenas, kleine, in Papier gebackene Kuchen, sind besonders zum Eintauchen in den Milchkaffee beliebt. Wie diese kommen auch die länglichen sobaos (Biskuitkuchen) in Ölpapier aus der Großbäckerei.
Bei den Arbeitern aber, die schon seit Stunden schuften, sieht das Frühstück ganz anders aus: Brötchen (bocardillos) sind hier die Norm, belegt mit Tortilla, Schinken oder Käse, und dazu gibt es häufig schon ein Glas Bier oder Wein.
Kaum sind zwei, drei Stunden Arbeit geschafft, treibt es den Madrileno abermals in die Cafeteria. Ab zehn Uhr herrscht hier Gedränge, und lauthals werden Fußballspiel oder Fernsehprogramm vom Vorabend debattiert. Einige mögen noch chocolate bestellen, die dickflüssige Trinkschokolade nach alter Tradition. Doch die Mehrheit trinkt jetzt eher Milchkaffee (café con leche) aus den typischen großen Tassen. Viele Cafeterias bieten von neun bis elf oder zwölf Uhr preiswerte Frühstückstarife an: einen festen Preis für Milchkaffee, Gebäck und häufig auch frisch gepressten Orangensaft."
[Culinaria España :Spanische Spezialitäten / Marion Trutter Hrsg. -- Köln : Könemann, ©1998 -- (Culinaria). -- ISBN 3829014422. -- S. 286. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
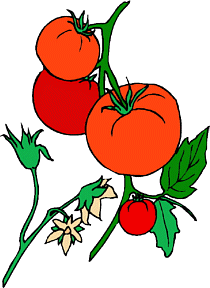
Abb.: Paradeiser (piefchinesisch = Tomate): nach dem Sündenfall schämte
sich der Paradiesapfel so sehr, dass er rot wurde (©ArtToday)
Echte Kommunikationsprobleme können auch innerhalb des deutschsprachigen Raums entstehen, wenn Deutsche und Österreicher sich über Nahrung verständigen. Österreichs Speisekarten können für Deutsche ebenso unverständlich sein wie chinesische. Umgekehrt haben Österreicher -- oft noch nach Jahren Aufenthalt in der BRD -- Schwierigkeiten, sich verständlich zu machen bzw. zu erraten, was sich hinter den "deutschen" Ausdrücken verbirgt. Es folgen nur einige wenige Beispiele aus Österreichs Küchendeutsch:
| Beiried = Roastbeef, Rückenfilet Beuschel = Innereien, v.a. Herz und Lunge Blunze = Blutwurst Brimsen = Schafsquark Buchteln = Hefegebäck (Dampf- oder Rohrnudeln) Eierschwammerl = Pfifferling Eierspeise = Rührei Faschiertes = Hack faschierte Laibchen = Frikadellen Fisole = Grüne Bohne Fleischlaberl = Frikadellen Fleischvögerl = Rouladen Gefrorenes = Eis Germ = Hefe Geselchtes = Geräuchertes Grammeln = Grieben G'spritzter = Schorle Heurige = Frühkartoffeln Indian = Puter Kaiserfleisch = Schweinsbrust |
Karfiol = Blumenkohl Kolatschen = gefüllter Hefekuchen Kracherl = Sprudel, Mineralwasser Kren = Meerrettich Kukuruz = Mais(kolben) Lungenbraten = Filet Marille = Aprikose Melange = Milchkaffee Obers = Schlagsahne Palatschinken = Eierkuchen normal Paradeiser = Tomaten Powidl = Pflaumenmus Ribisel = Johannisbeere Schlagobers = süße Sahne Schwammerl = Pilze Stoppel = Korken Topfen = Quark Weichsel = Schattenmorelle, Sauerkirsche Zuckerl = Bonbon |
[Bedeutungsangaben nach: Pini, Udo <1941 - >: Das Gourmethandbuch. - Köln : Könemann, ©2000. -- ISBN 3829014430. -- S. 719. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Zu Kapitel 10: Kleidung und Anstand