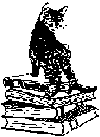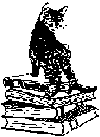Grundlagen der Formalerschließung
Skript
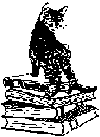
Kapitel 5: Arbeitsweise bei der Katalogisierung
von Margarete Payer
mailto:payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - >: Grundlagen der Formalerschließung
: Skript. -- Kapitel 5: Arbeitsweise bei der Katalogisierung. -- Fassung vom
2011-02-22. -- URL: http://www.payer.de/grundlagenfe/fegscr05.htm.
-- [Stichwort].
Überarbeitungen: 16.6.1997; 17.1.2000; 2004-01-06 [Revision];
2005-05-29; 2009-03-12; 2011-02-22 [Korrekturen]
Anlass: Lehrveranstaltungen an der HdM Stuttgart; im Studiengang
MALIS der FH Köln
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine
Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der
ausdrücklichen Genehmigung der Verfasserin.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Informationswesen,
Bibliothekswesen, Dokumentationswesen von
Tüpfli's Global Village Library.
5.0. Übersicht
- 5.1.
Vorfragen
- 5.2.
Konventionelle Titelaufnahme
- 5.3.
Titelaufnahme unter Einsatz der EDV
- 5.3.1.
Katalogisieren in Institutionen, die nicht Verbünden angeschlossen sind
- 5.3.2.
Katalogisieren in Verbundsystemen
5.1. Vorfragen
Abgesehen von den Fragen rund um den Einsatz der EDV sind u. a. folgende
Überlegungen anzustellen:
- soll die Katalogisierung in einem voll integrierten Geschäftsgang
stattfinden?
- oder ist ein teilweise integrierter Geschäftsgang anzustreben? z.B. die
Titelaufnahme der Erwerbung wird als Katalogisat benutzt. In den meisten
großen wissenschaftlichen Bibliotheken Baden-Württembergs werden zur Zeit
die Erwerbungs- und Katalogisierungsabteilungen zusammengelegt. Oder Formal- und
Sacherschließung liegt in der Hand einer Person (üblich in den USA)
- sollen und können Fremdleistungen übernommen werden? (Auch das Abschreiben von CIP-Aufnahmen -- cataloguing in publication
-- ist schon Übernahme von Fremdleistungen)
- und für größere Institutionen:
- wie weit soll und kann Teamarbeit eingeführt werden? (es gibt gute
Erfahrungen der gemeinschaftlichen Arbeitsaufteilung zwischen Personen mit
verschiedenen Graden von Ausbildung)
- Sollen in größeren Abteilungen die zu katalogisierenden Objekte unter
speziellen Gesichtspunkten aufgeteilt werden?
- z.B. Monographien, Zeitschriften, Musikalien,
Dissertationen, elektronische Ressourcen
- oder unter Verwaltungsgesichtspunkten: Eilbücher, Formate (aus
Platzgründen die großen Formate zuerst), Fortsetzungswerke
- oder nach Sprachen: im Prinzip erwartet man, dass jeder ausgebildete
Katalogisierer mit allen Objekten in lateinischer Schrift fertig wird. Es
empfiehlt sich aber, die Materialien nach vorhandenen Sprachkenntnissen zu
verteilen
- oder nach Schwierigkeit vom Regelwerk her gesehen: z.B. bei Kongressschriften
- oder inhaltlich nach Fächern
Es gilt: je stärker der Katalogisierer sich spezialisiert, desto schneller
und besser kann er im Normalfall seine Materialien bearbeiten. Der Nachteil
dieser Methode liegt im größeren Organisationsaufwand und größerer
Unbeweglichkeit beim Personal. Eine solche Spezialisierung kann die Freude an
der Arbeit erhöhen (z.B. wenn man ein Fach bearbeitet, an dem man interessiert
ist), kann aber auch in der Einseitigkeit Frust mit sich bringen -- und das ist
nicht gut für das Betriebsklima!
Zusätzlich zu diesen traditionellen Überlegungen müssen die Bibliotheken auf
die neuen Herausforderungen elektronischer Ressourcen reagieren. Elektronische
Ressourcen auf festen Trägern sind für das Erschließen kein großes Problem.
Hingegen müssen für elektronische Ressourcen im Fernzugriff (darunter vor allem
Texte im Internet) neue Methoden gefunden werden u.a.:
-
bezüglich des Regelwerks ist zu klären, ob man traditionelle
Regelwerke benutzt oder / und mit Metadaten z.B. nach Dublin Core
erfaßt. Kann man einfache Metadaten automatisch übernehmen? Muss man diese
Datensätze hochkatalogisieren, wenn man eine einheitliches Bild der
Datenbank haben möchte? Die IFLA in ihren Guidance on the structure,
content, and application of metadata records for digital resources and
collections. Draft 2003. URL:
http://archive.ifla.org/VII/s13/guide/metaguide03.pdf Zugriff am
2011-02-22
unterscheidet folgende allgemeine Metadatensatztypen:
Verwaltungsmetadaten (Aufnahmedatum, Sprache...)
Beschreibende Metadaten (Titel, Verfasser...)
Sachliche Metadaten [Analytical metadata] (Schlagwort, Abstract...)
Rights management metadata (Lizenzen, Copyright...)
Technische Metadaten (Digitalisierung, Softwareanforderung
Andere Metadaten (lokale Anforderungen)
- bezüglich der Vorlage für das Katalogisat ist zu klären, wie und wo die
eventuell flüchtige Ressource vorhanden ist. Eine dauerhafte URL ist
anzugeben z.B. eine URN. Eine gute Katalogdatenbank
lässt ihre Nutzer nicht ins Leere gehen.
- bezüglich des Geschäftsgangs muss geprüft werden, wieweit eine
Arbeitsteilung in Erwerbung, Formalerschließung und Sacherschließung noch
sinnvoll ist.
- Eine besondere Herausforderung auf nationaler und internationaler Ebene
ist die Notwendigkeit der Langzeitarchivierung, denn archiviert man die
digitalen Texte nicht, geht das kulturelle Erbe aus unserer Zeit verloren.
In Deutschland ist die DNB, die inzwischen das Pflichtexemplarrecht für
digitale Materialien hat, verantwortlich: Nestor - Kompetenznetzwerk
Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen für
Deutschland. URL:
http://www.langzeitarchivierung.de Zugriff am 2005-05-29;
2011-02-22. Vgl.
auch: Payer, Margarete: Unterlagen zum Modul Digitale Bibliothek :
Langzeitarchivierung. -- Fassung vom 2005-01-10. - URL:
http://www.payer.de/digitalebibliothek/digbib02.htm
5.2. Konventionelle Titelaufnahme
Die konventionelle Titelaufnahme bestand aus folgenden Schritten:
- Nachschlagen im Katalog (ob Verfasser, Körperschaft usw. schon vorhanden
sind, Notieren der Ansetzungen)
- Schreiben
- Vervielfältigen
- vervielfältigte Karten bearbeiten (Köpfen, Sortieren)
- Karten in den Katalog einlegen und den Katalog pflegen (z.B. Ziehen, wenn
die Karteikästen zu voll werden -- ein Finger muss bequem zwischen die Karten
passen)
5.3. Titelaufnahme unter Einsatz der EDV
5.3.1. Katalogisieren in Institutionen, die nicht
Verbünden angeschlossen sind
Es handelt sich dabei vor allem um Dokumentationsstellen und Bibliotheken von
Firmen, Behörden und speziellen meist unabhängigen Instituten.
Da viele dieser Einrichtungen heute häufiger ihre veralteten
Programme und Hardware ersetzen müssen, kann es durchaus
sein, dass Ihre erste berufliche Aufgabe die
Einführung des Ablösesystems ist. Daher folgen
ein paar Punkte zur Vorgehensweise bei einer solchen Einführung:
- Machen Sie eine Ist-Analyse mit mindestens den folgenden Punkten:
- um welche Datenmengen handelt es sich?
- sind schon vorhanden?
- kommen laufend dazu?
- über welches IT-Umfeld verfügt Ihre Institution oder ist sie
verpflichtet, bestimmte Hard- und Software zu nutzen? (Das ist z. B bei manchen Behörden
der Fall)
- Ist ein lokales Netz vorhanden (z.B. WLAN, Intranet)? Ist ein
schneller Internetanschluss vorhanden oder
geplant?
- über wieviel Geld können Sie verfügen?
- sind Sie ein EDV-Experte oder hat Ihre Institution solche? (wichtig,
wenn z.B. eine Anpassung der Software verlangt wird)
- welches Regelwerk wird oder soll angewendet werden? (Deutsche
Spezialbibliotheken, die AACR verwenden, schauen sich auf dem amerikanischen
Softwaremarkt um)
- welches Format wird oder soll angewendet werden?
- Überlegen Sie genau, was Sie brauchen und wollen! (treten Sie mit klaren
Vorstellungen an die Software-Firmen heran, überprüfen Sie anhand Ihrer
Wunschliste, ob die Produkte der Firmen die von Ihnen gewünschten Funktionen
enthalten. Verlassen Sie sich nicht auf Versprechungen, dass man bestimmte
Elemente noch programmieren will. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie der
erste Anwender sein sollen!). Soll es sein:
- ein System für den ganzen Geschäftsgang oder nur für die
Katalogisierung?
- Ist die Einbindung in ein lokales Netz geplant?
- Einplatz- oder Mehrplatzsytem?
- Soll ein alter Kartenkatalog konvertiert oder rekatalogisiert werden?
- Sollen Daten importiert werden? (z.B. Fremdleistungen der DNB)
- Sollen Daten exportiert werden?
- Welche Katalogform ist vorgesehen? (OPAC? OPAC im lokalen Netz und im Internet?
)
- Wie soll die Benutzeroberfläche im OPAC aussehen? (Menüführung und/oder
Expertensuche?)
- Sind die gewünschten Regelwerke anwendbar? (Formal- und
Sacherschließung, Erfassung besonderer Materialien, unselbständige Werke,
Abstract möglich, Einscannen von Inhaltsverzeichnissen?) Auf mögliche Länge des Datensatzes achten! Wieviele
Wörter können aus einem Feld heraus indiziert werden?
- Ist das gewünschte Format anwendbar? Liegen Umsetzungsroutinen vom
früher verwendeten Format auf das neue vor?
- Ist der gewünschte Zeichensatz anwendbar? (Vorsicht bei diakritischen
Zeichen)
- Soll es ein Mehrdateiensystem sein? Welche Verknüpfungen sind möglich?
Sind Normdateien einsetzbar?
- Welche Suchmöglichkeiten sind vorgesehen? Indexierung? Browsing möglich?
Welche Art von Trunkierung? Boolsche Verknüpfungen? String- bzw.
Phrasensuche?
- Wie sieht die Eingabe aus? Abfragemaske? welche Prüfungen
(Pflichtkategorienprüfung, Plausibilitätsprüfung, Dublettenprüfung)? Sind
Hilfsbildschirme vorhanden?
- In Deutschland häufiger für die Katalogisierung in kleineren Institutionen
benutzte Software:
Beispiele:
- Allegro-C (preiswert, erstellt von Eversberg -- UB Braunschweig)
- CDS/ISIS (ohne Kosten, wenn nicht kommerziell genutzt, von der UNESCO,
auf MARC-Basis, nicht für volles MAB geeignet)
- man mache sich kundig z.B. in der Firmenausstellung
eines Bibliothekartages, für Fragen nach Referenzen eines Systems ist die
Inetbib-Liste sehr geeignet
5.3.2. Katalogisieren in Verbundsystemen
Prinzip:
- eine Titelaufnahme nur einmal für alle erstellen, (shared cataloguing)
Ziel:
- Rationalisierung (Doppelarbeit wird vermieden)
- Beschleunigung des Geschäftsgangs
- zentraler Nachweis
- Vereinfachung der Fernleihe (in den großen Verbünden wird heute
online-Fernleihe eingesetzt)
Bedingungen:
- gemeinsames Regelwerk (Eliminieren von Kannvorschriften, um
Mehrfacheintragungen zu verhindern)
- einheitliches Format
- Normdateien
- gute kompatible Hard- und Softwareausstattung
- Finanzierung muss laufend gesichert sein (z.B. hohe Kosten bei der Einführung neuer Versionen usw.)
Nachteile:
- Ansprüche der lokalen Bibliotheken können zu kurz
kommen
- hohe Standardisierung ist arbeitsaufwändig
- Kosten [s. Neubauer : Grenzen und Zukunft der regionalen Verbundsysteme in
Deutschland. -- In: Mitteilungsblatt / Verb. der Bibl. des Landes NW. -- 36
(1986), Nr. 4 S. 350 insbes. -- immer noch lesenswert]
Man kann verschiedene Verbundvorstellungen
unterscheiden:
- Der "deutsche" Typ: gemeinschaftliches Erarbeiten eines
Kataloges, daraus folgt im allgemeinen: sämtliche lokalen Angaben sind eher in
der zentralen Datenbank enthalten, möglichst keine Mehrfacheintragungen
(Bedingung dafür: über das Regelwerk hinausgehende Regelungen, Verringerung
der lokalen Ansprüche). Die deutschen Verbünde bezogen ursprünglich im
allgemeinen nur wissenschaftliche Bibliotheken und Spezialbibliotheken ein.
Das ändert sich. Allerdings müssen sich beteiligende öffentliche
Bibliotheken RAK-WB und nicht RAK-ÖB als Regelwerk benutzen.
Mögliche Erscheinungsformen:
- Verbund mehrerer Bibliotheken gleichen Typs (mit gleicher Funktion)
(z.B. der ehemalige Verbund der Bibliotheken der obersten Bundesbehörden)
- Verbund im regionalen Rahmen (z.B. Bayerischer
Bibliotheksverbund)
Vgl. "Die Empfehlungen der DFG", 1979
vgl.
"Vorschläge zur Weiterentwicklung der Verbundsysteme unter Einbeziehung
lokaler Netze"
- Verbund im nationalen Rahmen bzw. innerhalb eines Sprachraumes (z.B. ZDB
= Zeitschriftendatenbank, seit Januar 2000 bei der DNB angesiedelt))
Während ursprünglich für jede Leihverkehrsregion in Deutschland ein Verbund
eingerichtet wurde (gemäß den Vorschlägen der DFG), findet heute eine stärkere
Konzentration statt. Eine weitere Konzentration oder zumindest Arbeitsteilung
unter den Verbünden könnte in den nächsten Jahren eintreten, wenn die
Vorschläge des Wissenschaftsrates und der DFG vom Februar 2011 befolgt
werden:
Empfehlungen zur Zukunft des bibliothekarischen
Verbundsystems in Deutschland / Wissenschaftsrat. -- 2011-02-03
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10463-11.pdf . -- Zugriff
am 2011-02-22
Positionspapier zur Weiterentwicklung der
Bibliotheksverbünde als Teil einer überregionalen Informationsinfrastruktur
/ DFG. - Ende Januar 2011.
http://www.dfg.de/lis/bibliotheksverbuende/ . -- Zugriff am 2011-02-22
Die regionalen Verbünde:
(Die Zahlenangaben in den Katalogdatenbanken sind nicht ohne Weiteres
vergleichbar: zu prüfen ist vorher der Umgang mit Dubletten)
- Nordrheinwestfälischer Bibliotheksverbund
(HBZ)
- Zentrale: HBZ (Hochschulbibliothekszentrum) in Köln (für
Nordrhein-Westfalen und Bibliotheken in Rheinland-Pfalz)
-
Gründung: 1973
- ursprüngliche Aufgabe: Katalogisierung und Erwerbung in den 7
neugegründeten Gesamthochschulbibliotheken des Landes
- System: BIS; jetzt Aleph ab Mitte
2000
- bedeutendste Produkte und Dienstleistungen: Verbunddatenbank mit etwa
13 Millionen Titeln und über 29 Mio. Nachweisen (Stand 2005);
Online-Fernleihe und Dokumentlieferdienste; Digitale Bibliothek [http://www.digibib.net
Zugriff am 2005-05-29; 2011-02-22]; Digital Peer Publishing [http://www.dipp.nrw.de
Zugriff am 2005-05-29; 2011-02-22]
- URL: http://www.hbz-nrw.de/. --
Zugriff am 17.1.2000; 2011-02-22
- Bayerischer Bibliotheksverbund
(BVB)
- Zentrale: Generaldirektion in München
- Gründung: 1982
- ursprüngliche Aufgabe: Katalogisierung (von Anfang an einschließlich
Sacherschließung) in den 22 wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes
- System: ab 2003 Aleph
- Wichtiges: Verbunddatenbank mit etwa 18 Millionen Titeln und
35 Mill.
Nachweisen unter der URL: http://opac.bib-bvb.de/.
-- Zugriff am 2011-02-22 ; Online-Fernleihe; Internetportal "Gateway
Bayern"
- URL des Verbundportals Bayern:
http://www.bsb-muenchen.de/Gateway-Bayern.88.0.html . -- Zugriff am 2011-02-22
- Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB)
- Zentrale: Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) in
Konstanz (zuständig für Bibliotheken, Museen und Archive des Landes
Baden-Württemberg und für Bibliotheken s.unten)
-
Gründung: 1983 (Gründung des BSZ: 1996)
- ursprüngliche Aufgabe: Katalogisierung (erst seit etwa 1990 auch
Sacherschließung) in den wissenschaftlichen Bibliotheken
Baden-Württembergs, des südlichen Teils von Rheinland-Pfalz (bis 2003) und des
Saarlands (ab 1998). Seit 1991
machen auch die wissenschaftlichen Bibliotheken Sachsens mit.
- 2009e: Verbundkatalog mit mehr als 10 Millionen Titeln und 31 Millionen
Nachweisen aus etwa 1000 Bibliotheken - über 130.000 Medien sind als
Online-Ressourcen nachgewiesen; auch Nachweis von Abstracts, Aufsätzen,
Rezensionen usw.; Online-Fernleihe
- System: BIS; ab 2005 ersetzt durch
CBS4 von OCLC PICA. Als Katalogisierungsclient wird WinIBW benutzt. Der
SWB-Online-Katalog basiert auf der PSI-Datenbank von OCLC PICA
- URL: http://www.bsz-bw.de. --
Zugriff am 2011-02-22
- Hessisches Bibliotheks-Informationssystem (HEBIS)
- Zentrale: Hessischer Zentralkatalog als bibliothekarische Zentrale,
Frankfurt/Main
- Gründung: 1987, völlig neuorganisiert seit 1995
- ursprüngliche Aufgabe: Katalogisierung in den wissenschaftlichen
Bibliotheken Hessens und Rheinland-Pfalz (Teil Rheinhessen)
- System: PICA (s. bei OCLC)
- Wichtiges: Angebot des HeBIS-Portals.
-
Adresse: http://www.hebis.de/. --
Zugriff am 17.1.2000
- Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV). (mit den Ländern Bremen, Hamburg,
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz)
- Zentrale: Bibliotheksrechenzentrum für Niedersachsen (BRZN) in
Göttingen, jetzt VZG
- Gründung: 1982, 1996: Zusammenschluss von Norddeutschem
Bibliotheksverbund und dem Bibliotheksverbund
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
- ursprüngliche Aufgabe: Sammeln und Zurverfügungstellen der
Katalogdaten aller größeren wissenschaftlichen und öffentlichen
Bibliotheken Niedersachsens. Verbunddatenbank enthält 2009 etwa 30 Millionen
Titel mit 49 Millionen Nachweisen
- heute: starke Betonung auf die Bereitstellung zusätzlicher Dienste wie
Bibliografien (z.B. IBZ), Einrichtung und Betrieb von lokalen
PICA-Systemen; Online-Fernleihe; OCLC-Bibliothek; Verbundportal und ein
Verbundkatalog und -Portal für Öffentliche Bibliotheken (ÖVK) (im
Aufbau)
- System: CBS von OCLC PICA
-
Adresse: http://www.gbv.de/vgm/ . --
Zugriff am 2009-03-12
Die sechs deutschen Verbünde bilden zusammen mit dem Österreichischen Verbund,
dem Informationsverbund Deutschschweiz (IDS), der DNB, der ZDB und der DFG die Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme
(gegründet 1983).
Man koordiniert vor allem Fragen gemeinsamer Standards für
Datenkommunikation, Regelwerke, Normdateien, verbundübergreifende Fernleihe usw. Das Sekretariat ist in der DNB, zu erreichen unter:
http://www.d-nb.de/wir/kooperation/ag-verbund.htm . -- Zugriff am 2011-02-22.
Wichtige Projekte sind zur Zeit:
- Umstieg auf MARC 21: MARC 21 wird im Laufe von 2009 als
Austauschformat implementiert
- VD 18 = Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienen Drucke
des 18. Jahrhunderts
- Die Arbeitsgruppe Kooperative Verbundanwendungen (früher:
Arbeitsgruppe Kooperative Neukatalogisierung) hat u.a. Praxisregeln für
die Katalogisierung von E-Books und Digitalisaten erarbeitet
- Verbesserung der Onlinekommunikation für die Normdateien
- Integration von Zeitschriftendatenbank und EZB (Elektronische
Zeitschriftenbibliothek) ist gelungen.
2. Der "amerikanische" Typ: Eine zentrale Datenbank, die im
wesentlichen durch das Einspielen der Daten ausgewählter Institutionen
(insbesondere der LoC, der Nationalbibliothek für Medizin, dem Amt für das
Drucken von Amtsdruckschriften usw.) aber auch durch das Hineinkatalogisieren
ausgewählter Bibliotheken gespeist wird, steht den lokalen Institutionen zum
Abrufen von Daten zur Verfügung. Die durchschnittliche Bibliothek kann etwa
95% der benötigten Daten abrufen. In der zentralen Datenbank stehen die
bibliographischen Daten und die Besitzvermerke (wegen der Fernleihe) bereit.
Alle lokalen Besonderheiten können in den lokalen OPAC's gepflegt werden.
Normdateien sind Gemeinschaftsaufgaben: es ist für die beteiligten
Institutionen eine Prestigeangelegenheit mitzuwirken: so arbeiten an
der Authority List der LoC alle bedeutenden Bibliotheken mit.
Eine Besonderheit in den USA ist die Konkurrenz (eine Bibliothek nutzt
mehrere Verbundsysteme und kündigt, wenn die Qualität nicht mehr stimmt) unter
den Systemen und die dadurch entstandene Konzentration (wenige leistungsfähige
Systeme). Die Systeme müssen sich selbst finanzieren d.h. sie leben aus dem,
was die Abnehmer bezahlen. Es handelt sich meistens um
Non-Profit-Organisationen (betriebswirtschaftlich organisiert, aber die
Gewinne gehen nicht an Privatleute, sondern werden zu Forschungszwecken u.ä.
eingesetzt.)
Die wichtigsten Institutionen:
- "WWW-Konzept": Die zentrale Verbundkatalogdatenbank
wird ersetzt durch verteilte lokale Katalogdatenbanken, die durch das
Internet verbunden werden. Es handelt sich um einen virtuellen
Verbundkatalog. Zur Recherche wird eine Suchmaschine
eingesetzt.
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV)
Der KOBV wurde ab 1997 im Rahmen eines Projektes
mit dreijähriger Laufzeit am Konrad-Zuse-Zentrum für
Informationstechnik Berlin (ZIB) aufgebaut. Die wesentlichen Aufgaben
sind die Realisierung eines neuen Verbundkonzeptes und die Entwicklung
der KOBV-Suchmaschine, dem technischen Kernstück des neuen Verbundes.
KOBV hat den Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg abgelöst. KOBV
betreibt das regionale Internetportal "KOBV-Portal - Digitale Bibliothek
Berlin-Brandenburg
URL:http://www.kobv.de/. --
Zugriff am 17.1.2000; 2011-02-22. KOBV arbeitet seit 2008 mit dem Bayerischen
Verbund zusammen: man ist dabei in einer "strategischen Allianz" eine gemeinsame Verbunddatenbank
aufzubauen.
ENDE