

Herausgegeben von Alois Payer (payer@payer.de)
Zitierweise / cite as:
Feuerbach, Ludwig <1804 - 1872>: Eine Gewissensfrage. -- 1839. -- Fassung vom 2005-01-21. -- URL: http://www.payer.de/religionskritik/feuerbach01.htm
Erstmals publiziert: 2005-01-21
Überarbeitungen:
©opyright: Public Domain
Dieser Text ist Teil der Abteilung Religionskritik von Tüpfli's Global Village Library
Text aus dem Jahre 1839
Wieder abgedruckt in:
Feuerbach, Ludwig <1804 - 1872>: Ludwig Feuerbachs sämtliche Werke / Neu hrsg. v. Wilhelm Bolin ; Friedrich Jodl. -- Stuttgart : Frommann, 1903 - 1911. -- 10 Bde. -- Bd. VII. -- S. 92 -99
Abgedruckt in:
Das Christentum im Urteil seiner Gegner / Hrsg. von Karlheinz Deschner. -- Wiesbaden : Limes-Verl., 1969 - 1971. -- 2 Bde. -- Bd. 1. -- 1969. -- S. 260 - 264 [Wiedergabe hier nach diesem Nachdruck]

"Feuerbach, Ludwig Andreas, berühmter Philosoph, geb. 28. Juli 1804 in Landshut, gest. 13. Sept. 1872 auf dem Rechenberg bei Nürnberg, hatte während seiner Gymnasialzeit in Ansbach eine entschieden religiöse Richtung, studierte in Heidelberg Theologie, ward durch Daubs Vorlesungen für die Philosophie Hegels gewonnen, ging, um letztern zu hören, 1824 nach Berlin, habilitierte sich 1828 zu Erlangen als Privatdozent der Philosophie, machte jedoch als Dozent wenig Glück und wurde als entschiedener Hegelianer angefeindet. Seine anonym erschienene Schrift »Gedanken über Tod und Unsterblichkeit« (Nürnb. 1830; 3. Aufl., Leipz. 1876; neu hrsg. von Jodl, Stuttg. 1903), in der er eine Religion, die sich ein Jenseits als Ziel setze, einen Rückschritt nannte und den Glauben an die Unsterblichkeit psychologisch erklärte, wurde konfisziert, sein Gesuch um eine außerordentliche Professur wiederholt (zuletzt 1836) abgeschlagen, Aussichten auf eine Professur an andern Universitäten erfüllten sich auch nicht, so dass er die akademische Laufbahn verließ, um sich nach Ansbach und (seit 1836) auf das drei Stunden von diesem entfernte Schloss Bruckberg in literarische Einsamkeit zurückzuziehen. Hier, wo er 1837 mit seiner treuen Lebensgefährtin Berta Loew, die daselbst Mitbesitzerin einer Fabrik war, eine glückliche Ehe schloss, sind in ländlicher Muße bis zum Jahr 1860, wo er auf den bei Nürnberg gelegenen Rechenberg übersiedelte, fast alle seine Hauptwerke entstanden. Nachdem er bereits unter dem unpassenden Titel: »Abälard und Heloise« (Ansb. 1833; 4. Aufl., Leipz. 1889) in humoristisch-philosophischen Aphorismen eine Parallele zwischen der realen und idealen Seite des Lebens veröffentlicht hatte, begann er mit seiner »Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie« (Ansb. 1833-1837, 2 Bde.), die sich, wie seine »Kritiken auf dem Gebiete der Philosophie« (das. 1835), durch klassische Schärfe der Charakteristik auszeichnete, den Kampf der Vernunft gegen die Theologie, des Wissens gegen den Glauben, den er im dritten Band: »Pierre Bayle nach seinen für die Geschichte der Philosophie und der Menschheit interessantesten Momenten« (das. 1838) in pikanter Weise fortsetzte, und wobei dieser selbst wie die vorgenannten Denker seinen persönlichen Ansichten zur Folie dienten. Seit 1837 trat er in Verbindung mit Ruge und den »Halleschen Jahrbüchern«, später »Deutschen Jahrbüchern«, wodurch sich sein Bruch nicht nur mit der Theologie, sondern auch mit der Hegelschen Philosophie vollzog, die er in Naturalismus umbildete, obgleich er Hegel noch in der Schrift »Über Philosophie und Christentum« (Ansb. 1839) gegen die »fanatischen Verketzerer aller Vernunfttätigkeit« in Schutz nahm. In der Schrift »Zur Kritik der Hegelschen Philosophie« (1839) erklärte er alle Spekulation, die über die Natur und den Menschen hinaus will, mit dürren Worten für »Eitelkeit«, den absoluten Geist für eine »Schöpfung des subjektiven Menschengeistes«; in der Rückkehr zur Natur fand er die einzige »Quelle des Heils«. In seinem Hauptwerk: »Das Wesen des Christentums« (Leipz. 1841, 4. Aufl. 1883; neu hrsg. von Bolin, Stuttg. 1903), zeigte sich der Zerfall mit der ganzen christlichen Philosophie. Der Satz, den auch Schleiermacher gelegentlich aufstellt, dass der angeblich nach Gottes Ebenbild geschaffene Mensch vielmehr umgekehrt das Göttliche nach seinem eignen Ebenbild schaffe, wird hier zum Ausgangspunkt der Naturgeschichte des Christentums. Die Theologie wird zur Anthropologie, die Feuerbach allmählich für die Universalphilosophie ansah. Feuerbach erklärt die Religion für einen Traum des Menschengeistes, Gott, Himmel, Seligkeit für durch die Macht der Phantasie realisierte Herzenswünsche; was der Mensch Gott nenne, sei das Wesen des Menschen ins Unendliche gesteigert und als selbständig gegenübergestellt; homo homini deus! Zur Ergänzung ließ er dem »Wesen des Christentums« die Schrift »Das Wesen der Religion« (Leipz. 1845), mehrere Aufsätze in den »Deutschen Jahrbüchern«, das Schriftchen »Das Wesen des Glaubens im Sinn Luthers« (Leipz. 1844, 2. Aufl. 1855) und die »Vorlesungen über das Wesen der Religion« (zuerst im Druck erschienen das. 1851, neue Ausg. 1892) folgen, die sämtlich »die Aufgabe der neuern Zeit, die Verwandlung und Auflösung der Theologie in die Anthropologie«, zu fördern bestimmt waren. Die »Vorlesungen« wurden ursprünglich im Winter 1848/49 zu Heidelberg infolge einer an Feuerbach von Seiten der dortigen Studentenschaft ergangenen Einladung gehalten und bezeichneten, wie das »tolle Jahr« selbst, einen Wendepunkt in Feuerbachs Leben. Er zog sich von nun an von dem öffentlichen Leben in philosophische Einsamkeit zurück und wandelte seinen anthropologischen Naturalismus in Materialismus um. Das Werk »Theogonie, oder von dem Ursprung der Götter nach den Quellen des klassischen, hebräischen und christlichen Altertums« (Leipz. 1857, 2. Aufl. 1866), das den Grundgedanken der Vorlesungen über das Wesen der Religion, dass die Götter »personifizierte Wünsche« seien, wiederholt, erregte nicht entfernt mehr das Aufsehen seiner literarischen Vorläufer. Der Materialismus hat bei ihm seinen stärksten Ausdruck erhalten in einer bekannten Rezension von Moleschotts »Lehre der Nahrungsmittel für das Volk« (1850) mit dem Worte: »Der Mensch ist, was er isst«. Diese letzte Gestalt seiner Philosophie enthält Feuerbachs letztes Werk, dessen Titel und Resultat jenem seines ersten verwandt, dessen philosophischer Standpunkt aber das gerade Gegenteil jenes des ersten ist, die Schrift »Gottheit, Freiheit und Unsterblichkeit vom Standpunkt der Anthropologie« (Leipz. 1866, 2. Aufl. 1890). In seinen letzten Lebensjahren (1868 und 1869) schrieb er ethische Betrachtungen nieder, die unvollendet geblieben und erst aus seinem Nachlass herausgegeben worden sind. Feuerbachs äußere Verhältnisse hatten sich trübe gestaltet; 1860 verlor er durch unverschuldete Unglücksfälle seine liebgewordene Heimat auf dem Bruckberger Schloss sowie die bescheidene Rente, die bis dahin dem Philosophen ein beschränktes, aber unabhängiges Einkommen gesichert hatte. Die Existenz auf dem Rechenberg bei Nürnberg (1860-72) wurde durch zahlreiche Beweise von Freundschaft, die ihm aus allen Ländern und aus allen Ständen (auch aus dem Bauernstand) zukamen, verschönert. Dass der als Materialist verrufene Philosoph des Humanismus als Mensch reiner Idealist, human im besten Sinne des Wortes war, dafür legen sein echt deutsches Familienleben, seine rührende Liebe zur Gattin und (einzigen) Tochter Eleonore und seine Wahrheits- und Menschenliebe atmende Korrespondenz Zeugnis ab. Feuerbachs sämtliche Werke sind (Leipz. 1846-66) in 10 Bänden erschienen, neu herausgegeben von Bolin u. Jodl (Bd. 1 u. 6, Stuttg. 1903). Besonders in den 1840er Jahren hat Feuerbach großen Einfluss ausgeübt; seine Anschauungen über Religion und ihren Ursprung sind auch jetzt noch von Bedeutung. Vgl. K. Grün, Ludwig Feuerbach, in seinem Briefwechsel und Nachlas dargestellt (Leipz. 1874, 2 Bde.); »Briefwechsel zwischen L. Feuerbach und Christian Kapp, 1832 bis 1848« (das. 1876); Starcke, Ludwig Feuerbach (Stuttg. 1885); Engels, L. Feuerbach und der Ausgang der klassisch-deutschen Philosophie (das. 1888); Bolin, L. Feuerbach, sein Wirken und seine Zeitgenossen (das. 1891)." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
Eine Gewissensfrage
Aber, meine Herren! noch eine Gewissensfrage zum Abschied
— sind denn unsere Staaten wirklich
christliche Staaten? Stimmt der Begriff des Staates überhaupt mit dem
Christentum überein, mit dem Christentum, welchem die Weltweisheit, die
Philosophie des Diesseits widerspricht? Weiß das Christentum von etwas Anderem
als von einer religiösen Gemeinde? Widerspricht nicht selbst schon eine solche
religiöse Gemeinde, die äußerlichen Staat und Prunk macht, die selbst durch den
Donner der Kanonen die Kraft ihres geistlichen Segens unterstützt, dem Wesen des
Christentums, geschweige erst der Staat? Kommt mir nicht mit den Stellen der
Bibel, welche die Anerkennung der weltlichen Obrigkeit1 aussprechen!
Anerkannte nicht auch das Christentum den Sklavenzustand2? Folgert
Ihr daraus die Christlichkeit dieses Zustandes? Und beziehen sich jene Stellen
nicht auf bestehende Obrigkeiten? Aber soll denn unter den Christen nicht die
einzige regierende Macht die religiöse Macht, nicht ihr einziger Herr und
Meister und König Der sein, von dem sie ihren Namen ableiten? Wo bleibt denn die
göttliche übernatürliche Macht des Christentums, wenn es zu seiner
Unterstützung, um die Christen in Zucht und Ordnung zu halten, der Polizeigewalt
bedarf? Und wenn ja Strafen auch unter ihnen notwendig sind, sollen und können
nicht bei Christen die kirchlichen Strafen diesem Bedürfnis hinreichend
entsprechen? Bedarf ferner der fromme Christ eines anderen Schutzes als der
göttlichen Obhut? Oder schickt sich etwa nicht für den Gott, der die Blumen auf
dem Felde kleidet, ohne dass sie spinnen, und die Raben nicht verhungern lässt,
eine unmittelbare Vorsehung3, bedarf er zur Vermittlung der Vorsorge
einer weltlichen Regierung? Aber ist dadurch nicht das Band zwischen Gott und
den Menschen unterbrochen? Ist dies nicht ein epikurischer4
Grundsatz? Haben die frommen, wahren Christen nicht selbst eingestanden, dass
mit der Erhebung des Christentums auf den Thron der weltlichen Macht der Verfall
des wahren Christentums begonnen habe? Haben sie nicht offen bekannt, dass
weltliches Glück das größte Unglück des Christen sei? Haben sie nicht selbst
Krankheiten des Leibes für Wohltaten der Seele erklärt? Wenn also ein Staat das
weltliche Glück seiner Untertanen sich zum Zwecke setzt, wenn er alle das
leibliche Wohlsein bezweckende Anstalten fördert, und folglich seinen Untertanen
nur weltliche Bestrebungen und Gesinnungen gewisser Maßen zum Gesetz macht,
widerspricht er nicht dem Glauben und den ausdrücklichen Lehren der Christen,
welche selbst die heutigen Christen noch als die Muster ihres Glaubens, wenn
auch nicht ihres Lebens, anerkennen?
Wenn nun aber der Staat den Krieg sanktioniert und selbst dem Kriegerstand den
Vorzug vor allen anderen Ständen gibt, sanktioniert er hiemit nicht ein
unchristliches Prinzip? —
Ihr helft Euch, um Euer Gewissen zu belügen, mit der Gerechtigkeit der Sache. Aber wenn einmal der Krieg an sich unchristlich ist, was Ihr nicht bezweifelt, so bleibt er dem Christen, auch wenn er gerecht ist, immer ein Gegenstand des Abscheues, denn nicht was Recht, sondern was christlich, ist dem Christen Gesetz und Richtschnur. Der Feind raubt Euch Euere Weiber, Euere Schätze, Euere Ehre, Euere Freiheit; das ist zweifelsohne sehr unrecht. Aber was raubt er denn Euch im christlichen Sinn? irdische Güter, die dem Christen in der Gewissheit der himmlischen Güter Nichts sein sollen. Opfert Ihr also nicht der Erhaltung der irdischen Güter die himmlischen Güter, der Heiligkeit des Eigentums die Heiligkeit des Christentums, der bürgerlichen Freiheit die christliche Freiheit, dem rechtlichen Sinn den christlichen auf? Selbst wenn der Feind Euch das Heiligtum Eueres Glaubens rauben will, was ist der einzige christliche Widerstand? — der Märtyrertod.
Ihr helft Euch ferner mit der traurigen Notwendigkeit dieser Welt. Aber für den Christen ist eben nur das Christliche das Notwendige. Trefflich sagt der Kirchenvater Tertullian5 in seiner Schrift De Corona im XI. Kapitel, wo er die Widersprüche des Kriegsdienstes mit dem Christentum aufzeigt:
„Der Stand des Glaubens lässt keine Notwendigkeit zu. Wo nur die Eine Notwendigkeit ist, nicht zu sündigen, da gibt es keine Notwendigkeit, zu sündigen."
Ihr helft Euch endlich damit, dass Ihr sagt, der Soldat, welcher seinen Nächsten oder gar seinen Bruder in Christo totschlägt, tue dies nicht aus persönlichem Hass und Rachegefühl. Aber was ist damit gesagt? Gegen diesen einzelnen Franzosen da, welchen der Deutsche niedersticht, hat er freilich keine besondere Malice6, aber den Feind, die Franzosen überhaupt, hasst er bis in den Tod; er würde, wenn er so glücklich wäre, die ganze Nation unter einen Hut zu bringen, mit dem größten Vergnügen der vielgliederigen Bestie mit einem Hiebe den Kopf abschlagen, nur um seinem lieben Vaterland die Kriegskosten zu ersparen.
Den alten unbedingten, unverdorbenen Christen war Blutvergießen (wenigstens zum Behufe weltlicher Zwecke) ein Greuel. Also meine christlichen oder vielmehr allerchristlichen Herren (. ..) bitte ich mir die Frage zu beantworten: — aber wohlgemerkt ohne schlechte Sophismen — ob und wie unsere Staaten, ja der Staat überhaupt mit dem Christentum zusammenstimmt? Doch verzeiht einem Philosophen diese törichte Frage! Philosophen sind ja schlecht in historicis7 bestellt. Eben fällt mir — aber leider zu spät — mein krasser Irrtum ein. Diese Frage ist ja schon seit Konstantin dem Grossen8 gelöst, der Standpunkt selbst, von dem diese Frage aufgeworfen werden könnte, ein abgetaner, überwundener Standpunkt. Ja wohl! Seitdem das Christentum das asketische Pallium9 Tertullians5 und das Ziegenfell des heiligen Antonius10 mit dem Purpur und Priesterrock vertauscht hat, ist selbst das Schinderhandwerk, ungeachtet die Kirche sich bei der Hinrichtung der auf ihr Anstiften geschlachteten Ketzer immer krank gestellt und eine besondere Blutscheu affektiert hat, nicht nur ein christliches, sondern — noch weit mehr — ein allerchristlichstes Handwerk geworden. Seitdem die Staaten christlich sind, sind die Christen keine Christen mehr. Wenn man einen Vicarius Dei11 hat, was braucht man Gott selbst? Und wenn die Welt christlich ist, was braucht der Christ selbst noch Christ zu sein? Freilich muss man hierbei nicht vergessen die übernatürliche magische Kraft des Christentums, welche die Natur der Dinge verkehrt, ihre natürlichen Eigenschaften in entgegengesetzte verwandelt. Die verfolgende, herrschende und herrschsüchtige Kirche ist z. B. in der Sprache des heiligen Augustinus12 nicht die verfolgende, Gott bewahre! sondern die verfolgte, die unterdrückte, die leidende, und der Strick, mit dem ein Ketzer erst gepeitscht und dann geknebelt und endlich gewürgt wird, nicht ein Zwangsmittel der peinlichen Halsgerichtsordnung13, nein! nur ein Angebinde der christlichen Liebe. So verwandelt die magische Kraft des christlichen Glaubens Galle in Honig, Hass in Liebe, Lüge in Wahrheit! O Wunder über Wunder! Erst geschehen nur natürliche Wunder, aber mit Konstantin dem Grossen8 kommen die moralischen Wunder an die Reihe. Sonst wurde Wasser zu Wein, der Kranke gesund, der Blinde sehend, aber jetzt wurde das Unchristliche zum Christlichen. Erst wurden die Heiden auf wunderbare Weise in Christen, aber dann wieder die Christen auf natürliche Weise in Heiden verwandelt. Das Mittelalter hatte die Aufgabe, den wunderbaren Transsubstantiationsprozess14 des Christlichen ins Unchristliche und des Unchristlichen ins Christliche fortzusetzen und auszubilden, und das tieffromme Mittelalter hat diese Aufgabe aufs Beste gelöst. Jetzt haben wir statt der Dornenkrone des Christentums die christliche Kaiserkrone, statt Armut Reichtum, statt Einfachheit Prunksucht, statt Demut Hochmut, statt Barfüssigkeit Stiefeln und Sporen. Sonst hieß es bei den Christen: nur die Tugend unterscheidet uns. Aber jetzt kommen die christlichen Höfe, die christlichen Fürsten, die christlichen Grafen und Freiherren zum Vorschein, und es schneiden sich die Unterschiede zwischen den Patriziern und Plebejern selbst mit Messerstichen angesichts der christlichen Liebe und des christlichen Glaubens in die allerchristlichsten Herzen ein. Und nicht genug haben die gläubigen Christen an den weltlichen Würden, Reichtümern, Distinktionen und Titulaturen: auch die Kirche, die Perle, die aus dem blutigen Saft des Seitenstichs des Heilands am Kreuze gequollen, muss mit allem Glänze irdischer Herrlichkeit und Eitelkeit schimmern, damit auch an der heiligsten Stätte die religiöse Macht des Christentums, als ein lockender Gegenstand der Ehrsucht und Habsucht, ihre Versöhnung mit der Welt und mit den menschlichen Schwächen und Leidenschaften feiere. So verwandelte sich das erst abstrakte Christentum in konkretes, reales Christentum! Geistigkeit, Einfachheit, Armut, Barfüssigkeit sind Abstraktionen, traurige Abstraktionen; aber glänzende Federn, aber Silber und Gold, aber Purpur und Seide, aber Stiefeln und Sporen sind "reale Potenzen", Dinge, womit sich schon ein menschliches Herz sattsam befriedigen kann. Zwar führte auch das Mittelalter in seinem Wappen die drei Blumen der Keuschheit, der Armut, der Demut (Gehorsams)15. Aber was einst freier Wille war, wurde jetzt, wo der Wille verschwunden, zu einem äußerlichen Gesetz, und was einst Tugend, zu einem Gelübde, welches nicht gehalten wurde. Das Wesen war untergegangen, aber der Schein davon zurückgeblieben als ein Bild der Vorstellung und Einbildungskraft. Die Verwirklichung dieses aus dem Leben verschwundenen, nur in der Einbildung existierenden Christentums war die christliche Kunst. Das Bild erhält den Menschen in der süßen Illusion, das noch zu besitzen, was er bereits verloren; es sagt ihm gleichsam in den wohlklingendsten Phrasen orientalischer Blumensprache die größten Schmeicheleien ins Gesicht, welche dem Thoren, weil sie ihm gefallen, für bare Münze gelten und ihn daher in den frommen Wahn einwiegen, dass er das wirklich noch sei und besitze, was das Bild ihm vorspiegelt. Die christliche Kunst war der Bernstein, zu dem sich das ätherische Öl des Christentums verdichtet hatte; aber das Christentum, das in dem schönen Stein eingefasst war, ach! es war so wenig ein lebendiges, wie das Insekt, das in dem Bernstein eingeschlossen ist, es war nur ein Rest einer untergegangenen Welt. Den Mangel an innerer Wahrheit sollte die Kunst mit ihrer Farbenpracht beschönigen. Das einfache Abendmahl des Herzens war so zu einem splendiden Ohren- und Augenschmaus geworden.
Endlich kam die Reformation und zerstörte den blendenden, aber wesenlosen Schein und verwarf die drei christlichen Tugenden, die längst als lästige Gebote empfunden waren, als die charakteristischen Eigenschaften des christlichen Standes und als die Mittel zur christlichen Seligkeit. Nur im Glauben, hieß es jetzt, liegt die charakteristische Eigenschaft des Christen; im Übrigen ist er Mensch wie ein Anderer, gehört er der Welt, dem Staate an. Ihr dürft heiraten und Kinder zeugen, so viel Ihr wollt und könnt, ohne Euch darüber ein einziges graues Haar wachsen zu lassen; Ihr dürft Euch Schätze sammeln im Himmel, aber auch auf Erden, ohne Euch damit einer widerchristlichen Handlung zu zeihen; Ihr dürft Kriege und Injurienprozesse führen, so viel Ihr wollt, ohne Euch darüber Skrupel zu machen; kurz Ihr dürft Alles tun, was nur nicht mit Recht und Moral streitet; aber glauben müsst Ihr, glauben steif und fest; nur der Glaube macht Euch selig, nur der Glaube zu Christen, sonst Nichts. So schwand das Christentum aus dem Leben und an seine Stelle trat die natürliche Moral, der weltbürgerliche Verstand.
Erläuterungen:
1 z.B. Römerbrief 13, 1ff.
1Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet.
2Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen.
3Denn die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, sondern den bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr haben.
4Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich; denn sie trägt das Schwert nicht umsonst; sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut.
5Darum ist's not, untertan zu sein, nicht allein um der Strafe willen, sondern auch um des Gewissens willen.[Luther-Bibel 1912]
2 z.B. 1. Korintherbrief 7, 20 ff., Philemonbrief. Auch einige
Gleichnisse Jesu setzen die Sklaverei als Faktum voraus (Mt 18, 23 ff., 25, 14
ff.; Mk 13, 34; Lk 12, 42 ff.; 17, 7 ff.)
3 Lukasevangelium 12, 24ff.
24Nehmet wahr der Raben: die sähen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller noch Scheune; und Gott nährt sie doch. Wie viel aber seid ihr besser denn die Vögel!
25Welcher ist unter euch, ob er schon darum sorget, der da könnte eine Elle seiner Länge zusetzen?
26So ihr denn das Geringste nicht vermöget, warum sorgt ihr für das andere?
27Nehmet wahr der Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, daß auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht ist bekleidet gewesen als deren eines.
28So denn das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, Gott also kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen![Luther-Bibel 1912]
4 epikurisch
"Epikuros, griech. Philosoph, als der Sohn eines gewissen Neokles nach der gewöhnlichen Annahme 341 v. Chr. wahrscheinlich auf der Insel Samos geboren, gest. 270, lehrte von seinem 32. Jahr an Philosophie, erst zu Mytilene, dann zu Lampsakos, und gründete um 305 in Athen in einem ihm gehörigen Landhaus und Garten, die er seinen Freunden vererbte, eine Schule, der er bis zu seinem Tode vorstand, und in der man Geselligkeit und Heiterkeit pflegte. Die Summe seiner Philosophie brachte er in kurze Auszüge, die im 10. Buch des Diogenes Laertios aufbewahrt sind. Er hat sehr viel Schriften verfasst, von denen wir aber, abgesehen von Briefen, nur noch Fragmente besitzen. Große Stücke aus einer Schrift über die Natur wurden unter den Trümmern Herkulaneums aufgefunden (hrsg. von Orelli, Leipz. 1818). Mit Ausnahme der Herkulanensischen Bruchstücke hat alles gesammelt Usener, »Epicurea« (Leipz. 1887). Philosophie ist dem Epikuros diejenige Wissenschaft, die durch Begriffe und Beweise ein glückseliges Leben bewirkt. daher auch von den drei Teilen, in die er sie zerlegt: Ethik, Kanonik und Physik, der erstere den Vorrang vor den übrigen hat. Das Wesen der Glückseligkeit (eudaemonia) findet er in der Lust, nicht aber in der des Augenblicks, wie die Kyrenaiker, sondern in der dauernden Lustempfindung, zu der man durch die Tugend gelangt. An der Spitze aller Tugenden steht die vernünftige Einsicht, die bei jeder Handlung abzuwägen weiß, ob mehr Lust oder Schmerz daraus folgt. Die höchste Lust ist die völlige Abwesenheit alles Schmerzes, ein Zustand, der teils durch das ungestörte Gefühl körperlicher Gesundheit, hauptsächlich aber durch eine unerschütterliche Ruhe der Seele bedingt ist. Zu empfehlen sind Mäßigkeit und Genügsamkeit im sinnlichen Genuss, um sich vor den schmerzlichen Folgen des Gegenteils zu bewahren und sich für derartige Genüsse um so empfänglicher zu erhalten. Unrecht ist wegen des daraus erwachsenden Leides der Bestrafung zu vermeiden, Freundschaft dagegen zu suchen, da sie das Leben mannigfach ausschmückt und demselben seine notwendigen Bedürfnisse sichert. Wissenschaftliche Kenntnisse sind nur deshalb wünschenswert, weil sie zur Entfernung aller Furcht dienen. Der Natur gegenüber soll die Physik dem Weisen alle abergläubische Furcht benehmen, die seinen Seelenfrieden stören könnte, und für diese soll wiederum als sichere Grundlage die Kanonik dienen, die Erkenntnis- oder Denklehre, in der er durchaus Sensualist ist und die Induktion stark betont. Die materialistische Naturanschauung des Epikuros schließt sich der Hauptsache nach an die Atomenlehre des Demokritos an. Alle Dinge und Erscheinungen in der Natur sind zufällige Aggregate von Atomen, durch deren verschiedenartige Beschaffenheit und Verbindung ihre eigne Verschiedenheit bedingt wird. Außer den Atomen, ihren Aggregaten und dem Leeren lässt sich etwas Reales nicht denken, sondern alles übrige ist entweder Attribut oder Akzidens von jenem. Einer Einwirkung der Gottheit auf die Bildung und Regierung der Welt widerspricht das viele Unvollkommene und Böse in derselben; das Dasein von Göttern ist zwar nicht zu leugnen, sie halten sich aber von den Menschen entfernt in den sogen. Intermundien, d.h. in den leeren Zwischenräumen der Weltkörper, auf und sind den Bitten der Menschen unzugänglich. Sie sind nichts als die reinsten Ideale der Glückseligkeit, von menschengleicher Gestalt, aus den feinsten Atomen gebildet, gleichwohl aber, im Widerspruch mit der Zerstörbarkeit der übrigen Atomenaggregate, von ewiger Dauer. Die Seele besteht aus den feinsten und beweglichsten Atomen und ist aus Wärme, Luft, Hauch und einem vierten, nicht näher zu bezeichnenden Stoff, der die übrigen drei noch an Feinheit übertrifft und der eigentliche Sitz der Empfindung ist, zusammengesetzt. Hiernach muss die Seele nicht minder als der Körper und wie jedes andre Atomenaggregat der Zerstörung unterworfen sein. Der Tod zerstreut sie in die Lüfte, hebt also auch alles Bewusstsein auf. Der Vorwurf der Stoiker, der Epikureismus sei ein Kultus des sinnlichen Vergnügens, ist ungerechtfertigt; der Epikureische Weise musste nicht allein ein höchst mäßiger, sondern auch der pflichtgetreueste Mann sein, um durch keinen Vorwurf des Gewissens seine eigne Ruhe zu stören; freilich dies alles, genau genommen, nur aus konsequentem Egoismus. Epikurs Schule, die auch unter den Römern viele Anhänger fand, unter denen namentlich Lucretius Carus zu nennen ist, erhielt sich bis ins 3. und 4. Jahrh. n. Chr., ohne jedoch das System ihres Stifters weiterzubilden." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
5 Tertullian
"Quintus Septimius Florens Tertullianus oder kurz Tertullian (* um 160 † um 230) war ein bedeutender, aber auch umstrittener früher Kirchenvater. Er hieß eigentlich Quintus Septimius Florens. Sein Beiname Tertullianus bedeutet in etwa: "Dreimal im Käfig". Tertullian wurde in Karthago (im heutigen Tunesien) als Sohn eines römischen Offiziers geboren. Um 190 wurde er Christ und siedelte nach Rom über. Er studierte die klassischen Fächer (Grammatik, Jura, Rhethorik) und arbeitete als Rechtsanwalt. Viele seiner Schriften lesen sich auch wie ein juristisches Plädoyer, entweder für oder wider. Zu seinen Werken zählen viele Streitschriften gegen die Juden, gegen die Gnosis (Valentinianer und Doketisten), gegen Marcionisten, andere Häresien und gegen die Kindertaufe, aber auch Verteidigungsschriften für das Christentum vor heidnischem Publikum.
Mehr als dreißig seiner Schriften sind erhalten. In der ersten Zeit seiner Schriftstellerei beschäftigte er sich mit privaten (u.a. De pallio, De patienta, Ad uxorem) und katechetischen Themen (u.a. De spectaculis, De idololatria, De testimonio animae, De baptismo). 197 schrieb er seine ersten apologetischen Werke. Tertullian plante offenbar ein größeres apologetisches Werk, als die Christenverfolgung in Karthago drastisch zunahm. Deshalb änderte er seinen Plan und stellte nun in Kürze sein gesammeltes Material zum Apologeticum zusammen, welches den Vorständen der afrikanischen Provinz überreicht worden ist. Während der Severianischen Verfolgung richtete er eine Trostschrift an die im Kerker befindlichen Märtyrer um 202 (Ad martyras). Sein Sprachstil hob sich von anderen ab: Tertullian schrieb engagiert, leidenschaftlich, ja sogar polemisch.
Zwischen 207 und 213 trat er einer montanistischen Sekte bei und plädierte nun enthusiastisch für die Legitimation dieser Sekte. Tertullian starb im hohen Alter irgendwann zwischen 220 und 240. Sein Verdienst lag darin, dass er die Theologie in die Latinität geholt hatte. Er übersetzte zahlreiche biblische Texte aus dem Griechischen und schuf dabei neue lateinische Worte. Viele spätere Vaterunser-Auslegungen sind von ihm abhängig. Außerdem wurde sein Apologeticum als große Ausnahme ins Griechische übersetzt, was auf eine große Relevanz dieses Werkes hinweist.
Der "heidnischen" Philosophie (vor allem Platon und der Stoa) blieb er -- trotz aller Angriffe im Detail -- im ganzen verpflichtet. In "De pallio" rechtfertigt er seine Gewohnheit, weiterhin den Philosophenmantel zu tragen.
Durch seinen scharfen, glänzenden Stil -- und die Tatsache, dass er war der erste Kirchenvater war, der auf Lateinisch schrieb -- gilt er als der Vater des Kirchenlateins. Er prägte z.B. das Wort trinitas für die Dreifaltigkeit Gottes. Tertullians theologische Begriffe und Formeln sind in späteren Auseinandersetzungen von Bedeutung: So nannte er Vater, Sohn, Heiliger Geist "drei Personen" (tres personae), die aber eine Einheit Gottes (una substantia) bilden. Christus ist wahrer Mensch und zugleich Gott. Demnach ist zwischen menschlichen und göttlichen Eigenschaften Christi zu unterscheiden: Sie sind zwar in der Person des Sohnes vereint, aber nicht vermischt. Auf diese Weise beeinflusste er nachhaltig spätere Kirchenväter, vor allem Cyprianus und Augustinus, die ebenfalls im Gebiet des heutigen Tunesien und Algerien wirkten, und somit die gesamte westliche Kirche. In dem theologischen Lehrschreiben des Papstes Leo I. an das Konzil von Chalcedon, dem sog. Tomus Leonis, tauchen verwandte Begriffe auf.Sein asketischer Eifer führte dazu, dass er sich gegen Ende seines Lebens von der orthodoxen katholischen Kirche abwandte und sich der rigorosen und apokalyptischen Sekte der Montanisten anschloss, um 210 sogar lokaler Anführer der Montanisten wurde -- eine Position, die er auch schriftlich vertreten hat. Deshalb wird er in keiner heutigen Christlichen Kirche als Heiliger anerkannt; viele Christen sehen auch seine früheren Schriften als von einem übertriebenen Radikalismus gekennzeichnet an.
In der Orthodoxen Kirche wird Tertullian teilweise als Quelle einer unguten theologischen Tendenz angesehen, die sich in Augustinus fortsetzte und 1054 schließlich zum Bruch zwischen West- und Ostkirche führte.
Fast alles, was wir von seinem Leben wissen, wissen wir von seinen eigenen Schriften."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Tertullian. -- Zugriff am 2005-01-20]
6 Malice (französisch): Bosheit, Tücke
7 in historicis (lateinsich): in Fragen der Geschichte
8 Konstantin, der Große
"Konstantin (lat. Constantinus, »der Beständige«), Name, dessen hervorragendste Träger sind: [Römische Kaiser.] 1) Konstantin J. (C. Flavius Valerius Constantinus), der Große, geb. 27. Febr. 274 zu Naissus in Obermösien, gest. 22. Mai 337, Sohn des Constantius Chlorus und der Helena. Er verbrachte seine Jugend im Lager, zuerst bei seinem Vater, dann, als dieser zum Cäsar westlich der Alpen ernannt worden war, in der Begleitung des Diokletian und des Cäsars Galerius und zeigte schon damals seine hervorragenden Soldatentugenden. Um so mehr musste es ausfallen, als bei der Abdankung der beiden alten Kaiser Diokletian und Maximian (305) zwar neben Galerius sein Vater Constantius zum Augustus, er selbst jedoch nicht zum Cäsar erhoben wurde. Zunächst fügte er sich, dann aber wusste er, als der Vater ihn zurückverlangte, von Galerius die Erlaubnis zur Abreise zu erreichen, traf Constantius gerade im Begriff, von Gallien zu einem Feldzug gegen die Pikten überzusetzen, folgte ihm dorthin und wurde, wie der Vater starb, von den Soldaten an seiner Stelle zum Augustus ausgerufen (25. Juli 306), von Galerius indes nur als Cäsar anerkannt. Während unter den uneinigen übrigen Machthabern die Entscheidung sich hin und her schob, beschränkte sich Konstantin darauf, die alten Reichsfeinde, die Franken, in ihre Grenzen zurückzuweisen, und ließ sich auch dadurch, dass der alte Maximian ihn zum Augustus ernannte und ihm seine Tochter Fausta zur Frau gab (307), aus seiner abwartenden Haltung nicht herausbringen. Von den sechs Augusti dieser Jahre: Galerius, Maximinus, Konstantin, Licinius, Maximianus und Maxentius, trat zuerst Maximianus vom Schauplatz ab. Nach einem vergeblichen Versuch, seinen Sohn in Rom zu stürzen, flüchtete er sich nach Gallien zu Konstantin und wurde von diesem, weil er eine Meuterei in seinem Heere hervorgerufen hatte, 310 getötet; Galerius starb 311, Maxentius wurde 312 von Konstantin in der berühmten Schlacht, die bei Saxa rubra, 9 Millien von Rom, begann und an der Milvischen Brücke endigte, geschlagen und ertrank im Tiber; Maximinus wurde 313 von Licinius bei Adrianopel geschlagen und starb auf der Flucht. So blieben also nur Konstantin und Licinius als Kaiser übrig. Schon 314 kam es auch zwischen ihnen zum Kriege; doch behielt der bei Cibalä (an der Sau) und bei Adrianopel geschlagene Licinius diesmal noch Asien, Ägypten und Thrakien. Die Entscheidung erfolgte im J. 324, in dem er nach erneutem Ausbruch des Krieges bei Adrianopel (3. Juli) und bei Chalcedon (18. Sept) völlig besiegt und gezwungen wurde, sich Konstantin auszuliefern, der ihn 325 angeblich wegen Hochverrats hinrichten ließ und sich so zum Alleinherrscher machte. Die Regierung Konstantins ist in den wichtigsten Punkten die Fortbildung der von Diokletian in Angriff genommenen festern Organisation des Reiches. Die neuen Regierungsformen konnten nicht wohl in dem Mittelpunkt der alten Republik, wo sich noch immer republikanische Erinnerungen und Formen erhalten hatten, ihren Hauptsitz haben. Wie daher schon Diokletian seine Residenz nach dem Osten, nach Nikomedeia verlegt hatte, so erhob Konstantin 330 Byzanz zu seiner Residenz, die er Konstantinopolis nannte. Ferner führte er die diokletianische Organisation des Beamtentums weiter, das in vier scharf voneinander gesonderte Klassen (illustres, spectabiles, clarissimi, perfectissimi) zerfiel; an der Spitze standen Reichs- und Hofbeamte, Oberkammerherr, Hofmarschall, Kanzler, Reichsschatzmeister, Schatzmeister des Fürsten, die Obersten der Leibwache zu Pferde und zu Fuß, jeder mit einer Menge von Unterbeamten. Endlich wurde das Reich unter völliger Trennung der Militär- und Zivilverwaltung in 4 Präfekturen, 12 Diözesen und 116 Provinzen eingeteilt. Da alle Beamten Besoldung erhielten und Konstantin selbst für seine Bedürfnisse viel Geld brauchte, musste er auf Erhöhung des Steuereinkommens bedacht sein und erregte dadurch große Unzufriedenheit; es gab unter ihm sowohl eine Grundsteuer (indictio) als eine Gewerbe- und Nahrungssteuer (chrysargyrum). Den Beinamen »der Große« verdankt er der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion (324); vgl. auch den Art. »Konstantinische Schenkung« (S. 421). Die innere Bekehrung soll durch eine Erscheinung vor der Entscheidungsschlacht an der Milvischen Brücke herbeigeführt worden sein; seitdem sicherte er durch mehrere Edikte, namentlich das Mailänder (313), den Christen Duldung zu und berief 325 das erste ökumenische Konzil nach Nicäa, um die Händel zwischen Arius und Athanasius zu schlichten; die Taufe hat er indes erst auf dem Totenbett an sich vollziehen lassen. Die Beurteilung dieses Schrittes wie überhaupt seines Charakters ist noch zu keinem sichern Abschluss gebracht worden. An Flecken fehlt es nicht; die Hinrichtung seines Sohnes Crispus (326) und seiner Gemahlin Fausta (327) ist ihm von jeher als schwerer Vorwurf angerechnet und von seinen christlichen Lobrednern (unter denen der Bischof Eusebios von Kaisareia die erste Stelle einnimmt) nicht genügend verteidigt worden; auch seine Bildung war nur mäßig. An seiner Selbstbeherrschung und der Klarheit seines Verstandes, an seinem staatsmännischen Blick und seinem Organisationstalent sowie an seiner Feldherrntüchtigkeit (er ist kein einziges Mal besiegt worden) ist indes nicht zu zweifeln. Konstantin starb in Nikomedeia, als er eben die Zurüstungen zu einem Kriege gegen die Perser traf, und hinterließ das Reich seinen drei Söhnen Konstantin II., Konstantius und Konstans."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
9 Pallium (lateinisch): bei den Römern ein weites, mantelähnliches Oberkleid
10 Antonius
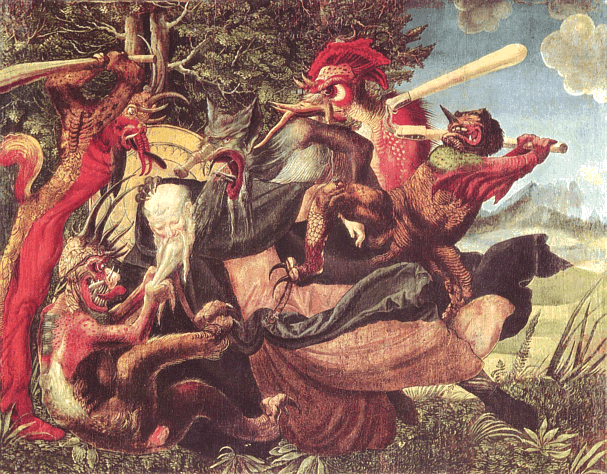
Abb.: Niklaus Manuel Deutsch (1484 - 1530): Dämonen peinigen den Hl.
Antonius. -- 1520
"Antonius, "der Große" Gedenktag katholisch: 17. Januar (gebotener Gedenktag)
Name bedeutet: der vorne Stehende
Gedenktag evangelisch: 17. Januar
Gedenktag anglikanisch: 17. Januar
Gedenktag orthodox: 17. Januar
(latein.: aus dem Geschlecht der Antonier)Einsiedler, Mönchsvater
* um 250 in Kome, dem heutigen Kema bei Heraclea
+ 356 (?) in TabennisiAntonius wurde als Sohn reicher christlicher Eltern geboren; mit zwanzig Jahren übernahm er nach dem Tod der Eltern die Verwaltung der Familiengüter und zog seine jüngere Schwester groß.
Ein Satz Jesu im Matthäusevangelium (19, 21) veränderte sein Leben: "Wenn Du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles, was Du hast, und gibt es den Armen." Er verkaufte seinen gesamten Besitz und wurde Einsiedler in radikaler Armut und zunehmender Abgeschiedenheit.
Die Schweine, mit denen er dargestellt wird, stehen für seine berühmten Versuchungen: So erschien ihm nach der Überlieferung der Teufel in Gestalt einer oder mehrerer schöner Frauen; in anderen Fällen wurde er mit Krallen, Zähnen oder Hörnern verwundet, zu Boden geschlagen, an den Haaren gerissen und, während seine Zelle in Flammen aufging, schließlich unter bedrohlichen Angriffen von allen Seiten in die Lüfte gehoben. Tatsächlich hat das Symbol der Schweine seine Begründung darin, dass später der == Antoniterorden bevorzugt Schweine hielt.
Antonius' kraftvolle Standhaftigkeit führte zu einer immer stärkeren Verehrung, vor der er sich auf einen Berg jenseits des Nils flüchtete. Zwanzig Jahre später kehrte ein äußerlich unveränderter, dennoch völlig verwandelter Antonius zurück, jemand "der in tiefe Geheimnisse eingeweiht und gotterfüllt" war. Immer mehr Jünger sammelten sich um ihn, es bildeten sich kleine Unterkünfte und zahlreiche Einsiedeleien. So stand Antonius am Anfang des Klosterwesens und wird "Vater des Mönchtums" genannt. Die von ihm geprägte Form des Mönchtums beruht auf Askese und Zurückgezogenheit, sie steht im Gegensatz zur Regel des Benedikt von Nursia. Antonius schrieb die Bestimmungen des in seiner Nachfolge gegründeten Ordens nicht auf, diese Aufgabe übernahm nach seinem Tod sein Freund Athanasios, der auch eine Biographie über ihn verfasste.
Im Alter von 90 Jahren bewegte ein Traum Antonius, den 110 Jahre alten Einsiedler Paulus von Theben aufzusuchen. Ein Wolf führte ihn durch die Wüste zu ihm, dem der Rabe an diesem Tage zwei Brote statt des gewohnten einen brachte. Auch dessen Tod wurde Antonius später durch ein Gesicht kund: er fand den Entschlafenen in betender Haltung und bestattete ihn mit Hilfe zweier Löwen, die das Grab scharrten. Als Vermächtnis nahm Antonius das aus Palmstroh geflochtene Gewand mit sich.
Sein Leben in Einsamkeit und Abgeschiedenheit hatte Antonius weder menschenscheu noch unpolitisch gemacht. Mehrfach verließ Antonius seine Einsiedelei. Um 311 stand er den von Kaiser Maximinus verfolgten Christen in Alexandria bei. Er setzte sich für Arme und Gefangene ein, stand ständig mit Kaiser Konstantin in Briefkontakt. In Briefen an dessen Sohn und Nachfolger versuchte er, diesem die Unterstützung des Arianismus auszureden. 350 reiste Antonius nach Alexandria und unterstützte öffentlich Athanasios im Kampf gegen den Arianismus.Antonius soll 105 Jahre alt geworden sein. Als seine Jünger ihn begruben, wurden Engel um ihn stehend gesehen.
Antonius' Verehrung begann schon im 5. Jahrhundert. Seine Reliquien wurden 561 nach Alexandria überführt, kamen 635 nach Konstantinopel, dann um 1000 nach Südfrankreich, 1491 wurden sie nach Arles in Südfrankreich gebracht; Reliquien liegen auch im Stammkloster des Ordens der Antoniter in St. Antoine zwischen Grenoble und Valence. Nach der Gründung des Ordens der Antoniter 1059 in St-Didier-de-la-Motte in Südfrankreich nahm seine Verehrung im Westen regen Aufschwung. Im Osten wird besonders der Mönchsvater, im Westen mehr der Wunderheiler geschätzt. Antonius wird gelegentlich als Nothelfer angerufen, er gehört aber nicht wirklich zu den vierzehn Nothelfern, aber er ist einer der vier heiligen Marschälle. In Italien wurde der Gedenktag als Volksfest begangen: die Tiere durften nicht arbeiten, auch vornehme Herren mussten deshalb zu Fuß gehen. In Rom wird, beginnend mit seinem Gedenktag, jährlich das einwöchige Fest der Weihe der Haustiere vor der Antoniuskirche begangen.
Attribute: Schwein, Teufel, Bettlerglocke
Patron der Haustiere, vor allem der Schweine; der Schweinehirten, Bürsten-, Korb- und Handschuhmacher, Ritter, Weber, Metzger, Zuckerbäcker, Bauern, Totengräber; gegen Feuersnot, Hautkrankheiten, Lepra, Pest, Syphilis, Feuer und Viehseuchen;
Bauernregel: "Wenn Antoni die Luft ist klar / so gibt es ein trocknes Jahr!" "[Quelle: http://www.heiligenlexikon.de/index.htm?BiographienA/Antonius_von_Padua.html. -- Zugriff am 2005-01-21]
11 Vicarius Dei: Stellvertreter Gottes (= Papst)
12 Augustinus
"Augustinus, Aurelius Augustinus, der hervorragendste Kirchenvater des Abendlandes, geb. 13. Nov. 354 in Tagaste in Numidien, gest. 28. Aug. 430 in Hippo. Von seiner frommen Mutter Monika in christlicher Frömmigkeit erzogen, gab sich der l7jährige Jüngling, der in Karthago Rhetorik studierte, einem lockern Leben hin, ohne dass doch die durch die Lektüre der Klassiker (Ciceros »Hortensius«) wachgehaltene Sehnsucht nach Höherm je in ihm erloschen wäre. In der Askese der Manichäer hoffte er Selbstüberwindung, in ihrer Geheimlehre helle Erkenntnis zu finden (374); der auf die Enttäuschung folgenden Verzweiflung an aller Wahrheit entriss ihn die Bekanntschaft mit der neuplatonischen Philosophie und ein neubelebtes Studium der Heiligen Schrift. Seit 383 in Rom, seit 384 in Mailand Lehrer der Rhetorik, erfuhr er an letzterm Orte zu seinem Heil den Einfluss des Ambrosius (s. d.), bekehrte sich und ward in der Osternacht 387 mit seinem natürlichen Sohn Adeodatus von Ambrosius getauft. Im folgenden Jahre kehrte er über Rom in seine Vaterstadt zurück, wo er mit einigen Genossen in einer Art klösterlicher Gemeinschaft in strenger Abgeschiedenheit lebte, bis ihn 391 die Gemeinde von Hippo Regius (Bona) wider seinen Willen zum Presbyter wählte; 395 (oder 396) ward er Bischof. Seitdem wurde die afrikanische Kirche durch die Macht seines Geistes und Wortes regiert. Er bekämpfte mit großem Erfolg alle bereits bestehenden oder neu auftauchenden Häresien, so die Donatisten (s. d.), Manichäer (s. d.), Arianer (s. Arianischer Streit), Pelagianer (s. d.) und Semipelagianer (s. d.), deren Niederlage zugleich den Sieg des afrikanischen Geistes über das übrige Abendland entschied. Augustins Ruhm hatte sich über die ganze Kirche verbreitet, als er in Hippo während der Belagerung dieser Stadt durch die Vandalen starb. Seine Gebeine ruhen seit 1842 neben dem von französischen Bischöfen auf den Ruinen von Hippo errichteten Denkmal des Augustinus Die römische Kirche verehrt ihn als Heiligen. Unstreitig ist Augustinus der für das Abendland einflussreichste unter den Kirchenvätern geworden, teils durch die Konsequenz, womit er Begriff und Interessen der katholischen Kirche wie in der Theologie so in der Praxis durchführte, teils durch die Tiefe seines spekulative und mystische Elemente eigentümlich verarbeitenden Geistes. Darum gilt er nicht bloß als Vater der mittelalterlichen katholischen Scholastik, auch Luther und die Reformatoren haben sich z. T. an ihm, jedenfalls an ihm am meisten unter allen Kirchenvätern, gebildet. In seinem Kampf gegen die Extreme des Manichäismus, des Pelagianismus und Donatismus suchte er die Mitte festzuhalten, indem er sich lediglich auf die beiden Grundideen der Allwirksamkeit göttlicher Gnade und der Kirche als dem Erde und Himmel verbindenden Reiche Gottes stützte. Seine Herleitung des Staates aus der Macht der Sünde und die darauf begründete Forderung der Unterwerfung desselben unter die Kirche war maßgebend für die Auffassung des Verhältnisses beider Institutionen im Papsttum. Eine Darstellung des eignen Lebens mit Strenge und Selbstverleugnung gab Augustinus in seinen oft herausgegebenen »Confessionum libri XII« (deutsch von Rapp, 8. Aufl., Brem. 1889; von Bornemann, Gotha 1889, u. a.; vgl. Harnack, Augustins Konfessionen, Gießen 1888; 2. Aufl. 1894), woran sich die »Retractationum libri II« als eine mildernde Kritik der eignen Werke anschließen. Solcher zählt er hier 93 in 232 Büchern auf, unter denen »De doctrina christiana libri IV«, »De trinitate libri XV« und »De civitate dei libri XXII« die wichtigsten sein mögen. Die beste Gesamtausgabe seiner Werke ist die der Mauriner (s. Benediktiner), die von 1679-1700 in 11 Foliobänden zu Paris erschien." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
13 Halsgerichtsordnung
"Halsgericht ist veralteter Ausdruck für ein Gericht, das über schwere, mit harten Leibes- oder Lebensstrafen bedrohte (»peinliche«) Verbrechen abzuurteilen hatte; auch soviel wie hochnotpeinliches Halsgericht; dann Ort der Vollziehung der Todesstrafe. Hochnotpeinliches Halsgericht hieß die öffentliche Kriminalgerichtssitzung, die früher der Vollstreckung eines Todesurteils am Richtplatz selbst vorherzugehen pflegte, und worin der zum Tode Verurteilte in Gegenwart des Kriminalrichters und der Schöppen nochmals über seine Schuld vernommen, dann das Todesurteil vorgelesen, hierauf der Stab über ihn gebrochen und, nach geschehener Umfrage bei den Schöppen und Umwerfung der Stühle und Bänke, der dabei gegenwärtige Scharfrichter zur sofortigen Vollstreckung des Todesurteils angewiesen wurde. Dieser Gebrauch war ein Überbleibsel der alten öffentlichen Rechtstage (Malefizrechtstage)." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
"Halsgerichtsordnung, die Regelung des Verfahrens vor den Halsgerichten (s. d.). Solche Gesetze finden sich zahlreich in der zweiten Hälfte des 15. und im Anfang des 16. Jahrh. in verschiedenen deutschen Gebieten. Am bekanntesten ist die Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V.: »Kaiser Karl V. und des heiligen römischen Rechts peinliche Gerichtsordnung«, oder kurzweg Carolina (Constitutio Criminalis Carolina, C. C. C.) genannt, das von Kaiser Karl V. unter Zustimmung der Reichsstände auf dem Reichstag zu Regensburg 1532 bekannt gemachte, aus 219 Artikeln bestehende Reichsgesetz über peinliche Verbrechen und Strafen sowie das Strafverfahren. Die über ihre Gerechtsame eifersüchtig wachenden Fürsten schützten sich gegen die Eingriffe der Carolina durch die clausula salvatoria (s. d.). Die Carolina, deren Vorgängerin die Bambergische Halsgerichtsordnung (s. d.) war, blieb direkt oder indirekt bis in die Mitte des 18. Jahrh. das in Deutschland herrschende Strafgesetzbuch, von da ab wurde ihr Geltungsgebiet mehr und mehr eingeschränkt, zunächst durch die partikulare Gesetzgebung Bayerns, Österreichs, Preußens, dann auch fast sämtlicher Mittelstaaten und der meisten Kleinstaaten. Nur noch in den beiden Mecklenburg, in Lauenburg, Bremen und Schaumburg-Lippe erhielt sie sich als Grundlage des Strafrechts in Geltung, bis sie 1871 auch hier durch das Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund beseitigt wurde. Die älteste Ausgabe (editio princeps) ist die zu Mainz von Ivo Schöffer im »Monat Hornung« des Jahres 1533 gedruckte. Nach ihr ist die Carolina in der Ausgabe von Zöpfl (3. Aufl., Leipz. 1883) abgedruckt, die in synoptischer Darstellung enthält: die Bambergensis und die Brandenburgica, den Entwurf von 1521, den Entwurf von 1529 und die Carolina. Eine brauchbare kritische Handausgabe ist die auf Grund der neu aufgefundenen Regensburger Handschrift von 1532 von Kohler u. Scheel herausgegebene (Halle 1900)." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
14 Transsubstantiation: Umwandlung (besonders von Brot und Wein in Leib und Blut Christi im Abendmahl)
15 Keuschheit, Armut, Gehorsam: die drei Ordensgelübde und die wichtigsten der evangelischen Räte (Ratschläge)
"Consilia evangelica (lat., »evangelische Ratschläge«), nach der Lehre der römischen Kirche solche von den Geboten (praecepta) unterschiedene sittliche Vorschriften, zu deren Befolgung der Christ nicht verpflichtet ist, deren Erfüllung jedoch ein besonderes Verdienst des Menschen begründet. Die schon in der alten Kirche geläufige Theorie wurde besonders von Thomas von Aquino entwickelt. Man zählt ihrer im ganzen zwölf; Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam, die drei Mönchsgelübde, gelten als praecipua consilia evangelica [hauptsächliche evangelische Räte]. Die Reformation hat die Consilia evangelica im Interesse der Gottwohlgefälligkeit der ordentlichen Berufsleistung verworfen." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
Zurück zu Religionskritik