

Fachliche Korrespondenz: mailto:
hausarzt@payer.de
Anfragen zur Website: mailto: payer@payer.de
Zitierweise / cite as:
Blessing, Susanne <1957 - >: Gesundheitsökonomie. -- 4. Managed Care. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- Fassung vom 2006-01-08. -- URL: http://www.payer.de/arztpatient/gesundheitsoekonomie04.htm
Erstmals publiziert: 2006-01-08
Überarbeitungen:
Anlass: Gesundheits"reform"
Copyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Verfasserin. Für zitierte Texte liegt das Copyright bei den jeweiligen Urhebern.

Dieser Inhalt ist unter einer
Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Arzt und Patient von Tüpfli's Global Village Library
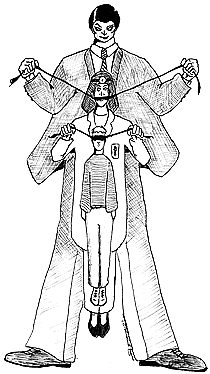
Abb.: Manager-Ärztin-Patient-Verhältnis im Managed-Care-System / von Julia Raiskin
[Bildquelle:
http://www.digitas.harvard.edu/~perspy/old/issues/1996/jun/hmos.html. --
Zugriff am 2006-01-03]
"Der Mensch ist kein PKW, für den es standardisierte Wartungspläne und normierte Ersatzteile gibt"
"Unter Managed care versteht man ein Steuerungsmodell innerhalb eines Gesundheitswesens. Zum Verständnis zunächst eine Zusammenfassung des Gegenteils: In einem nicht regulierten, aber nach dem Sozialprinzip geformten Gesundheitssystem sind Angebot, Nachfrage und Finanzierung weitgehend unabhängig voneinander. Überspitzt formuliert: Kranke verlangen die beste Behandlung ohne Rücksicht auf die Kosten, Ärzte bieten die für sie lukrativste Behandlung ohne Rücksicht auf die Kosten, Versicherer bieten die für sie lukrativsten Versicherungsmodelle ohne Rücksicht auf medizinische Notwendigkeiten und gesamtwirtschaftliche Kosten/Nutzen. Dieses unabhängige Agieren ist nur deshalb möglich, weil das Sozial-/Gesundheitswesen ein Unikum der freien Marktwirtschaft ist: Nicht der Konsument bezahlt die Rechnung, sondern die Allgemeinheit. Der Anbieter kann sein Angebot unabhängig von den wirtschaftlichen Möglichkeiten seiner Klientel gestalten und definiert sein Einkommen so weitgehend selber. Der versicherte Konsument kann auch überhöhte Bedürfnisse decken, auch wenn er es sich nicht leisten könnte. Der Versicherer wiederum erhöht wenn nötig die Prämien.
Aus diesen Gründen hat in einem so organisierten Gesundheitssystem keiner der Akteure einen Sparanreiz: Arzt und Patient sind an aufwändigen Untersuchungen und teuren Behandlungen interessiert, Versicherer sind an hohen Umsätzen interessiert, ebenso Pharmafirmen und andere Zulieferer des Gesundheitsmarktes.
Managed Care versucht, Angebot, Nachfrage und Finanzierung miteinander zu verknüpfen, ohne die Vorteile des Solidaritätsprinzips im Gesundheitswesen aufzugeben. Dazu gibt es verschiedene Modelle, die folgende Elemente beinhalten:
- Patienten schließen sich einem Managed-Care-System an. Der Grund können finanzielle Anreize wie niedrigere Prämien/Beiträge sein, oder auch Zwänge (beispielsweise in den USA eine mit dem Arbeitgeber zusammenarbeitende Health Maintenance Organization (HMO)), oder auch persönliche Überzeugungen.
- Leistungserbringer werden nicht mehr nach Zahl und Art der selbstverordneten Leistungen bezahlt (Einzelleistungsvergütung). Sie erhalten einen Fixlohn oder ein fixes Budget und/oder sie werden mit einem Anteil an Kosten und Gewinn des Gesamtsystems aus Versicherer/ Leistungserbringer/ Versicherten beteiligt.
Beispiele für Managed-Care-Modelle:
- HMO-Modelle (siehe [unten]: Health Maintenance Organization).
- Hausarztnetze mit Budgetverantwortung: eine Anzahl von Hausärzten schließt einen Vertrag mit einem oder mehreren Versicherern, in dem ein Kostenrahmen für alle in diesem Vertrag eingeschlossenen Versicherten festgelegt wird. Bei Kostenunterschreitung erhält das Netz einen Bonus, bei Überschreitung einen Malus. Die Versicherten, die sich einem solchen Netz anschließen, erhalten eine Prämienreduktion.
- Das Hausarztkonzept im niederländischen Gesundheitswesen: Patienten müssen immer zuerst zu einem ihnen anhand der Wohngegend zugeteilten Hausarzt gehen. Zahl und Niederlassungsorte dieser Grundversorger sind strikt reguliert. Die Grundversorger haben nur eine geringe apparative Ausstattung - weder Praxislabor noch Röntgen - und weisen bei Bedarf weiter.
- Im weiteren Sinne sind alle staatlichen Gesundheitssysteme Managed-Care-Systeme, dort allerdings mit zwangsweiser Mitgliedschaft.
Gelöste und ungelöste Probleme:
- Geringeres Angebot und weniger Reservekapazität. Bei betriebswirtschaftlich rechnenden Managern eines Managed-care-Systems besteht die Tendenz, die Kapazität möglichst knapp zu bemessen, um eine hohe Auslastung zu erreichen. Dies bewirkt eine Kosteneinsparung, aber auch einen Verzicht auf Reservekapazität, was sich in oft langen Wartezeiten äußert. (In den Niederlanden etwa für eine Blutentnahme ein bis zwei Wochen, für nicht lebenswichtige Operationen bis mehrere Monate). Da die Patienten während dieser Wartezeiten oft eingeschränkt oder nicht arbeitsfähig sind und da Spätfolgen einer zu späten Behandlung nicht ausgeschlossen sind, können solche Einsparungen im Gesundheitswesen zu schwer kalkulierbaren gesellschaftlichen Mehrkosten führen.
Aktuelle Bedeutung (Schweiz)
- Umgekehrtes Anreizsystem. Wenn Leistungserbringer nicht für das Erbringen, sondern zu einem gewissen Teil für das Vermeiden von Leistungen belohnt werden, besteht die Tendenz - mehr oder weniger unbewusst - eigentlich notwendige Leistungen einzusparen. Dies muss durch entsprechende Qualitätskontrollmechanismen kompensiert werden. Entsprechend muss bei den traditionellen Modellen die Versuchung zur Überbehandlung, zu unnötigen und zu teuren Therapien und zur Verschwendung bekämpft werden.
In der Schweiz waren am 1. Januar 2004 knapp 500'000 (von insgesamt ca. 7 Mio) Versicherte in Managed-Care-Modellen, 100'000 davon in HMOs, 400'000 in Hausarztnetzen.
Wenn Versicherer Hausarztversicherungen anbieten, treten diesen in der Regel 30 - 50% der Versicherten bei. Bei der HMO sind es weniger, da hier die Ärzte nicht bereits bekannt sind.
Aktuelle Bedeutung (Deutschland)Erste Ansätze zur Verwirklichung von Managed care in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung sind Disease-Management-Programme [siehe unten!] und die Integrierte Versorgung [siehe unten!]. Eine deutliche Ausweitung wird im Zusammenhang mit einem Wechsel zum Einkaufsmodell [siehe unten!] für die stationäre und ambulante Versorgung diskutiert."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Managed_Care. -- Zugriff am 2005-12-31]

Abb.: Dr. phil. Jürg Baumberger
[Bildquelle:
http://www.juergbaumberger.ch/d_index.php. -- Zugriff am 2006-01-04]
Dr. phil. Jürg Baumberger, geb. 1946, Soziologe, Politologe, BWLer und VWLer, Geschäftleiter eines Health Management Institute in der Schweiz, sieht in Managed Care eine kulturelle Revolution bzw. Kulturrevolution. Er war selbst zwei Jahre in China, weiß also, von was er spricht. Ein Auszug aus den Ausführungen in seiner Dissertation:
"Die neuen Paradigmen/Eine kulturelle Revolution
Managed Care ist mehr als ein wirtschaftliches Sparprogramm. Wer es auf ein solches Ziel reduziert, wird nicht einmal dieses erreichen.
Vor dem Hintergrund der Ausführungen in Kapitel 1 wird klar, dass das sozialpolitische Ziel einer ausreichenden Grundversorgung für alle Bürger zu vertretbaren Kosten nur erreicht werden kann, wenn sich insbesondere in den Köpfen der Akteure Veränderungen ergeben. Die organisatorisch strukturellen Veränderungen müssen so ausgelegt sein, dass sie diese kulturellen Veränderungen, dass sie neue Paradigmen bei allen Akteuren erfordern und zugleich fördern.
In diesem Sinne einer radikalen Neugestaltung der Denkweisen sowie der sozialen Beziehungen und Interaktionen bezüglich und innerhalb des Gesundheitssystems ist es berechtigt, von einer kulturellen Revolution zu sprechen. Denn, darüber müssen wir uns klar sein: Die Denkansätze, die sozialen Positionierungen sowie die Art der Interaktion müssen grundlegend umgestaltet werden. Und sie werden sich grundlegend umgestalten. Institutionen, die sich dessen nicht bewusst sind, geraten in Gefahr, unter den neuen Verhältnissen in ihrer heutigen Form nicht mehr gebraucht zu werden. Sie müssen sich wandeln, sie müssen zum Beispiel von Verwaltungsinstanzen zu Dienstleistern werden, sie müssen Macht abgeben und sich neue Kompetenzen erarbeiten. Die schiere Existenz genügt als Legitimation nicht mehr. Sie müssen dazu beitragen, die sich neu stellenden Fragen beantworten zu helfen, sonst sind sie wahrhaftig in ihrem Bereich nicht nur Teil des Problems, sondern das Problem selbst. Diese Legitimation der Existenz ist im System demokratisch neu zu erwerben. Kulturrevolution also auch hier.
Auf allen Ebenen müssen sich die Akteure mit neuen Paradigmen auseinandersetzen. Im Bereich der strategischen Steuerung der Gesundheitsversorgung tritt an die Stelle der bürokratischen Kostenbegrenzung die Ermöglichung von Selbstregulierung im Rahmen formulierter Zielvorgaben. In der Steuerung der Gesundheitsversorgung treten an die Stelle der Administration Gesundheitsziele und soziale Ziele, die von der Strukturebene und der klinischen Ebene umgesetzt werden sollen. Detaileingriffe sollten in den Hintergrund treten. Der Schwerpunkt wird von den einzelnen Leistungserbringern auf ein patientenorientiertes Management von Krankheit gelegt werden.
Die Versicherer/Leistungseinkäufer werden von Zahlern von Leistungen zu Einkäufern von Versorgungselementen. An die Stelle der einzelnen Leistung tritt der gesundheitliche Nutzen für die bei den Versicherten eingeschriebenen Kunden. Der Blickwinkel wird sich öffnen von der Administration hin zum Disease Management innerhalb der vertraglichen Beziehungen mit den Leistungserbringern.
Die Krankenhäuser werden in Zukunft nicht mehr bürokratisch institutionell geführt, sondern als autonome wirtschaftliche Einheiten. Dies gilt bei großen Krankenhäusern auch für die innere Führung von Teilbereichen, Kliniken. An die Stelle der Administration als wichtigste Steuerungsinstanz im Krankenhaus tritt das Management des klinischen Bereichs unter Einbezug der Mediziner. In der Steuerung wird die klinische Einzelfallkontrolle ersetzt durch Disease Management-Strategien, die den Klinikern, die durch Guidelines und Informationsinstrumente unterstützt werden, größere Entscheidungsfreiheit geben.
Insgesamt werden die Leistungserbringer weniger darauf konzentriert sein, ein Produkt zu entwickeln, für das sich dann schon eine Abnahme finden wird, sondern sie werden sich bei der Gestaltung ihrer Produkte stärker an den Bedürfnissen des Marktes orientieren müssen. Ihr Blickwinkel wird sich von der Bereitstellung von Einzelleistungen wenden auf den Beitrag, den sie zur Lösung von Problemen der Gesundheit leisten. So werden sie von Verkäufern von Leistungsbereitstellungen zu Partnern im Disease Management, sei das Partner von anderen Leistungssegmenten oder Partner von Leistungseinkäufern.
Diese Gesichtspunkte müssen alle Institutionen des Gesundheitswesens bei der Planung ihrer Strategie berücksichtigen, wollen sie langfristig im Markt bleiben. Für viele von ihnen ist die Idee der strategischen Planung sowie des regelmäßigen Strategiecontrollings heute noch eher fremd.
Bei größeren Unternehmungen gilt das zwar nicht unbedingt für die oberste Führung, aber das Kader ist, wie erwähnt, in traditionellen Denkschemata der Verwaltung und bürokratischen Strukturierung verhaftet. Die oberste Führung der Unternehmung unterschätzt dies sehr oft, was sich dann bei der Umsetzung von strategischen Höhenflügen in oft recht unsanften Bauchlandungen bemerkbar macht.
Während also traditionelle Verhältnisse gekennzeichnet sind durch die Finanzierung von Institutionen, werden unter Managed Care-Verhältnissen Leistungen finanziert.
[...]An die Stelle der Maximierung medizinischer Leistungen am Patienten, wie wir sie in den traditionellen Verhältnissen als gang und gäbe sehen, tritt die Optimierung. Nicht nur der Unterversorgung wird gegengesteuert, sondern auch der Überversorgung.
[...]Abbildung 33 (s.o.) zeigt den Übergang im Bereich der Gesundheitsinformation, zu denen Managed Care-Verhältnisse führen. Es werden prozessorientierte, patientenorientierte Systeme gebraucht, die von einem Kontinuum der Gesundheitsversorgung ausgehen und Patienten und Ärzte im Zentrum haben. Offene Systeme mit Standards werden dazu führen, dass die Partner auch untereinander kommunizieren können. Auch die Inhalte der Informationen werden sich verändern. Einheitliche Codierungssysteme für Krankheiten sind notwendig. Auch die Tarife müssen vereinheitlicht werden, ein Unterfangen, das in der Schweiz zur Zeit unter den Stichworten GRAT (Gesamtrevision Arzttarif) sowie dem daraus resultierenden System TARMED hohe Wellen schlägt. Zum einen werden nämlich Besitzstandsverschiebungen innerhalb der Ärzteschaft (Aufwertung der Grundversorger im wahrsten Sinne des Wortes) die Folge sein, zum anderen hat die Bundespolitik die Forderung einer kostenneutralen Einführung des Tarifs aufgestellt, ohne näher spezifizieren zu können, wie sie sich das vorstellt.
Managed Care-Strukturen werden auch zu einer Veränderung der Ausbildung der Ärzte führen. Die Ausbildung muss die Grundversorger in Zukunft besser qualifizieren, ihre Aufgaben als Koordinatoren wahrzunehmen, und sie muss die Ärzte insgesamt besser qualifizieren in Richtung von Kooperation innerhalb der Profession und richtigem Umgang mit Wirtschaftlichkeitsfragen. Richtiger Umgang meint in diesem Zusammenhang weder engstirniges Sparen noch Verschleudern von Mitteln, das, so die persönliche Erfahrung, heute sehr oft die beiden Pole ärztlichen ökonomischen Verhaltens sind. Den Mittelweg der Optimierung kennen sie meist nicht. Diese veränderten Ausbildungsanforderungen werden organisatorische Konsequenzen bis hinein in die Gestaltung der Krankenhäuser haben. Die Fakultäten werden sich damit beschäftigen müssen, und es ist durchaus vorstellbar, dass auch in der Lehre eine Neugestaltung angesagt ist. Die verschiedenen Ebenen der Organisation des Gesundheitswesens werden sich anpassen müssen. Die Ausbildung der Hausärzte ist neu zu gestalten.
[...]Der Bereich der Prävention wird im Zusammenhang mit Managed Care eine neue Bedeutung gewinnen. Wer mit Budgets arbeitet, dem ist der Gesundheitszustand der Bürger ein Anliegen und nicht erst jener der Patienten. So gewinnt dabei gerade auch die primäre Prävention, die Sorge für den allgemeinen Gesundheitszustand, an Bedeutung und nicht nur die Verhinderung einzelner Krankheiten. Gerade hier muss der Grundversorger die Schlüsselstelle in der Behandlungskette einnehmen. Bei ihm ist die Gefahr geringer, dass er Prävention reduziert auf sekundäre Prävention im Sinne des Verhütens einzelner Krankheiten, die er speziell gut kennt, wie dies im akademischen Bereich der medizinischen Profession mit seinem hohen Spezialisierungsgrad Usus ist.
[...]Auch der Nutzen medizinischer Tätigkeit wird neu definiert werden müssen. Seine Aspekte werden medizinisch und ökonomisch sein, und es wird nicht mehr angehen, dass die medizinische Seite diesen Nutzen rein medizinisch ansieht, ebenso wenig wie die wirtschaftliche Seite die ökonomischen Nutzenüberlegungen einseitig anstellen darf. Wenn über einen vernünftigen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Mitteln nicht allen Bürgern der Zugang zu guten Gesundheitsleistungen gewährleistet werden kann, ist medizinische Qualität abstrakt und damit obsolet. Wenn andererseits die Gesellschaft den Medizinern nicht die entsprechenden wirtschaftlichen Mittel zur Verfügung stellt, können diese ihre Arbeit nicht in der erforderlichen Qualität leisten. Hier das Gleichgewicht zu finden, ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben, die die Gesundheitspolitik zu leisten hat. Sie darf die Leistungseinkäufer und die Leistungserbringer damit nicht alleine lassen.
Im organisatorischen Bereich führt Managed Care zu neuen Partnerschaften, Allianzen. Die Amerikaner sprechen angesichts der Verschmelzung der Verantwortungsbereiche von „blending of roles", vom Rollenverschnitt also. Wenn wir uns die Ausführungen von Kapitel 3.2 vor Augen führen, so können wir uns durchaus vorstellen, dass die Bindung zwischen Leistungseinkäufern und Grundversorgern enger sein kann als jene zwischen den Grundversorgern und den Krankenhäusern. Dies zeigt sich schon heute ganz praktisch in den von Krankenversicherungen mit angestellten Ärzten aufgebauten HMOs, es ist aber auch im Bereich von freiberuflich tätigen niedergelassenen Ärztegruppen vorstellbar. Je nach den Aufgaben, die man sich gegenseitig vertraglich stellt, werden sich auch Kooperationsformen entwickeln.
Angesichts der heute so festgefahrenen Freund/Feind-Verhältnisse ist das keine einfache Vorstellung. In der Praxis zeigt sich, dass festgefügte Vorurteile der Kooperation immer wieder im Wege stehen. Das, was jeder normale Mensch zu Jahresbeginn einmal tun sollte, nämlich in seinem Kopf eine Feindbildentrümpelung vorzunehmen, um sich seinen Handlungsspielraum nicht unnötig einzuschränken, muss hier permanent geleistet werden, eine außerordentlich anspruchsvolle Aufgabe.
[...]
Ein weiterer Punkt des Umdenkens in der Medizin betrifft die Ethik (vgl. auch Kapitel 8.2). Die bisherige ethische Basis muss erweitert werden durch den Einbezug wirtschaftlicher Verantwortung in dem Sinne, dass in der Medizin ethisches Handeln die Berücksichtigung eines verantwortungsvollen und verantwortlichen Einsatzes
beschränkter Ressourcen bedeutet. Diese Diskussion ist innerhalb der medizinischen Profession noch zu führen vor dem Hintergrund der langfristigen Erhaltung eines der Grundwerte unserer Gesellschaft: dem solidarischen Umgang mit Gesundheit und Krankheit. Wenn uns die Mittel für die Bezahlung des medizinisch Möglichen und vor allem des medizinisch Notwendigen fehlen, ist die Gesellschaft als Ganzes gefährdet. Wer sich als Leistungseinkäufer oder Leistungserbringer an der Bereitstellung der medizinischen Grundversorgung beteiligt, ist ex professionem [sic!] für deren langfristige Erhaltung verantwortlich. Gerade dafür wird er unter anderem aus öffentlich finanzierten Mitteln bezahlt.
Auch die Patienten sind gefordert. Sie müssen lernen, Entscheidungen zu fällen, und zwar auch Entscheidungen des Verzichts. Der Vorteil von Managed Care-Systemen ist der, dass diese Einschränkungen in einem Zustand der Gesundheit getroffen werden können und nicht angesichts einer notwendigen Behandlungssituation wie bei Selbstbehalten, Bonus-Malus-Versicherungen etc.
[...]In diesem Zusammenhang ist auch immer wieder eine Angst der Versicherungen und der Leistungserbringer vor ihren Kunden festzustellen, wobei sie sich darin einig finden mit Vertretern traditioneller Sozialvorstellungen, die glauben, den Bürger beschützen zu müssen, indem sie für ihn handeln, statt ihn als Akteur zu aktivieren. Einschränkungen und Umdenken zu fordern ist nicht populär, es besteht die Angst, der Kunde könnte vergrault werden und zum Konkurrenten gehen. Dieser Angst dürften auch Aussagen von Gesundheitspolitikern entspringen, in unserer Gesellschaft seien genügend Mittel für Gesundheitsleistungen vorhanden. Der Hinweis darauf, dass die Bürger für Ferien viel oder sogar noch mehr Geld ausgeben, als für die Gesundheit, ist angesichts drohender Beitragssatzerhöhungen in Deutschland und Prämienerhöhungen in der Schweiz ein schwacher Trost.
[...]Schließlich ist Managed Care auch eine kulturelle Revolution bezüglich des Lernens in sozialen Systemen. Die Begründung dafür haben wir in Kapitel 1.1 gegeben. Die Akteure werden erfahren, solche Systeme auf die jeweiligen Gegebenheiten zu „übersetzen". So werden sie lernen, mit neuen sozialen Strukturen umgehen zu können, und sehen, dass es möglich ist, diese mitzugestalten. Der Weg dazu sind Modellversuche, die bei Misserfolgen auch wieder abgebrochen werden können. Diese Art des Vorgehens haben wir in der Schweiz gewählt, und, abgeleitet davon, wurde sie auch für Deutschland übernommen.
So zeigen sich unter dem Thema Managed Care Elemente einer Zukunft, in der die Gesundheitskultur sich wandelt von Maximalismus zu effektivem verantwortlichem Mitteleinsatz unter Berücksichtigung der Qualität. Von gleichberechtigten Partnern gemeinsam getragene Verantwortung anstelle von Bevormundungsversuchen könnte die Grundlage sein für eine gute Gesundheitsversorgung unter vernünftigem Einsatz der vorhandenen Mittel."[Quelle: Baumberger, Jürg <1946 - >: So funktioniert managed care : Anspruch und Wirklichkeit der integrierten Gesundheitsversorgung in Europa. -- Stuttgart : Thieme, 2001. -- 274 S. : graph. Darst. ; 23 cm. -- ISBN 3-13-128391-2. -- Zugleich Dissertation, Münster, Univ., Philosophische Fakultät. -- S. 95 - 102. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]

Abb.: Die
chinesische Kulturrevolution (无产阶级文化大革命), 1966 bis 1976, hat den Menschen ein
neues Paradies versprochen und die Hölle gebracht: auf dem Propagandaposter
sieht man einen Barfußarzt (赤脚医生), ein damals hochgelobtes medizinisches
Versorgungssystem
[Bildquelle.
http://www.iisg.nl/~landsberger/bfd.html. -- Zugriff am 2006-01-04]
Fürwahr eine Kulturrevolution! Schon im Stil liegen zwischen diesen Ausführungen über neue Paradigmen und der Anstiftung zum Umdenken von Bernard Lown Welten.
Lown, Bernard <1921 - >: Die verlorene Kunst des Heilens : Anstiftung zum Umdenken. -- 2., erweiterte und illustrierte Auflage. -- Stuttgart [u.a.] : Schattauer, 2004. -- XX, 307 S. ; 25 cm : Ill. + 1 Audio-CD. -- Originaltitel: The lost art of healing. -- ISBN 3-7945-2347-4. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Als seit 1982 tätige Ärztin, die unmessbar viel menschlicher Not und Leiden begegnet ist, ist es mir klar, auf welcher Seite ich zu stehen habe: auf der des Arztes Lown und nicht auf der des Gesundheitsmanagers Baumberger!
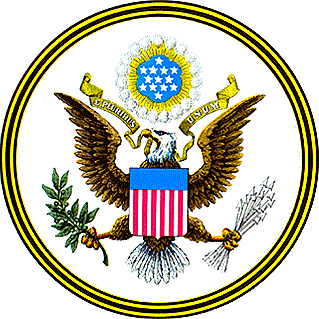
Abb.: Das Wappentier der USA ist ein Adler, kein Kapitalistengeier!
"Managed care is a concept in U.S. health care which rose to dominance during the presidency of Ronald Reagan [1911 - 2004] as a means to control Medicare payouts. As a major Medicare claims administrator, the Blue Cross-Blue Shield insurance firm was a major architect of managed care. It spread fairly quickly to the health insurance industry in the private sector.
Abb.: ®LogoManaged care is based on a effort to control escalating health care costs by the health insurance industry, which supposedly defines a reasonable maximum fee which health care providers may charge for any given service. Providers are ostensibly bound to accept these maximum fees if they wish to be listed in directories of specific insurance companies, which are provided to their policy holders as referral directories of "approved" physicians.
The rise of managed care was credited by the health insurance industry for the lessened rate of medical inflation seen in much of the 1990s in the U.S., which in some years of that decade the rate of increase in price of medical goods and services was little more than the overall rate of general inflation. However, this effect now seems to largely have ended, and U.S. medical inflation is once again two or three times the rate of overall inflation, as it was during much of the 1980s.
Forms of Managed CareThere are several forms of managed care. Ranging from more restrictive to less restrictive, they include:
Health Maintenance Organization (HMO)Proposed in the 1960s by Dr. Paul Elwood in the "Health Maintenance Strategy", the HMO concept was promoted by the Nixon Administration as a fix to rising health care costs and set in law as PL [Public Law] 93-222. As defined in the act, a federally qualified HMO would in exchange for a subscriber fee (premium) allow members access to a panel of employed physicians or a network of doctors and facilities including hospitals. In return the HMO received mandated market access and could receive federal development funds.
In practice, an HMO is an insurance plan under which an insurance company controls all aspects of the health care of the insured. In the design of the plan, each member is assigned a "gatekeeper", a primary care physician (PCP) who is responsible for the overall care of members assigned to him/her. Specialty services require a specific referral from the PCP to the specialist. Non-emergency hospital admissions also required specific pre-authorization by the PCP. Typically, services are not covered if performed by a provider not an employee of or specifically approved by the HMO, unless it is an emergency situation as defined by the HMO. Financial sanctions for use of emergency facilities in non-emergent situations were once an issue; however, prudent layperson language now applies to all emergency-service utilization and penalties are rare. A leading example is the Kaiser Permanente Plan.
Since the 1980s, HMOs have been protected by Federal law from malpractice litigation on the grounds that the decisions regarding patient care are administrative rather than medical in nature.
Preferred Provider Organization (PPO)PPOs are insurance plans in which the policy-holder is free to chose his/her own physician, although they will generally receive greater benefits returns (possibly including lower deductibles, lower copayments, and higher reimbursement percentages) if a pre-approved "network" of caregivers and facilites is utilized in non-emergency situations, and a PCP is identified and consulted. These "network" caregivers and facilities are independent of insurance company ownership, and may hold contracts for reimbursement with multiple insurors. "Pre-certification" (prior approval) may be required before nonemergency hospital admissions, testing, consultations or outpatient surgery under many plans. Providers remain liable for malpractice.
While not employees of the insuror, PPO healthcare providers do hold contracts with each insurance company for which they are designated as "preferred", under which they agree to accept the reimbursement that was negotiated at rates agreed upon between themselves and the insuror at the time of execution of the contract. In the beginning, the insurance companies used actuarial tables to determine a "reasonable and customary fee" for each service and the provider, if he/she generally charged more, was obligated to write off the difference. The insuror would then pay a percentage of the balance to the provider, and the rest would become the responsibility of the insured. But during the 1990s, many providers engaged the services of medical office management services to handle these contracting arrangements on their behalf, with the result that full fees, writeoffs, and percentages due from insuror and insured are jointly agreed-to amounts between the insuror and the provider on a plan-by-plan, provider-by-provider basis, which amounts are protected as corporate secrets and are not available to consumers who wish to compare benefits offered against premiums charged on a dollar basis. Furthermore, in the event the insuror defaults on payment by claiming a service provided was "not necessary" under the plan, the provider is free to charge any amount he/she deems desirable to the patient, instead of any generalized, capitated "reasonable and customary fee" determined by the insuror.
Point of Service (POS)A POS plan utilizes some of the features of each of the above plans. Members of a POS plan do not make a choice about which system to use until the point at which the service is being used.
Managed care in indemnity insurance plansMany "traditional" or "indemnity" health insurance plans now incorporate some managed care features such as precertification for non-emergency hospital admissions and utilization reviews."
[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Managed_care. -- Zugriff am 2006-01-03]

Abb.: Julia Raiskin, Harvard-Absolventin, Sozialanthropologin und
Russlandspezialistin, 1998
[Quelle:
http://www.rhodesscholar.org/win98.html. -- Zugriff am 2006-01-03
Julia Raiskin zog schon 1996 eine bittere Bilanz von Managed Care in den USA:
"Wall Street in Hospital Scrubs : Managed Care and American Health By Julia Raiskin
Three years ago, Christine deMeuers was diagnosed with metastatic breast cancer. Her only hope was a new type of therapy, the harvest and retransplantation of her own bone marrow. After receiving her diagnosis, Christine and her husband Alan sat down to read the ominously thick contract they had signed when they enrolled in Health Net, a California-based Health Maintenance Organization (HMO). Like most members, they had never opened the book; now they were poring over its pages. And although their despair was briefly interrupted by Alan's exclamation, "it's covered!", the fight for treatment was to continue for the next two years. Christine had to travel from clinic to clinic, plead with HMO officials, implore her doctors for a right to treatment and, astonishingly, question the veracity of their opinions and prescriptions. She died on March 10, 1995.
The growing frequency of experiences like deMeuer's--the failure of the HMO, the uncertainty surrounding the doctor-patient relationship, the anxiety about coverage--raises the obvious question: "What's happening to America's health care?" You don't have to be Oliver Stone to spot a story behind this story. The truth of the matter is that our medicine is less and less about trust and care, or even doctors and patients; the dictates of profit maximization are our medicine's new guiding principles. "It's a paradigm shift," states "new medicine's" success William Popik, chief medical officer of a large HMO, "What's shifting is patients can't drive it anymore; patients can't decide, `My ear hurts, so I'm going to go to the doctor today.'" While this executive may be justified in trivializing earaches, his attitude borders on monstrous when one considers that life-threatening conditions are often discovered through the examination of minor complaints.
Of course, ruthless moneymaking is the stuff of which our American dream is made. Open a business and amass millions; you are well on your way to fulfilling the dream. In a society where people hold Michael Milken and Bill Gates as cultural icons, and commodification is regarded as a form of creativity, allegiance to profit appears morally commendable. However, when the commodities are Life and Death, our laissez-faire attitudes run up against some ethical dilemmas.
Until a few decades ago, America had been a fee-for-service type of land, where medical care consisted of transactions between khaki-clad doctors and trusting patients; these could cost anywhere from $50 for a routine visit to hundreds of thousands of dollars for complex procedures such as transplants. For the insured, much, or at least a part, of this tab was picked up by the traditional insurance companies; the uninsured often had to rely on charity care.
That was then. Now, "managed health care" plans have been widely introduced to counteract the escalating costs of medical procedures and to allow coverage for patients unable to afford traditional insurance plans. For the privately insured, this managed care comes largely in the form of Health Maintenance Organizations. The idea is very attractive: for a reasonable fee ($5-10 for a routine doctor visit) patients are able to obtain care from a designated circle of physicians. Behind the veil of affordability, however, hides the boardroom decision-making of big business. In order to "manage" this health care, doctors have been turned into marionettes by behind-the-scenes entrepreneurs whose tight fists often prohibit costly treatments, regardless of patient need. In the jargon of market-driven medicine, patients are "covered lives," and physicians are "gatekeepers." The rise of market forces, with their exclusive focus on profit, threatens to transform the language of medicine into Wall Street newspeak.
HMO care is radically different from fee-for-service care because it merges two traditionally separate sectors--health care providers and insurers--into one. Patient premiums and payments to doctors are now controlled by the same set of executives. Conventional insurance companies operate through perpetual rounds of Russian roulette: they collect premiums calculated according to life models, smoking patterns, and general health risks in the population, and then hope the money they receive exceeds the funds they are forced to hand over to doctors. Since HMOs collect the premiums and employ the doctors, the risks which they assume are internally controlled by their managers.
HMO executives frequently use questionable methods to further their corporate goals. Most HMOs cut premiums to attract more patients, which, of course, requires internal costs to be reduced in order to maintain profits. So HMOs frequently resort to a cost-cutting measure dubbed "capitation." Capitation is, crudely put, much like giving a child with a sweet tooth a bag of candy, instructing her to give out as much as she wants and to keep the rest. Primary doctors are budgeted a fixed amount of money, a flat fee to treat each patient. And, since they are the "gatekeepers" to further care, they must share this sum with specialists. As a result, every time a doctor refers a patient to a specialist or performs a costly procedure, her take-home pay is docked. If the doctor spends less than the capitated rate, she keeps the difference. Those thrifty doctors who help to restrain health spending often receive bonuses or other financial rewards from the grateful HMO.
This practice pits patients and doctors against each other and, needless to say, breeds problems bigger than big business. "Understand, every time a patient comes into the doctor's office it's a liability, not an asset, because [the doctor] is on a fixed income," says David Robinson, a doctor hired by a California HMO. Dr. Herbert Lang, an internist who was formerly employed by the Share Health Plan of Illinois, claims that he had to quit because "when I did not order some expensive test like CAT scan, I was forever asking myself if I did that because it was not medically indicated or because I wanted to save money. In the end, I would over-order tests, and I didn't make as much as some of the other doctors."
Unstated limitations on medical services offered to patients are a logical consequence of the capitation "fat trimming" method. General practitioners control patient access to further medical care, including treatment by specialists. A further problem, however, is that the gatekeepers themselves are limited in their options because they, too, must consult a "higher authority"--HMO managers--for permission to administer and refer. One physician recalls "requesting a CAT scan for a boy who had experienced seizures and occasional losses of consciousness, possible warnings of a brain tumor, only to have his request denied."
Patients are also restricted in their options by the limited coverage of "experimental procedures," as defined by their HMOs; this was Christine deMeuer's predicament. The managed care system abhors complexity and innovation. Breakthroughs tend to be expensive, and so there is virtually no talk of funding research. Health Net recently rejected a proposal to support a study on ovarian cancer claiming: "If we put money into ovarian cancer research and the word gets out, then it isn't going to be long before AIDS groups or prostate-cancer groups start having a field day." The reluctance to invest in new treatments is peculiarly selective, and always dictated by cost concerns. While adamantly refusing to support expensive systematic clinical research or to cover transplants and innovative pharmacotherapies, some health care providers experiment with cheaper "miracle cures" by paying for visits to faith healers and acupuncturists.
As a result, HMOs have a perverse incentive to cheer for negative trial outcomes. In response to a trial showing transplants were an effective treatment for breast cancer-- treatment that would become standard in the near-future--a chief health official of an HMO reacted with despair. He was "very disappointed" to discover that the treatment was "not experimental." He even "raised a little hell" about the results.
We are caught in a situation in which the HMO benefits from patient ignorance. "You put yourself in a position where you don't discuss it, or else discuss it and, worse yet, indicate that all the data is negative or that there is not a significant amount of data about this," says Dr. Jones, a Colorado physician, "I think you are irreparably damaging the very thing that makes you as a physician so valuable to patients." The more the patient is kept in the dark about her treatment options, the more the doctor and the HMO stand to benefit.
All of this would less disturbing if patients had the right to know about the devil's kitchen behind the polished HMO facade. But patients often do not even have the option of knowing about the "standard practices" of managed care providers. By law, HMOs are permitted to limit the information which doctors may disclose to their patients. The use of "gag clauses" in contracts with doctors is an increasingly common practice. These clauses--which doctors often must sign as part of their contracts--give HMOs the right to regulate the level of disclosure. HMOs claim that this practice is intended to protect proprietary and trade secrets, as well as to divert doctors' venting of their frustrations from patients to management.
The practical consequence is that many doctors who want to advocate on behalf of their patients are muzzled. A standard "gag clause," found in a contract of Choice Care in Cincinnati reads: "Physicians shall take no action nor make any communication which undermines or could undermine the confidence of enrollees, potential enrollees, their employers, plan sponsors or the public in Choice Care, or in the quality of care which Choice Care enrollees receive." Some contracts, such as those offered to physicians by Kaiser Permanente of Ohio, do not even permit doctors to discuss any proposed treatments with patients before receiving authorization, while others bar doctors from making "disparaging" or "derogatory remarks" about the HMO.
Though many doctors are forced to accept the terms of the HMOs' contract for financial reasons, resistance has been significant. Doctors in New York recently filed a law suit claiming that confidentiality clauses destroy "the physician's liberty to convey needed information to patients concerning HMO operations." The deputy director of Medical Society of New Jersey, Neil Weisfield, added that "these gag clauses intimidate physicians and discourage them from talking openly to patients about the need for specialty care and the role of managed care companies in limiting tests and treatments. It's more like managed silence than managed care."
Even as care is severely restricted, corporate profits are soaring, and executives are receiving hefty pay raises. Last year Health Net's director earned a base salary of $815,000, an additional bonus of nearly $300,000, and other incentive-plan rewards that brought his yearly total to nearly $1.9 million. Massive mergers are continually boosting these corporate salaries by turning large HMOs into sprawling monopolies, as smaller insurers are pushed to the limits of fiscal viability.
How many more Christine deMeuers will it take for us to realize that health care should not be tied to the fluctuations of the market? Since we cannot radically alter our entrepreneurial mentality, the government should become more proactive in ensuring that medicine does not become a "growing economic field." Tough regulation is imperative. Legislation limiting HMOs' control over patient-doctor communication and enforcing coverage for particular procedures and support for research is long overdue. If this appears to be disadvantageous for big business, it is because, clearly, medicine must not be solely about big business. As Christine deMeuer's experience shows, the consequences of corporate strategizing in medicine may be lethal."
[Quelle: http://www.digitas.harvard.edu/~perspy/old/issues/1996/jun/hmos.html. -- Zugriff am 2006-01-03]
Dr. med. Dr. rer. pol. Michael Wiechmann, Leiter Bereich Gesundheitsmanagement und Medizin, Allianz Private Krankenversicherungs-AG befürwortet (erwartungsgemäß?) Managed Care für Deutschland:
" Wiechmann, Michael Managed Care in Deutschland: Sechs Thesen zur Einführung
Deutsches Ärzteblatt online, 08.10.2004, www.aerzteblatt.de/aufsaetze/0404
Mit der Umsetzung von Managed Care können sowohl die Kosten der medizinischen Versorgung gesenkt als auch die Qualität verbessert werden.Das deutsche Gesundheitssystem befindet sich seit Jahren in einer Krise. Die bisher durchgeführten Reformen brachten nicht den erhofften Erfolg, weil sie an den wesentlichen strukturellen Defiziten kaum etwas änderten. Als Option zur Reform beziehungsweise Weiterentwicklung des Gesundheitswesens werden immer wieder die Konzepte von Managed Care genannt. Managed Care ist vom Prinzip her ein integriertes System zur Steuerung der medizinischen Versorgung mit dem Ziel, sowohl die Qualität als auch die Wirtschaftlichkeit zu verbessern.
Managed Care wurde lange Zeit als rein amerikanisches System angesehen und erschien kaum übertragbar in andere Gesundheitssysteme. Die Erfahrungen in einigen europäischen Ländern zeigten aber, dass Managed-Care-Konzepte auch im europäischen Umfeld umgesetzt werden können. Für nähere Details und zur Frage der Umsetzbarkeit von Managed Care im deutschen Gesundheitswesen – hier vor allem im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) – sei an dieser Stelle auf die entsprechende Literatur verwiesen. Im Folgenden werden sechs Thesen zur Umsetzung von Managed Care in Deutschland aufgestellt, die anhand der aktuellen Datenlage diskutiert werden sollen.
These 1: Managed Care ist zwar in den USA in einem irregulierten und hoch kompetitiven Gesundheitsmarkt entstanden, dennoch kann Managed Care auch in andere Gesundheitssysteme übertragen werden.Die Gesundheitssysteme in Europa und den USA weisen in der Tat sehr unterschiedliche Strukturen und Prozesse auf. Das amerikanische Gesundheitssystem ist sehr marktwirtschaftlich orientiert und unterscheidet sich deshalb bezüglich Kontrahierungspflicht, Prämienkalkulation und Datenmanagement erheblich von anderen Versorgungssystemen.
Die bisherigen Erfahrungen mit der Einführung von Managed-Care-Elementen – wie zum Beispiel in den Niederlanden oder der Schweiz – haben aber gezeigt, dass diese ursprünglich in den USA entwickelten Konzepte auch in völlig anders strukturierte Gesundheitssysteme übertragbar sind. Diese Erfahrungen machten aber auch deutlich, dass die Einführung von Managed-Care-Konzepten in ein bisher eher traditionell organisiertes Gesundheitssystem an wichtige Voraussetzungen gebunden ist.
Diese Grundvoraussetzungen sind in Deutschland im Prinzip gegeben. Sowohl die Versicherten als auch die Leistungserbringer sind sich der Notwendigkeit bewusst, das Gesundheitssystem weiterzuentwickeln. Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Umsetzung von Managed Care sind im Jahr 1997 mit dem 2. GKV-Neuordnungsgesetz und im Jahr 2000 mit der GKV-Gesundheitsreform geschaffen worden. Wie in mehreren Untersuchungen dargestellt, können mit den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen wichtige Managed-Care-Konzepte in Deutschland umgesetzt werden. In einer Versicherten- und Ärzteumfrage konnte gezeigt werden, dass bei entsprechender Gestaltung von Managed-Care-Modellen, wie zum Beispiel der Integrierten Versorgung, sowohl bei den Versicherten als auch bei den Leistungserbringern die nötige Akzeptanz gegenüber diesen neuen Versorgungsformen vorhanden ist. Die ersten Pilotprojekte mit neuen Versorgungsformen zeigen, dass es für die Einführung von Managed Care entsprechende Protagonisten auch in Deutschland gibt und die Anwendung von Managed-Care-Elementen auch im deutschen
Gesundheitswesen in praxi möglich ist. Die bisherigen Erfahrungen mit neuen Versorgungsmodellen und die ersten Auswertungen bezüglich Kosteneinsparungen und Qualitätsverbesserung lassen eine intelligente und selektive Einführung von Managed Care in Deutschland möglich und sinnvoll erscheinen.These 2: Durch die Einführung von Managed Care kann die Gesundheitsversorgung kostengünstiger durchgeführt werden.
Empirische Untersuchungen aus verschiedenen Ländern konnten zeigen, dass die Gesundheitsversorgung in Managed-Care-Modellen kostengünstiger als in den traditionellen Versorgungssystemen durchgeführt werden kann.
Durch den Einsatz der verschiedenen Managed-Care-Instrumente konnten bis zu 30 Prozent niedrigere Versorgungskosten erreicht werden. Die Ausgaben pro Versicherten konnten in einigen Managed-Care-Organisationen (Health Maintenance Organizations, HMOs) gegenüber konventionellen Versicherungsmodellen um elf bis 13 Prozent reduziert werden. Allein durch den Einsatz von Arzneimittel-Leitlinien („Formularies“) ließen sich die Arzneimittelkosten um über zehn Prozent senken. In Managed-Care-Modellen konnten eine bis zu 40 Prozent geringere Rate an Krankenhauseinweisungen und eine bis zu 35 Prozent verkürzte Verweildauer der Patienten im Krankenhaus erreicht werden. Vergleichbare Ergebnisse wurden sowohl in den USA als auch im europäischen Umfeld mit verschiedenen Managed-Care-Modellen beobachtet. Ob sich die bisher gezeigten kurz- bis mittelfristigen Kosteneinsparnisse auch langfristig realisieren lassen, müssen weitergehende Untersuchungen zeigen.
Neben Kosteneinsparungen kann es durch Managed Care in Teilbereichen aber auch zu Kostensteigerungen kommen. Dies wird vor allem durch die notwendigen Qualitätssicherungsprogramme, die zu einer Erhöhung der Verwaltungskosten bei den Betreibern von Managed-Care-Modellen führen können, verursacht.
These 3: Mit Managed Care muss sich die Qualität der medizinischen Versorgung nicht zwangsläufig verschlechtern, sondern kann sogar verbessert werden.
Zusätzlich zur Reduktion der Versorgungskosten durch effizientere Behandlungsprozesse und veränderte Anreizstrukturen kann die Qualität der medizinischen Versorgung durch den Einsatz von Managed Care verbessert oder zumindest auf einem hohen Niveau gehalten werden. Managed Care ist bei richtiger Anwendung nicht zwangsläufig mit einer schlechteren Versorgungsqualität verbunden. Empirische Untersuchungen konnten zeigen, dass Managed-Care-Modelle bezüglich Prozess- und Ergebnisqualität mindestens genauso gute Ergebnisse wie traditionelle Versorgungsmodelle liefern können. Voraussetzung ist allerdings ein ausgeprägtes Qualitätsmanagement-System. Bezüglich der Struktur- und Prozessqualität konnten Vorteile der Managed-Care-Modelle gegenüber den traditionellen Versorgungsmodellen gezeigt werden. Neben einer deutlich besseren Dokumentation und Datenqualität waren die Leistungserbringer hier besser ausgebildet und höher qualifiziert. Die Kontrolle und Behandlung von kardiovaskulären Risikofaktoren (Nikotinabusus, Hyperlipidämie und Hypertonie) wurde in vielen Managed-Care-Modellen konsequenter und häufiger durchgeführt. Präventionsmaßnahmen (Krebsvorsorgen, Impfungen, Suchtentwöhnungen) wurden um bis zu 50 Prozent häufiger durchgeführt als in traditionellen Versorgungsmodellen. Die Einhaltung der gesetzten Standards und Leitlinien wird konsequenter überprüft.
In mehreren großen Übersichtsarbeiten konnten insgesamt keine statistisch signifikanten Unterschiede der Versorgungsqualität zwischen Managed-Care-Modellen und traditionellen Versorgungsformen gefunden werden. Allerdings gibt es Hinweise, dass die Betreuung bestimmter Patientengruppen (vor allem älterer oder chronisch kranker Patienten) in Managed-Care-Modellen nicht immer den geforderten Qualitätskriterien entspricht. Auch scheinen, zumindest in den USA, bestimmte Strukturmerkmale der Versorgungssysteme – wie zum Beispiel Krankenhauszusammenschlüsse – negativ mit der Versorgungsqualität assoziiert zu sein. Daher ist der Sicherung der Versorgungsqualität bestimmter Patientengruppen (vor allem älterer oder chronisch kranker Patienten) beziehungsweise der Strukturqualität neuer Versorgungsmodelle besondere Beachtung zu geben.
These 4: Viele Ärzte und Patienten stehen neuen Modellen der Gesundheitsversorgung durchaus positiv gegenüber, was die Umsetzung von Managed Care in Deutschland fördern sollte.
Mehrere Umfragen bei Versicherten haben ergeben, dass diese die Notwendigkeit für Reformen im Gesundheitswesen erkennen und neuen Versorgungsmodellen offen gegenüberstehen. Bei entsprechenden Anreizen wäre eine Mehrheit der Versicherten bereit, neue Formen der Gesundheitsversorgung auszuprobieren und an entsprechenden Modellen teilzunehmen (1). Als kritische Aspekte konnten die Beibehaltung der bisherigen Hausarztbeziehung und die Fragen zum Datenschutz identifiziert werden. Nach den bisherigen Erfahrungen mit Managed-Care-Modellen in anderen Ländern und neuen Versorgungsformen in Deutschland (Strukturverträge, Modellvorhaben) sollten die Widerstände seitens der Versicherten daher als relativ gering einzuschätzen sein. Mehrere Ärzteumfragen haben gezeigt, dass auch ein signifikanter Teil der Ärzte für Reformen im Gesundheitswesen ist und neuen Versorgungsmodellen positiv gegenübersteht. Eine wesentliche Motivation der Ärzte, an neuen Versorgungsmodellen teilzunehmen, ist die Stabilisierung oder Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation. Bei Managed-Care-Modellen mit den klassischen Instrumenten wie Gatekeeper, Capitation oder Guidelines werden die Widerstände seitens der Allgemeinmediziner gering sein, da ihre Position im Vergleich zur bestehenden Struktur deutlich aufgewertet wird. Demgegenüber ist – vor allem bei Gatekeeper-Modellen – mit Widerständen seitens der Fachärzte zu rechnen. Allen Fachgruppen gemeinsam ist die noch bestehende Abneigung, direkte Vertragsbeziehungen mit den Krankenkassen zu schließen.
These 5: Mit den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen ist Managed Care in weiten Teilen schon heute in der Gesetzlichen Krankenversicherung umsetzbar.
Die Einführung von Managed Care in einem Gesundheitssystem ist zwingend an die Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen gebunden. In Deutschland wurden seit 1997 wesentliche Neuerungen des SGB V eingeführt. Die neuen Regelungen zu den Modellvorhaben, Strukturverträgen und zur Integrierten Versorgung haben den Akteuren im Gesundheitswesen einen breiten Gestaltungsspielraum zur Erprobung und Einführung gänzlich neuer Versorgungs- und Vergütungsformen gegeben. In mehreren Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass mit den bestehenden flexiblen Regelungen des SGB V wichtige Managed-Care-Instrumente wie Gatekeeper-Modelle, selektives Kontrahieren, Guidelines oder das Qualitätsmanagement im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung umsetzbar sind. Hierbei sind nicht nur neue Organisations- und Prozessstrukturen, sondern auch innovative Vergütungs- und Anreizsysteme für die Versicherten und Leistungserbringer realisierbar.
Die rechtlichen Möglichkeiten zur Umsetzung sind prinzipiell gegeben. Der Gesetzgeber hat flexible rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz neuer Versorgungsformen geschaffen. Jetzt liegt es an den Akteuren, diese Möglichkeiten entsprechend zu nutzen. Allerdings fehlen hierzulande noch wichtige Anreizmechanismen für den Aufbau neuer Versorgungsformen, wie sie in den USA im HMO-Gesetz der Nixon-Administration aus dem Jahr 1973 vorhanden waren und wesentlich zur schnellen Verbreitung von Managed Care in den USA geführt haben. Der deutsche Gesetzgeber ist gefordert, den politischen Willen zur Förderung neuer Versorgungsformen auch durch entsprechende Anreizsysteme zu untermauern.
These 6: Die Einführung von Managed Care in Deutschland stellt hohe Anforderungen an die beteiligten Gruppen.
Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass die Einführung von Managed-Care-Modellen in der Tat sehr hohe Anforderungen an alle Beteiligten (Krankenkassen, Leistungserbringer, Führung der Managed-Care-Modelle, Versicherte) stellt und eine ausgeprägte Innovationsfähigkeit und -bereitschaft voraussetzt. Die Patienten müssen sich an neue Prozesse der Gesundheitsversorgung gewöhnen, zum Teil auf bisherige Wahlfreiheiten verzichten und unter Umständen eine höhere finanzielle Verantwortung übernehmen. Bei der Patientenversorgung wird oftmals ein Ausgleich zwischen medizinisch Möglichem, wirtschaftlich Finanzierbarem und ethisch Gebotenem zu finden sein. Die optimale Patientenversorgung ist zwischen der medizinisch bedenklichen Unterversorgung und der wirtschaftlich schädlichen Überversorgung zu finden. Die engere Abstimmung der einzelnen Leistungserbringer mit der Führung der Managed-Care-Modelle und den Krankenkassen wird zu einem höheren administrativen Aufwand führen. Durch die Einbindung in ein Versorgungsmodell müssen die Ärzte in vielen Fällen das gewohnte „Einzelkämpferdasein“ aufgeben und sich in ein kollegiales Netzwerk einfügen. Dies erfordert eine hohe Kommunikations- und Kompromissfähigkeit. Der Rückzug in die viel beschworene ärztliche Therapiefreiheit bei der Durchführung und Rechtfertigung medizinisch und wirtschaftlich umstrittener Maßnahmen wird in Managed-Care-Modellen mit der umfassenden Qualitätssicherung nicht mehr so einfach möglich sein. Durch die Einführung von Leitlinien, Standards und wirtschaftlichen Vorgaben kann das Versorgungsverhalten einzelner Ärzte deutliche Anpassungen erfordern. Im Management der Krankenkassen und Managed-Care-Modelle muss neben dem betriebswirtschaftlichen auch ein fundiertes medizinisches Wissen aufgebaut werden. In der Geschäftsführung vieler Managed-Care-Organisationen und Krankenversicherungen wird das nötige medizinische Wissen in Form von medizinischen Stabsabteilungen und eines medizinischen Direktors vorgehalten. Dieses medizinische Wissen ist unter anderem für die verschiedenen Reviews, die Qualitätssicherung sowie für die Case- und Disease-Management-Programme nötig.
Anschrift des Verfassers:
Dr. med. Dr. rer. pol. Michael Wiechmann
Leiter Bereich Gesundheitsmanagement und Medizin
Allianz Private Krankenversicherungs-AG
Fritz-Schäffer-Straße 9
81737 München
E-Mail: michael.wiechmann@allianz.de "[Quelle: Wiechmann, Michael. In: Deutsches Ärzteblatt online. -- 2004-10-08. -- http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/ao.asp?id=43751. -- Zugriff am 2006-01-03]
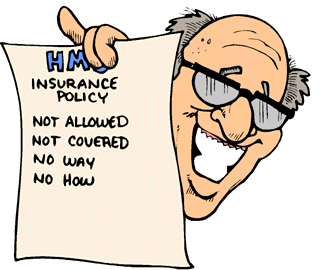
Abb.: The HMO Philosophy
[Bildquelle:
http://user.pa.net/~nrwing/hmo/. -- Zugriff am 2006-01-03]
"Health Maintenance Organization (HMO) bezeichnet ein bestimmtes Krankenversicherungs- und Versorgungsmodell. Grundidee dieses Modells ist einerseits, dass Leistungserbringer im Gesundheitswesen (ÄrztInnen, Physio-/Psycho-/Ergotherapien, Logopädien, Ernährungsberatung usw.) nicht für die Krankheit, sondern für die Gesundheit ihrer Klientel bezahlt werden, und andererseits, dass ein Leistungserbringer keine finanzielle Belohnung für ausufernde Diagnose- und Therapiemaßnahmen erhält. Dies wird im ersten Ansatz so realisiert, dass eine Gemeinschaft aus Klienten und Leistungserbringern ein bestimmtes fixes Gesamtbudget hat, aus dem alle medizinischen Maßnahmen bezahlt werden. Der Leistungserbringer hat dadurch einen Sparanreiz, dass er den nicht verbrauchten Rest des Budgets als Einkommen hat, während sein Einkommen dann sinkt, wenn er höhere Kosten verursacht.
(Im Gegensatz dazu steigt im traditionellen Krankenkassensystem das Einkommen des Leistungserbringers um so mehr, je mehr Leistungen er erbringt, also je mehr Kosten er verursacht).
Entwicklung und aktuelle Situation in den USAHMOs wurden ursprünglich in den USA entwickelt. Dort gibt es keine allgemeine Krankenversicherung (abgesehen von Medicaid für die Armen und Medicare für die Alten), sondern oft Versicherungslösungen zwischen Betrieben, deren Angestellten und einer Gruppe von Leistungserbringern. Die Idee, den Leistungserbringern ein festes Budget für die Behandlung aller Angestellten eines Betriebs zur Verfügung zu stellen ist so relativ einfach durchsetzbar. Dem Personal wird vor allem bei großen Firmen auch die Wahl zwischen verschiedenen HMOs (meistens drei) angeboten. Die Angestellten haben außerdem immer noch die Möglichkeit, bei Unzufriedenheit mit dem System zu einem anderen Arzt zu gehen, sie müssen dann aber selbst bezahlen.
Im Juli 2004 waren in den USA 66,1 Millionen Einwohner Mitglied einer HMO (2003: 71,8 Mio). Am meisten HMO-Mitglieder hatte Kalifornien (17,2 Mio), gefolgt von New York (5,2), Florida (4,1) und Pennsylvania (4 Mio). In Kalifornien waren 47,8% der Bevölkerung HMO-Mitglied. Insgesamt gibt es in den USA 414 HMOs.
Abb.: ®LogoDie größte HMO ist die Kaiser Permanente, welche in neun amerikanischen Bundesstaaten und im District of Columbia 8,3 Millionen HMO-Mitglieder, 134'000 Angestellte, 11'000 Ärzte, 30 medizinische Zentren und 431 Regional- und Lokalstellen umfasst. Der Jahresumsatz beträgt 22,5 Milliarden $.
Es konnten in den USA keine objektiv messbaren Unterschiede der Versorgungsqualität zwischen HMO's und traditionellen Arztpraxen gezeigt werden. Andererseits gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass speziell ältere Menschen sich in HMOs subjektiv ärztlich schlechter betreut fühlen als solche mit einer individuellen herkömmlichen Krankenversicherung. Die Kosteneinsparung durch HMOs steht dagegen außer Frage.
Existierende Modelle (Schweiz)
Abb.: Das Wappenschild der Schweiz bedeutet nicht Desolidarisierung!In der Schweiz existieren seit 1990 HMO-Praxen. Da die Schweiz zwar ebenfalls ein privatwirtschaftlich organisiertes Gesundheitssystem hat, aber andererseits eine allgemeine Krankenversicherungspflicht mit strenger Reglementierung kennt, sind HMOs hier komplexere Gebilde als in den USA. Verschiedene Krankenkassen bieten HMO-Modelle an, keine davon in der ganzen Schweiz. Im Zentrum steht jeweils ein HMO-Zentrum, das Ärzte verschiedener Fachrichtungen und Therapeuten unter einem Dach versammelt. HMO-Versicherte sind verpflichtet, sich primär im HMO-Zentrum behandeln zu lassen. Ausnahmen sind Notfälle, Erkrankungen außerhalb des geografischen Tätigkeitsbereichs der HMO sowie oft Gynäkologie und Augenheilkunde.
Im Gegenzug erhalten diejenigen, die sich für eine solche HMO-Variante entscheiden, eine Krankenkassen-Prämienreduktion. Wenn ein Versicherter sich nicht an die Spielregeln hält und beispielsweise zu einem externen Arzt geht, kann die Versicherung die Übernahme der Kosten dieser Behandlung ganz oder teilweise verweigern.
Organisation der HMO-Zentren
Die HMO-Zentren sind entweder Eigentum der Versicherung oder haben Verträge mit einem oder mehreren Krankenversicherern abgeschlossen. Ärzte und Therapeuten sind Angestellte oder Anteilseigner der HMO-Zentren mit Fixlohn und/oder Gewinn- und Verlustbeteiligung. Das Budget, das das HMO-Zentrum erhält, muss jedes Jahr neu ausgehandelt werden, und hängt von der Zahl und der Altersstruktur der Versicherten dieses Zentrums ab. Vom Budget müssen alle Kosten für die Versicherten bestritten werden, also beispielsweise auch Rechnungen externer Ärzte, Therapeuten oder von Krankenhäusern. Ziel eines HMO-Zentrums muss es daher sein, eine möglichst umfassende Betreuung mit allen wichtigen Fachrichtungen anzubieten, um die Zahl notwendiger externer Leistungen möglichst klein zu halten. Dies kommt wiederum dem Bedürfnis der Patienten entgegen, die eine ganzheitliche Behandlung "unter einem Dach" erhalten.
Allerdings kann aus diesen Gründen ein HMO-Zentrum nur ab einer bestimmten Mindestzahl von angeschlossenen Versicherten funktionieren. HMOs sind deswegen auf Ballungsräume beschränkt.
Aspekte des HMO-Konzepts
- Einschränkung der freien Arztwahl: Der HMO-Versicherte ist verpflichtet, sich im Normalfall nur durch Ärzte seiner HMO behandeln zu lassen oder durch externe (Fach-)ärzte, an die er aber von der HMO weiterverwiesen wurde. Der HMO-Arzt ist so ein "Gatekeeper" bezüglich weiterer Ärzte, Krankenhausaufenthalte usw. Dadurch kennt er seine Patienten gut und kann die ganze Behandlungskette übersehen, steuern und kontrollieren.
- Gruppenpraxis: Neben gewissen Nachteilen (z.B. unpersönlichere Behandlung und schwerfälligere Organisation) hat eine Gruppenpraxis (auch außerhalb einer HMO) erhebliche Vorteile: Öffnungszeiten, Ferienvertretung, interne Fortbildung, interne Qualitätskontrolle durch Kollegen, bessere Auslastung von teuren Geräten, Anstellung von Fachpersonal (wie Physiotherapeutin, Psychologe, Gesundheitsschwester, Ernährungs-, Diabetesberaterin, Praxismanager, Informatikspezialist), Präventionskurse, stärkere Verhandlungsposition usw.
- Versichertenstruktur: Das HMO-Versicherungsmodell wird vorwiegend von jüngeren und gesunden Menschen gewählt. Dies ist aus Sicht der HMO-Zentren erfreulich (da diese Klientel ja wenig Kosten verursacht), aus Sicht der Krankenkasse aber ungünstig. Ihr entgehen Prämien, weil diese ja im HMO-System niedriger sind, sie spart aber keine Kosten (da diese Versicherten ja sowieso selten ärztliche Leistungen beziehen und darum kaum Einsparungspotential bieten). Die älteren und kränkeren Menschen, die mehr Leistungen benötigen, bleiben dagegen eher im traditionellen Versicherungsmodell. Diesem fehlen die Prämienbeiträge der Gesunden, wodurch es seinerseits teurer wird. HMO ist damit ein Modell, dass die Solidarisierungsidee des Krankenkassensystems unterläuft und zu einer schleichenden Desolidarisierung führt.
- Versorgungsqualität: Da die HMO-Zentren umso mehr Gewinn machen, je weniger Leistungen sie erbringen, besteht eine inhärente Versuchung, eigentlich notwendige Leistungen "einzusparen". Es sind mehr oder weniger aufwändige Kontroll- und Qualitätssicherungsmaßnahmen notwendig, die das System bürokratisieren und verteuern. Da die Qualität einer einzelnen medizinischen Maßnahme nur schwer objektiv zu messen ist, ist es darüberhinaus auch gar nicht immer möglich zu beweisen, dass die teuren Qualitätssicherungsmaßnahmen überhaupt etwas bringen. Es gibt inzwischen Ansätze zu unabhängiger Qualitätszertifizierung (z.B. Equam), deren Wert und Wirksamkeit bisher wegen der zu kurzen Dauer ihrer Existenz noch nicht abzuschätzen ist.
- Zeithorizont: Das HMO-System basiert unter anderem auch auf der Idee, dass die HMO-Zentren präventive Maßnahmen fördern und so die Gesundheit ihrer Klientel verbessern (da sie ja davon profitieren, wenn ihre Versicherten gesund bleiben). Leider zeigt sich der Erfolg von Gesundheitsvorsorgemaßnahmen oft erst nach Jahren und Jahrzehnten (Raucherentwöhnung, gesunde Ernährung, Bewegungsförderung, Blutdruckeinstellung usw.), während das Budget des HMO-Zentrums kurzfristig und von Jahr zu Jahr im Lot sein muss. Einzelne Präventionsmaßnahmen lohnen sich kurzfristig somit eben doch nicht und werden darum tendenziell nur dann gefördert, wenn sie die Bilanz nicht verschlechtern, also nichts kosten oder wenn sie zum guten Image der HMO und damit zu mehr HMO-Versicherten beitragen (oder wenn die betreibende Krankenkasse einen ausreichend langen Atem hat, um Defizite der HMO-Zentren einige Jahrzehnte lang zu tolerieren).
Bilanz
- Hochrisiken: Schon wenige Patienten mit Erkrankungen, deren Behandlung sehr viel Geld kostet, könnten für eine HMO den finanziellen Untergang bedeuten. Deshalb sind für derartige unkalkulierbare Risiken Absicherungsmaßnahmen notwendig. Üblich sind beispielsweise Ausgleichsfonds zwischen verschiedenen HMO-Zentren oder Versicherungen beispielsweise beim Träger der HMO. Die Kalkulation einer solchen Absicherung ist allerdings alles andere als trivial und muss regelmäßig neu austariert werden. Für kleinere HMO-Zentren bleiben "teure" Erkrankungen ein schwer kalkulierbares finanzielles Risiko.
Auch nach 15 Jahren HMO in der Schweiz kann man keine klare Bilanz ziehen. Die oben umrissenen inhärenten Schwächen des Konzepts und die relativ geringe Akzeptanz in der Bevölkerung lassen einen größeren Erfolg in den nächsten Jahren eher unwahrscheinlich erscheinen. Andererseits steigen die Krankenkassenprämien weiter, so dass der Beitritt zu einer billigeren HMO attraktiver wird. Dazu tragen auch Bemühungen verschiedener politischer Kräfte bei, welche Versicherungsmodelle mit Budgetverantwortung der Leistungserbringer (und damit auch HMOs) mit Gesetzesänderungen fördern möchten.
Am 1. Januar 2005 waren 119'000 Menschen in der Schweiz in HMOs krankenversichert (1.1.2000: 100'000). Sie wurden von 121 HMO-Ärztinnen und Ärzten behandelt (1.1.2000: 80).
Verwandte Konzepte
- Gatekeeping: Patienten werden verpflichtet, bei Erkrankungen immer zuerst eine bestimmte Stelle aufzusuchen, die dann bei Bedarf weiterverweist. Diese Idee fand verschiedene Umsetzungen (Hausarztmodelle, Ambulanzmodelle, Triagestationen, telefonische Hotline usw.) und scheint auf mehr Akzeptanz zu stoßen als die reinen HMO-Modelle.
- Budgetverantwortung der Ärzte: Hausarztvereine schließen spezielle Verträge mit den Krankenkassen, die eine Beteiligung an Gewinn und Verlust des darin eingeschlossenen Patientenkollektivs beinhalten. Dies übernimmt einen Teil der HMO-Idee, ohne die Ärzte völlig von den Kassen abhängig zu machen.
- Staatliche Gesundheitssysteme. Dies ist quasi das HMO-Konzept bis zur letzten Konsequenz weitergeführt: Alle Leistungserbringer sind Angestellte des Staates. Für die Patienten entfällt sowohl die freie Wahl des Versicherungsmodells als auch die völlig freie Wahl des Arztes. Auf diese Weise lassen sich viele der Schwierigkeiten der privatwirtschaftlichen HMO-Zentren umgehen. Allerdings haben staatliche Gesundheitssysteme wieder eigene Probleme (vgl. zum Beispiel Gesundheitssystem Großbritannien).
["Das Gesundheitssystem Großbritannien
Abb.: ®LogoEin vernichtendes Urteil: "Selbst die Missionshospitäler in Simbabwe sind sauberer und besser geführt", sagt eine 55-jährige Krankenschwester aus dem afrikanischen Land über die Zustände in den Krankenhäusern Großbritanniens. Zwar ist die Behandlung im staatlichen Gesundheitssystem NHS kostenlos, Krankenkassen-Beiträge gibt es nicht. Und kürzlich verkündete die Regierung in London stolz, dass erstmals seit 1993 weniger als eine Million Patienten länger auf ihre Operation warten müssten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden einige Hundert Kranke sogar zur Behandlung nach Frankreich und Deutschland geschickt.
Abb.: Karikatur auf NHS
[Bildquelle: http://www.jwolfe.clara.net/Humour/NHS.htm. -- Zugriff am 2006-01-03]"Vor zwei Jahren musste ich 77 Stunden auf einem Notbett warten, bis ein richtiges Krankenbett frei war. Dieses Jahr waren es nur 60 - manche nennen das eine Verbesserung", sagt der 40 Jahre alte Diabetespatient Tony Collins aus Swindon. Kritiker finden, es habe sich in den Jahren der Regierung von Tony Blair kaum etwas getan. Auch die geplante Teilprivatisierung im Gesundheitswesen werde an den Zuständen wenig ändern.
Eine Befragung ausländischer Krankenschwestern in Großbritannien kam zu dem Ergebnis, dass der Standard in den Krankenhäusern auf der Insel schlimmer ist als in Ländern der Dritten Welt."
[Quelle: dpa [Deutsche Presseagentur]. -- 2003-07-24. -- http://www.welt.de/data/2003/07/24/139830.html. -- Zugriff am 2006-01-03]]
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Health_Maintenance_Organization. -- Zugriff am 2006-01-03]

Abb.: "Gemeinsam stehen sie für mehr Qualität in der Versorgung chronisch
kranker Menschen: Ärzte, Krankenkassen, Selbsthilfe und Teilnehmer von
DMP-Programmen."
[Quelle von Abbildung und Beschriftung: Bundesministerium für Gesundheit.
--
http://www.die-gesundheitsreform.de/infokubus_gesundheit/momentaufnahmen/tour_2005/foto_kubus_aachen_20.html.
-- Zugriff am 2006-01-03]
"Disease-Management-Programme (DMP, diese Abkürzung wird im Artikel für Singular und Plural verwendet) sind systematische Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen, die auf die Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin gestützt sind. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden diese Programme auch als strukturierte Behandlungsprogramme oder Chronikerprogramme bezeichnet. Das Konzept des Disease Managements als zentral organisierte Steuerung von chronisch kranken Patienten stammt ursprünglich aus den USA. Es gibt für den Begriff „Disease Management“ keine einheitliche Definition. Exemplarisch wird hier die Definition der Disease Management Association of America (DMAA) wiedergegeben. "Disease Management is a system of coordinated healthcare interventions and communications for populations with conditions in which patient self-care efforts are significant . Disease management:
- supports the physician or practitioner/patient relationship and plan of care,
- emphasizes prevention of exacerbations and complications utilizing evidence-based practice guidelines and patient empowerment strategies, and
- evaluates clinical, humanistic, and economic outcomes on an going basis with the goal of improving overall health.
Disease Management Components include:
- Population Identification processes
- Evidence-based practice guidelines
- Collaborative practice models to include physician and support-service providers
- Patient self-management education (may include primary prevention, behavior modification programs, and compliance/surveillance)
- Process and outcomes measurement, evaluation, and management
- Routine reporting/feedback loop (may include communication with patient, physician, health plan and ancillary providers, and practice profiling)"
Disease-Management-Programme sind im deutschen Gesundheitswesen noch recht neu (seit etwa 2002) und gelten als Bausteine für andere neuartige Konzepte wie integrierte Versorgung und Fall-Management.
ZieleMit Hilfe von Disease-Management-Programmen sollen
- Patienten, die unter chronischen Krankheiten leiden durch eine gut abgestimmte, kontinuierliche Betreuung und Behandlung vor Folgeerkrankungen bewahrt werden
- Haus- und Fachärzte sowie Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen koordiniert zusammenarbeiten
- die Therapieschritte nach gesichertem medizinischen Wissensstand aufeinander abgestimmt sein.
- mittel- bis langfristig die Leistungsausgaben der Krankenkasse gesenkt werden. Dieses Ziel steht bei den freien DMP im Vordergrund, bei den DMP nach RSAV [Risikostruktur-Ausgleichsverordnung] ist es eher ein Nebeneffekt.
Die Organisationsstruktur des deutschen Gesundheitswesens ist primär auf die Therapie von akuten Krankheitsbildern ausgerichtet, so dass ein chronisch kranker Patient (d.h. Langzeitkranker) in der Regel verschiedenste Anlaufstellen für verschiedene Aspekte seiner Krankheit hat. Der erste Ansprechpartner ist normalerweise der Hausarzt, welcher in den seltensten Fällen über ausreichend Zeit und Spezialkenntnisse verfügt. Daher muss der Patient bei akuten Symptomen Fachärzte oder Kliniken aufsuchen. Dort wird zwar der Akutfall therapiert, es findet allerdings auch keine präventive Langzeitbetreuung statt. Durch diese unsystematische, punktuelle Behandlung findet meistens entweder eine Unter-, Über- oder gar Fehlversorgung des Patienten statt. Diese Entwicklung soll durch Disease-Management-Programme korrigiert werden, indem eine langfristige, präventive Begleitung des Chronikers erfolgt. Damit soll Akutfällen vorgebeugt werden, so dass der Patient einen stabilen Lebensstandard erreicht, der nicht von seiner Erkrankung dominiert wird und insbesondere teure Krankenhausaufenthalte entfallen.
Gegenstand der Disease-Management-Programme sind insbesondere Indikationen, die zu den sogenannten Zivilisationskrankheiten gerechnet werden – wie Adipositas, Asthma, Diabetes mellitus Typ II oder Osteoporose, um nur einige zu nennen. Diese Krankheiten treten aufgrund der modernen Lebensumstände (schlechte Ernährung, Bewegungsarmut, Stress, Umweltgifte) flächendeckend und häufig auf und stellen daher einen wesentlichen Anteil der medizinischen Versorgungskosten. Allein der Anteil der Diabetiker an der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland und Europa wird auf 7% bis 8% geschätzt. Entsprechend zielen die begleitenden Maßnahmen der Disease-Management-Programme auf Verhaltensänderungen bei den Patienten ab – gesündere Ernährung, mehr Bewegung, Raucherentwöhnung etc.
InstrumenteDisease-Management-Programme stellen keinen Ersatz für die Therapie durch einen Arzt dar, sondern sind als unterstützende und koordinierende Maßnahme vorgesehen. In erster Linie haben sie informativen Charakter, d.h. der Patient wird über seine Krankheit, deren Symptome und Bedeutung, Behandlungsmöglichkeiten, Medikamente und Spezialärzte umfassend aufgeklärt. Dazu werden fast alle Möglichkeiten der modernen Kommunikation verwendet:
Varianten
- Informationsbroschüren
- Telefonische Beratungsgespräche
- Erinnerungen (z.B. an notwendige Arztbesuche) per Telefon, Brief, E-Mail oder SMS
- Statistische Auswertungen über den Gesundheitszustand
- Schulungen
- Unterstützung durch telemedizinische Geräte
Im deutschen Gesundheitswesen werden zwei Spielarten von DMPn unterschieden:
DMP nach RSAV [Risikostruktur-Ausgleichsverordnung]
- Disease-Management-Programme nach RSAV [Risikostruktur-Ausgleichsverordnung] (DMP nach RSAV bzw. RSA-DMP)
- Freie Disease-Management-Programme
Die Disease-Management-Programme nach RSAV wurden mit dem Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 10.12.2001 eingeführt. Sie sind den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) vorbehalten, da die Anzahl der am DMP teilnehmenden Patienten sich auf die Berechnung des Risikostrukturausgleichs auswirkt. Für eingeschriebene (d.h. teilnehmende) Versicherte werden neben den übrigen Versicherten eigenen Profile gebildet, auf deren Basis ein gesonderter Ausgleich unter Berücksichtung von durchschnittlichen Leistungsausgaben dieser Versichertengruppe stattfindet. Die Indikationen, für die DMP nach RSAV durchgeführt werden können, werden vom Gesetzgeber festgelegt. Im Einzelnen sind dies zurzeit:
- Brustkrebs
- Diabetes mellitus Typ II
- Koronare Herzkrankheit (KHK)
- Diabetes mellitus Typ I
- Chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen (COPD)
- Asthma bronchiale
Weitere Indikationen (wie Demenz) sind in Vorbereitung, ob sie tatsächlich umgesetzt werden ist allerdings noch nicht klar (siehe Ausblick).
"Der Risikostrukturausgleich (RSA) der gesetzlichen Krankenversicherung ist ein Finanzausgleich zwischen allen gesetzlichen Krankenkassen mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Krankenkassen. Der RSA gleicht in gewisser Hinsicht Nachteile aus, die sich durch die unterschiedliche Versichertenstruktur bei den einzelnen Krankenkassen und Kassenarten ergeben. Dabei werden Faktoren wie Einkommen, Alter und Geschlecht der Versicherten sowie der Anteil derjenigen, die eine Erwerbsminderungsrente beziehen, berücksichtigt. Durch einen Mix aus Vollerhebung und Stichprobenerhebung ermittelt das Bundesversicherungsamt (BVA) als Clearingstelle den Ausgleichsbedarfssatz (= Beitragssatz), den jede Krankenkasse aus den Beiträgen ihrer Mitglieder in den RSA einzubringen hat (2004: 12,8%). Gegengerechnet erhält jede Kasse für jeden ihrer Versicherten den altersdurchnittlichen Beitragsbedarf (auch "standardisierte Leistungsausgaben" genannt) und den Bedarf für ihre Chroniker (siehe unten unter "Disease-Management-Programme").
Im Jahr 2003 wurden durch den Risikostrukturausgleich ca. 15,8 Mrd. € zwischen den Krankenkassen umverteilt. Seit 1996 stieg das Transfervolumen von 10,5 Mrd. € nahezu linear durchschnittlich jährlich um rund 750.000 € an. Im Startjahr 1995 betrug es 12 Mrd. €.
Der RSA wurde im Jahr 1994 unter Gesundheitsminister Horst Seehofer eingeführt und war eine flankierende Maßnahme für die ab 1996 geltende freie Kassenwahl und den dadurch verstärkten Wettbewerb zwischen den Krankenkassen um gute Risiken.
Die Risikounterschiede zwischen den Kassen sind so groß, dass manche Kassen mit gesunden Mitgliedern, die zugleich hohe Einkünfte haben, mit einem Beitragssatz von unter 5 % auskommen könnten, wenn es keinen Risikostrukturausgleich gäbe. Andere Kassen hätten bei geringen Einnahmen und hohen Ausgabenlasten für kranke Mitglieder ohne Risikostrukturausgleich Beitragssätze von über 20 %."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Risikostrukturausgleich. -- Zugriff am 2006-01-03]
Möchte eine gesetzliche Krankenversicherung ein DMP nach RSAV durchführen, so entwickelt sie zunächst ein Programmkonzept und schließt dazu Verträge mit den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) oder einzelnen Ärzten zu dessen Durchführung ab. Da es in Deutschland derzeit 17 KV-Bezirke gibt, muss eine bundesweit operierende Kasse somit mindestens 17 Verträge abschließen, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Diese Verträge werden dann beim Bundesversicherungamt (BVA) zur Prüfung eingereicht. Entsprechen die Verträge den gesetzlichen Anforderungen, werden sie vom BVA akkreditiert, d.h. die Berücksichtigung im Risikostrukturausgleichs wird genehmigt.
Um die Qualität der Behandlungsprogramme sicherzustellen und die Versorgungsziele für einen Patienten festzulegen, ist im Laufe des Programms von Arzt und Versicherten regelmäßig gemeinsam ein Dokumentationsbogen auszufüllen. Dieser Dokumentationsbogen enthält einen Datensatz mit wichtigen Parametern, die zur Evaluation des Programms dienen. Auf dem Dokumentationsbogen werden – abhängig von der Indikation – folgende Werte festgehalten:
- Wichtige Laborparameter bzw. deren Veränderung
- Untersuchungen
- Begleit- und Folgeerkrankungen
- Relevante Medikamente
- Empfohlene und durchgeführte Schulungen
- Administrative Daten (behandelnder Arzt, Erstellungsdatum etc.)
Anhand dieser Dokumentationsbögen kann die Krankenkasse den Verlauf des Programms unterstützen und die Wirkung kann ausgewertet werden.
SelektionZur Durchführung des Programms muss die Krankenkasse aus ihrem Versichertenbestand diejenigen Personen selektieren, die für die jeweilige Indikation infrage kommen. Da die Kasse nicht die Diagnose des Arztes vorliegen hat, sondern nur die eingereichten Leistungen (d.h. Behandlungen, Medikamente) wird z.B. anhand typischer Medikamente eine Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer chronischen Krankheit ermittelt. Alle Versicherten, bei denen diese Wahrscheinlichkeit einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, werden als Kandidaten für die Teilnahme am Programm angesprochen.
GewinnungDie selektierten Versicherten werden schriftlich und/oder telefonisch für die Teilnahme am DMP geworben. Die Teilnahme ist dabei freiwillig, wird jedoch häufig mit Bonusmaßnahmen unterstützt – z.B. die Erstattung der Praxisgebühr. Möchte ein Versicherter an dem DMP teilnehmen, so muss er sich zunächst einen am Programm teilnehmenden Arzt auswählen. Der Arzt erklärt dabei seine Teilnahme gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung, die ihm nach Prüfung der Strukturvoraussetzungen, die Teilnahme bestätigt. Zusammen mit dem Arzt füllt der Patient dann eine Teilnahmeerklärung und die Erstdokumentation aus. Dabei handelt es sich um den ersten der oben beschriebenen Dokumentationsbögen. Die ausgefüllten Unterlagen werden an eine Datenstelle weitergeleitet. Die Datenstelle muss den Datensatz außerdem anhand definierter Kriterien auf Plausibilität, Vollständigkeit und fristgerechte Übermittlung überprüfen. Soweit Daten zu ergänzen oder zu korrigieren sind, fordert sie diese beim Arzt nach.
Die erhobenen Datensätze werden anschließend digitalisiert und in einen a- und b-Datensatz aufteilt. Der a-Datensatz wird mit pseudonymisierten Versichertendaten zur Gemeinsamen Einrichtung der das DMP durchführenden Krankenkassen und der KV übermittelt. Der b-Datensatz - welcher nur einen Teil der Daten erhält - wird an die Krankenkasse weitergegeben. Dabei ist von der Krankenkasse sicherzustellen, das nicht jeder Mitarbeiter Zugriff auf die Daten der Dokumentationen erhält. Die Dokumentationen stehen unter einem besonderen Datenschutz und dürfen nur für die Zwecke der DMP eingesehen und verarbeitet werden.
QualitätssicherungBestandteil der DMP-Verträge sind Ziele, die mit den Disease-Management-Programmen erreicht werden sollen sowie konkrete Auslösealgorithmen auf Basis der auf den Dokumentationsbögen dokumentierten Parametern. Dabei wird festgelegt, ob der Arzt durch die Gemeinsame Einrichtung der Krankenkassen und KV oder der Versicherte von seiner Krankenkasse Informationen erhalten soll. Dies bedeutet z.B., dass für am DMP Diabetes mellitus Typ 2 teilnehmende Versicherte nicht jährlich zur Untersuchung ihrer Augen eine Überweisung zum Augenarzt bekommen haben, von der Krankenkasse über die Wichtigkeit dieser Untersuchung informiert werden sollen.
RemindingJe nach Schweregrad und Disease-Management-Programm sind in jedem bzw. in jedem zweiten Quartal Dokumentationsbögen vom Arzt zu erstellen. Unter Reminding werden Erinnerungssysteme sowohl für den Arzt als auch für den Patienten verstanden. Der Arzt wird hierbei durch die Gemeinsame Einrichtung von Krankenkassen und KV an noch im Quartal zu erstellende Dokumentationen hingewiesen. Die Krankenkassen informieren daneben ihre Versicherten.
Beendigung der TeilnahmeDes Weiteren übernimmt die Krankenkasse das so genannte Fallclearing. Das bedeutet, dass die Kasse anhand festgelegter Regelwerke die Erfüllung des Programms kontrolliert und den Patienten gegebenenfalls ausschreibt, d.h. das die Programmteilnahme beendet. Bei der Indikation Brustkrebs muss beispielsweise die Ausschreibung vorgenommen werden, wenn die Erstmanifestation – also das erste Auftreten – der Krankheit mehr als 5,5 Jahre zurückliegt. Weitere Ausschreibegründe sind unzureichende Programmteilnahme - in der Regel fehlende oder zu spät eingehende Dokumentationsbögen oder nicht wahrgenommene Schulungen sowie Tod oder Kassenwechsel.
UmsetzungsschwierigkeitenBei der Umsetzung der DMP haben vor allem bürokratische Anforderungen die Umsetzung der DMP behindert. So mussten zunächst Patienten bei jeder Korrektur eines zunächst fehlerhaften Dokumentationsbogens erneut in der Praxis eine Unterschrift leisten. Dieses und andere Hemmnisse sind in der Zwischenzeit durch die RSAV beseitigt worden. Die Fehlerquote der von den Ärzten an die Datenstelle übermittelten Dokumentationsbögen betrug zu Beginn bis zu 80%. Durch Vereinfachungen der Dokumentationsbögen und vor allem durch die Einführung von DMP-fähiger Praxissoftware, welche bereits bei der Eingabe die Daten auf Plausibilität prüft, haben zu einer deutlichen Reduzierung der Fehler geführt.
Konzeptionelle KritikpunktePraktische Schwierigkeiten
- Die Definition der medizinischen Leitlinien für den Gesundheitszustand und die Methoden der Therapie sind in der medizinischen Fachwelt umstritten.
- Die Verbindung mit dem Risikostrukturausgleich der Krankenkassen hat dazu geführt, dass die Krankenkassen gezwungen sind, möglichst viele Patienten in ein Programm einzuschreiben, um nicht finanziell benachteiligt zu werden.
- Die Dokumentationen sind zu bürokratisch und zu kompliziert und wurden während des laufenden Verfahrens zum Teil drastisch geändert (Datenversionen 1 und 2 gemäß RSAV 7. Fassung und RSAV 9. Fassung), was zu weiteren Datenverarbeitungsproblemen führte. Die Formulare können nicht in einem der Untersuchung gerecht werdenden Ablauf ausgefüllt werden. Das Regelwerk für die Bearbeitung der Dokumentation ist umfangreicher als die abzubildenden Inhalte. Fehlerhafte Dokumentationen resultieren aus Regelkonflikten und bilden somit nicht Praxisprozeduren ab.
- Manche Ärzte fühlen sich in der Behandlungsfreiheit eingeschränkt, da sie sich bei ihrer Behandlung an der Leitlinie orientieren sollen. Der anfangs starke Widerstand der Ärzte hat sich allerdings mittlerweile gelegt. Die meisten Kassenärzte in Deutschland führen auch RSA-DMP durch.
- DMP-Verfahren mussten auf Grund der föderalen Struktur der Ärztevertretungen für jeden KV-Bezirk einzeln verhandelt werden. Hierbei wurden Verträge mit unterschiedlichen Inhalten abgeschlossen. Dies führte dazu, dass z. B. in Baden-Württemberg eine schriftliche Information der Krankenkasse mit dem behandelnden Arzt ins "Benehmen" gesetzt werden muss. In anderen KV-Bezirken ist es den Krankenkassen verboten, mit dem Patienten zu reden, ohne vorab den Arzt zu fragen.
- Durch Einschaltung des Bundesversicherungsamtes als Genehmigungs- und Prüfungsinstitution wurde der Prozess maßgeblich bürokratisiert und führt zu hohen Verwaltungskosten bei den Krankenkassen. So sind einige Punkte nicht klar geregelt bzw. wurden bei der Definition der Programme nicht berücksichtigt und lassen daher Interpretationsspielraum. Maßgeblich für die Kassen ist die Interpretation durch das BVA, die aber meist erst spät erfolgt, so dass die einzelne Krankenkasse zunächst ihre eigene Interpretation umsetzt und dann gegebenenfalls nachträglich den gesamten Datenbestand anpassen muss.
- Durch Interpretation des Gesetzes durch das BVA wurde die Konzeption von DMP-Programmen nach RSAV ausschließlich den öffentlich-rechtlichen Institutionen im Gesundheitswesen zugesprochen. Private Anbieter von DMP-Programmen konnten daher nur als Dienstleister der Kasse die Programme mitgestalten und umsetzen.
- Durch geschickte Rhetorik (Schlagwort "Balkanisierung") wurde verhindert, dass die Krankenkassen unterschiedliche Programme (z. B. stärker patientenorientiert) anbieten können. Somit ist es nicht möglich, unterschiedliche Ansätze und Konzepte umzusetzen und deren Wirksamkeit und Effizienz zu erproben.
- Durch die Koppelung an den Risikostrukturausgleich steht eher die Quantität der eingeschriebenen Versicherten als die Qualität der Versorgung von Hochrisikopatienten im Vordergrund.
- Der Fokus liegt auf der leitliniengerechten Behandlung durch den Arzt. Es wurde jedoch die Einbeziehung des Patienten vernachlässigt, dessen Verhalten bis zu 80% der Therapiekosten ausmacht.
Insbesondere bei der Einführung des DMP nach RSAV traten in der Praxis sehr große Schwierigkeiten auf, die bis heute nachwirken.
Ausblick
- Bereits beim Ausfüllen der Dokumentationsbögen traten Fehlerraten bis zu 90% auf.
- Die Datenstellen, die die Digitalisierung, Prüfung und Verteilung der Dokumentationsbögen zur Aufgabe haben, waren (und sind teilweise) dieser Aufgabe in keiner Weise gewachsen. So wurden die elektronischen Dokumentationen mit Verspätungen im zweistelligen Monatsbereich geliefert und die Plausibilitätsprüfungen fanden de facto überhaupt nicht statt. Auch wurden Dokumentationsbögen zur kostengünstigen Kalibrierung von Beleglesern nach Vietnam weitergeleitet - obwohl vertraglich vereinbart war, dass dies nur in Deutschland stattfinden darf. Da das BVA die Datenstellen jedoch dem Verantwortungsbereich der Krankenkassen zurechnet, zählt die mangelhafte Datenqualität nicht als „Ausrede“ bei Prüfungen. Daher müssen die Plausibilitätsprüfungen redundant bei den Krankenkassen durchgeführt werden, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet.
- Die Anpassungen des Prozessdesigns und der Dokumentationsbögen (hier besonders hervorzuheben die neunte Änderungsverordnung der RSAV) führten zu einem erheblichen Mehraufwand in der Datenverarbeitung. So müssen Programmbestandteile, die vor Inkrafttreten der 9. RSA-Änderungsverordnung durchgeführt wurden, nach den alten Regeln behandelt werden, alles danach nach den neuen Regeln. Die Dokumentationsfristen wurden so geändert, dass ein sinnvolles Reminding kaum mehr möglich ist. So müssen im Prinzip alle Patienten präventiv an anstehende Arztbesuche erinnert werden, was zu einer großen Zahl von „false positives“ führt. Das bedeutet, es werden hier auch Versicherte kontaktiert, die das Programm ordnungsgemäß durchführen, was natürlich zu Verärgerung führt. Gestaltet man das Reminding so, dass nur Versicherte kontaktiert werden, die tatsächlich ihre Teilnahme vernachlässigen, so führt das meistens dazu, dass die Fristen überschritten werden und eine unverhältnismäßig hohe Teilnehmerzahl ausgeschrieben werden muss
- Die DMP-Verträge mit den einzelnen KV-Bezirken gestalten sich unterschiedlich, so dass der Programmteilnehmer einem KV-Bezirk zugeordnet werden muss. Maßgeblich für die Zuordnung ist allerdings nicht der Wohnort des Versicherten, sondern die Praxisniederlassung des behandelnden Arztes, was ebenfalls häufig Probleme verursacht.
- Aufgrund der förderalen Gliederung der Kassenärzte in 23 KV-Bezirke gibt es keine bundesweit einheitliche Liste mit akkreditierten Ärzten. Hier müssen Krankenkassen oder Dienstleister selbständig Listen pflegen, die aus Daten der einzelnen KV-Bezirke zusammengesetzt sind. Struktur und Qualität der Arztdaten der KV-Bezirke sind durchmischt, so dass die Pflege einer einheitlichen Arztliste mit hohem Aufwand verbunden ist.
Im Jahr 2007 soll die der bisherige Risikostrukturausgleich, der die Finanzverteilung anhand statistischer Risikofaktoren berechnet, durch einen Morbiditätsorientierten RSA [Risikostrukturausgleich] (Morbi-RSA) abgelöst werden, bei dem die tatsächlichen Erkrankungen des Versichertenbestandes eine zentrale Rolle für den Verteilungsschlüssel darstellen. Dabei soll auch die Koppelung der Disease-Management-Programme an den RSA entfallen. Aufgrund der unklaren politischen Situation in Deutschland und den starken Umbrüchen, denen das Gesundheitssystem ausgesetzt ist (Stichwort Bürgerversicherung bzw. Kopfpauschale) ist die weitere Entwicklung der DMP nach RSAV derzeit nicht sicher einschätzbar.
Freie DMPEin freies Disease-Management-Programm ist jedes DMP, welches ohne RSA-Koppelung und BVA-Aufsicht entwickelt und durchgeführt wird. In erster Linie sind das die DMP der privaten Krankenkassen (PKV), es gibt jedoch auch gesetzliche Kassen, die solche freien DMP durchführen, beispielsweise das Programm „Herzensgut“ der Kaufmännischen Krankenkasse. Die Gestaltung der freien DMP ist wesentlich patientenzentrierter und in der Regel auch umfangreicher als die der RSA-DMP. Es finden hier regelmäßige Beratungsgespräche statt, bei denen relevante Daten erhoben werden. Auch Info-Broschüren und statistische Auswertungen des Gesundheitszustandes sind Bestandteil der medizinischen DMP. Weiterhin unterstützen selbst zusammengestellte Befundbögen und telemetrische Geräte das Betreuungsprogramm. Oft werden die Patienten abhängig von ihrem Gesundheitszustand auch verschieden intensiv betreut. Die Indikationen sind ähnlich den RSA-DMP hauptsächlich Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Osteoporose, Herzkrankheiten, Asthma, Hypertonie usw. Auch Präventionsprogramme z.B. zur Ernährung werden im Rahmen von freien DMP angeboten. Der prinzipielle Ablauf gliedert sich ähnlich den RSA-DMP in drei Phasen: Selektion, Gewinnung und Betreuung. Der Schwerpunkt liegt hier weniger auf der Quantität, sondern auf der Qualität der Betreuung, da die DMP zunächst erhöhten Verwaltungsaufwand für die Krankenkasse bedeuten und die Kosteneinsparungen nicht pauschal durch die Quantität der eingeschriebenen Patienten entstehen, sondern durch die gezielte Betreuung von Hochrisikopatienten und Schwerkranken. Bei der Umsetzung der freien DMP haben sich ebenfalls einige praktische Schwierigkeiten ergeben.
Evaluation
- Mangelnde Mitwirkungsbereitschaft der Versicherten. Besonders in bei Herzkrankheiten und Diabetes sind die Patienten meist schon sehr alt und haben eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Diese Gruppe zu Verhaltensänderungen zu motivieren oder ihnen eine positive Einstellung zum Programm abzuringen gestaltet sich recht schwierig. Besonders die PKV-Kunden sind zudem Gutverdiener und Bessergestellte, die in ihrem Leben bereits viel erreicht haben und viel Verantwortung tragen. Diese Gruppe lässt sich nicht gern in ihre Lebensgestaltung hineinreden, da sich ihr beruflicher Erfolg psychologisch kaum mit „mangelhaftem“ Privatleben in Übereinstimmung bringen lässt.
- Die Ärzteschaft steht den freien DMP meist noch skeptischer gegenüber als den RSA-DMP, da weder ihre eigenen Vertretungen (z.B. Kassenärztliche Vereinigungen) noch übergeordnete Institutionen wie der Gesetzgeber mit einbezogen sind. Dadurch entsteht noch mehr das Gefühl, ihnen würde die Verantwortung für den Patienten entzogen.
Obwohl der Konzept des Disease Managements in Deutschland noch recht jung ist, gibt es aus dem Bereich der freien DMP und aus anderen Ländern bereits erste Auswertungen bezüglich des Erfolges. Aus diesen Studien geht hervor, dass Disease-Management-Programme vor allem bei schweren Erkrankungen wie Herzinsuffizienz oder Diabetes signifikante Verbesserungen erreichen. Inhalt der Studien ist in der Regel der Vergleich des Krankheitsverlaufs oder die kumulierten Kosten pro Patient mit und ohne DMP. Erhoben wird dabei die Häufigkeit von Symptomen, Folge- und Begleiterkrankungen sowie in Folge die Anzahl der Krankenhauseinweisungen. Die Ergebnisse zeigen eine durchgehende Reduktion der Krankenhausaufenthalte (und damit eines Hauptkostenfaktors) – meist zwischen 20% und 30%, teilweise auch um über 80%. Eine der aktuellsten Studien aus Deutschland (KKH, Herzinsuffizienz) belegt Einsparungen von durchschnittlich 1400 Euro bis hin zu über 5000 Euro. Obwohl der Fokus aller Studien in der Regel auf dem monetären Aspekt liegt, kann man davon ausgehen, dass sich auch die Lebensqualität der Patienten verbessert, wenn weniger Akutfälle vorliegen.
AnbieterEs gibt in Deutschland einige Dienstleistungsunternehmen, die Disease-Management-Programme anbieten. Das umfasst sowohl die Entwicklung und Durchführung freier DMP als auch die Durchführung von RSA-DMP, z.B.:
- Anycare GmbH
- ArztPartner almeda AG
- Innovacare GmbH
- MedicalContact AG
- PCG Pro Consilio AG
- Sanvartis GmbH
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Disease-Management-Programm. -- Zugriff am 2006-01-03]
Die Mehrheit der Hausärzte des Kreises Tübingen lehnt die Teilnahme an DMP-Programmen ab. In einem Brief vom 2005-11-17 an die AOK gibt die "Arbeitsgemeinschaft der Hausärzte des Kreises Tübingen" dafür folgende Begründung:
"Auf unserem Arbeitstreffen am 17.11.2005 haben wir auch über Ihren Brief vom . November bzgl. DMP KHK gesprochen.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass eine deutliche Mehrheit von uns neuen DMP-Programmen inzwischen sehr kritisch gegenübersteht und nicht daran teilnehmen will, zumal ja der generelle medizinische Nutzen dieser Programme noch nicht belegt werden konnte. Zudem bestätigen Sie ja, dass die Patienten gerade Im Kreis Tübingen bereits auf hohem medizinischen Niveau versorgt sind.
Wir halten grundsätzlich die finanzielle Koppelung DMP/RSA [Risikostrukturausgleich] für falsch und hoffen, dass die Politik dies jetzt auch entsprechend modifizieren wird.
Wir halten den Verwaltungsaufwand - insbesondere auch den Werbeetat - für unangemessen hoch und denken, dass diese Gelder sinnvoller für eine konsequente Schulung aller Patienten, auch der problematischen schwer DMP-Motivierbaren eingesetzt werden könnten.
Wir beobachten, dass der Zeitaufwand für DMP- und die vielen anderen Krankenkassen-Programme unsere Praxen langsam erdrückt. Für unsere eigentliche Tätigkeit - die Basisversorgung der Bevölkerung - haben wir immer weniger Zeit.
Auch sind wir nicht begeistert, dass unsere Praxen "online" gehen sollen und finden die finanzielle Bevorzugung der elektronischen Dokumentation ungerecht.
Es erscheint uns auch nicht korrekt, dass DMP-Patienten inzwischen auf den verschiedensten Formularen einen VIP-Status erhalten; dies ist eine ungerechte Bevorzugung gegenüber Patienten mit selteneren Erkrankungen.
Weiter sind wir der Meinung, dass die Arzthonorierung für die Untersuchung und umständliche Dokumentation wie auch die "Teilnahmeprämie" für Patienten in keinem Verhältnis zu den tatsächlich an die Kassen fließenden Beträge - es handelt sich immerhin um Versichertengelder - stehen.
Es tut uns leid, falls der AOK Tübingen auf diesem Wege Ausgleichsgelder entgehen sollten. Aber wir versichern Ihnen, dass wir auf der anderen Seite unsere AOK-Patienten auch künftig gut versorgen werden und Ihnen hierbei höhere Summen wie z.B. Krankenhauskosten einsparen können."
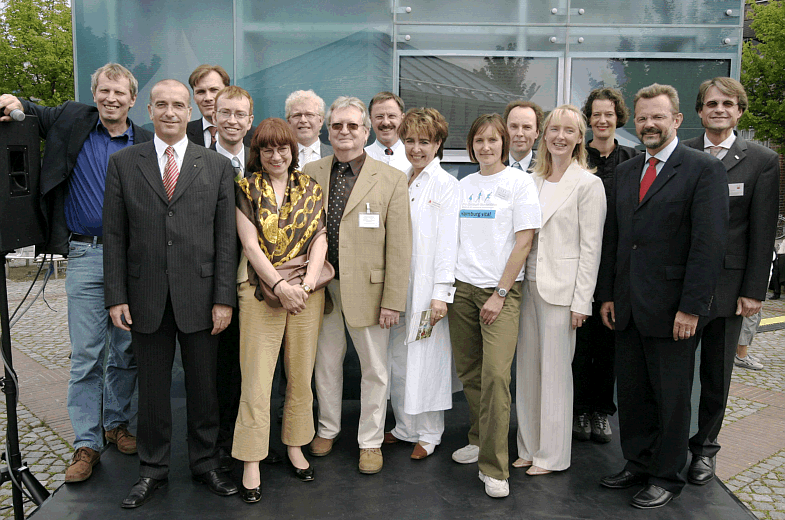
Abb.: "In Sachen Gesundheit ganz vorn: Vertreter von Barmer, AOK und DAK
informierten über Hauarzt- und Hausapothekermodell, Integrierte Versorgung und
strukturierte Behandlungsprogramme für Chroniker."
[Quelle von Abbildung und Beschriftung: Bundesministerium für Gesundheit.
--
http://www.die-gesundheitsreform.de/infokubus_gesundheit/momentaufnahmen/tour_2005/foto_kubus_norderstedt_03.html.
-- Zugriff am 2006-01-03]
"Die Integrierte Versorgung ist eine neue "sektorenübergreifende" Versorgungsform im deutschen Gesundheitswesen. Sie fördert eine stärkere Vernetzung der verschiedenen Fachdisziplinen und Sektoren (Hausärzte, Fachärzte, Krankenhäuser), um die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern und gleichzeitig die Gesundheitskosten zu senken.
HistorieAnsätze zur Ablösung der sektoralen Trennung im deutschen Gesundheitswesen durch ein integriertes System gibt es seit etwa 1975 (z.B. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut des DGB). Bis zur Umsetzung dauerte es jedoch über eine Generation: Zu tief waren in der Zwischenzeit die Gräben und zu kompliziert die Finanzierungsregeln für den Übergang zwischen den Arztgruppen und Sektoren geworden.
Am 1. Januar 2004 schaffte die rot-grüne Koalition mit dem GKV-Modernisierungsgesetz die Grundlagen für die Aufweichung der Fronten. Dafür wurde eigens ein neuer Paragraph (140 a-d) in das Sozialgesetzbuch V (SGB V) eingefügt.
Abb.: "Integrierte Versorgung ist koordinierte Behandlung von A- bis Z. Christian Weck, Experte für Integrierte Versorgung im Bundesgesundheitsministerium."
[Quelle von Abbildung und Beschriftung: Bundesministerium für Gesundheit. --
http://www.die-gesundheitsreform.de/infokubus_gesundheit/momentaufnahmen/tour_2005/foto_kubus_aachen_41.html. -- Zugriff am 2006-01-03]
"§ 140 a Integrierte Versorgung (IV) (1) Abweichend von den übrigen Regelungen dieses Kapitels können die Krankenkassen Verträge über eine verschiedene Leistungssektoren übergreifende Versorgung der Versicherten oder eine interdisziplinär-fachübergreifende Versorgung mit den in § 140b Abs. 1 genannten Vertragspartnern abschließen .§ 140 b Verträge zu integrierten Versorgungsformen (1) Die Krankenkassen können die Verträge nach § 140 a Abs. 1 nur mit 1. einzelnen ... Ärzten und Zahnärzten und einzelnen ... Leistungserbringern ... 2. Trägern zugelassener Krankenhäuser ... 3. Trägern von Einrichtungen nach § 95 Abs. 1 Satz 2 (Medizinische Versorgungszentren) ... 4. Trägern von Einrichtungen, die eine integrierte Versorgung nach § 140 a durch zur Versorgung der Versicherten nach dem 4. Kapitel berechtigte Leistungserbringer anbieten (Managementgesellschaften), 5. Gemeinschaften der vorgenannten ... abschließen. ..."
Zum 1.1.2004 wurde nach §140 d SGB V eine Anschubfinanzierung in Höhe von 1% der Gesamtvergütung ambulanter und stationärer Leistungen bereit gestellt, um die bis dahin zögerliche Inanspruchnahme der neuen Möglichkeiten zu beschleunigen. Danach stehen bis zum Jahr 2006 jährlich maximal 680 Mio Euro zur Verfügung (220 Mio aus der vertragsärztlichen Vergütung und 460 Mio aus der stationären Versorgung).
Ende 2004 gab es etwa 300 Integrationsverträge, im Herbst 2005 wurde die Marke von 1000 Verträgen mit einem Vergütungsvolumen von über 300 Mio Euro erreicht.
]VertragsgestaltungDie meisten IV-Verträge nach § 140 a-d SGB V beziehen sich nur auf bestimmte Indikationsgebiete, es ist jedoch auch möglich, sog. populationsgestützte Verträge für ganze Bevölkerungsgruppen abzuschließen. Häufig wird die hausarztzentrierte Versorgung nach § 73b SGB V in IV-Verträge eingebettet. Diese sogenannte "hausarztbasierte Versorgung" zielt allerdings stärker auf die standespolitische bzw. finanzielle Stärkung der Hausärzte als auf eine echte Integration von Leistungserbringern. Teilweise wurden diese "Hausarztverträge" den Krankenkassen durch streikartige Aktionen aufgezwungen, um so die finanzielle Basis des Hausärzteverbandes zu stärken. Eine Verbesserung der Versorgungsqualität konnte damit bislang nicht nachgewiesen werden.
Indikationsgestützte IV-Verträge entsprechen dem klassischen Case Management [Fallmanagement, siehe unten!], bei dem ein Krankheitsfall in einem definierten Zeitraum behandelt und standardisiert vergütet wird. Da operative Indikationen wie z.B. Hüftendoprothesen bei Arthrose besonders gut in dieses Schema passen, gibt es dafür auch besonders viele Vertragsbeispiele.
Populationsgestützt bedeutet im Gegensatz dazu eine Vergütung über Kopfpauschalen (engl. Capitation) bzw. Gesundheitsprämien pro eingeschriebenem Versicherten, ggflls. beschränkt auf eine bestimmte Region. In Reinform, wie sie in den USA gelebt wird, sind solche Verträge bislang in Deutschland noch im Pilotstadium, doch Ärztenetze und bundeslandweite hausarztzentrierte Versorgungsmodelle (AOK Sachsen, Barmer Hausarztvertrag für bestimmte Gebiet der BRD) stellen erste Schritte in diese Richtung dar.
Der aktuelle Trend geht von einfachen indikationsbezogenen hin zu komplexeren Verträgen, die mehrere Sektoren überspannen, schwierigere Indikationen beinhalten und ganze Versorgungslandschaften entwickeln.
Einige Leistungserbringer stellen die Inhalte der von ihnen geschlossenen Verträge im Internet zur freien Verfügung. Von den Versicherern werden hingegen Verträge mit Hinweis auf Wettbewerbsverbote oder fehlende Offenlegungspflicht üblicherweise nicht publiziert. Es existiert eine Datenbank bei der Registrierungsstelle, die durch die Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung BQS betrieben wird. Auskunftsberechtigt sind lediglich die Krankenhäuser und Kassenärztlichen Vereinigungen, die vom Abzug der Anschubfinanzierung (bis max. 1% der Rechnungen) betroffen sind. Patienten können sich von ihrer Krankenkasse über Vertäge, Vertragsinhalte und Vertragspartner informieren lassen.
Verwandte VertragsformenDie Integrierte Versorgung kann als Teilkomponente eines modifizierten Managed Care Systems nach US-Vorbild angesehen werden. Dieses ist im Gegensatz zum deutschen Krankenversicherungsmodell Bismarck'scher Prägung primär betriebswirtschaftlich ausgelegt und dient eher der Gesunderhaltung (siehe Health Maintainance Organizations HMO) als der Versicherung bereits eingetretener Gesundheitsschäden.
Weitere Managed Care Komponenten, die mit der Gesundheitsreform 2000 in Deutschland auf den Weg gebracht wurden, sind Disease Management Programme (DMP) und Diagnosis Related Groups (DRG). Gemeinsam zielen diese Maßnahmen darauf ab, standardisierte Behandlung zu standardisierten Preisen anzubieten. Ziel ist die Schaffung von Transparenz durch bessere Vergleichbarkeit der erbrachten Leistungen.
Vom Mengen- zum QualitätsmodellDie im folgenden beschriebenen drei Ansätze zur sog. indikationsgestützten IV zeigen beispielhaft, wie man über das inzwischen vielfach beschriebene Modell der Mengenskalierung gegen Preisrabatt hinausgehen und stattdessen geldwerte Qualitätsmomente in IV-Verträge einbringen kann.
- Case Management [Fallmanagement]: Sind bei der Behandlung chronischer Erkrankungen mehrere Ärzte beteiligt, so kann es zu Abstimmungsproblemen und nebenbei auch Anreizverzerrungen kommen. Traditionelle Lösungen wie standardisierte Behandlungspfads, Fallkonferenzen etc. stoßen bei langen und variablen Verläufen mit rekursiven Elementen an ihre Grenzen. Für solche Indikationen kann ein Case-Manager eingesetzt werden, der immobile Patienten regelmäßig ambulant besucht oder mobile Patienten in seine Sprechstunde einlädt. Er ist verantwortlich für den gesamten Prozess und überwacht die Maßnahmen aller beteiligten Therapeuten.
- Modulare Komplexpauschalen: Bei komplexen langwierigen Behandlungen über ambulante und stationäre Sektoren hinweg (z.B. Krebserkrankungen) ist eine Modularisierung der Komplexpauschalen zur Vergütung sinnvoller als die Bepreisung heterogener Fälle mit Durchschnittswerten. Ziel ist es, durch geeignete Vergütungsmodule einen Anreiz zu kürzeren Krankenhausaufenthalten zu bieten. So kann man z.B. durch höherpreisige Aufnahme- und Entlassungsmodule mit entsprechenden Folgeangeboten für teilstationäre und ambulante Versorgung das häusliche Umfeld stärker einbeziehen und gleichzeitig den Patienten aktivieren.
- Komplettpakete: Für inhomogene Indikationen, die aber im therapeutischen Prozess ähnlich sind, sind Komplettpakete sinnvoll. Sie könnten z.B. beim ambulanten Operieren gemäß EBM [Einheitlicher Bewertungsmaßstab] 2000plus die präoperative Standarddiagnostik, Nachversorgung, Komplikationsmanagement und eine zeitlich befristete Qualitätsgarantie enthalten.
Über diese drei indikationsorientierten Varianten hinaus gibt es noch die populationsgestützte Form der integrierten Versorgung. In dieser wird die komplette Versorgung oder eine Gruppe wesentlicher Versorgungsformen durch eine Leistungserbringergemeinschaft gegen eine morbiditätsadjustierte Kopfpauschale erbracht."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Integrierte_Versorgung. -- Zugriff am 2006-01-03]

Abb.: Dieses Bild dient als Reklame (!) für Case Management eines Altenheims
[Bildquelle:
http://www.maevolen.com/casemanagement.htm. -- Zugriff am 2006-01-03]
"Fallmanagement bezeichnet ein Ablaufschema organisierter bedarfsgerechter Hilfeleistung, in dem der Versorgungsbedarf eines Klienten sowohl über einen definierten Zeitraum als auch quer zu bestehenden Grenzen von Einrichtungen, Dienstleistungen, Ämtern und Zuständigkeiten geplant, implementiert, koordiniert, überwacht und evaluiert wird. Das Konzept wurde zunächst als Erweiterung der Einzelfallhilfe in den USA entwickelt und fand in Deutschland in den letzten Jahren zunehmend Eingang in die Interventionsstrategien der sozialen Arbeit und im Gesundheitswesen. Zuletzt wurde Fallmanagement zum zentralen Hebel der Umsetzung der Hartz IV -Gesetze im Hinblick auf die Betreuung und Arbeitsintegration der ALG-II [Arbeitslosengeld II]Empfänger.
[...]
Fallmanagement in der Praxis
Die Umsetzung von Fallmanagement stößt in der Praxis auf Hemmnisse und Grenzen. Im Gesundheitswesen wurden zuerst im Bereich der Rehabilitation und später auch zur Steuerung von Leistungsketten bei Erkrankung Elemente des Fallmanagement eingeführt. So soll ein übergreifender Rehabilitationsplan erarbeitet werden, in dem die verschiedenen Behandlungsschritte von stationärer bis ambulanter Behandlung integriert sind. Zur Kosteneinsparung und Vermeidung von Mehrfachuntersuchungen bei Erkrankungen soll im Krankheitsfall der Hausarzt die Fallsteuerung übernehmen. Probleme ergeben sich vor allem daraus, dass zur wirkungsvollen Umsetzung von Fallsteuerungen zusätzliche Kapazitäten freigestellt werden müssten, dass die verschiedenen Systeme z.B. stationärer und ambulanter Therapie noch immer nicht ausreichend verknüpft sind und sich für den Betroffenen Schwierigkeiten ergeben, sobald verschiedene Kostensträger beteiligt sind. Weiterhin bleiben das soziale und berufliche Umfeld ausgeklammert und die Eigeninitiative und Aktivität des Hilfenehmers eher eingeschränkt als gefördert."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Case_Management. -- Zugriff am 2006-01-03]

Abb.: Einkaufsmodell
(©MS Office)
"Das Einkaufsmodell ist das Konzept für eine veränderte Organisationsform in der gesetzlichen Krankenversicherung, bei dem Krankenkassen direkt Verträge mit einzelnen Leistungsanbietern oder Zusammenschlüssen von Leistungsanbietern abschließen können. Der Begriff wird insbesondere im Zusammenhang mit der ambulanten Versorgung verwendet, betrifft jedoch auch andere Sektoren des Gesundheitswesens. Status quo
In großen Teilen des deutschen Gesundheitswesens ist der Wettbewerb stark eingeschränkt. In der ambulanten Versorgung schließen die Krankenkassen Verträge mit den Kassenärztlichen Vereinigungen, die ein Vertragsmonopol für ihre Mitglieder haben. In der Krankenhausversorgung schließen alle Krankenkassen jeweils gemeinsam mit den zugelassenen Krankenhäusern Vergütungsvereinbarungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.
Charakterisierung EinkaufsmodellDas Einkaufsmodell eröffnet die Möglichkeit eines Vertragswettbewerbs. Einzelne Kassen können mit einzelnen Leistungsanbietern oder mit freiwilligen Zusammenschlüssen mehrere Anbieter individuell Verträge aushandeln. Damit verbunden sind zwei wesentliche Änderungen zur bisherigen Organisationsform im Gesundheitswesen: Die Kassen müssen nicht mehr einheitlich handeln (wie bisher im stationären Sektor) und sie müssen nicht mehr mit allen Leistungsanbietern kontrahieren (bisher ambulant: alle Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung, stationär: alle zugelassenen Krankenhäuser) sondern können selektiv Verträge schließen, der Kontrahierungszwang wird also weitestgehend aufgehoben. Die verstärkte Einführung von Einkaufsmodell/Vertragswettbewerb wird vor allem von einigen großen gesetzlichen Krankenkassen gefordert, die Verbände der Leistungsanbieter stehen dem skeptisch gegenüber.
UmsetzungsstandBisher ist das deutsche Gesundheitswesen nur in einigen Ansätzen nach dem Einkaufsmodell organisiert. Beispielsweise in der stationären und ambulanten Rehabilitation schließen die Krankenkassen bereits selektiv Einzelverträge mit Leistungsanbietern. In jüngster Zeit ist mit der Integrierten Versorgung ein weiterer Bereich hinzugekommen, in dem Vertragswettbewerb herrscht. Es ist erklärter Wille der Gesundheitspolitik, zukünftig zu mehr Vertragswettbewerb zu kommen.
Vergabeentscheidungen im EinkaufsmodellFür die Gestaltung ihrer Vergabeentscheidungen im Einkaufsmodell haben die Kassen einen breiten Handlungsspielraum, da sie bisher in vielen Bereichen ausdrücklich vom Kartellrecht ausgenommen sind. Neben Einzelverhandlungen können sie auch strukturierte Vergabemethoden nutzen, wie Ausschreibungen und Auktionen."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Einkaufsmodell. -- Zugriff am 2006-01-03]

Abb.: Dr. med. Susanne Blessing, geb. 1957, Fachärztin für Allgemeinmedizin
Wettbewerb (diametral zu Solidarität) sollte nicht zu euphorisch gesehen werden.
Erstens besteht bereits ein Wettbewerb zwischen den Anbietern, (der ja angeblich zu Kostensteigerungen führt!), und
zweitens bedingt ein Wettbewerb auch für den Patienten langfristig unerwünschte Effekte (Dumping, Rabattaktionen, letztendlich Konzentration und Monopolbildungen).
Wehret den Anfängen! Auch sollten Patienten nicht durch
Lockangebote (z. B. nur kurzfristig geltende niedrigere Prämien und Zusatzangebote) irregeführt werden! In diesem Zusammenhang seien auch die diversen
Bonusangebote der verschiedenen Krankenkassen genannt, die nur als
Werbemaßnahmen fungieren. Wir müssen uns entscheiden, ob wir in Deutschland
eine abgerundete Versicherung für alle oder eine Teil- und
Vollkaskoversicherung mit der Gefahr der zusätzlichen Einforderung von
(nicht vorhandenen) Steuermitteln wollen. Viele Patienten sind bereit, für
eine gute Versorgung auch etwas mehr zu bezahlen.
Der Einfluss der Pharmaindustrie mit ihrer optimalen Lobbyarbeit wird
erheblich unterschätzt. Hier könnte durch entsprechende Regelungen sicherlich am
meisten eingespart werden, was aber unter Berufung auf die "freie
Marktwirtschaft" angeblich nicht möglich ist. Die Beeinflussung von "Experten",
Meinungsbildnern, Studien (durch dringend gewünschte Drittmittel), von
Patienten, Selbsthilfegruppen und von ärztlichen Fortbildungsveranstaltungen, um
nur einige Beispiele zu nennen, kostet das Gesundheitssystem jährlich steigende
Summen.
|
|
|
|
Abb.: Primärprävention? |
|
[Bildquellen: Helmut Kohl:
http://www.machopan.com/assets/04-09-07_Kohl_Helmut.jpg. -- Zugriff am
2006-01-08; Gerhard Schröder: aus einem Wahlplakat der PDS]
Im übrigen können politische Entscheidungsträger
normalerweise nicht aus persönlicher Erfahrung mitreden, da sie im System
natürlich privilegiert behandelt werden.
Die Krankenversicherungen dürfen - angesichts der
Negativbeispiele aus den USA - keinen direkten Einfluss auf die Behandlung
erhalten, auch wenn sie dies wünschen. Bereits jetzt haben die Kassen durch
den gemeinsamen Bundesausschuss und die MDK-Prüfungen [Medizinischer Dienst
der Krankenkassen] erhebliche Einflussmöglichkeiten, die auch genutzt
werden. In einem demokratischen solidarischen Staat müssen - auch wenn die
Vorgänge manchmal länger dauern - die Entscheidungen pluralistisch getroffen
werden, denn Monopole sollten ja gerade verhindert werden.
Integrierte Versorgung kann nur in ganz kleinen Bereichen juristisch korrekt "geplant" werden. Die große Gefahr bei Integrierter Versorgung besteht darin, dass geschlossene Zirkel (ohne Wettbewerb) entstehen, die der Gefahr unterliegen, die Patientenversorgung immer weiter herunterzufahren, um einen Bonus fürs eigene geschlossene System zu erwirtschaften. Der Patient ist hier chancenlos. Alternativ müssten sich alle im Gesundheitssystem wirklich bemühen, auf dem kleinen Dienstweg und unbürokratisch das jeweils gerade Beste für den Patienten zu wählen, wie es von bewährten Hausarztpraxen (mit losen und nicht fixierten Kontakten zu Facharztpraxen und Kliniken) seit Jahrzehnten auch erfolgreich praktiziert wird. Eine Planung und vorherige vertragliche Absicherung bis ins kleinste Detail kann betriebswirtschaftlich hiermit nie konkurrieren. Allerdings ist dieses patientenideale System in Gefahr, da nur noch ca. 10% eines Medizinerjahrgangs den schwierigen Gang in die Hausarztpraxis wagen wollen. Die Politik hat hier ihre letzte Chance, ein bewährtes System am Leben zu erhalten; ansonsten folgt (ungewollt/gewollt?) der Übergang in eine standardisierte Staatsmedizin.
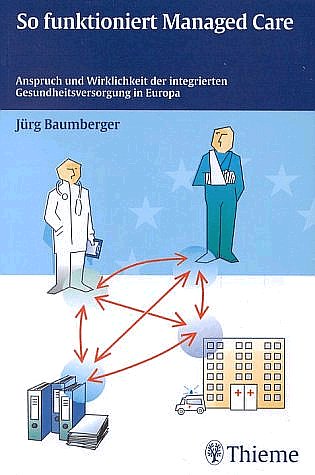
Abb.: Einbandtitel
Baumberger, Jürg <1946 - >: So funktioniert managed care : Anspruch und Wirklichkeit der integrierten Gesundheitsversorgung in Europa. -- Stuttgart : Thieme, 2001. -- 274 S. : graph. Darst. ; 23 cm. -- ISBN 3-13-128391-2. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}