

Fachliche Korrespondenz: mailto:
hausarzt@payer.de
Anfragen zur Website: mailto: payer@payer.de
Ich danke Dr. med. Burkhard Gmelin für die Genehmigung, diesen Vortrag hier wiederzugeben.
Mit freundlicher Genehmigung der Nürnberger Medizinischen Gesellschaft e.V.
Zitierweise / cite as:
Gmelin, Burkhard: Gesundheitsökonomie. -- 6. Institutionalisierung und Ökonomie — der Arzt und die Utopie der Gegenwart. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- Fassung vom 2006-06-12. -- URL: http://www.payer.de/arztpatient/gesundheitsoekonomie06.htm
Erstmals publiziert: Vortrag bei der Nürnberger Medizinischen Gesellschaft e.V., Herbst 2005
Erstmals hier publiziert: 2006-06-12
Überarbeitungen:
Anlass: Gesundheits"reform"
Copyright: Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Verfassers.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Arzt und Patient von Tüpfli's Global Village Library
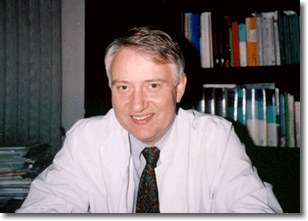
Dr. med. Burkhard Gmelin
Dr. med. Burkhard Gmelin, Facharzt für Innere Medizin / Nephrologie, ist 1. Vorsitzender der Nürnberger Medizinischen Gesellschaft e.V. Webpräsenz: http://www.dr-gmelin.de/
Vor nunmehr ca. 20 Jahren begann man zunächst fast unmerklich damit, neben
den zahllosen Kostendämpfungsgesetzen die ärztliche Tätigkeit selbst ins
ökonomische Visier zu nehmen. Hierzu war zunächst eine Kategorisierung
erforderlich, die unsere Arbeit der Beschreibung und ökonomischen Bearbeitung
überhaupt erst zugänglich machen soll. Und ich kann mich noch sehr gut an meine
Empörung erinnern, als ich zum ersten Mal das Unwort vom Arzt als dem
"Leistungsanbieter" vernahm. Empörung deshalb, weil mit diesem Begriff weder
unsere Tätigkeit selbst, noch unser berufliches Selbstverständnis, noch das
Arzt-Patienten-Verhältnis auch nur andeutungsweise beschrieben wird. Die
Konsequenz war natürlich die ebenso unsinnige Eingruppierung der Patienten als
"Kunden". Wiederholt wurde auf der Basis dieser Kriterien von ökonomischer Seite
tiefes Unverständnis geäußert, warum sich Ärzte auch in scheinbar aussichtslosen
Fällen so verhalten, wie sie es tun - so, als müsste es auch uns vor allem ums
Geld bzw. die Bilanz gehen (was uns andererseits ständig pauschal vorgeworfen
wird) und als gäbe es eine berechenbare Prognose im Einzelfall.
Bis in die achtziger Jahre hatten alle Beteiligten, Ärzte, Ökonomie und
Verwaltung, im Gesundheitswesen im Grunde eine dienende Rolle gehabt. Das
Prinzip: "Aegrotum salus suprema lex esto" (Das Wohl des Kranken sei höchstes
Gebot) war bereits in der Nürnberger Medizinalordnung von 1592 festgelegt
worden. Welchen ethisch vertretbaren Grund gäbe es heute, diesen Grundsatz zu
verlassen? Bisher ging es also primär um Optimierung der Versorgung, und erst
sekundär um Ökonomie. Diese Rolle hat sich umgekehrt. Von ärztlicher Seite
befinden wir uns seither zunehmend in der Defensive, da wir fachlich und
argumentativ auf diesen Einbruch völlig fachfremder Kriterien in unsere
Berufsrealität nicht vorbereitet waren - und sind -, und da diese Kriterien mit
scheinbar zwingender Logik und geschulter glatter Eleganz vorgetragen und
durchgesetzt werden. Das ist Anlass genug für die Medizinische Gesellschaft sich
dieses Themas und seiner den ärztlichen Alltag zunehmend bedrängenden
Auswirkungen anzunehmen. Denn machen wir uns keine Illusionen: alle, ob als
Patienten oder als Ärzte, werden wir davon persönlich betroffen sein (denn
zumindest Patienten sind wir irgendwann alle).
Hier geht es, das sei zu Beginn noch vorausgeschickt, nicht um "noch mehr Geld
für sowieso schon überbezahlte Ärzte". Dass hochqualifizierte Arbeit nach einem
der anspruchvollsten Studiengänge überhaupt und anschließender jahrelanger
Weiterbildung dem zeitlichen Aufwand und der Verantwortung des Arztes angemessen
zu honorieren ist, steht nicht zur Diskussion. Das ist also nicht Thema der
Medizinischen Gesellschaft. Wir bekennen uns ebenso zum wirtschaftlichen Umgang
mit den Geldern der Solidargemeinschaft - hier ist Unterstützung durch
betriebswirtschaftliche Kompetenz unverzichtbar und wertvoll, aber nicht in
Fragen der Behandlung selbst. Wir unterstützen sinnvolle kooperative
Versorgungsformen auch zwischen dem ambulanten und stationären Sektor und
erwarten dabei aber Fairness aller Beteiligten. All das ist also nicht Thema
dieses Aufsatzes. Die Frage, um die es heute geht, ist vielmehr, welche
Auswirkungen die mit Macht neu entstehenden Rahmenbedingungen auf das berufliche
Verhalten der Ärzteschaft haben, oder anders gesagt: Welche Ärzte wir für die
Zukunft heranzüchten?!
Tatsächlich haben Ärzte Interessen. Diese Interessen ergeben sich zwingend
aus ihrer beruflichen Aufgabenstellung und Verantwortung. Sie entsprechen also
über weite Strecken den Interessen der Patienten, für die die Ärzte ja tätig
werden sollen, das sei hier ausdrücklich betont. Und es ist Aufgabe der Politik,
sicherzustellen, dass sie in diesem Sinne ihre Tätigkeit ausüben können. Das
Problem in einem ökonomisierten Umfeld ist: diese Interessen, diese Loyalität
mit den Patienten also, kosten Geld. Und in einem System, in dem dieses Geld aus
den Lohnnebenkosten kommen soll, sind diese Interessen höchst unwillkommen. Als
könnten die Ärzte etwas dafür, dass die Beiträge der Krankenversicherung als
Teil der Lohnnebenkosten eingezogen werden. Das war und ist Entscheidung der
Politik - nicht der Ärzte und übrigens auch nicht der Krankenkassen. Man könnte
es also auch anders machen. Dennoch sind die Ärzte zunehmend gleichzeitig sowohl
ins ökonomische als auch ins politische Schussfeld geraten. Denn aus
ökonomischer Sicht sind wir nicht nur Leistungsanbieter, sondern damit eben auch
Kostenverursacher. Und der Patient wird ab einer den statistischen Durchschnitt
übersteigenden Komplexität seiner Erkrankung zum unerwünschten Kostenfaktor. Die
Krankheit selbst kommt in der Diskussion kaum noch vor, in der es vorwiegend
Schuldige, aber eigentlich kein Schicksal mehr gibt.
Folgerichtig werden Ärzte bei den Überlegungen zur Fortentwicklung unseres
Gesundheitswesens kaum noch und wenn, dann nur mit deutlich spürbarem
Widerwillen gehört. Mit dem gebetsmühlenartig vorgebrachten Verweis auf
angeblich allgemein und ausschließlich profitorientierte Ärzte wurde leider auch
von den meisten Medien die kritische Begleitung des Umbaus des Gesundheitswesens
bisher erfolgreich vernebelt. Wer sollte aber die Patientennöte und die das
ärztliche Selbstverständnis kompromittierenden Auswirkungen einer konsequenten
Ökonomisierung realistischer beurteilen können als die beruflich davon
Betroffenen selbst?!
Die gesundheitsökonomische Umwidmung des Arztes zum "Leistungsanbieter" und
des Patienten zum "Kunden" hat in ihrem anhaltenden Überraschungseffekt offenbar
auch viele Kollegen argumentativ erschlagen, demonstriert aber eigentlich nur
die Begriffsarmut der Ökonomen bezüglich der Beschreibung unserer Arbeit. (Das
ist kein Vorwurf, denn jeder kann nur das wissen, was er gelernt hat. - Jeder
sollte sich dessen aber auch bewusst sein!). Denn hätten Letztere die geringste
Vorstellung von der Realität von Krankheit, ärztlicher Tätigkeit und dem von
daher zu fordernden und unverzichtbaren Arzt-Patienten-Verhältnis, dann wüssten
sie, dass all diese Dinge mit diesen Begriffen nicht andeutungsweise zu erfassen
sind. Unser Problem ist also ganz aktuell, dass versucht wird, unsere
Tätigkeit massiv zu beeinflussen unter Verwendung von Ordnungsbegriffen, die für
die Abbildung dieser Tätigkeit völlig unzureichend und unzutreffend sind!
Der Einbruch der Ökonomie in unsere Tätigkeit ist also kein Fortschritt, sondern
- auch für viele Patienten - ein Unglück! (Auch wenn noch so viele gesunde (!)
Verantwortungsträger und leider auch manche Kollegen davon offenbar regelrecht
besoffen sind!). Denn wo ökonomische Forderungen im Zentrum stehen, ist gezielte
Patienten-Selektion die logische, weil ökonomisch gebotene Folge,
Von ökonomischer Warte aus gesehen unterliegt nahezu jede berufliche Tätigkeit
wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Das ist richtig. Deswegen steht es für das
Selbstverständnis der Ökonomen außer Frage, dass sie im Grunde für alle Bereiche
- vom Handel mit Bananen über Waffen bis hin zu Gesundheitsleistungen - optimale
Konzepte einbringen können. Das ist falsch. Überall da, wo menschliche und
mitmenschliche Belange und die maximale Komplexität der biologischen Abläufe im
Vordergrund stehen, hört die Berechenbarkeit auf - und damit die Zuständigkeit
und Kompetenz der Ökonomen. Wer glaubt, sich darüber hinwegsetzen zu können, wer
hier dennoch mit ökonomischem Druck Zwang auszuüben versucht, wird sehr schnell
zynisch und schlicht inhuman. Und: Er wird scheitern. Deswegen ist der
gegenwärtige allumfassende Anspruch der Ökonomie eine Utopie. "Politischer
Erfolg ist," wie es Jürgen Kaube (FAZ) jüngst sehr treffend formulierte, "kein
Kind aus der Ehe des medialen Effekts mit der ökonomischen Phrase." Für die
Versorgung unserer Patienten gilt das Gleiche! Auch die gesundheitspolitische
Diskussion schwelgt derzeit geradezu in medial gut verkäuflichen ökonomischen
Phrasen. "Wir haben eine Über-, Unter- und Fehlversorgung," gehört z.B. hierher.
(Das Bewundernswerte an dieser Phrase ist ihre zeitlose Gültigkeit!). Inzwischen
geht es jedoch längst um die Prioritäten, die bei der Organisation der
Versorgungswirklichkeit gesetzt werden sollen, und nicht etwa um "Sozialromantik
von gestern".
Im Rahmen der Ökonomisierung mit ihrer überall zu beobachtenden
Konzentrationstendenz wurden immer mehr Elemente unserer Tätigkeit
"institutionalisiert: Dem Ambulatorium soll politisch und ökonomisch ganz
offenbar die Zukunft der fachärztlichen Versorgung gehören. Wir erleben also
gegenwärtig den grandiosen Versuch, aus einer aus guten Gründen noch immer
höchst individuellen Beziehung, dem Arzt-Patient-Verhältnis, die Dienstleistung
von anonymen Instituten mit scheinbar austauschbaren Akteuren zu machen.
Und so ist es nur konsequent, wenn es derzeit zu einer der Lieblingsphrasen der
Gesundheitsökonomen gehört, dass wir uns angeblich "die doppelte Facharztschiene
in Praxen und Kliniken nicht mehr leisten können." Es gibt in Nürnberg ein
Facharztnetz, in dem sich ca. 10% der hier niedergelassenen Fachärzte
zusammengeschlossen haben. In diesem Netz werden jedes Quartal ca. 60 000
Patienten betreut. Ich überlasse es hiermit Ihrer Fantasie, sich die Bedingungen
auszumalen, unter denen diese Patienten (und natürlich die der restlichen 90%
Fachärzte zusätzlich) in Zukunft in Klinikambulatorien versorgt werden sollen.
Im immer wieder als leuchtendes Beispiel angeführten Holland, in dem es
praktisch keine niedergelassenen Fachärzte gibt, müssen die Patienten mit
Wartezeiten auf einen Ambulanztermin von bis zu ½
Jahr und ständig wechselnden ärztlichen Ansprechpartnern rechnen. Jährlich
Tausende von Holländern begeben sich deshalb nach Deutschland zur fachärztlichen
Behandlung - und das System ist zudem dennoch teurer als unseres, wie kürzlich
zu lesen war. Holland liegt bei den Kosten seines Gesundheitswesens hinter den
USA und der Schweiz an dritter Stelle. Großambulatorien machen also nichts
billiger.
Die ersten Folgen dieser Planvorhaben sind längst eingetreten: Wenn nämlich ein
junger Kollege weiß, dass seine berufliche Perspektive in die lebenslange
Tätigkeit in einem Massenambulatorium mündet und dass er ansonsten als Facharzt
politisch unerwünscht ist, wird er möglichst eine andere berufliche Laufbahn
anstreben. Die Folge: Die Weiterbildungsassistenten in den Kliniken bleiben aus.
Und genau das ist geschehen. Mehrere Tausend Assistenzarztstellen in den
deutschen Krankenhäusern sind derzeit nicht zu besetzen, aktuell allein in
Bayern 900, in Thüringen 1000, viele andere nur mit zuwandernden Kollegen aus
dem ferneren Osten. Zu diesem zweifelhaften Erfolg kann man der Politik und
ihren Beratern nur "gratulieren". Man sieht: Auch wenn die ökonomische Theorie
noch so bestechend scheint, die Beteiligten darf man dabei nicht vergessen.
Weder Patienten noch Ärzte dienen nämlich als willenlose ökonomische
Verfügungsmasse.
Jerome Groopman, Immunologe in Harvard, zitiert einen seiner krebskranken
Patienten, einen Unternehmer, im Gespräch mit seinem Arzt so: "Aber da gibt es
einen Unterschied zwischen dem, was ich mache, und dem was Sie tun. Ich kümmere
mich den Teufel um das Produkt. In Ihrer Welt ist es das Produkt, das zählt -
neue Erkenntnisse können die Heilung einer Krankheit ermöglichen. Für mich
bedeutet das Produkt überhaupt nichts. Es kann Öl sein, oder Platin oder
Software oder Gesellschaftsspiele. Alles ist ein Glasperlenspiel, das wir um das
große Geld spielen, und wenn ich einmal genügend gewinne, werde ich "Good-bye"
winken." (J.Groopman, "The Measure of our Days", Penguin, New York, 1997).
Die Zeiten, in denen sich auch ökonomisch agierende Personen dieses
entscheidenden Unterschiedes bewusst waren, sind offenbar vorbei. Was weitgehend
abhanden gekommen ist, ist der Respekt vor der Kompetenz und damit der
Zuständigkeit des Arztes. Das "Produkt", die medizinische Dienstleistung, ist
dabei, zu einer ökonomisch scheinbar verfüg- und vermarktbaren Ware zu
verkommen, um dessen Bedeutung man sich "den Teufel" kümmern muss.
Und so ist es nur konsequent, wenn sich entsprechende Phantasien entwickeln, die
- ein konkretes Beispiel! - einen Immobilienmakler auf einem Kongress zur
Zukunft des Gesundheitswesens im Dezember 2004 von der Etablierung von
Gesundheitsketten träumen lassen, betriebswirtschaftlich geführten Institutionen
also, bei denen Ärzte als (Zitat!) "Franchise-Nehmer und lächelnde
Dienstleister" fungieren; als eine Art Facharbeiter also, die nach den Vorgaben
des Unternehmers Leistungen durchzuführen haben, und diese auch dann den
Patienten gegenüber positiv darzustellen haben, wenn sie mit ärztlichen
Vorstellungen kollidieren (also z.B. den medizinischen Möglichkeiten nicht
entsprechen) - "Weß' Brot ich eß', deß' Lied ich sing," das ist mit dem
"lächelnden" Dienstleister gemeint. Derartige Strukturen drängen inzwischen auf
den "Gesundheitsmarkt". In Nürnberg wurde erst kürzlich ein "integrierter
Versorgungs-Vertrag" geschlossen, in dem eine Managementgesellschaft
Behandlungspläne erstellt, nach deren Vorgaben die Ärzte zu verordnen haben
(dafür braucht man sie noch...), während zugleich das volle Regressrisiko bei
den Ärzten verbleibt. Wir sprechen also nicht etwa von nur theoretischen
Gefahren in irgendeiner fernen Zukunft.
Es ist bekanntlich eines der Prinzipien von Managed Care-Unternehmen in den USA,
dass dort vor allem die Vermeidung von Leistungen honoriert wird. Auch
hierzulande gibt es viele Anhänger dieses Prinzips. Den größten wirtschaftlichen
Erfolg hat der Arzt, der bis möglichst nahe an die Grenze der Justiziabilität
den Patienten Untersuchungen und Therapien ausredet, bzw. sie gar nicht erwähnt.
Wer nichts tut, ist logischerweise am billigsten. Nach einer Umfrage der Agency
for Healthcare Research and Quality unter Managed Care-Ärzten vor einigen Jahren
fühlen sich denn auch über 80% in ihrem ärztlichen Selbstverständnis
kompromittiert. In einer Studie der - ärztlicher Standesinteressen gewiss
unverdächtigen - Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen wurde
festgestellt: Wirtschaftlicher Druck verleitet zum "Weggucken". Denn wer die
teure Krankheit nicht erkennt, muss sie auch nicht behandeln (und damit das
wirtschaftliche Ergebnis des Betriebes gefährden). Man muss kein Prophet sein:
Die so zwangsläufig erzeugten "lächelnden Dienstleister" der schönen neuen Welt
der Gesundheitsökonomie werden auch noch das restliche Vertrauen in das
zukünftige Gesundheitswesen verspielen. Unser oben genannter Immobilienhändler
träumt nach eigenen Aussagen bereits von Renditen von 8% - für die Kapitaleigner
(nicht etwa für Patienten, Ärzte oder das Pflegepersonal).
Ein für den Internisten fast alltägliches Patientenschicksal als konkretes
Beispiel aus diesem Jahr: 45 jährige Patientin, seit 15 Jahren Lupus
erythematodes (LE), eine schwere Autoimmun-Erkrankung mit möglichem Befall aller
Organe, vor 12 Jahren Nierenversagen und Einleitung der Dialyse-Behandlung
(3x/Woche je 5 Stunden), vor 9 Jahren Nierentransplantation mit zunächst guter
Funktion der Transplantat-Niere, LE-Befall der Transplantat-Niere und trotz
intensiver immunsuppressiver Therapie erneut Nierenversagen und Dialysepflicht,
auch dann weiterhin ständig schwelende Aktivität des LE trotz Therapie,
zunehmend Muskelkontrakturen verbunden mit ständigen Schmerzen, im Oktober 2004
stationäre Aufnahme wegen eines Dialyseshunt-Defektes am rechten Oberarm, wenige
Tage nach der Operation Lungenentzündung bei vorbestehender chronischer
Bronchitis, anschließend hämatogene Infektion des operierten Shunts mit
Abszessbildung, anschließend Prä-Infarkt-Syndrom bei drohendem Verschluss eines
Herzkranzgefäßes, Herzkatheterisierung und ,,Aufdehnung" des Gefäßes,
anschließend Sturz beim Toilettengang und Beckenringfraktur mit der Folge
dauernder Bettlägerigkeit, anschließend erneut Lungenentzündung trotz ständiger,
auch krankengymnastischer, Mobilisierungsbemühungen; während des Aufenthaltes
trotz meist guten Appetits Gewichtabnahme auf 35kg, im Februar (also nach
5-monatigem Krankenhausaufenthalt!) schließlich Verlegung in ein Pflegeheim.
Angesichts dieser für ärztlich Tätige nicht ungewöhnlichen Verkettung von
Problemen schicksalshaft schwerst geschlagener Patienten stellen sich hier
einige entscheidende Fragen: Beschreibt der Begriff "Kunde" denn auch nur
andeutungsweise die reale Situation eines Patienten? Welches "Produkt" wird hier
von den betreuenden Pflegepersonen und Ärzten angeboten? Welche Wahl wird dem
Patienten in der von niemandem zu verantwortenden Situation noch gelassen? Wie
lässt sich ein solcher Verlauf im DRG-System statistisch eingruppieren? Welches
,"Disease-Management-Programm" ist für diese Patientin heranzuziehen, damit sie
optimal behandelt wird (z.B. das für Koronare Herzerkrankung?), und wie ist dann
mit ihren zahlreichen und nicht weniger wichtigen Problemen umzugehen, die von
diesem Programm gar nicht erfasst werden? Sagt ein Qualitätsbericht eines
Krankenhauses, in dem Ergebnisse von Einzelbehandlungen aufgeführt werden (z.B.
Bypass-Operationen o.a.), über die Gesamtbehandlungsqualität des Hauses wirklich
etwas aus? Wo hätten wir die Behandlung unterlassen sollen, weil die Kosten in
keinem Verhältnis zum "Nutzen" stehen (die Patientin ist zwischenzeitlich
verstorben)? Wie steht es mit Kliniken, die auf bestimmte Behandlungen (hier
z.B. auf Herzkranzgefäßeingriffe) spezialisiert sind, diese fraglos medizinisch
und wirtschaftlich optimal erbringen, wenn derartige Komplikationen eintreten?
Sind nicht angesichts des Primats des wirtschaftlichen Erfolges diese Patienten
hier systembedingt - und ab einer gewissen Häufung, die die Wirtschaftlichkeit
des Betriebes infragestellt, auch tatsächlich unerwünscht? Werden darüber hinaus
Ärzte, die ihrem ethischen Anspruch gerecht werden wollen, nicht zum
wirtschaftlichen Risiko des Betriebes, da ihre - ethisch ohne Frage gebotene! -
Behandlung nur unzureichend vergütet wird? (Wo ökonomischer Erfolg vorrangig
ist, sind "Wohltaten" schließlich nur begrenzt zu verteilen). Ob sich mit
anderen Worten das Gesundheitssystem weiterhin zur Versorgung dieser
schicksalsmäßig schwer betroffenen Patienten bekennt, auch wenn sie sich nicht
"rechnet"?
Fragen also an die Humanität des zukünftigen Systems, die nicht oft und laut
genug gestellt werden können. Und wir dürfen keinesfalls hinnehmen, wenn die
Protagonisten dieser Entwicklung versuchen, sich mit "Sachzwängen"
herauszureden. Die Versorgung unserer Patienten ist der Sachzwang, und nicht die
Bilanz! Der Patient mit seinem Problem steht vor uns und muss versorgt werden -
unabhängig davon, ob das nun betriebswirtschaftlich willkommen ist oder nicht.
Die Behandlung multimorbider Patienten (die internistisch der "Normalfall" sind)
ist in jedem System defizitär, also subventionsbedürftig gewesen. Die Frage, die
sich heute zunehmend stellt, ist, wer diese Subventionen in Zukunft zu leisten
bereit ist - wer also mit anderen Worten das Morbiditätsrisiko übernimmt.
Effizienzdenken ist fraglos ein wichtiges Mittel, die wirtschaftlichen
Bedingungen einer Behandlungseinrichtung zu sichern. Aber es ist nicht der Zweck
der Einrichtung selbst. Der Zweck ist die Versorgung. Krankheit lässt sich im
konkreten Einzelfall nicht nach finanziellen Vorgaben planen oder gar steuern.
Der Patient in seiner individuellen Not ist alles andere als eine statistische
Größe. Zuwendung, Vertrauen, Engagement, Erfahrung sind statistisch (und
ökonomisch) nicht erfassbar. Sie sind aber die entscheidenden Elemente
ärztlicher Tätigkeit! Statistik gibt wertvolle Informationen, aber sie
beschreibt nicht die Wirklichkeit. Dennoch wird sie von Gesundheitsökonomen und
der Politik mit der Beschreibung der Wirklichkeit gleichgesetzt. Noch nie zuvor
hat sich die Gesundheitspolitik so weit von den Patientenbedürfhissen und von
der ärztlichen Realität entfernt wie heute.
Die Politik ist auf Anraten der Gesundheitsökonomie derweil andere Wege
gegangen. So wurden mit dem löblichen Ziel, die Versorgung chronisch Kranker für
die Kostenträger wirtschaftlich attraktiv zu machen und vielleicht sogar
qualitativ zu verbessern, zwischenzeitlich mehrere "Disease-Management-Programme"
aufgelegt, u.a. zum Diabetes mellitus. Jeder in dieses Programm eingeschriebene
Patient bedeutet für die Krankenkasse einen nicht unerheblichen Geldbetrag, den
sie aus dem sogenannten "Risikostruktur-Ausgleichstopf" erhält. Inhaltlich
entsprechen die Programme weitgehend den aktuellen Leitlinien der
Fachgesellschaften, an denen wir sowieso unser Handeln ausrichten. Inhaltlich
sind sie also nicht schlecht. Das Problem ist aber, dass der Eindruck erweckt
wird, dass alle Patienten, bei denen möglichst alle Zielvorgaben erreicht sind,
optimal behandelt sind. Dann könnte die Behandlung doch eigentlich auch ein
Computer erledigen. Wozu also noch Ärzte? Die Stunde der Dilettanten hat
geschlagen.
Auch hier stoßen wir nämlich sofort wieder auf die Patientenwirklichkeit. Denn
kaum ein Patient hat nur allein einen Diabetes mellitus als
behandlungsbedürftige Gesundheitsstörung. Ein einfaches Beispiel zur
Illustration: Die Diabetes-Leitlinien und folglich auch das DMP fordern mit
guten Gründen eine Einstellung des Blutdruckes unter Werte von 130/80 mmHg, bei
zusätzlicher Nierenschädigung möglichst erheblich niedriger. Hat der Patient
aber z.B. eine Verengung seiner Halsschlagadern, was nicht gerade selten
vorkommt, bekommt er bei einer programmgemäßen Blutdrucksenkung einen
Schlaganfall. Der Arzt aber, der es gut macht, und den Blutdruck bis zur
Operation des Patienten höher toleriert, muss sich wegen Nichterfüllung der
DMP-Vorgaben rechtfertigen.... Ich überlasse es der Beurteilung des Lesers, ob
eine solche Regelung besonders weise ist. Denn die Patienten-Wirklichkeit ist im
Allgemeinen noch weitaus komplexer als dieses noch immer banale Beispiel.
Als Arzt reibt man sich derzeit mehrmals täglich erstaunt die Augen. Nicht
nur, dass man mit der Ökonomisierung genau die Denkweise zum Herrschaftswissen
über das Gesundheitswesen gemacht hat, die man der Ärzteschaft so oft pauschal
zum Vorwurf machte. Als wäre Gewinnstreben weniger verwerflich, nur weil es von
Betriebswirtschaftlern anstelle von Ärzten praktiziert wird. Bisher sind wir
alle (nicht nur die Ärzte) auch davon ausgegangen, dass unnötige Bürokratie ein
ökonomisch schädlicher Kostenfaktor ist, der zudem zu einer zunehmenden
Verkrustung eines Gemeinwesens führt. Seit die Gesundheitsökonomie das Heft in
die Hand genommen hat, sieht es jedoch ganz anders aus. Unter der geradezu
wahnhaften Vorstellung, alles müsse messbar, objektivierbar und "transparent"
sein, wurde die Ärzteschaft in den letzten Jahren mit einem Wust von
Dokumentationspflichten, Kontrollanfragen, aufwendigsten Formularen etc.
überschwemmt, die nicht das Geringste mit der Patientenbehandlung zu tun haben.
Und dazu kam noch die Verpflichtung zum Einzug der Praxisgebühr im Auftrag der
Krankenkassen.
Beispiele: Im Rahmen von DMP's und Verträgen zur integrierten Versorgung ist
jede einzelne Krankenkasse seit der letzten Gesundheitsreform berechtigt,
Einzelverträge mit Ärzten und anderen Behandlungseinrichtungen abzuschließen.
Bemerkenswerterweise ist bei den Verantwortlichen bisher keine Antwort auf die
Frage zu erhalten, nach welchen Qualifikationsvoraussetzungen diese Verträge
abgeschlossen werden. Es geht derzeit nur darum, wer den Verträgen beitritt
(sind das immer die besseren Ärzte?) und wer nicht (sind das immer die
schlechteren?). Das heißt aber auch im Umkehrschluss, nicht alle Ärzte, mit
denen man bisher zusammengearbeitet hat, sind weiterhin Vertragsteilnehmer bei
der Behandlung einer bestimmten Erkrankung. Es wird also Aufgabe des Arztes bei
jeder Überweisung sein, zu überprüfen, welche Ärzte für welche Erkrankung mit
welcher der 300 Krankenkassen einen Vertrag abgeschlossen haben. Denn nur zu
diesen Kollegen soll er vertragsgemäß den Patienten überweisen. Allein in
Baden-Württemberg gibt es inzwischen rund 120 Kleinverträge. Nach Auffassung von
Walter Scheller, dem neuen Chef der Ersatzkassenverbände im Südwesten verheißt
die Zukunft Tröstliches; "Nicht jeder Arzt ist mit 120 Verträgen konfrontiert. -
Maximal 50 werden übrig bleiben." ...
Das Interessante ist dabei: Die Konkurrenz um die Patienten im niedergelassenen
Bereich ist angesichts der noch hohen Arztdichte seit Jahren maximal, die
Honorierung der einzelnen Leistung ist zugleich um ca. 50% zurückgegangen - bei
zugleich (wie überall) erheblich gestiegenen Kosten. Die Patienten stimmen
derzeit mit den Füßen ab, bei welchem Arzt sie sich am besten aufgehoben fühlen.
Diese Konkurrenzsituation, von der die Patienten erheblich profitieren, wird von
der Gesundheitsökonomie eigenartigerweise überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.
Wie wir gesehen haben, hat sich vielmehr die Politik entschlossen, die
Patientenströme in Zukunft willkürlich zu steuern - und hebelt eben dadurch die
Konkurrenz aus. Ökonomisierung bedeutet für uns derzeit auch: Die Kooperation
zwischen Ärzten wird zum bürokratischen und planwirtschaftlichen Moloch.
Diese von den Gesundheitsökonomen massiv geforderte Entwicklung wird übrigens
bereits von vielen Patienten kritisch hinterfragt. Denn die mit den
Einzelverträgen logischerweise verbundene Einschränkung der freien Arztwahl wird
erkannt und keineswegs als Fortschritt empfunden. Auch die
Managed-Care-Unternehmen in den USA sind hier inzwischen erheblich
zurückgerudert.
In Praxen und Kliniken nimmt der Aufwand für bürokratische Aufgaben mittlerweile
30-40% der Arbeitszeit in Anspruch - fast möchte man annehmen, dass die Ärzte
von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten werden sollen. In der Klinik ist in den
letzten Jahren vor allem der Aufwand für die Diagnosenverschlüsselung
hinzugekommen, von der das wirtschaftliche Wohl und Wehe des Krankenhauses
entscheidend abhängt: Die "Disease related Groops" (DRG), also die
diagnosebezogene Zuordnung des Patienten zu einem stringent vorgegebenen
Erlösbetrag. Zusätzlich ist eine Flut von Anfragen des medizinischen Dienstes zu
bearbeiten, die den Grund für die stationäre Behandlung hinterfragen. In Bayern
war im letzten Jahr jeder 6. Klinikaufenthalt betroffen, das macht allein in
unserem Bundesland 250.000 Anfragen/Jahr! All diese Anfragen müssen gelesen,
bearbeitet, beantwortet, ausgewertet, entschieden und archiviert werden... . Wie
zukunftsträchtig ist Misstrauen als bürokratisches Prinzip?
Vielleicht ist es jetzt nachfühlbar geworden, wenn Ärzte auf die Straße gehen
und Bürokratieabbau fordern. Denn es sei sanft daran erinnert: sie sind zur
Patientenbetreuung angetreten und nicht zum Ausfüllen von Zetteln.
Ärztliche Ethik einzufordern ist richtig und ohne jede Frage berechtigt. Aber Ethik ist kein Privatproblem des Arztes. Ethisches Verhalten muss auch durch die politisch gesetzten Rahmenbedingungen gestützt werden. Das ist die Herausforderung, an der sich die Politik messen lassen muss. Wenn es in Zukunft Erkrankungen gibt, die sich für die dafür spezialisierten Einrichtungen "rechnen", und es zum erfolgreichen Geschäftsmodell gehört, sich der anderen Erkrankungen möglichst zu entledigen, hat das mit Versorgung im eigentlichen Wortsinne und mit Ethik nichts mehr zu tun. Dass es die sogenannten "Rosinenpicker"-Kliniken und -Praxen gibt, ist eine bekannte Tatsache, und dass man mit betriebswirtschaftlicher Lust ausgerechnet auf die Einrichtungen eindrischt, die den allgemeinen Versorgungsgedanken noch nicht aufgegeben haben und folglich ökonomisch weniger erfolgreich agieren, ebenfalls. Ethik ist auf dem Wege, zu einem reinen Totschlag-Argument gegenüber Ärzten zu werden, die unerwünschte, weil möglicherweise mit Kosten verbundene, Forderungen an Politik und Kostenträger stellen. Darauf sollten wir in Zukunft nicht mehr hereinfallen.
Das Ziel einer gesundheitsökonomisch dominierten Politik ist die Sachleistung
zu möglichst minimierten Kosten. Etwas anderes ist mit betriebswirtschaftlichen
Methoden gar nicht darstellbar. Das ist das Ziel der "Stärkung von
Konkurrenzmechanismen", die derzeit lautstark gefordert wird. Die Aufgabe des
Arztes geht aber über Sachleistungserbringung weit hinaus. Wenn sich die derzeit
von ökonomischer und gesundheitspolitischer Seite favorisierten
Konkurrenz-Vorstellungen durchsetzen, wird der Mediziner zu den wenigen Berufen
gehören, die in zwei Richtungen zugleich konkurrieren: um die Patienten, wie
schon jetzt, - und um die Lizenzverträge mit den Krankenkassen.
Die entscheidende Frage bei der Umgestaltung des Sozialsystems wird dagegen
nicht gestellt.
Sie lautet: "Wer benötigt in welcher Situation wie viel Solidarität?"
Braucht z.B. der Patient zwischen Normalverdiener und Millionär die
Unterstützung der Solidargemeinschaft, wenn er seine Bronchitis behandeln lässt?
Solange beliebig im Einzelfall billige, aber in der Gesamtsumme Kosten in
Milliardenhöhe verursachende Leistungen eingefordert werden können, nur weil man
versichert ist (und nicht erst dann, wenn man andernfalls in finanzielle Not
geraten würde), hat unser System mit einer Sozialversicherung im Grunde nichts
zu tun. Das soll kein moralischer Vorwurf sein, denn wir alle verhalten uns
lediglich systemkonform. Eine Änderung dieses Systems in Richtung des genuinen
Versicherungsgedankens wäre also eben kein Sozialabbau, sondern im Gegenteil
erst die Durchsetzung des wirklichen Sozialgedankens!
Freilich sieht es dafür schlecht aus: Denn mit diesem Gedanken lässt sich keine
Wahl gewinnen... Daß wir derzeit längst in einem ethischen Dilemma stecken,
indem wir über die Finanzierbarkeit teuerer Behandlungen diskutieren, während
zugleich die ungleich höheren Gesamtkosten banaler Massenkrankheiten, die für
jeden Einzelfall gering und von der Mehrzahl der Betroffenen selbst zu tragen
wären, selbstverständlich durch die Kostenträger bezahlt werden, - dieses
Dilemma wird nicht wahrgenommen.
Und so sucht man das Heil wohl weiterhin in der Durchökonomisierung des Systems.
Wenn dieses Ziel erreicht ist, hat man den Arzt endgültig abgeschafft. Dann ist
alles, was wir an berufsethischen Grundsätzen über Jahrhunderte erarbeitet
haben, nur noch schöngeistiger Bailast. Denn dann endlich geht es wirklich nur
noch ums Geld. Und wo's nur noch ums Geld geht hört bekanntlich die Liebe auf.
Dr. med. Burkhard Gmelin
1. Vorsitzender der Nürnberger Medizinischen Gesellschaft e.V.
Albrecht-Dürer-Pl. 11
90403 Nürnberg