

mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - > ; Payer, Alois <1944 - >: Bibliothekarinnen Boliviens vereinigt euch! = Bibliotecarias de Bolivia ¡Uníos! : Berichte aus dem Fortbildungssemester 2001/02. -- Teil 2: Chronik Boliviens. -- 5. Von 1555 bis 1665. -- Fassung vom 2002-10-09. -- URL: http://www.payer.de/bolivien2/bolivien0205.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: Anlässlich des Bibliotheksseminars in La Paz vorläufig freigegeben am 2002-09-19
Überarbeitungen:
Anlass: Fortbildungssemester 2001/02
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Teil ist ein Kapitel von:
1550 - 1800
Entwicklung der spanischen Silberimporte aus Potosí und Mexiko
Abb.: Entwicklung der spanischen Silberimporte aus Potosí und Mexiko 1550 - 1800[Quelle der Abb.: Braudel, Fernand <1902 - 1985>: Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. -- München : Kindler. -- Bd. 2: Aufbruch zur Weltwirtschaft. -- ©1986. -- ISBN 3-463-40027-8. -- S.470. -- Originaltitel: Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVe - XVIII siècle: Le temps du monde (1979)]
"Bis 1560 herrschte in Europa Silberknappheit. Zwar produzierten die Minen in Tirol und Sachsen zwischen 1526 und 1535 jährlich 10.000 bis 15.000 Mark Silber, das entsprach ca. l Million spanischer Dukaten (35.000 kg Silber) in zehn Jahren, aber dieses Angebot scheint die Nachfrage nicht gedeckt zu haben . Nach 1525 trafen auch Silberlieferungen aus Amerika ein, aber erst in den sechziger Jahren lag der Wert der Silberimporte über den amerikanischen Goldlieferungen. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bestanden die Edelmetalleinfuhren aus Amerika zu über 90 % aus Silber." [Pieper, Renate: Die Preisrevolution in Spanien (1500 - 1640) : neuere Forschungsergebnisse. -- Wiesbaden : Steiner, ©1985. -- 170 S. : 6 graph. Darst. -- (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; Bd. 31). -- Zugleich: Magisterarbeit, Univ. Köln, 1983. -- S. 20]
"Da die spanische Krone und die kastilischen Cortes in Übereinstimmung mit der in Europa herrschenden Meinung die Gold- und Silbereinfuhren als Quelle des Reichtums schlechthin ansahen, war die Ausfuhr der Edelmetalle aus Spanien grundsätzlich verboten. Auf der anderen Seite benötigten die spanischen Habsburger für ihr Engagement im Reich, in Italien und in den Niederlanden die Kredite deutscher und italienischer Bankiers. Die Rückzahlung der Kredite erfolgte meist in Kastilien, und so flossen die Edelmetalle, versehen mit einer königlichen Lizenz, aus Spanien ab. Seit der Regierungszeit Philipps II. wurde der Export über Barcelona via Genua nach Flandern abgewickelt. Außerdem ist ein bedeutender Edelmetallabfluss über den privaten Handel zu berücksichtigen. Bis 1566 war Privatleuten die Edelmetall ausfuhr zwar untersagt, aber diese Bestimmung wurde durch Schmuggel umgangen . Nach 1566 änderte sich die Situation dadurch, dass die Krone ihren Bankiers und Gläubigern handelbare Ausfuhrlizenzen ausstellte, die dann unter den Kaufleuten zirkulierten. Spaniens Warenaustausch mit Mitteleuropa wies ein Handelsbilanzdefizit auf, das durch Geldzahlungen ausgeglichen wurde. Die von Sevilla nach Hispanoamerika exportierten Güter, die zu über 70 % aus Textilien und Metallerzeugnissen bestanden, waren gegen Ende des 16. Jahrhunderts nur zur Hälfte spanischen Ursprungs . Die Edelmetalle mit denen diese Produkte bezahlt wurden, verließen daher auf die eine oder andere Art die Halbinsel. Zur Abschätzung der Edelmetallabflüsse aus Spanien ist unter Berücksichtigung der negativen Handelsbilanz und des großen Anteils der Reexporte am Amerikahandel davon ausgegangen worden, dass 50 % der Edelmetallimporte, die in Sevilla für Private registriert wurden, das Land wieder verließen."
[Pieper, Renate: Die Preisrevolution in Spanien (1500 - 1640) : neuere Forschungsergebnisse. -- Wiesbaden : Steiner, ©1985. -- 170 S. : 6 graph. Darst. -- (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; Bd. 31). -- Zugleich: Magisterarbeit, Univ. Köln, 1983. -- S. 24f.]
"... würde bei einem Grundbestand an Münzgeld in Höhe von 5 Millionen Dukaten eine Verweildauer des amerikanischen Goldes und Silbers in Spanien von fünf Jahren angenommen werden. In Sevilla verblieben die amerikanischen Metalle jedoch höchstens ein Jahr. 2/5 des Goldes und 1/3 des Silbers flossen 1570/71 nach Valladolid und Madrid, den Finanzzentren Kastiliens ab. Wie lange sie dort in Umlauf blieben, ist nicht abzuschätzen. Ein Hinweis für eine längere Verweildauer als ein Jahr lässt sich aus der Tatsache ableiten, dass die Menge der in einem Zeitraum von fünf Jahren geprägten Münzen mit den Edelmetallimporten in dieser Periode übereinstimmte Ein weiteres Indiz für den partiellen Verbleib amerikanischen Silbers im spanischen Wirtschaftskreislauf liefert die Verringerung des durchschnittlichen Goldgehalts der in Kastilien und Aragon zwischen 1479 und 1665 geprägten Silbermünzen. A. A. Gordus und J. P. Gordus bestimmten mit Hilfe der Neutronenaktivierungsanalyse den Goldgehalt einer Auswahl von Silbermünzen, die in Potosí, in Mexiko und in Europa im Verlauf des 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ausgeprägt worden waren. Dabei stellten sie fest, dass Silber aus Potosí eine sehr viel geringere Goldverunreinigung aufwies, als mexikanisches Silber oder vor 1556 in Europa ausgeprägte Münzen. Auch nach der Entdeckung Potosís enthielt das in Europa ausgemünzte Silbergeld überwiegend einen hohen Anteil Gold. Nur bei einigen spanischen, italienischen und in den spanischen Niederlanden hergestellten Münzen entsprach der Grad der Verunreinigung mit Gold dem des Silbers aus Potosí . Aus diesem Befund auf eine weitgehende Abwesenheit peruanischen Metalls in europäischen Münzen zu schließen, wäre falsch, denn die amerikanischen Edelmetalle gelangten größtenteils als Geldstücke nach Europa und wurden häufig noch eine Zeitlang als Zahlungsmittel benutzt. Die Umprägung auf dem europäischen Kontinent erfolgte meist zusammen mit anderen Münzen, so dass das Edelmetall aus Potosí gleichzeitig mit mexikanischem, sonstigem peruanischem und altem europäischen Silber eingeschmolzen und neu ausgeprägt wurde . Aus den Graphiken von A. A. Gordus und J. P. Gordus läßt sich ablesen, dass der Goldgehalt der Münzen aus Potosí im Mittel bei 0,02 ‰ lag und der des mexikanischen Silbers bei 1,84 ‰. Vor Ankunft der Lieferungen aus Peru enthielten die kastilischen Reales durchschnittlich 1,85 ‰, die Gesamtheit der untersuchten spanischen Silbermünzen enthielt 1,63 ‰ Gold. In den nach 1556 in Kastilien ausgeprägten Reales fand sich im Mittel ein Goldanteil von l,00 ‰, und im Durchschnitt aller spanischen Münzen lag er bei 1,03 ‰. Durch den Einfluss des amerikanischen Silbers war der Goldgehalt spanischer Münzen daher um 37%, in Kastilien um 46%, gesunken, d.h. ca. 40‰des Münzmetalls, das in spanischen Prägeanstalten verwandt wurde, kam aus Potosí. Wenn man davon ausgeht, dass das übrige im Vizekönigreich Peru abgebaute Silber, das ca. 15 % der amerikanischen Silberexporte darstellte, einen dem mexikanischen vergleichbaren Goldanteil hatte, gingen bis zu 90 % amerikanischen Silbers in spanische Münzen ein . Aus diesem Grunde ist es unwahrscheinlich, dass die amerikanischen Edelmetalle nach Ablauf von fünf Jahren vollständig aus Spanien exportiert worden sind. Entsprechend den der Geldmengenabschätzung zugrunde gelegten Prämissen wird der Anteil des im Lande verbleibenden Edelmetalls bei ca. 30 % gelegen haben." [Pieper, Renate: Die Preisrevolution in Spanien (1500 - 1640) : neuere Forschungsergebnisse. -- Wiesbaden : Steiner, ©1985. -- 170 S. : 6 graph. Darst. -- (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; Bd. 31). -- Zugleich: Magisterarbeit, Univ. Köln, 1983. -- S. 26f.]
1550 bis 1650
Verlorengegangene Schiffe aus der Amerika-Route. Die meisten Schiffe fielen Naturgewalten zum Opfer, ein kleinerer Teil Seeräubern und Kaperern.
Abb.: Verlorengegangene Schiffe 1550 bis 1650[Quelle der Abb.: Chaunu, Pierre <1923 - >: Europäische Kultur im Zeitalter des Barock. -- Zürich : Ex Libris, ©1968. -- (Knaurs große Kulturgeschichte). -- S. 384. -- Originaltitel: La civilisation de L'Eurpe classique (1966)]
1555 - 1560
|
1556 - 1598
|
| «Den katholischen Glauben in seiner ganzen Reinheit
erhalten!» Niemals sollte Philipp diese letzte Ermahnung seines Vaters
[Carlos I] vergessen. Sobald er an die Macht gelangt war, fasste er drei
Feinde ins Auge: die Juden, die Muselmanen und die Protestanten. Um sie zu vernichten, war ihm jedes Mittel recht. Mit Feuer und Schwert gedachte er sein Ideal der absoluten Reinheit des Glaubens zu verwirklichen. Jean Descola, der Historiker des christlichen Spanien, beschrieb ihn als jemanden, der «der Versuchung zur Heiligkeit» unterlegen ist, gab sich aber keine Mühe zu verheimlichen, dass drei furchtbare Begriffe auf diesem Wege seine unheilvolle Begleiter waren: Inquisition, Sacrum Officium, Autodafe." [Géoris, Michel: Die Habsburger. -- Lausanne : Rencontre, ©1968. -- (Die großen Dynastien Europas). -- S. 117] |
| "Gold und Silber der Neuen Welt Kriege haben stets viel Geld gekostet, und verlorene Kriege machen da keine Ausnahme. Nicht selten folgen ihnen gewaltige Preissteigerungen, begleitet von tief greifenden Zerrüttungen des Staatshaushalts und einem Staatsbankrott. Kriege verschlingen ungeheuer viel Geld. Die Niederlage der Armada kostete den spanischen Staatshaushalt rund zehn Millionen Dukaten, und der Krieg in den Niederlanden verschlang weiterhin jährlich etwa zwei Millionen. Ein fahr nach der Niederlage der Armada, im Jahr 1589, gaben die kastilischen Stände notgedrungen ihre Zustimmung für eine neue Steuer, die jährlich acht Millionen Dukaten einbringen sollte. Die spanischen Habsburger gaben Geld aus, als strebten sie darin die Weltmeisterschaft an. Ihre Finanziers waren zu Zeiten Karls V. in erster Linie die Fugger. Philipps Vater verprasste in den Kriegen gegen Frankreich und die Türken ungeheuer viel Geld, er ließ in der ersten Jahrhunderthälfte dafür die Niederlande gehörig zur Ader. Karl gab das Geld rücksichtslos aus, die Ratschläge seines Finanzfachmannes Francisco de los Cobos schlug er bedenkenlos in den Wind. Cobos scheiterte als Finanzminister, weil Karl Unmögliches von ihm verlangte. Schon vor dem Ende von Karls Regierung, nach den langen Kriegen mit Frankreich, hatte Spanien beträchtliche Schwierigkeiten, die Summen zu beschaffen, die Karls Kriege kosteten. Im Herbst 1552 musste Philipp im Auftrag seines Vaters zu den Geldflüssen aus der Neuen Welt seine Zuflucht nehmen, das heißt, auf sie gestützt Kredite aufnehmen. Und im folgenden November, 1553, forderte Karl schon wieder von ihm, neue Gelder zu beschaffen. Das war überhaupt das Geheimnis von Spaniens Geldflut -die Neue Welt. Philipps Spanien war kein reiches Land; fast der gesamte Reichtum, über den Philipp verfügte, kam aus der Neuen Welt. Die Spanier suchten in Amerika nach Gold, von Anfang an war das Gold eines ihrer wichtigsten Ziele, man kann es im «Bordbuch» des Kolumbus nachlesen. In den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts waren die Edelmetallfunde noch gering; aber nach 1530 floss das Gold doch in beträchtlichen Mengen von der Neuen in die Alte Welt. Zwischen 1531 und 1540 kamen beinahe 15 Tonnen Gold aus Amerika nach Spanien, im folgenden Jahrzehnt waren es schon 25 Tonnen und im sechsten gar 43. Nach 1560 wird es allerdings wieder weniger, die Menge fällt in diesem Jahrzehnt auf unter 10 Tonnen. Dann stieg sie wieder auf fast 19,5 Tonnen im letzten Jahrzehnt. Nur ein kleiner Teil davon, ein Fünftel, ging an die Krone.
Weitaus bedeutender war die Gewinnung von Silber. Schon kurz vor Philipps Thronantritt, 1545, wurden in Peru, südlich des Titicaca-Sees, am Cerro Rico de Potosí in 4700 Meter Höhe gewaltige Silbervorkommen entdeckt. Im Jahr darauf begann auch in Zacatecas in Nordmexiko die Ausbeute. Mit Hilfe einer neuen Methode, eines Amalgamierungsverfahrens - wobei größere Mengen an Quecksilber aus den Minen der spanischen Gruben von Almaden eingesetzt wurden - gelang es gegen 1560, ohne großen Aufwand das amerikanische Silber abzubauen. Der Aufstieg der amerikanischen Silberproduktion zeigt sich daher auch spiegelbildlich an den Fördermengen des Quecksilbers von Almaden. Die Gruben von Potosí und vor allem die in Mexiko wurden bald berühmt für ihren Silberreichtum. Silber strömte seit 1530 herein, in einzelnen Jahrzehnten über 300 Tonnen; im Jahrzehnt nach 1570 wurde erstmals die Schwelle von 1000 Tonnen überschritten, zwischen 1580 und dem Jahr 1600 waren es pro Jahrzehnt sogar deutlich mehr als 2000 Tonnen. Entsprechend dieser gewaltigen Zufuhr fiel auch der Preis für Silber gegenüber dem Goldpreis: Er machte unter Karl V. noch ein Zehntel des Goldpreises aus und fiel unter Philipp auf 1: 12. Zwischen 1503 und 1660 trafen insgesamt etwa 16000 Tonnen Silber aus der Neuen Welt in Sevilla ein, hingegen nur etwa 185 Tonnen Gold, und halfen die Bestände an Silber in Europa zu verdreifachen. Um diese Mengen an Edelmetall sicher nach Spanien zu befördern, ordnete Philipp 1561 an, dass jedes Jahr zwei Flotten nach Amerika auslaufen sollten, die eine im Frühjahr, die andere im Sommer. Die Frühjahrsflotte fuhr im April aus, ihr Ziel war Veracruz, das Ziel der Sommerflotte war Porto Bello an der Landenge von Panama. Durch den Zustrom von Edelmetall entspannte sich die Lage des spanischen Staatshaushalts wieder etwas, wenigstens zeitweise. Solange Francisco de Toledo als Vizekönig von Peru an des Königs Statt dort regierte, nahmen die jährlichen Einnahmen zwischen 1568 und 1580 von 100000 auf über eine Million Dukaten pro Jahr zu. Aber höheren Einnahmen folgen in der Regel höhere Ausgaben, das ist bei Staaten nicht anders als bei Privatleuten. Mehr noch, die Phantasie ist bei den Ausgaben zumeist noch größer als mit Blick auf mögliche Einnahmen. Die öffentlichen Finanzen von Kastilien hatten 1560 Einnahmen in Höhe von etwa 3, 1 Millionen Dukaten zu verzeichnen; bis 1575 waren sie auf 5, 5 Millionen Dukaten angestiegen. 1598, im Todesjahr Philipps, erreichten die Einnahmen 9, 7 Millionen Dukaten. Doch die Ausgaben des spanischen Staates wuchsen noch sehr viel schneller, sodass im selben Zeitraum auch die staatliche Verschuldung beträchtlich zunahm, nämlich von 2, 5 auf über 40 Millionen im Jahr 1575 und auf 85 Millionen Dukaten 1598. Der jährliche Schuldendienst stieg von 1, 6 über 2, 7 auf 4, 6 Millionen Dukaten. Am 18. August 1577 traf in Sevilla eine aus 55 Schiffen bestehende Flotte aus den Westindischen Inseln ein, die mehr als zwei Millionen Dukaten in Gestalt von Goldbarren mit sich führte. Das Fünftel, das der Krone zustand, war weit mehr, als König Philipp je zuvor erhalten hatte. Einige Wochen später kam daher auch eine Übereinkunft mit seinen genuesischen Bankiers zustande, in der Philipp sich verpflichtete, die noch ausstehenden Staatsschulden zu übernehmen; dafür sollte er von ihnen eine neue Anleihe über 5 Millionen Dukaten erhalten, zahlbar in Italien, und zwar in mehreren Tranchen, 1578 und 1579. Das gab dem König neuen Spielraum in den Niederlanden: Nun konnte er dort also getrost weiterkämpfen. Mitte der 1580er Jahre war König Philipp - dank der Goldströme aus der Neuen Welt - wieder etwas besser bei Kasse. Er konnte große Begleitschiffe mit Gold und Silber von Spanien nach Italien entsenden; was sie an Schätzen mit sich trugen, war für den Krieg in Flandern bestimmt. 1584 und 1585 trafen Philipps Gelder schon im Voraus ein, und dank dieser Gelder konnten nun seine Truppen die gesamten südlichen Niederlande und Antwerpen erobern. Dies geschah, nach einjähriger Belagerung, am 17. August 1585. Sehr viel schlechter wurde die finanzielle Situation für die Krone nach den großen Kosten, die Philipp für die Aussendung der «Unbesiegbaren Armada» aufzuwenden hatte. Sie beliefen sich allein für dieses Unternehmen auf annähernd 10 Millionen Dukaten - eine damals unvorstellbar große Summe. Und der Krieg in den Niederlanden ging gleichfalls weiter, und er ging nicht gut. Außerdem zahlte König Philipp seinen katholischen Verbündeten in Frankreich Subsidiengelder, die zwischen 1585 und 1590 weitere 3 Millionen Dukaten ausmachten. Das musste alles erst einmal aufgebracht werden. Einen weiteren Aderlass verursachten ihm die Freibeuter. Sie waren keine Seeräuber im herkömmlichen Sinne, die Freibeuter handelten im Einverständnis ihrer Regierung, und da sie zum größten Teil Engländer oder Niederländer waren, mit der Einwilligung Elisabeths I. Mehr als hundert von ihnen lagen beständig auf der Lauer auf spanische oder portugiesische Schiffe, die - reich beladen mit Gold und Silber - die Häfen Südamerikas in Richtung Sevilla verließen. Von Zeit zu Zeit überfielen die Freibeuter auch Orte in der Neuen Welt - Recife 1595, Puerto Rico 1598 - und brachten zeitweise den transatlantischen Verkehr zum Erliegen. Sie erbeuteten vermutlich zwischen einer halben und einer Million Dukaten im Jahr, aber möglicherweise erbeuteten die Niederländer noch viel mehr. 1589, im Jahr nach der Armada-Tragödie, wurde die Cortes gedrängt, eine neue Steuer zu beschließen, die als «millones» bekannt wurde. Sie sollte dem Fiskus rund 8 Millionen Dukaten bringen; aber ihre Eintreibung zog sich über fast ein Jahrzehnt hin und brachte nicht das erhoffte Ergebnis. Die Ständeversammlung von Kastilien sollte dazu überredet werden, die wichtige Verbrauchssteuer «alcabala» auf Nahrungsmittel zu verdreifachen. Das Komitee empfahl der Krone außerdem, eine Bankrotterklärung abzugeben, wie es auch schon 1557 und 1560 gemacht wurde - so ganz unerfahren war der spanische Staat in derlei Dingen nicht. Das hieß allerdings nur, dass der Staat seine Schulden umwandelte: von kurzfristigen mit hohem Zinsfuß in langfristige mit niedrigerem. Allerdings war dazu auch das Einverständnis der Gläubiger einzuholen. Die Schulden waren dem spanischen Staat längst über den Kopf gewachsen; und König Philipp fehlte der Durchblick: Ich habe es niemals geschafft, diese Probleme mit Anleihen und Zinsen in meinen Kopf zu bekommen; ich habe es nie geschafft, das zu verstehen, sagte er einmal. Die Anhebung der Steuern und der von König Philipp angehäufte Schuldenberg hatten noch eine andere Seite: Der kastilische Durchschnittsbauer war am Ende von Philipps Herrschaft gezwungen, die Hälfte seines Einkommens für Steuern und grundherrschaftliche Gefalle abzuliefern. Unter Philipps Vater scheint die Steuerlast in Spanien insgesamt nicht zugenommen zu haben; unter Philipp stieg sie an, alleine zwischen 1556 und 1570 um etwa die Hälfte, und zwischen 1570 und 1600 noch einmal um rund 90 Prozent. Die Kaufkraft der Arbeitsentgelte - also der Reallohn -fiel vom zweiten zum letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts mindestens um ein Drittel. Das heißt, dass der Enkelsohn eines Mannes für ein bestimmtes Produkt wenigstens vier Stunden arbeiten musste, für das sein Großvater nur drei Stunden gearbeitet hatte. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts ging es den spanischen Bauern ausgesprochen schlecht. «Wenn man Bauer sagt, so denkt man an grobes Essen, Knoblauch- und Gerstenbrot, an die ungegerbten Lederschuhe und zerrissenen Kittel, die Narrenkapuze und groben Kragen, die rupfenen Hemden und plumpen Tragbeutel, die halbzerfallenen Lehmhütten, den Fleck schlechtbebauter Erde und die paar mageren Rinder und an die Last der Hypotheken, Zinsen, Steuern und Abgaben», heißt es in einer Beschreibung von 1629. Angesichts des Stroms von Gold und Silber aus der Neuen Welt wurden sich die Spanier zu fein, selbst etwas anzufassen, man holte sich für die eigentliche Arbeit Fremde. Das Problem zeigt sich überall in der spanischen Wirtschaft. Das Land geriet ins Hintertreffen; reich gewordene Spanier legten ihr Kapital zum Beispiel nicht in der Eisenverarbeitung oder dem Textilgewerbe oder dem Schiffbau an, sondern lieber in landwirtschaftlichen Unternehmungen oder in aufwendigem, sichtbarem Konsum. Ende des 16. Jahrhunderts musste Spanien Weizen importieren, um seine Bevölkerung ernähren zu können- dies könnte freilich auch mit der Verschlechterung des Klimas zu tun haben. Gerade die letzten Ernten unter König Philipp waren schlecht, die von 1597 war sehr wenig ertragreich, und der folgende Winter war so kalt, dass Olivenbäume und Weinstöcke erfroren und selbst das ausgesäte Getreide Schaden nahm. Die Nahrungsmittel wurden knapper in diesen Jahren, aber Gold und Silber waren reichlich vorhanden - die Folge waren gewaltige Preissteigerungen. Einzelne Spanier, wie Martin de Azilpueta, verstanden diesen Mechanismus bereits: Wenn man einer gewissen Menge an Waren eine immer größere Menge an Geld gegenüberstellt, steigt das Preisniveau. Es kam zu Verzerrungen im gesamten Wirtschaftsgefüge, zu Inflation und Arbeitslosigkeit. Einzelne Regionen - vor allem die, die das Gold zuerst erreichte, also Andalusien mit seiner großen, schnell wachsenden Stadt Sevilla - litten unter dieser Entwicklung ganz besonders. Zudem verbreitete sich die Einstellung immer mehr, dass man eigentlich nicht mit seinen Händen arbeiten müsse. Philipps älterer Zeitgenosse, der Humanist Philipp Melanchthon, hat davon schon einiges verstanden; er schrieb: «Wer Schulen gründet und die Universitäten pflegt, der macht sich um sein Volk und die ganze Nachwelt besser verdient, als wenn er neue Silber- und Goldadern fände.» Spanien stand in den 1590er Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, und sie war in erster Linie das Ergebnis von Philipps Politik. Eines freilich haben Gold und Silber aus der Neuen Welt wohl doch mitbewirkt: Das «Goldene Zeitalter», das Mitte des 16. Jahrhunderts in Spanien einsetzte und rund hundert Jahre andauerte - eine Glanzzeit der spanischen Malerei und Literatur -, hat ganz sicherlich mit den Schätzen der Neuen Welt zu tun. Reichtum erlaubt Muße, und die Muße ist eine wesentliche Voraussetzung höherer Kultur." [Vashold, Manfred <1943 - >: Philipp II. -- Reinbeck : Rowohlt, ©2001. -- (Rowohlts Monographien ; 50401). -- ISBN 3499504014. -- S. 122 - 129. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}] |
Eine packende Darstellung der Zustände im Quecksilberbergbau in Almadén im 20. Jahrhundert ist:
Kisch, Egon Erwin <1885 - 1948>: Menschen im Quecksilber, Quecksilber im Menschen. -- In: Eintritt verboten. -- 1934. -- Wieder abgedruckt in: Ders.: Gesammelte Werke in Einzelausgaben. -- Berlin <Ost> [u.a.] : Aufbau. -- Bd. 6. -- 1973. -- S. 139 - 152
1557
Spanien erklärt den Staatsbankrott. Es sieht sich nicht mehr fähig, die fälligen Zinsen die Kredite zu bezahlen. Dies bedeutet eine Umschuldung: kurzfristige Kredite mit hohem Zins werden von den Gläubigern in langfristige mit niedrigem Zins umgewandelt. Hauptverlierer sind die Augsburger Fugger, bei denen Spanien mit vier Millionen Gulden verschuldet ist.
1558/59
Die Grippeepidemie, die 1556 in Europa ausbrach, sucht in Hispanoamerika Spanier und Indios heim.
Zwischen 1558 und 1603
Richtlinien zur Ausstellung von Kaperbriefen unter Elizabeth I. (1533 - 1603, Königin 1558 - 1603) von England:
"Artikel, festgesetzt von den Lords und anderen Mitgliedern des Privy Council [Geheimen Rates] Ihrer Majestät, für Kaufleute, Reeder und andere, deren Güter in Spanien beschlagnahmt worden sind und die vom Lord Admiral auf Grund der ihm zu diesem Zweck erteilten Königlichen Vollmacht eine Prisenerlaubnis haben:
- Alle Kaufleute und sonstigen Personen, die Kaperbriefe zur Wegnahme und Aneignung von Gütern spanischer Untertanen haben wollen, müssen zuerst vor dem Lord Admiral oder seinem Stellvertreter, dem Admiralitätsrichter, den Nachweis führen, dass ihnen Güter auf die erwähnte Weise beschlagnahmt worden sind, und über alle Verluste und Schäden, die sie auf Grund irgendeiner Beschlagnahme oder gerichtlichen Einbehaltung ihrer Schiffe, Güter und Waren in Spanien, Portugal oder sonstwo in den Reichen des Königs von Spanien erlitten zu haben behaupten.
- Die genannten Kaufleute und sonstigen Personen sollen gesetzlich berechtigt sein, auf See alle Schiffe und Güter der Untertanen des Königs von Spanien mit Waffengewalt anzugreifen, wegzunehmen und zu behalten, ganz so und im gleichen Umfang, als ob es zur Zeit offenen Kriegszustandes zwischen Ihrer Majestät und dem König von Spanien geschähe.
- Die genannten Kaufleute und sonstigen Personen müssen sich dem Lord Admiral oder seinem Vertreter, dem Admiralitätsrichter, gegenüber verpflichten, dass sie und ihre Leute die erbeuteten Schiffe und Güter in einen ihnen bequem gelegenen Hafen des Königreiches England einbringen, und dürfen ihre Ladung nicht löschen, bevor nicht der Vizeadmiral des betreffenden Hafens oder sein Beauftragter oder sonstige Hafenbeamte benachrichtigt sind, so dass unverzüglich ein genaues Verzeichnis der erbeuteten Güter aufgenommen werden kann . ..
- Erst nach Aufnahme dieses Verzeichnisses . . . dürfen die genannten Kaufleute und sonstigen Personen die Schiffe, Güter und Waren rechtmäßig in Besitz nehmen, sie verkaufen und darüber verfügen . . .
- Jeder Untertan Ihrer Majestät oder jeder beliebige andere, der in eigener Person bei einem solchen Unternehmen Dienste leistet oder auf andere Weise nach Maßgabe dieser Artikel als Führer oder Unternehmer daran beteiligt ist, soll in keiner Weise eines Vergehens gegen irgendeines der Gesetze Ihrer Majestät beschuldigt oder angeklagt werden, sondern vielmehr auf Grund der ihm von dem Lord Admiral erteilten Ermächtigung als ein unter Ihrer Majestät gesetzlichem Schutz Stehender von jeder Beeinträchtigung oder Behelligung, die ihm aus diesem Anlaß zugefügt werden könnte, befreit sein und bleiben . . .
- ...
- ...
- Die auf vorgenannte Weise erbeuteten Güter, Schiffe und Waren sollen nach Aufnahme des oben erwähnten Verzeichnisses in drei gleiche Anteile geteilt werden, von denen einer den Unternehmern und Eigentümern der an der Kaperung beteiligten Schiffe, der zweite den Lieferanten, der dritte dem Befehlshaber, dem Kapitän, den Matrosen und den Soldaten des beteiligten Schiffes bzw. der Schiffe gehören soll."
[F. Dickmann]
[Übersetzung: Renaissance, Glaubenskämpfe, Absolutismus / bearbeitet von Fritz Dickmann -- 3. Auflage. -- München : Bayerischer Schulbuch-Verlag, ©1982. -- (Geschichte in Quellen). -- ISBN 3762760845. -- S. 388f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1559-04-03
Mündliche Vereinbarung von Cateau Combrésis:
"Bei den Friedensverhandlungen von Cateau-Cambrésis wurde eine Bereinigung aller Streitfragen zwischen Frankreich und Spanien erstrebt, aber nur für die europäischen Fragen erreicht. Über die kolonialen Fragen kam man zu keiner Übereinstimmung. Sie wurden daher im Vertragstext nicht erwähnt. Man traf jedoch eine mündliche Vereinbarung, deren Wortlaut wir nicht kennen und von der mir nur aus späteren Berichten missen. Auf ihr beruhte bis ins 17. Jahrhundert das Verhältnis der beiden Großmächte in Übersee. Die hier vereinbarte Linie (später allgemein als „Amity-line" bezeichnet) grenzte künftig den Geltungsbereich europäischer Friedensverträge nach außen ab gegen ein Gebiet, in dem auch in Friedenszeiten der Kampf in Form von Kaperei und Piraterie weiterging. Bericht der spanischen Bevollmächtigten an Philipp II., 13. März 1559.
«...Außerdem haben wir lange verhandelt, um die Franzosen von der Indienschifffahrt auszuschließen, haben sie aber nicht dahin bringen können, dass sie zustimmten, ihre Untertanen von dieser Schifffahrt auszuschließen oder ihnen bestimmte Einschränkungen wenigstens in der Art aufzuerlegen, dass es ihnen verboten würde, solche Gegenden aufzusuchen, die zwar [schon] entdeckt, aber [noch] nicht dem Königreich Kastilien oder dem Königreich Portugal einverleibt sind. Sie würden einwilligen, die Gebiete zu meiden, die von Eurer Majestät oder von dem König von Portugal in Besitz genommen sind, oder auch einverstanden sein, dass man es so hielte wie bei den früheren Verträgen, d. h. die Sache überhaupt nicht zu erwähnen und die französischen Seefahrer, falls sie etwas Verbotenes tun1), zu bestrafen. Sie führten das übliche Argument an, dass das Meer allen gehöre (que la mer soit commune), wogegen wir uns zur Begründung auf die Bulle des Papstes Alexander [VI.] und Julius II.,2) auf den öffentlichen Aufruf an die christlichen Fürsten, durch den ermittelt werden sollte, wer von ihnen zu den Unkosten der Entdeckung beitragen wolle3), und auf die geschehene Abgrenzung dieser Entdeckungen beriefen, und dass es nicht recht sei, dass jetzt andere kämen, um den Ertrag fremder Mühen und Kosten bei der Entdeckung Indiens zu genießen. Wir wünschten unsererseits ihnen zu erklären, dass wir sie, wenn sie dort [in Übersee] auftauchen sollten, in den Grund bohren würden, und zwar auch in Friedenszeiten, ohne dass nach unserer Auffassung daraus der Vorwurf eines Verstoßes gegen die Vertragsbestimmungen über freien Verkehr und Aufenthaltsrecht der beiderseitigen Untertanen im Staatsgebiet des anderen Teiles hergeleitet werden könne...»" [F. Gickmann]
[Übersetzung: Renaissance, Glaubenskämpfe, Absolutismus / bearbeitet von Fritz Dickmann -- 3. Auflage. -- München : Bayerischer Schulbuch-Verlag, ©1982. -- (Geschichte in Quellen). -- ISBN 3762760845. -- S. 383f.. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1560 - 1571
|
| "Er war mit seinem jüngeren Bruder Tupac Amaru in Vilcabamba zurückgeblieben. Er übernahm die Inka-Würde über den kleinen unabhängigen Staat,
ließ aber die Verbindung mit den spanischen Kolonialbehörden nie ganz abreißen. Seine wiederholten Beteuerungen, er werde sich den neuen Herrn unterwerfen, sobald seine (gerechten Ansprüche) anerkannt seien, wurden vom Vize-König nicht ernst genommen. Dies geht aus einem Brief von Francisco Toledo an Philip II hervor. Im Jahre 1568
ließ sich Titu Cusi Yupanqui sogar taufen, ohne Vilcabamba indessen zu verlassen. Dies hinderte ihn nicht, die überlieferte Sonnenreligion weiterhin (wohl im Geheimen) zu fördern. In einem Tempel der kleinen Hauptstadt befand sich immer noch das
größte Heiligtum des Sonnenkultes: eine goldene Scheibe des Sonnengottes. Titu Cusi Yupanqui verfasste einen langen Brief, der für den spanischen König bestimmt war und der vom Augustinermönch Marcos Garcia aus dem Quechua ins Spanische übersetzt wurde. Im Beisein von mehreren Zeugen — darunter der Augustinermönch und der vizekönigliche Notar — wurde das Schriftstück am 6. Februar 1570 dem ehemaligen Gouverneur Licenciado Garcia de Castro ausgehändigt. Ein Jahr später starb der Inka-Herrscher plötzlich, wohl infolge einer Pestkrankheit. Seine Anhänger vermuteten (sicher zu Unrecht) einen Giftmord, und der Sekretär des Inka, Martin de Pando, sowie der Missionar Diego Ortiz, wurden des Mordes verdächtigt und erschlagen. Obgleich der neue Inka, Tupac Amaru, diesen Akt verurteilte, wurde der Tod der beiden Männer ihm von den spanischen Behörden angelastet."
[Bollinger, Armin: Indios, Indios, Indios ... : gesammelte Schriften zum Wirken der Indios, zur Verfolgung der Indianer, zum Problem der indianischen Identität. -- Chur [u.a.] : Rüegger, 1992. -- (Schriftenreihe des Instituts für Lateinamerikaforschung und Entwicklungszusammenarbeit an der Hochschule St. Gallen ; Bd. 4). -- ISBN 3-7253-0422-X. -- S. 146f.] |
1560 - 1564
|
1560
Santo Tomás Navrrete, Domingo de <1499, Sevilla - 1570, La Plata>: Grammatica, o Arte de la lengua general de los indios de los reynos del Perú. -- Erste Quechua-Grammatik
1560
Spanien erklärt schon wieder den Staatsbankrott. Es sieht sich nicht mehr fähig, die fälligen Zinsen die Kredite zu bezahlen. Dies bedeutet eine Umschuldung: kurzfristige Kredite mit hohem Zins werden von den Gläubigern in langfristige mit niedrigem Zins umgewandelt. Hauptverlierer sind die Augsburger Fugger, bei denen Spanien mit vier Millionen Gulden verschuldet ist.
1560-02-26
Ñuflo de Chávez (Santa Cruz de la Sierra, Spanien, 1518 - 1568, Chiquitos?) gründet Santa Cruz de la Sierra.
|
|
|
[Bildquelle: Los ciemientos de Santa Cruz. -- La Paz : Sociedad Boliviana de Cemento, 1997. -- S. 65, 73]
1563
Entdeckung des Quecksilbervorkommens in Huancavélica. Bisher wurde Quecksilber nur in Almadén (Spanien) und Idria (Slowenien) gefördert. Quecksilber wird in Potosí für die Amalgamierung zur Silbergewinnung benötigt.
Abb.: Lage von Huancavélica
"Zu unterscheiden bleibt die Amalgamation der Golderze vom »amerikanischen Silberamalgamieren, das seit der Mitte des 16. Jahrhunderts im Gebiet der großen «Silberminen von Pachuca nördlich der Hauptstadt Mexikos entwickelt wurde und nach der um 1570 erfolgten Entdeckung der Quecksilbervorkommen im peruanischen Huancavelica als drittem Großrevier neben Almaden und Idria in zunehmend größerem Umfang zum Einsatz kam. In der Neuen Welt soll das Amalgamationsverfahren von einem namentlich unbekannt gebliebenen deutschen Bergmann eingeführt worden sein. Die europäischen Quecksilberbergwerke gewannen bis zur Entdeckung des peruanischen Reviers Weltmarktdimensionen, weil nur mit ihren Lieferungen der Bedarf in Mexiko gedeckt werden konnte. Die Erschließung der Vorkommen in Peru begrenzte jedoch bald den aufwendigen und kostenträchtigen Import aus der Alten Welt. Im Rahmen des auf dem südamerikanischen Kontinent entwickelten »Patio-Verfahrens« pulverisierte man das Silbererz und vermischte es mit Kupfervitriol, Kochsalz und Wasser zu einem Brei, dem Quecksilber zugesetzt wurde. Ein anschließendes mehrfaches Stampfen dieser Masse und deren mindestens 8 Wochen lang dauernde Lagerung im Freien unter Sonnenbestrahlung führten zur Bildung von Silberamalgam. Durch Erhitzen dieser Verbindung in einem Ofen ließ sich das Quecksilber vom reinen Silber trennen. Für diese Form der Amalgamation waren erhebliche Mengen von Quecksilber erforderlich: So benötigte man für die Erzeugung von 10 Kilogramm Silber immerhin 14 bis 17 Kilogramm Quecksilber. Als Einschränkung derartiger Effizienzberechnungen sei jedoch der Hinweis auf die Wiederverwendbarkeit des Quecksilbers erlaubt. In der Neuen Welt ließen sich die von den Spaniern 1542 in Mexiko und 1545 in Peru gefundenen Silbererzvorkommen mit Hilfe des chemisch kalten Amalgamationsverfahrens voll ausbeuten. Ein Ausschmelzen der Erze wäre in den sehr hoch gelegenen und daher waldarmen Bergbauregionen überaus schwierig gewesen, da die dafür benötigte Holzkohle nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stand. Mittels des Amalgamationsverfahrens und durch die um 1574 in den Silber- und Quecksilbergruben in Peru eingeführte Zwangsarbeit der Indios stieg gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Silberproduktion in großem Umfang an. Die Einfuhr dieser Ausbeute nach Europa hatte weitreichende Konsequenzen für die Wirtschaft und den Geldverkehr der einzelnen Länder. Nach der Einführung des Amalgamationsverfahrens in Mexiko wuchs auch die Bedeutung der Quecksilberminen von Almaden für die spanische Wirtschaft. König Philipp II. (1527-1598) verpachtete in Ermangelung eigenen Investitionskapitals das Bergwerk im Jahr 1562 wieder an das Haus Fugger und schloss damit den ersten von insgesamt acht aufeinander folgenden Verträgen über jeweils zehn Jahre. Allerdings hatten sich die Geschäftspartner aus Augsburg wegen des von der spanischen Krone verlangten Handelsmonopols für Quecksilber mit der Bedingung abzufinden, die gesamte Produktion von Almaden an den König zu verkaufen. Gleichwohl gelangen den Fuggern über die jahrzehntelange Ausbeute erhebliche Gewinne, bis 1645 König Philipp IV. (1605-1665) die Bergwerke wieder unter eigene Verwaltung stellte. Aufgrund des Engagements der Fugger in Almaden kamen viele in Deutschland angeworbene Bergleute in dieses spanische Revier. Sie brachten Erfahrungen in fortgeschrittenen Abbau- und Verhüttungsmethoden mit und sorgten für deren Verwirklichung. In Almaden wurden allerdings auch Sträflinge und von den Fuggern gezielt für die Arbeit in den Minen gekaufte Sklaven eingesetzt. Die Zwangsarbeiter hatten vor allem die gefährlichen und anstrengenden Arbeiten wie das Heben des Grubenwassers auszuführen. Zwischen 1563 und 1572 gelang es dem Handelshaus Fugger, die Quecksilberausbeute von fast 28 Tonnen auf nahezu 97 Tonnen jährlich zu steigern. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wuchs die Jahresproduktion sogar um mehr als das Doppelte. Das Quecksilber wurde über Sevilla nach Amerika verschifft. Dort benötigte man trotz der erschlossenen Bergwerke von Huancavelica das europäische Quecksilber dringend, um die reichen, ebenfalls in Peru gelegenen Silbervorkommen von Potosi mittels der Amalgamation zu erschließen. Die Quecksilberausbeute in Huancavelica ließ sich nicht auf die für die gesamte peruanische Silbererzeugung benötigte Menge steigern, weil es an Arbeitskräften fehlte und die örtlichen Bedingungen in fast 4.000 Meter Höhe mancherlei Schwierigkeiten verursachten."
[Ludwig, Karl-Heinz <1931 - >; Schmidtchen, Volker <1945 - >: Metalle und Macht : 1000 bis 1600. -- Berlin : Propyläen, 1992. -- (Propyläen Technikgeschichte ; Bd. 2). -- ISBN 3-549-05227-8. -- S.229 - 231]
1564 - 1569
|
1564 - 1566
Abb.: Pedro Menéndez de AvilésAuf Empfehlung von Pedro Menéndez de Avilés (1519 - 1574), der seit 1555 die Silberflotte mehrfach die Silberflotte sicher heimgebracht hatte, erlässt der Consejo de las Indias mehrere Anordnungen zur Sicherheit der Silberflotten:
Festungen an allen Stützpunkten und Anlaufhäfen der Flotte
intensive Marinepatrouillen in der Karibik und vor der atlantischen Küste
Flottensystem (Konvoisystem) (s. unten)
1564
Für den Verkehr nach Hispano-Amerika wird das Flottensystem endgültig eingeführt.
"Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatte das 'Flottensystem' noch Geltung, welches im Jahre 1564 endgültig eingeführt worden war. Es legte fest, dass jährlich zwei Flotten, die eine im April und die andere im August, von Spanien aus nach Amerika fahren sollten. Beide Flotten nahmen den Weg zu den Kleinen Antillen. Die Frühjahrsflotte fuhr dann über Puerto Rico, la Española und Kuba nach Veracruz. Die Sommerflotte lief zuerst Cartagena de Indias an und erreichte dann Puerto Bello. Beide Flotten trafen sich im folgenden März in Havanna und traten dann gemeinsam die Rückreise an. Von diesem System blieben die La-Plata-Region und die südamerikanische Pazifikküste ausgeschlossen. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts durften daher alle zwei Jahre zwei Schiffe von 100 Tonnen ('navios de registro' oder 'navios de permiso') von Spanien aus Buenos Aires anlaufen. Im allgemeinen erhielten die Gegenden des Rio de la Plata, Peru und Chile ihre Waren über die Landenge von Panama und den Seeweg bis zum Hafen El Callao, wo die Kaufleute von Lima sie in Empfang nahmen und weiterverteilten.
Eine Sonderregelung galt auch für die Einwohner der Kanarischen Inseln, welche die Erlaubnis zum Direkthandel mit Landesprodukten nach Amerika hatten.
Da die Schifffahrt auf dem Guadalquivir mit wachsenden Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, erlaubte die Krone im Jahre 1519 das Befrachten und Entladen der Schiffe im Hafen von Cádiz. Die Schiffskontrollen führten aber Beauftragte der 'Casa de la Contratación' von Sevilla durch. Vorübergehend hatten auch einige andere Häfen, zum Beispiel La Coruña, Bilbao, San Sebastian, Cartagena, Malaga und andere, die Erlaubnis zum Direkthandel mit Amerika gehabt. Dieses Privileg war ihnen entzogen worden, weil die Schiffe dieser Städte auf der Rückreise häufig ausländische Häfen anliefen, statt sich zur Kontrolle in Sevilla bzw. Cádiz einzufinden. ...
Es zeigte sich mehr und mehr, dass das Flottensystem Nachteile hatte. Es fielen besonders die hohen Frachtkosten ins Gewicht, die sehr stark durch die hohen Gebühren beeinflusst waren, welche die Kaufleute für die Geleitschiffe zu bezahlen hatten und die unter der Bezeichnung 'averia' nach dem wert der Warensendungen ermittelt wurden. Hinzu kam, dass die Flotten kaum zum festgesetzten Termin abfuhren. Als Folge hiervon litten die Kolonialgebiete häufig entweder unter einem Über- oder Unterangebot von Waren. Es wurden daher in zunehmendem Maße Sondergenehmigungen für außerhalb des Flottensystems fahrende Schiffe ('Navios de permiso ' oder 'registro') erteilt, die hauptsächlich Buenos Aires und El Callao anliefen."
[Driesch, Wilhelm von den: Die ausländischen Kaufleute während des 18. [achtzehnten] Jahrhunderts in Spanien und ihre Beteiligung am Kolonialhandel. -- Köln [u.a.] : Böhlau, 1972. -- (Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ; 3). -- Zugleich: Köln, Univ., Wirtschafts- u. Sozialwiss. Fak., Diss. 1968. -- ISBN 3-412-92572-1. -- S. 442 - 444]
1564
Vasquius [Vásquez], Ferdinandus: Controversiae illustres. -- Venezia, 1564
"Schon Vitoria hatte ein Naturrecht aller Völker auf freien Weltverkehr (commercium) gelehrt. Ihm folgten andere spanische Völkerrechtslehrer. Systematisch entwickelte du Lehrt von der Freiheit der Meere als erster der spanische Theologe: «Es ist tatsächlich eine verdächtige Theorie, wenn gesagt wird, es sei das gute Recht der Genuesen oder sogar der Venezianer, andere am Befahren des Tyrrhenischen oder Adriatischen Meeres zu hindern, wie wenn sie die Wasserfläche durch Verjährung erworben hätten. Das ist nicht nur gegen das römische Recht, sondern auch gegen das natürliche Recht oder primäre Völkerrecht, das insoweit nicht geändert werden kann. Dass die genannte Theorie gegen das natürliche Recht verstößt, ergibt sich daraus, dass nach diesem Recht nicht nur die Meere, sondern auch alle übrigen unbeweglichen Sachen im Anfang von Rechts wegen gemeinsam waren. Wenn später von diesem Recht teilweise abgewichen worden ist, nämlich bezüglich des Eigentums an Grund und Boden, das nach natürlichem Recht gemeinsam war, dann aber geteilt und unterschieden, also aus jener Gemeinschaft herausgenommen wurde, so liegt dieser Fall bei der Herrschaft über das Meer nicht vor : sie war von Anbeginn der Welt an immer und ist bis auf den heutigen Tag unverändert allen gemeinsam. Und wenn ich auch zahlreiche Stimmen aus Portugal in dem Sinne gehört habe, dass ihr König die Indienfahrt und den weiten Ozean derart durch Verjährung erworben habe, dass es den übrigen Nationen nicht erlaubt sei, jene Meeresflächen zu durchqueren, und wenn bei uns in Spanien die öffentliche Meinung auf ungefähr dem gleichen Standpunkt steht, wonach also das unermessliche große Meer nach Westindien, das unsere mächtigen spanischen Könige unterworfen haben, von anderen Sterblichen als Spaniern nicht befahren werden darf, wie wenn dieses Recht von ihnen ersessen worden wäre, so ist das alles gleichwohl genau so unvernünftig wie die phantastische Theorie, die gewöhnlich ungefähr das gleiche von den Genuesen und Venezianern behauptet. Das Sinnlose solcher Behauptungen geht schon deutlich daraus hervor, dass diese einzelnen Nationen nicht gegen sich selbst Rechte erwerben können, nicht die Republik Venedig gegen sich selbst, nicht die Republik Genua gegen sich selbst, nicht das Königreich Spanien gegen sich selbst, nicht das Königreich Portugal gegen sich selbst. Es muss nämlich bei der praescriptio [Ersitzung] einen aktiven und einen passiven Teil geben, die nicht in der gleichen Person vereinigt sein können. Gegen die anderen Nationen aber ist eine praescriptio erst recht nicht möglich, denn das Recht der Verjährung und Ersitzung ist, wie wir früher gezeigt haben, ein rein privatrechtliches Institut. Dieses Recht wirkt nicht auf die gegenseitigen Angelegenheiten der souveränen Fürsten oder Völker. Das rein interne Recht eines Landes kommt für die fremden Völker, Staaten oder auch Einzelpersonen so wenig in Betracht, wie wenn es ein solches Recht überhaupt nicht gäbe oder je gegeben hätte, und es ist auf das allgemeine primäre oder sekundäre Natur- und Völkerrecht) zurückzugreifen. Nach diesem steht aber fest, dass eine solche Ersitzung und Aneignung am Meere niemals zulässig gewesen ist. Noch heute ist der Gebrauch der Gewässer gemeinsam, nicht anders als bei Beginn der Welt. An den Gewässern und Meeren gibt es für die Menschheit kein anderes Recht, und kann es kein anderes geben als das auf den allgemeinen Gebrauch. Außerdem gibt es ein Gebot des natürlichen und göttlichen Rechts: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem ändern zu; die Seefahrt kann aber niemand schädlich sein, es sei denn dem Seefahrer selbst, und deshalb ist es billig, dass sie von niemand behindert werden kann oder darf; niemand darf in einer Sache, die ihrer Natur nach frei und ihm selbst in keiner Weise schädlich ist, die Freiheit der Seefahrer behindern und verletzen entgegen dem genannten Gebot und entgegen der Regel, wonach alles als erlaubt zu gelten hat, was nicht ausdrücklich verboten ist. Ja es wäre nicht nur gegen das natürliche Recht, diese Schifffahrt unter dem Vorwand der Verjährung stören zu wollen — denn dem Störer nützt es in keiner Weise und schadet dem Gestörten —, sondern wir sind im Gegenteil auch verpflichtet, den Mitmenschen zu nützen, wo immer wir können, wenn es ohne Schaden für uns geschehen kann...»" [E. Reibstein]
[Übersetzung: Renaissance, Glaubenskämpfe, Absolutismus / bearbeitet von Fritz Dickmann -- 3. Auflage. -- München : Bayerischer Schulbuch-Verlag, ©1982. -- (Geschichte in Quellen). -- ISBN 3762760845. -- S. 385f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1564-01-12
Brief eines Minenbesitzers in Potosí an seine Schwester in Andalusien:
"An meine Frau Schwester Catalina Garcia, die die Frau des verstorbenen Juan Márques Canamero war, in der Stadt Ronda in Andalusien in den Königreichen von Spanien. Potosí, den 12. Januar 1564
Frau Schwester!
Vor sechs Monaten erhielt ich zwei [Briefe] von Euer Gnaden durch einen Boten, den mir Gonçalo Franco schickte, der in der Stadt La Paz wohnt, das sind 80 Meilen von Potosí, wo ich wohne. Gott unser Herr weiß, welche Freude ich daran hatte zu erfahren, dass Ihr und die anderen [Mitglieder unserer Familie] bei guter Gesundheit seid, obwohl es mich sehr geschmerzt hat, von dem Tod einiger der Unseren zu lesen und auch über die Mühen und die Einsamkeit, die Ihr dort [in Spanien] zu erdulden habt. Aber das sind Angelegenheiten Gottes, wir schulden Ihm Dank und haben uns Seinem Willen zu fügen.
Über meine Gesundheit, Frau Schwester, kann ich Ihnen mitteilen, dass es mir, Gott sei Dank, gut geht, obwohl ich alt und müde geworden bin. Und ich bin so alt, dass man mich dort [in Spanien] nicht mehr erkennen würde, und ich bin krank, weil in diesem Land so schwierige Verhältnisse herrschen, weil die Mühen so groß sind und weil einem wenig geschenkt wird. Alles, was ich hatte, habe ich verbraucht in jenem Berg, beim Vorantreiben der Minen, in der täglichen Hoffnung, dass große Gewinne dabei herauskommen würden. Ich hoffe, dass es nun schnell passieren wird, denn ich bin kurz davor. Deshalb habe ich dieses Gebiet bis jetzt noch nicht verlassen.
Ich will die Hazienda verkaufen, um [dann] fortgehen zu können, aber ich kenne niemanden, der mir [auch] nur ein Achtel von dem [dafür] gäbe, was ich hineingesteckt habe. Und wenn ich sie dennoch verkaufe, so deshalb, um Euch zu unterstützen und die anderen, meine Brüder, und um unseren Toten etwas Gutes zu tun. Betet zu Gott, dass Er mir immer die Gesundheit dazu gebe und die Gnade, um in heiligem Dienst an Ihm und an allen zu enden.
Frau Schwester, ich sende Euch durch einen Kaufmann mit Namen Alonso Castellón, der hier ein geehrter und sehr reicher Mann ist, verheiratet in Sevilla, darum geht er jetzt von hier fort, 600 Pfund Silber, geprüft und markiert; jedes hat ein Gewicht von 450 Maravedís, das sind in kastilischen Dukaten 720. Das Silber reist in Form von zwei Silberbarren. Der eine hat die Nummer 48 und einen Feingehalt von 810 Maravedís, das Silber wiegt 601 Mark und sieben Unzen und ist 248 Pesos und 7 Tominen wert. Der andere Barren hat die Nummer 191, einen Feingehalt von 1810 Maravedís, wiegt 59¼ Mark und ist 244 Pesos wert. Diese beiden Barren haben auf der Rückseite als Markierung einige Buchstaben, die mit einem Stichel gemacht worden sind, sie bedeuten López Chito. Sie sind [zusammen also] 492 Pesos und 7 Tominen wert. Um 600 Pesos voll zu machen, fehlen [noch] 107 Pesos und ein Tomin, sie werden in einem anderen Barren des genannten Alonso Castellón folgen. Auf diese Weise schicke ich, wie ich gesagt habe, 600 Pfund, und außerdem gab ich ihm Geld für die Ausgaben, [die nötig sind, ] um das Silber nach Sevilla zu bringen.
Er [Alonso Castellón] hat eine Aufstellung von mir bei sich, die festlegt, wie das Geld verteilt werden soll, nämlich folgendermaßen:
- Es sollen 50 Messen für die Seelen unserer Eltern bestellt werden,
- 25 Messen für die Seele unseres Bruders Markus,
- weitere 25 für mich,
das sind im ganzen hundert Messen, das kostet 9 Dukaten und einen Real.
Die anderen 710 Dukaten und zehn Reales sollen folgendermaßen verteilt werden:
- Ihr sollt 215 Dukaten und zwei Reales bekommen,
- mein Bruder Alonso López Chito 175 Dukaten und zwei Reales,
- meine Schwester, Ana Gutiérrez, die Frau von Bartolomé Domínguez, weitere 175 Dukaten und zwei Reales,
- und meine Schwester Juana, die Frau von Alonso Guerra, weitere 175 Dukaten und zwei Reales.
Auf diese Weise bekommen alle gleich viel und Ihr 50 Dukaten mehr. Und wenn einer von ihnen [in der Zwischenzeit] verstorben sein sollte, soll man seinen Anteil unter seinen Kindern verteilen und für seine Seele etwas Gutes tun. Auf diese Weise sollen die 720 Dukaten, die dieses Silber wert ist, verteilt werden.
Zu dem, was Sie, Frau Schwester, erwägen, dass Sie kommen wollen, um mich zu sehen, und dass Sie es nur unterlassen haben, weil Sie kein Geld haben, dazu sage ich, dass Sie es auf keinen Fall tun sollen, weil der Weg sehr weit ist und unsagbare Mühe bedeutet. Wenn ihn Männer kaum ertragen können und unterwegs [nicht selten] sterben, um wieviel mehr [Leiden bedeutet er für] eine Frau. Aber um etwas anderes will ich Euch bitten, weil Gott mir hier eine Hazienda gegeben hat, ich aber sehr alt bin und jeden Tag erwarte, dass Gott mich zu Sich holt: Zwei meiner Neffen sollen hierher kommen, damit sie [als meine Söhne] haben und erben, was Gott mir in diesem Land gegeben hat. Ich habe viele ertragreiche Silberminen und zwei Mestizensöhne, die Gott mir geschenkt hat. Ich möchte sie [die erbetenen Neffen] als meine Testamentsvollstrecker und Erben, zusammen mit meinen Söhnen und als deren Beschützer, zurücklassen. Sie können von hier jene dort [in Spanien] jedes Jahr aus dem reichlichen Ertrag, den die Minen abwerfen, unterstützen. Ich bitte Euch dringend, dass Ihr diese Bitte erfüllt, damit nicht das verlorengeht, was ich habe, und damit sie es genießen können.
Ich schreibe auch an alle [anderen] Briefe, die zusammen mit diesem abgehen. Ihr mögt sie weiterschicken und mir von allem ausführlich berichten, denn ich ersehne Nachrichten von Euch sehr. Diesem Brief liegt ein Dokument bei, das mir Herr Alonso Castellón aufgesetzt hat, über das Silber, das er bringt. Es wird unabdingbar sein, dass jeder für sich eine Vollmacht und eine Empfangsbestätigung mit sich bringt, damit der Betreffende sie dann ihm [Alonso Castellón] aushändigen kann. Dieser Alonso Castellón hat sein Haus in Sevilla an dem Goles-Tor. Er ist dort [in Sevilla] eine bekannte Persönlichkeit, sie sollen sich mit allem an ihn wenden, und sie können ihm auch Briefe geben, damit er sie dorthin schickt, wo ich bin.
Es ist nichts anderes nötig, als dass ich sie bitte, dass sie immer der Seelen unserer Eltern gedenken mögen, für sie Gutes tun, und ich versichere, dass ich gefühlt habe, was die Vernunft forderte, zu fühlen, als ich mit diesem Brief die Nachricht von ihrem Tod erhielt. Unser Herr gebe Euch allen jene Gesundheit und Ruhe, die ich Euch wünsche und lasse Euch in Seinem heiligen Dienst enden und lasse uns uns in der Herrlichkeit wiedersehen.
Aus der kaiserlichen Stadt Potosí, in der Provinz Charcas, am 12. Januar 1564.
Es küsst Eure Hände
Cristoval López Chito."
[Übersetzung: Wirtschaft und Handel der Kolonialreiche / hrsgg. von Piet C. Emmer .... -- München : Beck, ©1988. -- (Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion ; Bd. 4). -- ISBN 3406306616. -- S. 444. - 446. -- Dort Quellenangabe. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1566-07-31
Der Dominikaner Bartolomé de las Casas (1474 - 1566) stirbt in Madrid. Mit ihm verlieren die Indios den engagiertesten Vertreter ihrer Interessen bei der kastilischen Krone.
1569--01-25
Felipe II (spanischer König 1556 - 1598) sanktioniert mit Real Cédula die Errichtung des Inquisitionsgerichts Santo Oficio Hispanoamericano. Bisher unterstand die Inquisition in Peru -- seit 1538 gab es in Lima einen Inquisitor -- der spanischen Inquisiton, Das Gericht besteht aus 12 Mitgliedern und hat in den Provinzen Kommissare. Hauptaufgabe des Gerichts ist die Unterdrückung jeglicher der Kirche unangenehmen Freiheit, besonders der Gedanken- und Gewissensfreiheit, durch drastische Strafen.
Das königliche Edikt lautet:
"Nuestros gloriosos progenitores fieles y católicos hijos de la Santa Iglesia Católica Romana considerando cuánto toca a nuestra dignidad real y católico celo procurar por todos los medios posibles que nuestra santa fe sea dilatada y ensalzada por todo el mundo fundaron en nuestros reinos el Santo Oficio de la Inquisición para que se conserve con la pureza y entereza que conviene. Y habiendo descubierto e incorporado en nuestra real corona por providencia y gracia de Dios nuestro señor los reinos y provincias de las Indias Occidentales Islas y Tierrafirme del Mar Océano y otras partes pusieron su mayor cuidado en dar a conocer a Dios verdadero y procurar el aumento de su santa ley evangélica y que se conserve libre de errores y doctrinas falsas y sospechosas y en sus descubridores pobladores hijos y descendientes nuestros vasallos la devoción buen nombre reputación y fama con que a fuerza de cuidados y fatigas han procurado que sea dilatada y ensalzada. Y porque, los que están fuera de la obediencia y devoción de la Santa Iglesia Católica Romana obstinados en sus errores y heregías siempre procuran pervertir y apartar de nuestra santa fe católica a los fieles y devotos christianos y con su malicia y pasión trabajan con todo estudio de traerlos a sus dañadas creencias comunicando sus falsas opiniones y heregías y divulgando y exparciendo diversos libros heréticos y condenados y el verdadero remedio consiste en desviar y excluir del todo la comunicación de los hereges y sospechosos castigando y extirpando sus errores por evitar y estorbar que pase tan grande ofensa de la santa fe y religion católica a aquellas partes y que los naturales dellas sean pervertidos con nuevas falsas y reprobadas doctrinas y errores. El Inquisidor apostólico general en nuestros reinos y señoríos con acuerdo de los de nuestro Consejo de la General Inquisición y consultado con Nos ordenó y proveyó que se pusiese y asentase en aquellas provincias el Santo Oficio de la Inquisición..."
[Zitiert in: Ayllón, Fernando <1959 - >: El tribunal de la inquisición : de la leyenda a la historia. -- Lima : Fondo Editorial del Congreso del Perú, ©1997. -- ISBN 9972-755-53-3. -- S. 457f.]

Abb.: Der Inquisitor und sein Gehilfe [Guaman Poma de Ayala, 1615, Abb. 480]
Einen objektiven Eindruck vom Wirken des Santo Oficio Hispanoamericano geben folgende Statistiken:
Inquisitionsprozesse nach ethnischer Zugehörigkeit 1570 - 1600 Ethnische Zugehörigkeit der Angeklagten Anzahl der Prozesse Prozentueller Anteil Spanier 391 79% Ausländer 86 17% Mestizen, Neger, Mulatten 21 4% Total 498 100% Strafen der Inquisition 1570 - 1600 Strafart Anzahl Prozentueller Anteil Geistliche Bussen (Gebete, Fasten usw.) 92 19% Körperstrafen (Kerker, Galere, Auspeitschen) 109 22% Geldstrafen 72 15% Verbannung 36 7% Ablässe 11 2% Freispruch 13 3% Ohne Angabe 164 33% Insgesamt 497 100% Angeklagte Vergehen 1570 - 1635 Vergehen Anzahl Judentum 84 Luthertum 45 Falsche Lehren 177 Gotteslästerung 126 Hexerei 63 Bigamie 103 Verführung von Beichtenden 55 Messfeier von Nicht-Priestern 15 Heirat von Priestern, Mönchen, Nonnen 5 Verschiedenes 117 Total 790 Prozesse der Inquisition in Lima nach dem Geschlecht der Angeklagten 1670 - 1820 Männer 1294 88% Frauen 180 12% Total 1474 100% [Alle Angaben nach: Ayllón, Fernando <1959 - >: El tribunal de la inquisición : de la leyenda a la historia. -- Lima : Fondo Editorial del Congreso del Perú, ©1997. -- ISBN 9972-755-53-3. -- S. 465 - 479, 507]
|
1569-11-26 bis 1581
|
1570 bis 1650
Entwicklung des spanischen Amerikahandels
Abb.: Entwicklung des spanischen Amerikahandels 1570 bis 1650[Quelle der Abb.: Chaunu, Pierre<1923 - >: Europäische Kultur im Zeitalter des Barock. -- Zürich : Ex Libris, ©1968. -- (Knaurs große Kulturgeschichte). -- S. 507. -- Originaltitel: La civilisation de L'Eurpe classique (1966)]
1570
Der spanische König entsendet die erste wissenschaftliche Expedition in Alto Perú. Die Anweiseungen bezüglich der Botanik lauten:
- "que en la primera ocasión pasase a Nueva España por haber en ella más yerbas y plantas;
- que donde llegare se informe de las yerbas, árboles y plantas medicinales que hubiere;
- que se informe qué experiencia se tiene de las cosas susodichas y de su uso, y de dónde nacen y cómo se cultivan, y en qué temples se dan, y si hay especies diferentes, y que escriba sus notas y señales;
- que de todo lo que pudiere haga pruebas y experiencia, y de lo demás se informe y sepa la verdad, y lo escriba de manera que las cosas sean bien conocidas por su uso, facultad y temperamento;
- que haga enviar a estos reinos las medicinas, yerbas y simientes que le parecieren;
- que el escribir la historia se le comente, por tener entendido lo hará como convenga;
- que habiendo concluido con toda la Nueva España, pasara a Perú al mismo efecto, etc., etc." (Leyes de Indias, 1756).
[Zitiert in: Paz, Ramiro V. : Dominio amazónico. -- La Paz : Plural, 1999. -- ISBN 84-89891-56-7. -- S. 228f.]
1570
König Felipe II dekretiert für die Kolonien staatliche Gesundheitsbehörden (Protomedicato) wie sie in Spanien seit 1477 bestehen:
"Hemos resuelto enviar uno o muchos Protomédicos generales a las provincias de las Indias y sus islas adyacentes, los cuales deberán informarse de los médicos, cirujanos, herbolarios, españoles e indios que hubiere, así como de las personas curiosas que les pareciera atender y saber algo, informándose de las experiencias que tengan en las cosas susodichas, y el uso, facultad, cantidad que se dan de las medicinas, de todas las plantas y medicinas que hubiere, escribir la historia natural, ejerciendo la profesión con el titulo de Protomédicos, residiendo en las ciudades donde hubiera Audiencia y Chancillería, ejerciendo la profesión en cinco leguas alrededor."
[Zitiert in: Rodriguez Rivas, Julio <1908 - >: Medicos y brujos en el Alto Perú. -- La Paz [u.a.] : Los Amigos del Libro, 1989. -- (Enciclopedia boliviana). -- ISBN 84-8370-169-3. -- S. 116]
1570/1580
Abb.: Lage von Genua (©MS Encarta)Genua wird Verteilungszentrum des amerikanischen Silbers
"Ab 1570-1580 funktioniert Genua als Redistributionszentrum des amerikanischen Silbers, unter der Kontrolle der Finanzaristokratie: der Grimaldi, der Lomellini, der Spinola und anderer mehr. Alles Geld, das sie nicht in ihre erhabenen, prachtvollen Stadtpaläste stecken, investieren sie in Grundbesitz oder Lehen, vorzugsweise »in Mailand, Neapel und den Montferrato inferiore« (die armen Berge um Genua können keine sichere Geldanlage bieten); oder aber in Renten, die nach Spanien, Rom oder Venedig gehen. Das Unheil, das diese hochmütigen Kaufleute in Spanien anrichten - wo sie vom Volk instinktiv verabscheut werden, wo Philipp II. sie gelegentlich wie seine Untertanen behandelt und sie beim Kragen packen lässt -, wäre eine genauere Untersuchung wert. Mit dem Nürnberger Handelskapitalismus und seinen verheerenden Folgen für Böhmen, Sachsen und Schlesien ist eine marxistische Historiographie ins Gericht gegangen. Sie spricht ihm die Verantwortung für die ökonomische und soziale Rückständigkeit dieser von der Außenwelt abgeschnittenen Regionen zu, die nur über jene ausbeuterische Zwischeninstanz Verbindung zu ihr aufnehmen konnten. Die gleichen Vorwürfe kann man den Genuesen in Spanien machen: Sie haben die Entwicklung eines spanischen Kapitalismus blockiert. Die Malvenda in Burgos oder die Ruiz in Medina del Campo sind nur zweitrangige Bankiers; und die verantwortlichen Finanzleute Philipps II. erweisen sich ausnahmslos als käufliche oder gekaufte kleine Leute, von Eraso und Garnica bis hin zum Marquis von Aunón, der gerade frisch in Ämter, Pfründe und Veruntreuungen eingeweiht worden ist ..." [Braudel, Fernand <1902 - 1985>: Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp. -- Originaltitel: La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II (1966). -- ISBN 3518405977. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Abb.: Genuesische Geldtruhe mit komplizierten Schlössern, für den Transport von Silber aus Spanien nach Genua verwendet[Quelle der Abb.: Braudel, Fernand <1902 - 1985>: Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. -- München : Kindler. -- Bd. 2: Aufbruch zur Weltwirtschaft. -- ©1986. -- ISBN 3-463-40027-8. -- S.470. -- Originaltitel: Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVe - XVIII siècle: Le temps du monde (1979)]
1571 - 1572
|
| "Er übernahm nach dem Hinschied seines Bruders die Würde des Sapay-lnka. Inzwischen war vom spanischen Vize-König Francisco de Toledo eine
'Strafexpedition' gegen Vilcabamba angeordnet worden. Unter Führung von Martin
Garcia Oñaz y Loyola — einem Neffen des Gründers des Jesuiten-Ordens — waren auserlesene Krieger nach der Hauptstadt des kleinem unabhängigen Reiches eingedrungen. Die Siedlung war von
der Bevölkerung bereits aufgegeben worden, das 'Hauptstück', wie der Vizekönig sich ausdrückte — nämlich
das goldene Abbild der Sonne — fiel in die Hände der Spanier. Am 5.
Oktober 1572 schickte Francisco de Toledo das Beutestück aus Gold an den König von Spanien mit der Bitte, es dem
Papst zu schenken.
Der geflohene Tupac Amaru wurde samt seiner schwangeren Frau in dem Urwalddschungel durch Verrat überrumpelt und gefangen genommen. Kurze Zeit später wurde ihm von der Kolonialverwaltung der Prozess gemacht und der letzte Inka-Regent hingerichtet." [Bollinger, Armin: Indios, Indios, Indios ... : gesammelte Schriften zum Wirken der Indios, zur Verfolgung der Indianer, zum Problem der indianischen Identität. -- Chur [u.a.] : Rüegger, 1992. -- (Schriftenreihe des Instituts für Lateinamerikaforschung und Entwicklungszusammenarbeit an der Hochschule St. Gallen ; Bd. 4). -- ISBN 3-7253-0422-X. -- S. 147f.] |
1571
Spanier gründen Manila (Philippinen). Diese Stadt wird für die Lieferung von chinesischen Luxusgütern gegen amerikanische Silber sehr wichtig werden.
1571-08-02
Capitán Jerónimo de Osorío (1530, Madrid - 1604, Cochabamba) gründet Villa de Oropesa (heute: Cochabamba, einheimischer Name: Khocha Pampa)
1572
Abb.: Benzoni, Girolamo: Zubereitung von Maisfladen, 1572
1572
Abb.: Sir [! seit 1580] Francis Drake, Seeräuber im Dienste der englischen Königin[Bildquelle: http://www.smithsonianmag.si.edu/smithsonian/issues97/jan97/drake_jpg.html. -- Zugriff am 2002-03-13]
"Ihr werdet sagen, dieser Kerl ist ein Teufel, der bei Tage raubt und nachts betet. So ist es. Mein Verhalten ist aber ebenso gerechtfertigt wie dasjenige des spanischen Vizekönigs, der die Anweisungen eines Schreibens König Philpps ausführt. So hat auch mir meine Landesherrin befohlen, in diese Gegenden (Westindien) zu kommen. Ich hab's getan -- und ob es unrecht ist oder nicht, wird sie am besten wissen." Francis Drake zu gefangenen Spaniern
Der englische Kapitän und Seeräuber Francis Drake (um 1540 bis 1596) kapert in Panama das Schiff Nuestra Señora de la Concepción der spanischen Silberflotte. Er erbeutet dabei neben einem riesigen Silberschatz und zahlreichenSchmuckstücken auch 40 Tonnen Münzen. Die Beute teilt er mit dem englischen königlichen Hof (Elizabeth I.) soeie den Adeligen und leitenden Beamten des königlichen englischen Hofes, die mit Kapitalanteilen Schiffe und Ausrüstung Drakes finanziert haben ("Investieren sie in Seeräuberei"!). Drake ist einer von den vielen Piraten, Freibeutern und Kaperern, die es auf die spanische Silberflotte abgesehen haben.
- Piraten: gewöhnliche Seeräuber, die nicht auf die Nationalität des beraubten Schiffes achten
- Freibeuter: private Krieger, die mit stilschweigender Billigung einer Nation (im Falle von Spanisch-Amerika vor allem England, Frankreich, Niederlande) einen nicht erklärten Krieg gegen Schiffe bestimmter Nationen richten. Die Freibeuter der Karibik nennen sich boucaniers (Bukaniere)
- Kaperer: sind Freibeuter, die eine offizielle Beglaubigung durch eine Regierung besitzen (Kaperbrief).
Freibeuter und Kaperer werden völkerrechtlich oft nicht als Räuber sondern als Kriegsteilnehmer bewertet. Immer wenn in Europa seefahrende Nationen Konflikte hatten, blühte die Freibeuterei und Kaperei. In Friedenzzeiten kehrten die Freibeuter und Kaperer wieder zur Piraterie zurück.
Piraten hatten nur dann etwas von ihrer Beute, wenn sie sie auch losschlagen konnten. Da sie völkerrechtlich geächtet waren, konnten sie in den "zivilisierten" Seefahrernationen nicht legal handeln (in England wurden sie schwer bestraft). Viele nordamerkanische Kolonien (und ihre Gouverneure) kooperierten aber mit den Piraten und waren der ideale Handelsplatz für Piratenbeute (so konnten die Kolonien nebenher auch noch ihr Mutterland England schädigen).
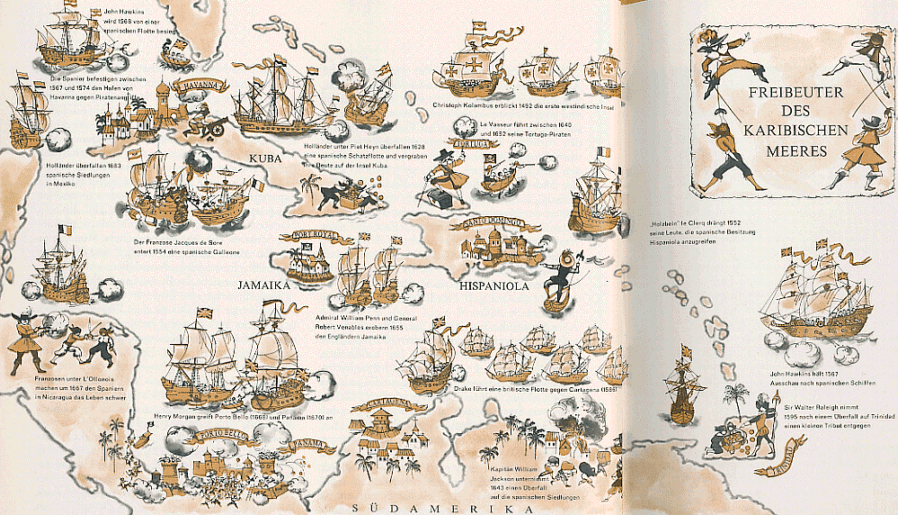
Abb.: Die bedeutendsten Freibeuter der Karibik
[Bildquelle: Westindien / von Carter Harman und der Redaktion der TIME-LIFE-Bücher. -- Amsterdam : TIME-LIFE, ©1968. -- (LIFE Länedr und Völker). -- S.. 228f.]
"Das Ungeheuer Francis Drake
Am leidenschaftlichsten wurde diese Übereinkunft von England befürwortet. Das Königreich war damals der schwächste Partner in dem exklusiven Kreis der Seefahrernationen, und vielleicht erkannten gerade deshalb die britischen Staatsmänner und Herrscher besonders früh, dass England daraus den größten Nutzen ziehen konnte. Seine Piraten hatten fast ausnahmslos nichts anderes im Sinn, als in den Freiräumen der Meere Beute zu machen. Aber diejenigen von ihnen, die immerhin Anflüge von Format besaßen, achteten sorgsam darauf, dass ein hoher Prozentsatz des Geraubten am Königshof abgeliefert wurde - manchmal war es fast die Hälfte.
Das englische Freibeutergewerbe wurde erstmals von John Hawkins auf einen bemerkenswerten Stand gebracht. Er entstammte einer Familie von Kaufleuten und Schiffseignern aus Plymouth. 1562, 30 Jahre alt, segelte er mit einer Dreierflottille zu seiner ersten Fahrt nach Afrika. An der Sierra Leone überfiel er portugiesische Schiffe, raubte dreihundert Negersklaven und verkaufte sie mit riesigem Gewinn in Haiti. Königin Elisabeth I. wusste offiziell nichts von dieser Fahrt, was sie aber nicht hinderte, höchst offiziell die prachtvollen Perlen zu tragen, die ihr Hawkins aus Westindien mitbrachte.
1566 wurde John Hawkins von einem jungen Mann besucht, einem entfernten Verwandten seiner Familie. Dieser Francis Drake hatte sich kürzlich unter Kapitän John Lovell an einer Fahrt nach Mexiko beteiligt; sie war ein katastrophaler Misserfolg gewesen, die Engländer wurden von den Spaniern völlig ausgeraubt. Von dieser Fahrt brachte Francis Drake vollendete seemännische Kenntnisse und einen maßlosen Hass auf die Spanier mit. Hawkins bereitete für das folgende Jahr eine neue Kaperexpedition vor. Im Oktober 1567 lichteten sechs Schiffe die Anker. Das Flaggschiff »Jesus von Lübeck«, 700 Tonnen groß, hatte Königin Elisabeth dem Flottillenchef Hawkins selbst zur Verfügung gestellt; sie war an dem Unternehmen noch mit einem zweiten Schiff, der »Minion«, beteiligt. Francis Drake befehligte eine kleine Barke von 50 Tonnen, die »Judith«. An der Guineaküste erbeuteten die Engländer 500 Sklaven und segelten mit ihnen nach Amerika. Die Fahrt war ein halber Rachezug, denn sie liefen die Hafenstadt Rio de la Hacha an, in der Kapitän Lovell und Drake 1565 ausgeplündert worden waren. Als die Spanier jeden Handel mit den Engländern ablehnten, landete ein Kommando zu einem Plünderungszug, anschließend wurde die Stadt beschossen. Erst jetzt erklärten sich die Bewohner bereit, die Sklaven abzukaufen. Auf der Rückfahrt kamen die Schiffe in ein schweres Unwetter, des Flaggschiff schlug leck, Hawkins und Drake mussten in San Júan de Ulloa bei Veracruz Schutz suchen. Am nächsten Tag fuhren dreizehn spanische Geleitschiffe in den Hafen ein. Hawkins
und der spanische Befehlshaber vereinbarten ein neutrales Verhalten. Wenig später brachen die Spanier jedoch das Abkommen, eröffneten das Feuer auf die britischen Schiffe und töteten jeden Engländer, der sich an Land befand. Hawkins und Drake konnten zwar vier Spanier in den Grund bohren, verloren aber selbst die »Jesus von Lübeck« und drei weitere Schiffe; nur die »Minion« und die »Judith« retteten sich, schwer beschädigt, aufs offene Meer. Drake erreichte am 20. Januar 1569 Plymouth, seine »Judith« kroch mehr in den Hafen als dass sie segelte. Eine Woche später erreichte auch Hawkins die Küste von Cornwall. Die »Minion« war in einem so jämmerlichen Zustand, dass er sie von hier nach Plymouth schleppen lassen musste.Das Missgeschick der beiden Korsaren wurde in England als eine quasi öffentliche Demütigung empfunden. Hawkins und Drake, die sich genaugenommen nur hatten übertölpeln lassen, unterstützten diese Meinung durch kräftige Klagen über die Wortbrüchigkeit der Spanier. Der königliche Hof zeigte lebhaftes Verständnis für diese Version, denn durch den Verlust der »Jesus von Lübeck«, durch die unerfüllte Hoffnung auf ihren Anteil an der Beute und die havarierte »Minion« war auch Elisabeth I. geschädigt worden. Bei Hawkins hielten sich Rachegefühl und Resignation die Waage, Drakes verletzter Stolz dagegen ließ keine andere Empfindung zu als Hass.
Sein nächstes Unternehmen bereitete er außerordentlich gründlich vor. 1570 segelte er mit zwei kleinen Schiffen zu einer Erkundungsfahrt nach Westindien. Drake war zwar inzwischen in die Königliche Marine aufgenommen worden, doch die Expedition unternahm er auf eigene Faust, ebenso eine zweite Rekognoszierungsfahrt mit nur einem Schiff im darauffolgenden Jahr. Er lernte die Inseln der Karibik, die Küste Südamerikas, die Strömungen, Untiefen und Windverhältnisse, die Schlupfwinkel und versteckten Naturhäfen so gut kennen, als wäre er dort aufgewachsen. Drake wusste jetzt auch bis in die Einzelheiten, wie die spanischen Galeonen mit Gold beladen wurden, wie ihr Geleitzugsystem funktionierte, wie die Schatzschiffe gesichert wurden. Im Jahre 1626, dreißig Jahre nach dem Tod von Francis Drake, veröffentlichte einer seiner Neffen einen Bericht über das Unternehmen, zu dem Drake 1572 mit nur zwei Schiffen aufbrach. Die Notizen erschienen unter dem Titel »Sir Francis Drake redivivus fordert dieses stumpfsinnige und verweichlichte Zeitalter auf, seinen noblen Schritten nach Gold und Silber zu folgen«. Die »noblen Schritte nach Gold und Silber« des Kapitäns Drake machten seinen Namen binnen wenigen Monaten in ganz Europa berühmt und berüchtigt. Es war eines der verwegensten Projekte der ganzen Epoche, würdig auch des Beinamens, mit dem Königin Elisabeth inzwischen von spanischen und französischen Diplomaten ausgezeichnet wurde: »Perfide, freche Jezabel des Nordens«. Und wirklich mehr als frech - sofern dieses Wort die Drakesche Expedition treffend charakterisiert - war seine spektakuläre Kaperfahrt, zu der er im Mai 1572 auslief.
Die Besatzung hatte Drake ausnahmslos aus Freiwilligen zusammengestellt, aus blutjungen Seeleuten, insgesamt 73 Mann. Ein volles Jahr trieb sich Drake mit ihnen an der Nordküste Panamas herum, überfiel Städte und Garnisonen, kaperte Fregatten, lieferte sich Gefechte mit spanischen Truppen, tauchte blitzschnell und völlig unerwartet auf, landete einen Coup und verschwand ebenso rasch, als hätte ihn die See verschluckt - offensichtlich ein ebenso genialer wie verrückter Abenteurer, der es nur darauf angelegt hatte, seinen Hals zu riskieren, aber mit dem Teufel im Bunde sein musste, weil er jeder Falle entschlüpfte.
Verrückt musste er deshalb sein, weil er auf eigene Faust, aber namens angemaßter Stellvertretung des kümmerlichen Inselkönigreiches England, die Weltmacht Spanien zu attackieren wagte, vielmehr: Ein einzelner Mann mit zwei kleinen Schiffen und einem Haufen verwegener Burschen führte Krieg gegen den spanischen König, gegen den faktischen Herren der Welt in dieser Zeit. Die Hälfte von Drakes Raubzügen schlug fehl, endete ganz anders als geplant, aber sein jähes Hervorbrechen und urplötzliches Verschwinden, die Tollkühnheit seiner Angriffe mit wenigen Männern, die Unverschämtheit, mit der er sowohl an Land als auch auf See alles überfiel, was ihm einen Versuch wert zu sein schien, festigte seinen Ruf bei den Spaniern: Der Einzelgänger Drake war kein normaler Kapitän, sondern ein Ungeheuer des Meeres. Dementsprechend wurde sein Name spanisch abgewandelt: »El draque — der Drache«. Soweit es die Mischung aus Bewunderung und Wut betraf, die darin lag, glaubte auch Drake selbst an seine »Ungeheuerlichkeit« , denn er war maßlos eitel auf seine Tollkühnheit und seemännische Überlegenheit und hatte unstreitig auch ein gewisses Recht dazu.
Sein Hauptziel war es, einen der großen Silber- und Goldtransporte, die von Peru über Land nach Panama zum Hafen Nombre de Dios gingen, zu überfallen. Ein erster Versuch missglückte, der zweite wurde ein voller Erfolg. Der Transport bestand aus fast zweihundert Packtieren; um die ganze Beute fortzuschleppen, war die Zahl der Engländer zu gering, sie beschränkten sich deshalb auf das Gold. Anfang August 1573 fuhren die Schiffe Drakes in den Hafen von Plymouth ein, schwer beladen mit einer ungeheuren Beute.
Die Achillesferse Spaniens
England jubelte, Spanien schäumte vor Zorn, Francis Drake lachte - und plante das nächste Piratenstück, ein Projekt, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Dass er, der Seemann, die Geldtransporte nach Panama an Land überfallen musste, passte so zu ihm, als wäre ein Hai gezwungen, außerhalb des Wassers zu jagen. Die Konvois über den Atlantik waren schwer bewacht; ein Überfall im Alleingang hatte von vornherein keine Aussicht, nur mit einem größeren Schiffsverband war ein erfolgreicher Angriff möglich. Dazu aber konnte sich die Königin nicht entschließen, England fehlte noch bei weitem die maritime Macht, um Spanien offen herauszufordern, so stetig Elisabeth I. auch die Flotte vergrößern ließ.
Andererseits handelte es sich bei dem Verbindungsweg zwischen der Karibik und dem iberischen Mutterland um den Lebensnerv des spanischen Weltreichs. Der gesamte Staatsschatz hing völlig von den Silber- und Goldtransporten über den Atlantik ab; wenn dieser Zustrom versiegte oder auch nur kurze Zeit unterbrochen wurde, konnten die Truppen in den Niederlanden nicht besoldet, die neuen Schiffe nicht gebaut, die europäische Politik Spaniens nicht fortgeführt werden. In der Karibik und in Peru, das die größten Goldvorräte besaß, befand sich die Achillesferse Spaniens.
Drake erreichte eine Audienz und entwickelte der Königin seinen Plan. Das Edelmetall aus den Minen Perus wurde zu den Häfen der Pazifikküste Amerikas gebracht und dort auf die Schatzschiffe verladen, die nach Norden in den Golf von Panama fuhren. Hier wurden die Lasten auf Maultiere umgeladen und über die Landenge zu den karibischen Häfen transportiert, um dann an Bord der Schiffe nach Europa zu kommen. Drake hatte vor, durch eine Umsegelung Südamerikas in den Pazifik vorzudringen. Die Durchquerung der Magellanstraße war zwar nach dem Bericht Pigafettas das Entsetzlichste, was Seefahrer durchmachen könnten, aber er, Drake, schrecke vor nichts zurück. Auf der pazifischen Seite würde er dann in dem gewaltigsten Raubzug, den die Piratengeschichte kannte, die Schiffe des spanischen Königs ausplündern.
Elisabeth I. hungerte kaum weniger nach Gold als Drake. Der Plan versetzte sie in helle Begeisterung, sie versicherte Francis Drake, dass er ihre volle Unterstützung erhalten werde, und sie würde sich an dem Unternehmen auch finanziell beteiligen; offiziell könne und dürfe sie allerdings mit der Piratenfahrt nichts zu tun haben, besonders weil im Augenblick das Verhältnis Englands zu Spanien aufmerksamer denn je gepflegt werden müsse. Drake hatte für alles Verständnis, er wollte nichts weiter, als mit stillschweigender königlicher Rückendeckung seine Schiffe ausrüsten und schnellstens aufbrechen. Die Vorbereitungen wurden nicht eigens getarnt, um keine Neugier und keine Gerüchte zu wecken. Drake wusste, dass er seine Pläne am sichersten geheimhielt, wenn er möglichst offen vorging. Am 15. November 1577 verließ er mit fünf Seglern England.
Drakes Fahrt ähnelte in vielem dem Unternehmen Magellans, allerdings nur in nebensächlichen Dingen; beide brachen mit fünf Schiffen auf, beide mussten Meutereien niederschlagen, beide verloren Schiffe in Stürmen, beide Expeditionen endeten damit, dass nur ein einziges Schiff in den Heimathafen zurückkehrte. Drake durchquerte die Magellanstraße in der erstaunlich kurzen Zeit von sechzehn Tagen, mit drei Schiffen erreichte er im Herbst 1578 den Pazifik, verlor in einem wochenlangen Sturm zwei weitere Schiffe und segelte schließlich allein mit seinem Flaggschiff »Golden Hind« nach Norden.
Mit einem Überfall Valparaisos begann sein beispielloser Kaperzug. Er lief in den Hafen ein, plünderte die Stadt, raubte die Kirchen aus und überholte dann in aller Ruhe das Schiff, ergänzte die Vorräte und lag auf der Reede, bis sich die Mannschaft von den Strapazen erholt hatte. Während der nächsten fünf Monate segelte er ohne Hast die Küste entlang nach Norden, systematisch die Hafenstädte plündernd, über eine Strecke von mehr als 3000 Kilometer bis Lima. Die Stadt war der zentrale Stapelplatz für die Schätze Perus. Im Hafen ankerten zwölf große spanische Schiffe, die Kapitäne fühlten sich so sicher, dass die ganze Takelage an Land war; kein Mensch rechnete mit einem Überfall. Drake hatte kaum jemals so leichte Beute gemacht und noch nie in solchen Dimensionen.
In Lima erfuhr er, dass vor kurzem eine besonders große Galeone mit vielen Tonnen Silber, Gold und Schmuck nach Panama gesegelt war; das Schiff war allerdings schwer bestückt. Drake setzte dem Spanier sofort nach, holte ihn knapp jenseits des Äquators ein und konnte ihn trotz seiner Geschütze und der starken Besatzung entern. Außer Gold und Silber befanden sich unter Deck dreizehn Truhen mit Schmuck, Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten. Drake dehnte seinen Piratenzug bis nach Mexiko aus, als Beute nahm er jetzt nur noch Gold und Perlen mit. Den Nordkurs hatte er deshalb eingeschlagen, weil er den amerikanischen Kontinent nach einer Nordwestpassage absuchte. Er drang bis zum 48. Breitengrad vor. Auf der Höhe der Insel Vancouver gab er das Projekt auf, überquerte im Gefolge Magellans den Pazifik, erreichte die Molukken, wurde von den Herrschern freundlich empfangen, belud den restlichen Laderaum seiner »Golden Hind« mit den kostbarsten Gewürzen und nahm endlich Kurs in die Heimat, quer durch den Indischen Ozean und seine Stürme, um das Südkap Afrikas und durch den Atlantik vorbei an den Azoren. Im Herbst 1580 tauchte die »Golden Hind« vor Plymouth auf, zerlumpt und abgerissen wie ihre Besatzung, ein jämmerliches Schiff, doch bis über den Freibord beladen mit einem ungeheueren Schatz: die »Golden Hind«, der berühmteste Segler der Epoche.
Vom Räuber zum Ritter
Niemand hat nach so langer Zeit noch mit der Rückkehr Drakes gerechnet. Der Hafenkommandant von Plymouth begrüßt das Schiff mit Salutschüssen, die Stadt taumelt vor Begeisterung, der Jubel brandet über das Land, die Nachricht von Drakes Ankunft erreicht London in der Nacht, die Menschen rütteln sich gegenseitig wach, sie strömen auf die Straße, auch die Königin wird im Palast von St. James geweckt, sie wirft ein Neglige über, trommelt ihre Räte zusammen - so wird erzählt - und stammelt ihnen die Nachricht entgegen: »Drake ist zurück, er hat die Welt umsegelt!« Dabei rinnen Tränen über ihre Wangen.
Francis Drake hatte dem Namen seines Schiffes auch in einem materiell messbaren Sinn alle Ehre gemacht. Die spanische Regierung war laufend über die mutmaßliche Größe der Schäden, die ihr Drake zufügte, informiert worden; der Gesamtumfang der Beute jedoch - in Spanien auch jetzt mehr durch Gerüchte als durch exakte Schätzungen bekannt - trieb die Erregung in Madrid auf den Höhepunkt. Philipp II. hatte sich schon nach den ersten Meldungen von Drakes Überfällen im Pazifik heftig in London beschwert. Seine Proteste wurden zunehmend schriller, als die Goldverluste so anstiegen, dass sich die Gefahr einer unmittelbaren Auswirkung auf das spanische Schiffsbauprogramm und die Besoldung der Truppen im Niederländischen Krieg abzeichnete. In heutiger Währung - vorsichtig geschätzt und samt den unerlässlichen Vorbehalten bei Umrechnungen — betrug die Beute auf der »Golden Hind« mehr als 56 Millionen DM. Die Hälfte davon war persönliches Eigentum der englischen Königin.
Nicht nur deshalb bestritt Elisabeth dem spanischen König gegenüber energisch, dass sie auch nur das geringste von den Überfällen Drakes gewusst habe; sie wehrte schon bei der ersten Demarche Madrids eineinhalb Jahre vorher alle Verdächtigungen und angedeuteten Mutmaßungen über ihre Mitwisserschaft, Billigung oder gar aktive Unterstützung ebenso scharf wie scheinheilig ab. Nach der triumphalen Rückkehr Drakes ging es jedoch nicht mehr nur um Gold und Edelsteine; es ging darum, dass Drake mit der ersten Weltumsegelung eines englischen Schiffes, mehr als ein Halbjahrhundert nach der Fahrt Magellans, die Überzeugung der Wortführer einer britischen Ozeanopolitik am Königshof — der »Navalisten« oder »Blue-Water« -Vorkämpfer- bewahrheitet hatte: »Wer das Meer beherrscht, der beherrscht die Welt.« Mit der Ankunft der »Golden Hind« in Plymouth begann Englands neue Zukunft. Und deshalb wies Elisabeth die spanische Forderung, dass alles von Drake Geraubte an Madrid zurückgegeben und »der größte Dieb der bekannten Welt« kategorisch bestraft werden müsse, kühl und ebenso kategorisch zurück. Es gäbe keine Beweise, dass Drake tatsächlich spanisches Gut geraubt habe; immerhin, sie werde die Angelegenheit gründlich und in Ruhe prüfen lassen.
Sie lud Drake zu einer Audienz und prüfte zunächst die Qualität der erbeuteten Schätze, und Drake überreichte ihr eine große Goldschüssel, gefüllt mit den herrlichsten Edelsteinen. Elisabeth war überwältigt, sie ließ umgehend eine neue Krone anfertigen. Die drei größten Smaragde prangten auf dem Diadem, die Königin zeigte sich damit am Neujahrsfest 1581 in der Öffentlichkeit. Francis Drake war jetzt zwar nicht mehr »ihr kleiner Pirat«, sie feierte ihn als »Helden des Landes«, als Ruhm Englands, aber sie passte trotzdem ihr Verhalten sorgfältig der außenpolitisch unvermindert delikaten Situation Englands an. Drake musste für einige Monate unter eine Art Tarnkappe; sein Schiff wurde, flankiert von Wachbooten, in ein Trockendock nach Deptford Yard an der Themse, zwischen den Surrey Docks und Greenwich, gebracht und dem spanischen Botschafter Don Bernardino de Mendoza gegenüber die Existenz Drakes und seine Affäre in der Schwebe gelassen. Das Verhältnis Englands zu Spanien in diesen Jahren legte eine solche Taktik nahe; dem unerklärten Krieg auf See durfte noch nicht der erklärte Krieg an Land folgen. Von Monat zu Monat wurde jedoch deutlicher, dass sich Spanien auf England als seinen hartnäckigsten und England auf Spanien als seinen gefährlichsten Feind konzentrierte - doch solange noch die geringste Hoffnung bestand, ein Arrangement zwischen beiden Mächten herzustellen, legten weder Philipp II. noch Elisabeth I. die Masken ab. Immerhin entschloss sich die Königin im April 1581 zu einem Schritt, den ganz England längst erwartete. Sie besuchte mit großem Gefolge Englands berühmten Seehelden auf seiner legendären »Golden Hind«. Drake und die Besatzung erwarteten die Herrscherin in Festkleidung, alle Schiffe im Hafen hatten über Topp geflaggt, und die Seeleute jubelten der Königin in ihrem Staatsboot mit dem traditionellen Ruf zu, den jedes weibliche Wesen auslöste, das sich damals einem Schiff mit Matrosen näherte: »Whore, Whore! - Hure, Hure!« Und die Königin, Queen Bess, durchaus in Einklang mit dem Vulgären ihrer Zeit, in der Welt Shakespeares genauso zu Hause wie in den Labyrinthen der Diplomatie, in den gemeinsten Seemannsflüchen ebenso bewandert wie in den erquickenden Bedrängnissen der Liebesnöte - Elisabeth nahm die Ovation ihres Seevolks strahlend und mit souveränem Witz entgegen; sie rief zurück: »Ay, ay! Seid ihr doch alle meine lieben Kinder!«
Auf den teppichbelegten Planken der »Golden Hind« trat Francis Drake der Königin entgegen, er verneigte sich, beugte das Knie. Elisabeth lächelte ihm zu und meinte, freimütig auf die spanischen Beschwerden anspielend, sie sei mit einem Schwert gekommen, um ihm den Kopf abzuschlagen. Drake blieb knien, und auf ein Zeichen Elisabeths trat der französische Gesandte vor und schlug in Stellvertretung der Königin den erfolgreichsten aller Piraten zum Ritter. Drake, in den Adelsstand erhoben und von nun an Sir Francis, wurde zum Vizeadmiral der Flotte ernannt."
[Diwald, Hellmut <1929 - >: Der Kampf um die Weltmeere. -- München [u.a.] Droemer Knaur, ©1980. -- ISBN 3-426-26030-1. -- S. 217 - 226]]
1572/73
Vizekönig Francisco Toledo macht eine Generalvisitation.
Abb.: Route der Generalvisitation von Francisco Toledo[Quelle der Karte: Abecia Baldivieso, Valentín <1925 - >: Las relaciones internacionales en la historia de Bolivia. -- La Paz [u.a.] : Los Amigos del Libro. -- Tomo I. -- 2. ed. -- 1986. -- S. 57]
1573 - 1574
In La Plata (Sucre) prägt eine Münze (Casa de moneda) Silbermünzen. Die Münzmarke von La Plata ist PTA bzw. P [nicht unterscheidbar von Potosí P] Ab 1574 wird stattdesssen in Potosí geprägt. Die Prägung in Hispanoamerika sollte verhindern, dass ungeprägtes Silber am Fiskus vorbeigehen konnte. Die Münzstätten mussten ein Fünftel (quinto) an den König abliefern. Trotzdem bleiben weiter Silberbarren (Gewicht 22 bis 26 kg) im Umlauf. Diese müssen münzähnliche Markierungen tragen.
Abb.: Silberbarren aus dem 17. Jhdt.Bedeutung der Markierungen:
- römische Ziffern: Feingehalt: 2376 Teile Reinsilber auf einer Skala von 0 bis 2400
- arabische Ziffern: Gewicht (ca. 32,5 kg)
- Stempel: Steuern wurden bezahlt
- Buchstaben: Prüfer, Versender, Besitzer
- ausgebrochene Stelle rechts: Probenentnahme zur Feingehaltsbestimmung
[Quelle: Walton, Timothy R. <1948 - >: The Spanish treasure fleets. -- Sarasota, FL : Pineaple, ©1994. -- ISBN 1561640492. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1574
Luis de Fuentes ý Vargas (1530, Sevilla - 1598, La Plata) gründet Villa y Frontera de Tarija (heute: Tarija)
|
|
|
|
|
|
1574
"Von den Spaniern, die nach Amerika gehen Die Spanier wären in jenen Provinzen viel zahlreicher, wenn allen die Konzession gegeben würde, die eine solche wünschen. Es sind nun aber im allgemeinen die Arbeitsscheuen und die Männer hochfahrenden Gemüts und Geistes, die eher begierig sind, in kurzer Zeit reich zu werden, als in dem Land für immer wohnen zu bleiben, geneigt, aus diesen Reichen [der Krone Spaniens in Europa] in jene zu gehen. Sie geben sich nicht damit zufrieden, Essen und Kleidung dort sicher zu haben, woran es ihnen in jenen Ländern bei mäßigem Fleiß nicht mangeln kann, seien sie nun Handwerker und Bauern oder nicht; ihrer selbst vergessend streben sie nach Höherem und streifen faulenzend im Land umher und beanspruchen Ämter und Repartimientos. So werden diese Leute für sehr schädlich für Ruhe und Frieden des Landes gehalten, und deshalb wird so wenigen wie möglich die Konzession erteilt, in jenes Land zu fahren, besonders nach Peru, wo diese Leute äußerst abträglich gewesen sind, wie die Rebellionen und Unruhen gezeigt haben, die es dort gegeben hat. Daher dürfen nur die Inhaber von Ämtern in jene Länder fahren und in beschränktem Maße Gesinde und Dienstpersonal, welches sie brauchen, sowie diejenigen, die in den Kampf und zu neuen Entdeckungen ziehen, und die Händler und Kaufleute und ihre Faktoren, denen die Beamten in Sevilla die Konzession für eine begrenzte Zeit, die nicht über zwei oder drei Jahre hinausgeht, erteilen, und die eigene Waren und Besitz bis zu einem bestimmten Wert mitnehmen dürfen. Folgende Personen erhalten keine Erlaubnis, nach den In-dias zu fahren: Ausländer dieser Reiche, auch Portugiesen, dürfen dort weder wohnen noch arbeiten; aus diesen Reichen dürfen keine Juden oder Mauren oder Personen, die von der Heiligen Inquisition bestraft wurden, hinfahren. Verheiratete dürfen nicht ohne ihre Frauen fahren, mit Ausnahme der Händler und derjenigen, die mit zeitlicher Beschränkung fahren; ebenso keine entlaufenen Mönche und ehemaligen berberischen oder levantinischen Sklaven, sondern nur die Sklaven aus Manicongo und Guinea. Aber trotz des Verbotes und des Bemühens, das darauf verwendet wird, niemanden ohne Konzession hinüberfahren zu lassen, fahren sie, sich als Händler und Seeleute ausgebend, überall hin. [...]
Die Spanier jener Länder teilen sich in [zwei Gruppen,] die Konquistadoren, die an der Eroberung und Befriedung des Landes teilhatten, und die ersten Siedler; diese alle sollen bei den Zuteilungen der Indios, wenn sie neu vergeben werden oder freigeworden sind, und bei der Vergabe von Ämtern und anderen Nutzungen des Landes bevorzugt werden, zuvörderst die Konquistadoren und dann die Siedler, die von Rechts wegen am meisten begünstigt werden. Nicht alle Einwohner werden Bürger der One genannt, sondern nur diejenigen, die Repartimientos in dem Land haben, und diese können sie nicht haben, wenn sie das Land ohne Genehmigung verlassen. Sie sind verpflichtet, Waffen und Pferde für seine Verteidigung zu halten. Die übrigen sind Landwirte, Bergleute und Handwerker mit verschiedensten Berufen - davon gibt es in jenen Ländern sehr gute, sowohl Indios als auch Spanier -, und Kaufleute und Händler oder deren Faktoren. Den sichersten und angesehensten Erwerbszweig des Landes bilden die Tribute und Zuteilungen von Indios, die man nicht abtreten, verkaufen, umtauschen oder veräußern kann, weil sie nur auf zwei Lebensalter vergeben werden; danach sind sie wieder frei oder fallen an die Krone zurück. Die ertragreichsten Unternehmungen jener Länder waren immer die Gold- und Silberminen; dabei stand an erster und allgemeinster Stelle die Goldmine und an zweiter die Silbermine dort, wo es kein Gold gab, wohl aber reiche Silberminen entdeckt wurden. Nach den Minen kommt dann der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, hauptsächlich Weizen, Wein, Wolle, Früchte, Geflügel und Vieh aus Spanien. Wolle und Häute ebenso wie etwas Seide werden schon in diese Reiche von Neu-Spanien und nach den Inseln des Nördlichen Meeres6 gebracht, desgleichen viel Zucker, Röhrenkassie, Edelhölzer. Nach Amerika werden aus Spanien Wein, Öl, Tuche und Seiden und Leinen, Eisen und Stahl und Gegenstände daraus wie Waffen und Werkzeuge sowie Bücher, Papier, Bekleidung, Geschirr und andere angefertigte Kleinigkeiten, die in Amerika noch nicht hergestellt werden, gebracht."
[López de Velasco, Juan: Geografia y descripciön universal de las Indias desde el ano de 1571 al de 1574. -- Übersetzung: Der Aufbau der Kolonialreiche / hrgg. von Matthias Meyn ... -- München : Beck, ©1987. -- (Dokumente zur Geschichet der europäischen Expansion ; Bd. 3). -- ISBN 3406303730. -- S. 315f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1574
Die Münze (Casa de moneda) von Potosí beginnt Silbermünzen zu schlagen. Die Prägungen sind von sehr schlechter Prägequalität und werden von Numismatikern als cob ("Hieb") bezeichnet, deutsche Numismatiker nannten sie Schiffsgeld, weil man irrtümlich annahm, dass diese rohen Prägungen auf den Schiffen bei der Überfahrt nach Spanien hergestellt wurden. Die Münzmarke von Potosí ist P bzw. PTS.
Abb.: Silber-cob aus Potosi (12 Gramm), um 1618 [Bildquelle: http://www.users.globalnet.co.uk/~travis1/or5.jpg. -- Zugriff am 2002-07-01]
1576-01
Die erste Versammlung der Jesuitenprovinz in Lima beschließt u.a.:
"Que la Compañá [de Jesus] haga dos Catecismos en las dos lenguas, quechua y aymara, uno pequeño ... ya otro mayor y copioso. ... Item: es necesario que se haga un Arte, Vocabulario, Confesionario y Cartilla, con las oraciones en las dos lenguas." [Monumenta Peruana II, 67]
1577
Die Jesuiten gründen ihre erste Niederlassung in Potosí
Abb.: Buen Gobérno / Reverendo Rector General de la Compañía de Jsús de este reino / Obediencia / Orden muy obediente, en Lima y en el mundo. -- Der Rector general der Jesuiten mit zwei Patres, "ein sehr gehorsamer Orden in Lima und der ganzen Welt" [Guaman Poma de Ayala, 1615, Abb. 482]
Abb.: Anonymus: Die Einheimischen begehen die Sünde des Götzendienstes, Detail aus "Der Tod", Kirche von Caquiaviri, Provinz La Paz, 1739[Bildquelle: Gisbert, Teresa: El paraíso de los pájaros parlantes : la imagen del otro en la cultura andina. -- La Paz : Plural, 1999. -- ISB 84-89891-42-7. -- Nach S. 76]
1578
P. Francisco de la Cruz OFM wird von der Inquisition verurteilt, weil er die Zerstörung des Vizekönigtums Perú voraussagte und das tausendjährige Reich in Amerika prophezeite. Außerdem vertrat er die Polygamie. P. Luis López wird von der Inquisition verurteilt, weil er die spanische Herrschaft als Provisorium betrachtete und das Auftreten eines einheimischen peruanischen Herrschers verkündete.
um 1580
Sprachverteilung auf dem Altiplano:
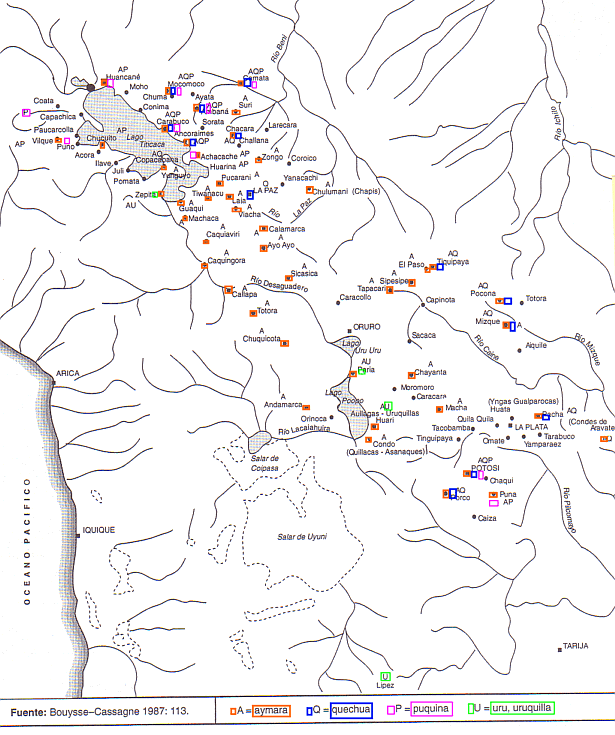
Abb.: Sprachen, die um 1580 für die Katechisierung empfohlen wurden
[Vorlage: Albó, Xavier: Bolivia plurilingüe : guía para planificadores y educadores. -- La Paz : UNICEF-CIPCA, ©1995. -- Bd. 1. -- Depósito legal 4-1-713-95. -- S. 187]
1580-02-01
König Felipe II hat in kurzer Zeit (Einmarsch von Fernando Alvarez de Toledo y Pimentel, Herzog von Alba) seinen Anspruch auf die Erbfolge in Portugal durchgesetzt und wird als Felipe I König von Portugal
1580 - 1640
|
1581 - 1583
|
1582
Jesuitenniederlassung in La Paz
1583 - 1586
|
1583-02-02
Abb.: ohne Behang
Abb.: mit BehangAbb.: Gnadenbild Nuestra Señora de la Candelaria de Copacabana Der Inka-Nachkomme Francisco Tito Yupanqui (?., Isla del Sol. - 1608) kommt mit der von ihm geschnitzten Marienstatue nach Copacabana. Diese wird zum wunderbaren Gnadenbild. Daraufhin wird Copacabana zum Wallfahrtsort.
1584
Abb.: Silbergewinnung in Potosí, 1584
1584/85
1585III. Concilio Provincial in Lima. Es wird u.a. ein Katechismus mit pastoralen Anhängen beschlossen
Doctrina christiana y catecismo para instrucción de los indios, y de las de mas personas, que han de ser enseñadas en nuestra sancta fé. Con un confessionario y otras cosas necessarias para los que doctrínan, que se contienen en la pagina siguente / compuesto por auctoridad del Concilio Provincial, que se celebra en la Ciudad de los Reyes, el año 1583 y per la misma traducido en las dos lenguas generales de esto Reyno, Quichua y Aymara. -- Lima : Antonio Ricardo, 1584. -- 168 S.
Abb.: Titelblatt
"Confesionario para los curas de indios con las instrucciones contra sus ritos y exhortación para ayudar a bien morir y summa de sus privilegios y forma de impedimientos del matrimonio. Sexto mandamiento: No fornicarás
- ¿Estás amancebado? ¿ Qué tiempo que lo estás? ¿Cuántas mancebas tienes? ¿ Dónde tienes la manceba? ¿ Es casada o soltera?
- ¿ Has tenido cuenta con otras mujeres solteras o casadas? ¿ Cuántas veces con cada casada? ¿ Cuántas con cada soltera?
- ¿Has pecado con alguna doncella?
- ¿Has forzado alguna mujer?
- ¿Hasla persuadido con palabras o dádivas a que peque? ¿O has usado de tercera persona para persuadirla?
- ¿Has emborrachado a alguna mujer para pecar con ella?
- ¿Has tenido cuenta con alguna parienta tuya? ¿Qué parentesco tenía con ella?
- ¿Has pecado con dos hermanas? ¿O con madre e hija? ¿O con alguna parienta de tu mujer? ¿Y qué parentesco tenía con tu mujer?
- ¿Has pecado con mujer infiel?
- ¿Antes de casarte qué tanto tiempo estuviste con tu mujer?
- ¿Confesaste antes de casarte? ¿O estabas en pecado?
- ¿Has dado palabra de casamiento a alguna mujer? ¿Conjuramento? ¿ O sin él? ¿ Fue para engañarla?
- ¿Has retozado con mujeres? ¿O besádolas? ¿O hecho otras cosas deshonestas?
- ¿Has pecado con mujer en iglesia o cementerio?
- ¿Has usado huacanqui para alcanzar las mujeres?
- ¿Has ido al hechisero o a la guaca para pedir remedio o bebedizo para que te quieren las mujeres?
- ¿Has hablado u oído hablar las palabras deshonestas o cantares deshonestos, deleitándole en ellos?
- ¿Haste alabado de pecados y hechos deshonestos? ¿Y eso si fue con mentira?
- ¿Has sido alcahuete? ¿De soltero o de casado?
- ¿Has tenido polución voluntaria? ¿o tocamentos sucios contigo mismo?
- ¿Has usado del pecado nefando con alguna persona?
- ¿Has usado de bestialidad con algún animal?
(A las mujeres se han de hacer preguntas dichas, acomodándolas a personas. Y no se ha de preguntar de lo dicho más de lo que probablemente se entiende hecho el que se confiesa. En lenguas quechua y aymara se acomoden en las preguntas de este mandamiento con los vocablos pertenecientes a varón y mujer).
Nono mandamiento: no desearás la mujer ajena.
- ¿Has puesto a mirar mujeres y tenido deseo de pecar con ellas, ¿ Eran casadas? ¿O solteras? ¿O doncellas? ¿O parientas tuyas? ¿O de tu mujer?
- Ese mal deseo que te vino, ¿Apartástele de ti luego, o consentiste con él diciendo dentro de ti que pecaras con aquella mujer si pudieras?
- ¿Ha sido muy ordinario el desear mujeres de esa manera? ¿Y eso en con cuántas veces? ¿O son pocas veces?
- ¿Andas aficionado a alguna mujer? ¿Haste pulido y vestido bien para que se aficione a ti? ¿Qué tanto andas con esa afición?"
[Zitat in: La mujer en la historia de Bolivia : imágenes y realidades de la colonia (Antologia) / Eugenia Bridikhina. -- La Paz : Anthropos, 2000. -- Depósito legal 4-1-1402-99. -- S. 137 - 139]
Aus dem Dritten Katechismus: Ratschläge an die Seelenarbeiter für die Katechisierung der Indios (1585) "l. Da die Indios nun einmal unwissende und unerfahrene Leute in der Lehre des Evangeliums und die meisten von ihnen nicht von hoher und erhabener Fassungskraft oder gar schriftkundig sind, ist es zunächst vonnöten, dass man sie das Wesentliche unseres Glaubens lehre, das alle Christen wissen müssen. Dies nennt der Apostel die Elemente oder das Abc der Gotteslehre [Hebr 5, 11-14], was der Katechismus oder die Fibel enthält. Denn mit den Indios andere Dinge der Heiligen Schrift oder delikate Fragen der Theologie, der Sittenlehren oder Allegorien zu behandeln ist zur Zeit überflüssig und wenig nützlich, ähnlich der schweren Kost, die Zähne erfordert; das ist etwas für Menschen, die in der christlichen Religion bereits gewachsen sind, nicht aber für Anfänger. Es kommt nämlich vor, dass viele Indios, nachdem sie lange Zeit Predigten gehört haben, wenn ihr sie befragt, was sie denn von Christus halten und vom anderen Leben, ob es mehr als einen Gott gibt, und ähnliche Dinge des christlichen Abc, so unwissend sind, dass sie nicht einmal einen Schimmer von alledem haben, was ganz sicherlich eine große Schande ist, nachdem sie so viele Jahre zur Kirche gegangen sind und Gottes Wort vernommen haben.
2. Zum zweiten darf sich derjenige, der die Indios unterrichtet, nichts daraus machen, die wichtigsten Punkte der christlichen Lehre bei verschiedenen Gelegenheiten zu wiederholen, damit sie sich diese einprägen und vertraut machen: »Mir macht es nichts aus, euch dasselbe nochmals zu schreiben, euch aber dient es zur Festigung«, sagt der Apostel [Phil 3]. Und so verhält es sich mit diesen, und es ist von Vorteil, ihnen wie unwissenden Schülern die wesentlichsten Punkte unserer Religion einzuflößen, besonders in den Bereichen, in denen ihre Ignoranz besonders groß ist; so z. B. bezüglich der Einheit des einzigen Gottes, und dass man nur einen Gott anbeten darf; dass Jesus Christus Gott ist und Mensch, einziger Retter der Menschen; dass man durch die Sünde den Himmel verliert und der Mensch so auf immer verdammt wird; dass er getauft werden muss, um von der Sünde befreit zu werden, oder vollständige Beichte abzulegen hat; dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist; dass es ein anderes Leben gibt und ewige Strafe für die Bösen, ewige Herrlichkeit aber für die Guten. Diese wesentlichen Fundamente unseres Glaubens (wie sie die Schrift in Hebr 6 nennt), müssen ihnen bei allen Gelegenheiten wiederholt und ihnen so lange eingeprägt und nicht nur ungefähr kennen.
3. Der dritte Hinweis bezieht sich auf die Art und Weise, in der die Lehre vorgestellt und unser Glaube unterrichtet werden soll, so schlicht, einfach, klar und kurz nämlich, wie es die nötige Genauigkeit erlaubt. Ebenso der Stil der Predigten und Ansprachen an die Indios, der leicht verständlich und demütig statt hochtrabend und erhaben zu sein hat: keine zu langen Schlussfolgerungen, keine Umschweife, keine auserlesene Sprache und keine gekünstelten Begriffe, mehr in der Art, wie man sich unter Companeros unterhält, als nach Art von Bühnendeklamationen. Schließlich muss der Unterrichtende der Fassungskraft des Indios gewärtig sein, zu dem er spricht, und auf dessen Maß die Argumente zuschneiden; dies im Wissen, dass zu dicke Brocken die enge Kehle ersticken machen. Dazu ermahnt der Weise, wenn er sagt: »Doch dem Verständigen ist Erkenntnis ein leichtes« [Spr 14, 6].
4. Der vierte und wichtigste Hinweis besteht darin, dass die christliche Lehre derart unterrichtet werde, dass sie nicht nur vernommen wird, sondern auch überzeugt. Sosehr dies auch das Werk des Heiligen Geistes ist, dem es zukommt, das Gehör des Herzens zu öffnen und die Seele aufzurichten, damit sie Dinge erfasse, die unser Verstehen übersteigen und nicht nach unserem Geschmack sind: die guten Argumente und die Wirkung dessen, der predigt oder unterrichtet, helfen doch viel. Wiewohl wir diese Geheimnisse auch nicht unmittelbar einsichtig machen können, so sind wir doch in der Lage sie als glaubhaft zu erweisen und von unserem Glauben Rechenschaft zu geben, wie die Schrift sagt [Ps 92; l Petr 3, 15]. So taten auch die Apostel, als sie den Juden und Heiden das Evangelium verkündeten, wobei sie sich bei den einen der Schriftzeugnisse bedienten, bei den anderen der guten Gründe und der Erkenntnisse ihrer Weisen [Apg 2, 3; 7, 13-17]. Deutlicher noch ist darauf hinzuweisen, dass bei den Indios sehr subtile Vernunftgründe nicht dienlich sind und sehr profunde Argumente nicht überzeugen. Was sie stärker überzeugt, sind schlichte Gründe, die an ihnen ihr Maß nehmen, sowie Vergleiche von Dingen, die unter ihnen gebräuchlich sind, auch Beispiele, die die Schrift erzählt, und vor allem, ihre Irrtümer aufzudecken und ihnen den Spott und die Täuschung aufzuzeigen, die sie enthalten, und ihren Lehrern, den Zauberern, ihre Autorität zu nehmen, indem man deren Unwissenheiten, Schwindel und Schlechtigkeiten offenlegt. Das ist sehr einfach, wenn man sich darum bemüht, ihre Riten und abergläubischen Praktiken von Grund auf kennenzulernen.
5. Schließlich steht aus Erfahrung fest, dass diese Indios (wie die übrigen Menschen) gemeinhin sich eher durch Gefühle überzeugen und bewegen lassen denn durch Vernunftgründe. Darum ist es wichtig, in den Predigten sich dessen zu bedienen, was das Gemüt anruft und erweckt, wie Schmähreden, Ausrufe und andere Formen, welche die Redekunst lehrt, aber viel mehr noch die Gnade des Heiligen Geistes, wenn das Gefühl des Verkünders des Evangeliums entbrennt. Der Apostel sagte: »Ich wollte, ich könnte jetzt bei euch sein und in anderer Weise mit euch reden« [Gal 4, 20]. Kein Zweifel: wenn auch die Wirksamkeit seiner Briefe groß war, ungleich wirksamer waren seine Aussprache und sein Ausdruck, mit dem er allem, was er sagte, einen himmlischen Geist verlieh; darum rät der hl. Augustinus so sehr, dass der Prediger, der mit seinen Predigten das Wort Gottes anderen einflößen will, es mit Hilfe des Gebetes zunächst in sich selbst aufnehme (Lib. 4 de doctrina christiana, c. 15). Auch wenn dies allgemein für alle gültig ist: ganz besonders lässt sich erleben, dass die Indios, von Natur aus sanfte Wesen, wenn sie jemanden in gefühlvoller Art reden hören, außerordentlichen Gefallen daran finden und sich dadurch anregen lassen. Sie selbst nämlich haben in ihrer Art, miteinander zu sprechen, so viel Stimmungsvolles, dass es jemandem, der sie nicht kennt, als reine Manieriertheit und Ziererei erscheint. Der Gebrauch einiger Effekte außer der zu erteilenden Lehre, mit denen sich die Liebe zum Guten und die Verschmähung des Bösen wecken lässt, ist ein sehr wichtiges Unternehmen für denjenigen, der diese Indios zu unterweisen hat. Und all diese Ermahnungen sowie andere darüber hinaus darf der nicht geringachten, der ein Seelenarbeiter zu sein und das Geheimnis des Gotteswortes würdig zu behandeln trachtet."
[Quelle der Übersetzung: Gott in Lateinamerika : Texte aus fünf Jahrhunderte. Ein Lesebuch zur Geschichte / ausgewählt und eingeleitet von Mariano Delgado ... -- Düsseldorf : Patmos, ©1991. -- ISBN 3-491-77041-6. -- S. 251f.]
Pockenepidemie in Peru.
1586 - 1589
|
1587
Abb.: Karte von Juan Martinez, 1587
1587
Jesuitenniederlassung in Santa Cruz de La Sierra
1588/89
Acosta, José de <SJ> <1540-1600>: De natura Noui Orbis libri duo ; et De promulgatione Euangelij apud barbaros, siue De procuranda Indorum salute libri sex / autore Iosepho Acosta ... -- Salmanticae : Foquel, 1589. -- 640 S. (8vo). -- ["Consists of the same sheets (except t.-p. and preliminary leaves) as the edition dated 1588. -- De natura Novi Orbis appeared in Spanish in 1590 as books 1-2 of: Historia natural y moral de las Indias. e promulgatione Evangelii apud barbaros has special t.p. dated 1588, with title: De procuranda salute Indorum, libri sex.
Colophon dated 1588.]
Aus De procuranda Indorum salute (in spanischer Übersetzung aus dem Latein): "LOS TRIBUTOS Y EL OCIO
Dicen los que más entienden las cosas y condición de los indios, que les conviene mucho a ellos que les echen tributos pesados, porque siendo una nación floja y perezosa, si no se les fuerza a trabajar e industriarse para pagar el censo, llevan una vida desidiosa como bestias, entregados vergonzosamente a ocupaciones de irracionales, porque no les da cuidado aumentar la hacienda, ni mirar para el porvenir, sino contentos con el sustento de cada día se dejan llevar de su genio indolente. Semejantes palabras no se les caen de la boca a los más experimentados, y nosotros, conformes con su parecer, confesamos que trabajar, negociar y estar ocupados en sus granjerias y tratos es ciertamente muy provechoso a los bárbaros, y completamente necesario para constituir bien su república. Por lo cual, sus príncipes Ingas, que fueron sin duda de agudo ingenio y de juicio excelente, pusieron la suma de su administración para que fuera recta y duradera en hacerles trabajar lo más posible y no dejarles un instante de ocio; de suerte que cuando faltaban trabajos útiles, los ocupaban en cosas superfluas; y causa admiración a quien conoce sus instituciones lo que refieren los ancianos, que a ciertas naciones se les impuso la obligación de presentar cierta cantidad de insectos parásitos, y a otras de mover rocas de una parte a otra. Y no es oscura ni dificultosa la causa de que convenga urgir a los indios con el trabajo; porque los bárbaros son todos de condición servil, y fué proverbio de los antiguos, como refiere Aristóteles, que a los esclavos no se les debe tener nunca ociosos, porque el ocio los hace insolentes; y lo mismo amonesta el Sabio: "Envía, dice, el esclavo al trabajo, y que no esté ocioso, porque la ociosidad enseña muchas malicias".
No negamos, pues, que hay que ocupar a los indios en el trabajo, antes gustosamente lo confesamos. Mas pregunto: ¿Para quién deben trabajar, para quién granjear, en provecho de quién deben servir? El dominio de los reyes se diferencia del de los tiranos, en que los reyes no buscan su propia utilidad en el gobierno de los subditos, sino la de ellos; de donde se sigue, para los que no quieran cerrar los ojos a la luz, que los trabajos y granjerias de los indios deben ordenarse a la propia utilidad de ellos. No hay que hacer con los pobres indios lo que el colmenero que no deja en los panales más miel que la que basta para sustentar las abejas, y la demás la coge para sí; o lo que hacen los que trasquilan las ovejas, que les quitan toda la lana sin dejarles más que las raíces, para que la sigan criando. No se puede hacer eso con los indios. Fuera de lo que una prudente caridad tase como necesario para su gobierno político y espiritual, todo lo demás que se tome a los indios bajo pretexto de su salud y bienestar es manifiesta rapiña."
[Zitat in: Cronistas que describen la colonia, las relaciones geografica, la extirpación de idolatrias / Francisco Carrillo. -- Lima : Horizonte, ©1990. -- (Enciclopedia historica de la literatura peruana ; 5). -- S. 91f.]
Aus De promulgatione evangelii apud barbaros sive de procuranda indorum salute [Buch I, Auszug aus Kapitel II:] "Wie man die Indios behandeln muss, um sie für Christus zu gewinnen
Die Verachtung, die die Griechen für die Barbaren bekundeten oder unsere Landsleute für die Indios, ist ziemlich dasselbe, als wenn man die Tiere für geringer hält als die Menschen. Für beide aber hat die Güte Gottes einen Platz bereit. Beide versammelt er in seinem Hause. „Ich werde säen", so sagt er durch Jeremias, „das Haus Juda und das Haus Israel mit dem Samen der Menschen und dem Samen des Viehs" (Hier. 31,27).
Es gibt nur eine Kirche Gottes, und sie verbreitet sich nicht nur mit dem Samen der Menschen, sondern auch der Tiere. Und voll Staunen über Gottes herrliches Wirken ruft der Prophet aus: „Wie umfassend ist Dein Erbarmen, Gott!" Und warum? Weil Er gesagt hatte: „Du wirst erretten, Herr, die Menschen und das Vieh" (Ps. 35,7). An diese Worte knüpft Ambrosius die Fragestellung: „Was sind Menschen und was sind Tiere? Die einen sind vernunftbegabte, die anderen unvernünftige Wesen. Die Vernünftigen errettet Seine Gerechtigkeit, die Unvernünftigen Sein Erbarmen; die einen werden geleitet, die anderen ernährt" (Ambros. Enarratio in PS. 35, n. 19.ML. 14,969). Derselben Auslegung folgen andere Kirchenväter wie Hieronymus (Hieron. In Hieremiam, c. 31, v. 37.ML.24,916; et in Jonam c. 3.ML.25,11430, II44A.) und Gregor (Gregor. Moral. L. n, c.2 - nunc c. 3 -, n. 5 ML 75,9550.); letzterer sagt über die Worte „Deine Tiere werden in Deinem Hause wohnen" (Ps. 67,11): „Wahrhaftig wird in der Kirche Christi sogar das Vieh selig, weil Gottes Barmherzigkeit sich auf alles erstreckt."
Triffst du einen Menschen mit mangelndem Gefühl, schwer von Begriff und unfähig zu urteilen, so verachte ihn nicht und halte ihn nicht für untauglich für das Himmelreich. Er versteht von den göttlichen Dingen nichts (i Kor. 2,14), und was man auch an Geistlichem an ihn heranträgt, schmeckt ihm nach Torheit, und er ist nicht fähig, es zu begreifen. Stoße ihn dennoch nicht zurück, auch ihn will und kann der erlösen, der nicht möchte, dass jemand verderbe (2 Petr. 3,9); die Mysterien des Glaubens spricht er zwar mit den Lippen, versteht sie jedoch nicht, und vermag sie kaum nachzusprechen; selbst wenn man sie immer aufs neue wiederholt und sie ihm mit Nachdruck eintrichtert, lernt er fast nichts, verharrt stumm und bleibt dumm; es ist, als ob du einem Esel das Singen beibringen wolltest.
Ich wiederhole: Verliere nicht den Mut; der Indio oder Neger ist ein unvernünftiges Wesen, ein Stück Vieh. Höre auf Ambrosius, der da sagt, man muss diese Wesen zum Glauben bringen mit dem Halfter des Wortes. Selbst wenn sie das, was sie hören, nicht vollends begreifen, so lernen sie doch fortwährend durch den Glauben, und das genügt für ihre Errettung; denn andernfalls, wenn sie nicht so viel glauben könnten wie nötig, wie soll dann wahr sein, dass, wer nicht glaubet, verdammt werde (Mc. 16,16)? Oder du bildest dir gar ein, mit der Verkündigung des Evangeliums würden sie erst in die Gefahr der Verdammnis kommen und nicht mehr errettet werden können; das aber wäre kleingläubig und klänge im Munde eines Christen geradezu nach Gotteslästerung.
Nein, man muss daran festhalten: Es gibt keine Barbaren ohne jede Fähigkeit zur Glaubenserkenntnis. Erst recht sind die Indios, wie alle wissen, die mit ihnen zu tun haben, nicht so schwach bei Verstand, und wenn sie ihn nur anwenden wollten, lieferten sie Beweise von recht ordentlichen Anlagen und hinreichender Einsicht. Aber man muss auch hinweisen auf ihre verderbten Sitten; sie lassen sich völlig von der Begierde ihres Bauches und ihrer Sinnlichkeit regieren und hängen nach wie vor ihrem alten Aberglauben an. Trotzdem gibt es auch für sie die Erlösung, wenn sie nur richtig geführt werden. Drücke dem Esel das Maul mit Zügel und Zaum (Ps. 31,9) und lege ihm die rechte Last auf, nimm, wenn es nicht anders geht, den Stachel, und wenn er ausschlägt, so stoße nicht blindwütig mit dem Schwert zu, sondern schlage mit Maßen; zügle ihn allmählich, bis er sich an den Gehorsam gewöhnt. Wenn dein Pferd störrisch ist oder den Reiter abwirft oder den Zaum aus dem Maul reißt, wirst du es doch nicht abstechen oder aus deinem Haus jagen, denn es ist ja dein; du hast es mit deinem Geld gekauft und willst es nicht verlieren. Wenn aber ein Mensch nicht gleich die himmlischen Lehren annimmt oder sich nicht dem Willen des Meisters anbequemt, soll man ihn dann gleich verabscheuen und verwerfen? Ist der Preis, den Christus für ihn bezahlt, und das Blut, das er vergossen hat, nichts wert?
Es besteht kein Zweifel: Die Erfahrung bestätigt die Sklavennatur der Barbaren, und wenn man nicht die Furcht als Mittel einsetzt und sie mit Gewalt zwingt wie Kinder, widersetzen sie sich und gehorchen nicht. Was soll man dann machen? Sollen nur freie Männer von adeligem Sinn auf ihre Erlösung hoffen dürfen? Darf man nicht auch den Kindern Jesus Christus als Lehrer und Meister geben? Natürlich, das muss man tun; man muss vorsichtig und wachsam mit ihnen umgehen; man muss die Peitsche brauchen, nur im Namen Christi; man muss Zwang anwenden im Namen des Herrn, damit sie Zutritt erhalten zum großen Abendmahl (Lc. 14,23), denn man soll nicht ihr Gut, sondern sie selber suchen. So spricht der Weise: „Rute und Zucht bringen Weisheit, und der Knabe, den man seinen Launen überlässt, macht seiner Mutter Schande" (Prov.29,15). Und weiter unten: „Den Sklaven kannst du nicht mit Worten anleiten; er versteht wohl, was du ihm sagst, denkt aber nicht daran, dem nachzukommen" (Prov.29,19). Und an anderer Stelle: „Dem Esel die Gerste, der Stock und die Last; das Brot, die Zucht und die Arbeit dem Sklaven; mit Hilfe der Zucht arbeitet er, sich nach der Ruhe sehnend; ist deine Hand zu leicht, dann wird er die Freiheit suchen" (Eccli. 33,25,26). Also: Wenn ihn die Arbeit drückt, denkt er an den Müßiggang. Was macht er, wenn er sich frei sieht und ausgeruht ist? Dann denkt er an Flucht, und deshalb heißt es: „Das Joch und der Riemen beugen den harten Nacken, und den Sklaven zähmt ständige Arbeit" (Eccli. 33,27). Und anschließend: „Halte ihn zur Arbeit an, damit er nicht müßig geht, denn der Müßiggang lehrt ihn tausend Bosheiten" (33,28).
Wenn sich auch diese Ratschläge auf die Anleitung von Sklaven beziehen -und wie weise sie sind, sehen wir aus den Erfahrungen in dieser Weltgegend hier, die voll ist von Negersklaven in den Haushalten und anderen Beschäftigungen -, so passen sie nicht minder gut für die Indios, die zwar freien Standes, aber in ihren Sitten und ihrer Natur nach wie Knechte sind. [. . .]
[Buch VI, Auszug aus Kapitel II:] In dieser neuen Welt wird häufig gegen die Gebräuche der Kirche verstoßen
Kaum hatten wir, geleitet von unserer Gehorsamspflicht, diese Gegenden Indiens betreten, mussten wir mit Erstaunen, Bestürzung und Schmerz wahrnehmen, dass in der Verwaltung der Sakramente Praktiken im Schwange waren, die den kirchlichen Einrichtungen wenig dienten und mitunter völlig ungeeignet und geradezu absurd waren.
Für mich ist es so gut wie gewiss: Diese Missstände können nur davon herrühren, dass das Evangelium in diesem Land weniger durch die Prediger als durch die Soldaten seinen Einzug hielt. Deren Beschränktheit und Unerfahrenheit ließ so manches aufkommen, was zu verurteilen ist. Man hat sich aber so daran gewöhnt, dass man es nun für legitim hält.
So ebneten die ersten den Weg für die Irrtümer der Nachfolgenden, und die Gelehrten und frommen Männer tun sich schwer, der altbewährten Kirchendisziplin wieder Geltung zu verschaffen. Man wirft ihnen Unerfahrenheit in den Verhältnissen Indiens vor, sobald sie bemüht sind, den Indios die Sakramente voll zuteilwerden zu lassen und die Religion in ihrer ganzen Fülle zu lehren.
Obwohl im Provinzialkonzil von Lima1 alle Bischöfe Perus und viele andere ernsthafte Männer viel Zeit und Mühe darauf verwandten, Missstände abzustellen, und zahlreiche sehr gute Reformdekrete veröffentlicht wurden, ist nicht mehr dabei herausgekommen, als wenn sich ein paar müßige Matrosen zusammengesetzt hätten, um über staatspolitische Dinge ihre Meinung abzugeben.
Wen schmerzt es nicht, dass in den ersten Jahren zahllose Indios getauft wurden, bevor sie auch nur annähernd mit der christlichen Lehre vertraut waren, und dass dies heute noch so weitergeht, ohne dass sich einer darum kümmert, ob sie auch wirklich ihr in Laster und Aberglauben verbrachtes Leben bereuen und die Taufe überhaupt begehren?
Ist es nicht zum Weinen, dass Beichten abgenommen werden, wo der Indio nicht den Priester und der Priester den Indio nicht versteht, und die Pfarrer dabei oft so fest schlafen, dass sie sich gar nicht nach den Sünden erkundigen und auch nicht prüfen, ob die Reue echt ist, sondern immer nur darauf bedacht sind, das Beichtkind so schnell wie möglich loszuwerden?
Und nun zur Eucharistie! Warum hindert man die Indios gegen alles göttliche und kirchliche Recht daran, die Kommunion alljährlich zu empfangen, warum enthält man sie ihnen sogar in der Stunde des Todes und nach der Beichte vor? Und wenn einer der Unsrigen einem Sterbenden die heilige Wegzehrung spenden und ihn stärken will, dann bezichtigen sie ihn der Neuerung, und es fehlt wenig, dass sie ihn nicht der Gotteslästerung für schuldig erachten. Und wenn man ihnen schon aus Pietät die Kommunion verweigert, warum gibt man ihnen nicht wenigstens die letzte Ölung? Solchermaßen wird das Heil den Indios vorenthalten, nicht nur irgendwo im Urwald und in abgelegenen Dörfern, sondern hier in der Stadt [Lima], ja sogar im geistlich geführten Indianerhospiz. Beispiele dieser Art sind keine Seltenheit."
[Hinweis: Die Angaben der Bibelzitate folgen den Abkürzungen in Latein. Bei den Kirchenvätern verweist die Übersetzung ins Spanische, von der hier ausgegangen wurde, auf die „Patrologiae Cursus Completus . . .", accuranta J. P. Migne: Series Latina (ML), Paris 1878 sg.; Series Graeca (MG), Paris 1886 sg.]
[Übersetzung: Der Aufbau der Kolonialreiche / hrgg. von Matthias Meyn ... -- München : Beck, ©1987. -- (Dokumente zur Geschichet der europäischen Expansion ; Bd. 3). -- ISBN 3406303730. -- S. 512 - 515. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1588-07/08
Beim Versuch, England zu erobern, wird ein Teil der spanischen Flotte (Armada) vernichtet, ein anderer Teil fällt vor der schottischen und irischen Westküste dem Sturm zum Opfer.
1589
Spanien erklärt schon wieder den Staatsbankrott. Es sieht sich nicht mehr fähig, die fälligen Zinsen die Kredite zu bezahlen. Dies bedeutet eine Umschuldung: kurzfristige Kredite mit hohem Zins werden von den Gläubigern in langfristige mit niedrigem Zins umgewandelt.
1589 - 1596
|
1590
Während die Staatseinnahmen aus Perú 1568 100.000 Dukaten betrugen, sind sie jetzt vor allem dank der Edelmetalle aus Amerika auf über eine Million Dukaten angestiegen.
1592
Jesuitenniederlassung in Chuquisaca (heute: Sucre)
1594
Der Kaufmann Justo Canes aus Ghent ersucht um die Staatsbürgerschaft Kastiliens, um mit Hispanoamaerika Handel treiben zu dürfen [Archivo de Indias, Sevilla][Bildquelle: Discovering the Americas : the Archive of the Indies / by Pedro González García ... -- New York [u.a.] : Vendome, ©1997. -- ISBN 0-86565-991-5. -- S. 106]
1596 - 1604
|
1596
Bry, Theodor de <1528-1598>: [America. Sive, Historiae ab Hieronymo Be[n]zono scriptae, sectio tertia ... In hac ... reperies, qua ratione Hispani ... Peruäni regni provincias occuparint, capto rege Atabaliba ... Additus est ... de Fortunatis insulis co[m]mentariolus ... Accessit Perväni regni chorographica tabula., pt. 6.] Americae pars sexta / omnia figuris in aes incisis expressa à Theodoro de Bry. -- [Francoforti] , 1596. -- 108 S. : Ill.
Abb.: Lamakarawane, aus dem Werk de Bry's[Vorlage der Abb.: Crespo Rodas, Alberto <1917 - >: Alemanes en Bolivia. -- La Paz [u.a.] : Los Amigos del Libro, 1978. -- Depósito legal La Paz 170/77. -- S. 65]
1596
Der Jesuit Antonio de Ayanz (1559, Güendulain - 1598, La Paz) zur Mita (Arbeitsverpflichtung für Indios im Silberbergbau):
"Kurze Schilderung der Leiden und Benachteiligungen, denen die Indios von der Gegend um Cuzco bis nach Potosí aus der besten und reichsten Region Perus ausgesetzt sind. Dieser Bericht ist verfasst von sehr erfahrenen und gewissenhaften Personen, die von jeglichem Interesse an weltlichen Gütern frei sind und deren einziger Wunsch es ist, dass Gott unser Herr nicht allzu erzürnt sein möge über all den Schaden, den die Indios an ihren Seelen und ihrem Gut erleiden; ferner dass das Gewissen Seiner Majestät erleichtert und nichts von den königlichen Einkünften veruntreut werde, sondern diese fürderhin ungeschmälert der Krone zufließen (1596) In den Provinzen zwischen Potosí und der Gegend von Cuzco hat die Indiobevölkerung derart abgenommen, dass die Dörfer verlassen und die Versorgungsstationen (tambos) ohne Personal und Bedienung sind. Es ist schon überall bekannt, wie menschenleer und verlassen das ganze Land ist. Neben anderen Schäden erwächst daraus ein großer Nachteil für die königlichen Finanzen: in vielen Gegenden können keine Tribute und Steuern mehr erhoben werden, und viele Einwohner sind schon im Verzug mit den Abgaben. [. . .]
Es gibt, abgesehen von einigen anderen gewichtigen und nachfolgend aufgeführten Motiven; zwei Hauptgründe für die Flucht so vieler Indios aus ihren Dörfern in andere Gegenden:
- Alljährlich ziehen viele Indios nach Potosí, um die Mita von Potosí, d. h. die Arbeitsverpflichtung in den Minen, abzuleisten.
- Es werden dauernd und in großem Umfang Waren von einer Provinz zur anderen transportiert. [. . .]
1. Kapitel: Über die Mita von Potosí und die Schäden und Nachteile, welche die Indios dadurch erleiden
In der ganzen Welt sind die großen Silberschätze bekannt, die aus diesem Reich Peru, vor allem aus dem Berg und den Silberminen von Potosí kommen. Dieser Berg liegt in einer Entfernung von 40 bis mehr als 100 Meilen [200-600 km] von den Dörfern der Indios entfernt, die dort arbeiten. Auf Grund der Beschaffenheit des Landes liegen die Wohngebiete der Indios nicht beiderseits der Stadt Potosí, sondern ziehen sich an der Stadt entlang.
Aus den übrigen Bezirken oder Provinzen kommen alljährlich insgesamt 13 000 Indios, um in den Bergwerken zu arbeiten. Zwar erfüllen einige Orte ihre Verpflichtung, Arbeiter zu stellen, in voller Höhe, doch die meisten sind nicht in der Lage, die von ihnen geforderte Zahl von Arbeitskräften zu entsenden.
Zum besseren Verständnis dieses Sachverhalts soll hier aufgeführt werden, welche Veränderungen sich alljährlich in der Provinz Chucuito [Titicaca—Hochland] durch Abwanderung und Rückkehr von Indios ergeben. Ähnliche Verhältnisse müssen in den übrigen Provinzen, wie z.B. bei den Carangas, bei den Pacajes und in Paria und Humasuyo, auf der ganzen [Hochebene von] Collado und im Gebiet der Canas und Canches [südlich von Cuzco] vorausgesetzt werden. Diese Provinz [Chucuito] teilt sich in sieben Bezirke auf. Bei der letzten Zählung vor 16 Jahren lebten dort insgesamt 17000 Indios im Alter von 18 bis 50 Jahren, wobei auch die jeweils Abwesenden mitgezählt wurden. Vor einigen Jahren gingen von dort nur 1100 Indios zur Mita. Auf Geheiß des damaligen Vizekönigs D. Francisco de Toledo wurde diese Zahl auf 2200 erhöht.
- Diese Indios nehmen normalerweise ihre Frauen und Kinder mit, so dass sich ihre Gesamtzahl auf über 7000 Seelen beläuft. Jeder Indio nimmt zudem mindestens 8-10 Lamas sowie einige Pacos oder Alpacas als Schlachttiere mit. Andere, die mehr Besitz haben, nehmen 30-40 Lamas mit, auf denen sie Nahrungsmittel, Kochgerät sowie die groben Wolldecken transportieren, mit denen sie sich zudecken und vor der Kälte schützen, denn sie schlafen immer im Freien.
Die Indios nehmen also je nach der Größe ihres Besitzes mehr oder weniger Vieh mit, so dass im allgemeinen zwischen 40000 und 45000 Stück Vieh mitgeführt werden; in einem Jahr waren es sogar 53000. Zusammen mit Chuno [gefrorenen und getrockneten Kartoffeln], Mais, Quinoamehl und Dörrfleisch, das sie Charqui nennen, sowie neuen Kleidungsstücken dürfte der "Wert des Mitgeführten mehr als 320000 Pesos derzeitiger Währung betragen.
So machen sich diese Indios mit all ihrer beweglichen Habe auf den Weg nach Potosí, und für die Strecke von etwa 100 Meilen brauchen sie normalerweise zwei Monate, denn sie können das Vieh nicht zu größerer Eile antreiben. Auf dem ganzen Hinweg und auch auf dem Rückweg in ihre Dörfer verpflegen sie sich auf eigene Kosten, ohne dass sie für diesen beträchtlichen Aufwand irgendeine Entschädigung erhalten.
- Sie lassen ihren Heimatort, ihre Herden und Acker schutzlos zurück. Auch wenn einige das wenige, was sie zurücklassen, ihren Verwandten anvertrauen und tatsächlich zurückkehren, finden sie ihren Besitz so verwahrlost und schlecht geführt vor, dass sie es für besser halten, überhaupt nicht mehr heimzukommen, weil sie aus Erfahrung wissen, dass nur neue Not und Mühsal auf sie zukommt.
- Bei der Trennung spielen sich zwischen den Dorfbewohnern bewegende und traurige Szenen ab, wie bei Leuten, die gegen ihren Wunsch ihre Heimat verlassen und sich in offenkundige Lebensgefahr begeben, wie später noch zu beschreiben sein wird, und die aus gutem Grund befürchten müssen, darin umzukommen. Andere werden von dem Gedanken an die Mühsal und den Verlust ihres Besitzes, die ihnen bevorstehen, so verstört und aus der Bahn geworfen, dass sie sich dem Laster und der Trunksucht hingeben. Andere nehmen [den Auszug in die Fremde] zum Anlass, ihre Frauen zu verlassen, und leben mit ihren Töchtern oder Schwestern oder mit anderen Indiofrauen in wilder Ehe zusammen. Da der Geistliche der Pfarrei, in der sie sich nach ihrer Ankunft in Potosí niederlassen, dies nicht anerkennt, verbleiben sie in ihren sündigen Lebensumständen, und nach Ablauf ihres Mitajahres flüchten sie in die Täler und schlüpfen bei irgendeinem Chacarero [spanischem Landbesitzer] unter, der ihre wilde Ehe anerkennt.
So ergibt es sich, dass in der genannten Provinz die Frauen [oft] ohne eigene Schuld über sieben, acht oder gar zehn Jahre die Steuern ihrer Männer zahlen müssen, und ihr Weinen und Klagen ist herzzerreißend mitanzusehen. [. . .] Auf die gleiche Weise werden die Steuern von den Töchtern und Schwestern vieler abwesender Indios erhoben, von denen nicht feststeht, ob sie tot sind oder ob und wohin sie geflüchtet sind und was aus ihnen geworden ist, und jene zahlen die gesamten Steuern über viele Jahre mit ebensoviel Weinen und Klagen wie die vorher genannten Frauen.
- Wenn alle diese Leute in Potosí angekommen sind, wird ihre Zahl überprüft, und wenn einer fehlt oder wenn von denen, die die Provinz verlassen haben, 100 oder 200 Indios in die Täler geflohen sind, die zu beiden Seiten des Weges liegen, wird ein Justizbeamter auf Tagegeld von Potosí ausgesandt, um Ersatz für die Fehlenden in gleicher Anzahl aus ihrer Provinz zu holen. Da aber nie nach denen gesucht wird, die in die Täler geflohen sind, und da so wenige aus Potosí zurückkehren, hat die Bevölkerung immer mehr abgenommen, so dass heute die Zahl von 2200 Indios, die alljährlich nach Potosí zogen, nicht mehr erreicht werden kann, selbst wenn heute alle Bewohner der Provinz Chucuito auf einmal herausgeholt würden.
Obwohl Don Francisco de Toledo nur deshalb 200 Indios zusätzlich zu den 2000 anforderte, um die Ausfälle, Verluste und Desertionen der übrigen auszugleichen, hat man sich nie daran gehalten. Auch wenn nur 20 Indios fehlen, werden, wie oben erwähnt, besagte Lohnbeamte ihretwegen ausgesandt. Oft kommen die Beamten aus Potosí nur in die Provinz, um den Lohn für ihre Reisetage einzufordern, und auch wenn die Kaziken, denen die Bereitstellung der fehlenden Indios obliegt, gar keine Schuld trifft, weil sie keine Indios mehr haben, so müssen sie doch dem Beamten Strafgelder zahlen. Die Beamten sind von Potosí aus mit solchen Machtmitteln ausgestattet, dass sie diese Gelder eintreiben können, ohne Gewalt anwenden zu müssen, und sie werden mit Namen bedacht, die man hier gar nicht wiedergeben kann.
- Wenn die Indios sich in ihren Pfarrgemeinden niedergelassen haben, werden sie zur Arbeit in den Bergwerken gezwungen; diejenigen, die diese Zwangsarbeit verrichten, werden Indios Cedulas genannt. Wenn ein Spanier oder Minero [Grubenverwalter] eine Cedula13 für 10 oder 20 Indios erhält, geht er zu ihren Unterkünften und holt sie mit roher Gewalt unter Peitschenhieben und Misshandlungen heraus, wenn sie sich nicht so beeilen, wie er es wünscht. Wenn der zum Anführer ernannte Indio ihm nicht die volle auf der Cedula genannte Anzahl von Indios bereitstellt, wird er oft geohrfeigt und misshandelt, bis die volle Zahl erreicht ist. Wenn der Minero seine Indios so weit gebracht hat, dass sie in das Bergwerk einfahren und das Metall abbauen, und wenn sie ihm dann nicht genug herausholen, bekommen sie solche Peitschenhiebe und Fußtritte, dass viele behaupten, die Peitschenhiebe auf den Galeeren seien weniger schlimm. Dabei kann der arme Indio oft gar nicht mehr, denn die Mine ist sehr tief, die schweren Lasten erschöpfen seine Kräfte und er muss befürchten, zu stürzen und zu Tode zu kommen. Da das Metall sehr hart ist und der Arbeiter mit der Brechstange nur sehr wenig fördern kann, fürchten die Indios diese harte und schwere Arbeit sehr, zumal es oft vorgekommen ist und immer noch geschieht, dass die Spanier die Indios mit Tritten und Peitschenhieben zu Tode schinden.
- Der Lohn, den sie als Entschädigung wöchentlich erhalten, beträgt 2x/2 Pesos heutiger Währung, was 20 Realen entspricht. Um ermessen zu können, in welch schlimme und elende Lage sie durch eine solchen Hungerlohn versetzt werden, soll hier gesagt werden, wie viel sie bei größter Einschränkung zum Leben ausgeben müssen:
In den letzten Jahren hat eine Fanega [55 1] getrockneter Kartoffeln (chuno) 20, 22 und 24 Pesos heutiger Währung und auch mehr gekostet und eine Fanega Mais kaum weniger. Wenn man nun rechnet, dass ein Indio im Monat mindestens eine halbe Fanega Chuno isst — bei Mais ist es noch mehr, weil dieser beim Kochen nicht aufquillt wie der Chuno -, so bezahlt er für diese halbe Fanega 10 Pesos, meist aber noch mehr; außerdem gibt er im Monat noch wenigstens 2 Pesos für Maismehl aus. Pro Monat verbraucht er das Fleisch eines Alpacas, und wenn es 4 Pesos kostet, ist das noch wenig. Für Fisch, Pfeffer und Salz zahlt er immer 2 Pesos, für Brennmaterial zum Kochen wie Holz oder Lama-Mist mit Stroh, was sie Hichu nennen, gibt er wöchentlich einen Peso aus, denn dort ist das sehr teuer; am Monatsende sind das 4^/2 Pesos. Die meisten Indios verbrauchen täglich Coca im Wert von 2 Realen; da jährlich Tausende von Körben voll Coca nach Potosí geliefert werden, ist klar, dass es alle nehmen. Manche geben täglich 2 Realen aus, andere il/2, und wieder andere - allerdings nur wenige - einen Real. Das ergibt, wenn man einen möglichst niedrigen Wert ansetzt, mindestens 5 Pesos monatlich. Dazu käme noch ein Peso, den ein Indio mindestens pro Monat für Chicha [Maisbier] ausgibt. Dieser Posten ist aber in dieser Aufstellung ebensowenig berücksichtigt wie Obst und andere Dinge, die hie und da nur dann gekauft werden, wenn man sie dringend braucht.
Es ergibt sich so ein Gesamtbetrag von 281/2 Pesos; nicht eingerechnet sind dabei die Ausgaben für Kochgeschirr, für die Decken, die bei der Arbeit im Bergwerk schadhaft werden, für Kleidung, für die jährliche Steuer von 30 Pesos heutiger Währung, sowie die Ausgaben für Essen und Kleidung von Frau und Kindern, die mindestens genauso hoch sind wie für den Indio selbst. Zu all diesem kommt noch, dass der Minero ihm oft nicht den vollen Lohn zahlt, weil er angeblich seine Arbeit nicht im vollen Umfang erledigt hat, so dass der arme Indio im Monat nur so viel bekommt, wie er für seine eigene Person ausgibt. Mit Steuern und Ausgaben für Kleidung wären dies mehr als 32 Pesos, wozu dann noch Essen und Kleidung für die Familie kommen, was über 60 Pesos ergibt. Der Lohn dagegen, den er ausbezahlt bekommt, beträgt oft nur 11 1/2 Pesos. [. . .]
- Neben den obengenannten Verlusten, der Strenge und den Peitschenhieben der Mineros sowie den anderen bereits geschilderten elenden Lebensumständen fürchten die Indios vor allem die große Lebensgefahr, in die sie sich beim Einfahren in die Gruben begeben. Diese sind nämlich sehr tief und das Ein- und Ausfahren wegen der häufigen Erdrutsche und des Steinschlags äußerst gefährlich; viele sind durch herabfallendes Gestein schon übel zugerichtet oder gar getötet worden. Manche rutschen auch auf den aus Lederriemen gefertigten Leitern aus, und wenn einem Vorausgehenden etwas aus der Hand fällt oder er durch irgendein Missgeschick ausgleitet, verletzt oder tötet er die hinter ihm Gehenden. So werden jede Woche mindestens sieben oder acht Bergarbeiter verletzt, erleiden Bein-, Arm- oder Schädelbrüche oder Verletzungen am ganzen Körper. Alle zwei Wochen werden ein bis zwei tödliche Unfälle bekannt, ganz abgesehen von jenen Vermissten, die wohl zerschmettert am Grunde des Schachts liegen. Darüber hinaus gibt es oft Unfälle mit 30 oder 40 Toten, wenn ein Teil des Bergwerks einstürzt und die Arbeiter verschüttet. Manche werden bei lebendigem Leib begraben, und von benachbarten Stollen nimmt man ihnen mit lauten Rufen die Beichte ab. All diese Dinge müssen größtes Bedauern und Mitleid erwecken, und diejenigen, die sie erleiden, fürchten sie mehr als den Tod. Und so geschieht es, dass manche dieser unglücklichen Indios - Gott gebe es, es wären nicht so viele - unter dem Druck der erfahrenen Mühsale, bei denen sie so viel von ihrer Habe verloren und nur die anderen bereichert haben, aus Furcht vor der Gewalttätigkeit und Härte der ihre Arbeit beaufsichtigenden Mineros, angesichts der beständigen Lebensgefahr und vor Kummer darüber, dass sie ihre Heimat verlassen mussten, sich vom Teufel in falscher Hoffnung täuschen lassen, am Leben verzweifeln und sich erhängen. So hat es allein in einem Dorf dieser Provinz fast jedes Jahr einen Fall von Erhängen gegeben; doch das wird verschwiegen, und man versucht nicht mehr, solche Fälle bei Stellen vorzubringen, von denen man sich Abhilfe erhofft.
Viele Indios, die über einen gewissen Wohlstand verfügen, werben für Geld andere an, die an ihrer Stelle nach Potosí gehen, wenn die Mita sie trifft. Die Mindestpreise, die von manchen noch überboten werden, sind im folgenden aufgeführt: Zunächst 30 Alpacas im Wert von 300 Pesos, 12 Lamas im Wert von 50 Pesos, außerdem 8 Traglasten Lebensmittel, zusammen 4 Fanegas im Wert von 36 Pesos. Manchmal bieten sie auch 12 Traglasten und geben darüber hinaus zwei Ausstattungen mit neuer Kleidung. Außerdem zahlen sie 30 Pesos heutiger Währung, die sie als Steuern in Potosí zahlen. Zusammen ergibt sich ein Betrag von mehr als 426 Pesos für einen Indio allein. Man schätzt sich glücklich, wenn man jemand gefunden hat, der bereit ist, für diese Bezahlung [nach Potosí] zu gehen; dieser erhält dann zusätzlich zu der obengenannten Entschädigung noch den Lohn, der ihm in Potosí gezahlt wird.
Gemäß den Anweisungen des Don Francisco de Toledo müssen die genannten 2200 Indios nach Ablauf ihrer einjährigen Mita in ihre Dörfer zurückkehren, wenn die nächsten 2200 eintreffen, die nach ihnen dieselben Arbeiten übernehmen.
Während bisher [der Rückkehr der Indios in ihre Heimatdörfer] keinerlei Beachtung geschenkt wurde, erscheint es zweckmäßig, hier anzugeben, wie viele zurückkehren, was sie von ihrem ursprünglich mitgeführten Besitz wieder zurückbringen und wieviel sie in Potosí verdient haben.
Auf Grund von gesicherten Aussagen und nicht nur von Vermutungen und Annahmen ist bekannt, dass nicht einmal 500 Indios zurückkehren, während der Rest mit Frauen und Kindern, zusammen etwa 5000 Seelen, in Potosí bleibt oder in den Tälern abseits des Weges verschwindet. [. . .]
Von den mehr als 30000 Stück Vieh, die sie mit sich geführt hatten, kommen weniger als 1000 oder gar 500 zurück, und die Indios kehren so arm und zerlumpt zurück, dass es Mitleid erregt, wie sie von Tür zu Tür und bei den Vorübergehenden um Almosen betteln. Dabei trägt der Mann ein Kind, die Frau ein zweites auf dem Rücken, und im allgemeinen weiß man schon, ohne zu fragen, woher sie kommen, wenn man sie nur sieht, wie sie so arm und zerlumpt mit Klagen, Tränen und tiefgebeugt Almosen erbetteln, um in ihre Dörfer zurückkehren zu können. Wenn ein Indio etwas Geld mit heimbringt, dann ist es keiner von denen, die gearbeitet haben, sondern einer, der angeschafft hat. Wenn man nun überschlägt, dass jeder dieser 2200 Indios 30 Pesos an Steuern an den König gezahlt hat, welch große Mengen an Silber die Mineros aus den Bergwerken abgebaut haben, wie reich sie durch die Arbeit der Indios geworden sind und wie viel sie davon als Quinto [Fünftel] an Seine Majestät entrichtet haben; ferner, dass viele, denen 10 oder 20 Indios de Cedula zugeteilt wurden, pro Jahr an jedem Indio schätzungsweise 100 Pesos verdient haben; [wenn man zudem bedenkt,] dass die bedauernswerten Indios von ihrem Besitz mehr als 320000 Pesos mitgebracht und völlig verbraucht haben, um sich ernähren, kleiden und die Steuern bezahlen zu können, und ohne einen Real oder Maravedi zurückkehren; dass diejenigen, die in die Täler fliehen oder in Potosí bleiben, ganz ohne Mittel dastehen, so ist aus dieser Rechnung nur der Schluss zu ziehen, dass sich alle anderen an ihnen bereichern und sie allein in der beschriebenen Weise verarmen.
Einige Kaziken lassen sich oft bestechen und schicken nicht die Indios nach Potosí, die entsprechend dem Verteilungsplan eigentlich dazu verpflichtet wären. Dafür lassen sie sich 200 oder 300 Silberpesos oder Gegenstände in entsprechendem Wert schenken. Manchmal werden sie auch bestochen, um solche Indios zu benennen, die eigentlich nicht nach Potosí gehen müssten.
2. Kapitel: Beschreibung des Trajín und der Schäden und Nachteile, welche den Indios daraus erwachsen
Im folgenden wird beschrieben, was der Transportdienst (trajín) eigentlich ist. Dann wird der Grund klar, warum die Indios nicht in ihre Dörfer zurückkehren. Sobald sie nämlich zurückkommen, werden sie sofort zum Transportdienst verpflichtet, und anstatt von den Strapazen auszuruhen, die sie in Potosí erlitten haben, müssen sie gleich wieder an die Arbeit, wobei sie wieder große Verluste hinnehmen müssen.
Der Transportdienst ist folgendermaßen organisiert: Der Corregidor einer Provinz weist die Kaziken seines Bezirks an, ihm 100 Indios zur Verfügung zu stellen, die mit den Lasttieren dieses Corregidors Coca aus Paucar-tambo und Wein aus den Tälern von Arequipa holen sollen. Manchmal kauft er selbst die Coca oder den Wein und lässt sie auf seinen Lasttieren transportieren, manchmal sind die Waren für andere bestimmt, und er hat sich gegen Bezahlung verpflichtet, sie mit seinen Lasttieren und den Indios nach Potosí zu bringen; das wird dann als Frachtauftrag oder „fletar" für Wein oder Coca bezeichnet. Außerdem geben die Corregidores oft dahergelaufenen Soldaten und Freunden die Anweisung, bei den Kaziken ihres Gerichtssprengels die von ihnen angeforderten Indios auszuheben. Pro Monat erhält jeder Indio 5 Pesos zu 8 Realen; die ausgehobenen Indios übernehmen die Verantwortung für die Lasttiere und ziehen damit zu dem Ort, wo Coca oder Wein aufgeladen wird. Anschließend kehren sie mit den Tieren zu ihrem Dorf zurück und werden dort von anderen abgelöst, die den Transport nach Potosí übernehmen. Für den ganzen Weg brauchen sie gewöhnlich sechs oder sieben Monate und manchmal auch mehr. Dabei muss man berücksichtigen, dass die Indios, die den Transport übernehmen, für den Rückweg in ihre Dörfer keine Bezahlung bekommen, und nach kurzer Zeit sind so wenige Indios in den Dörfern übrig, dass keine Ablösung mehr vorgenommen wird, sondern ein und derselbe Indio den Transport über die ganze Strecke übernehmen muss. Auch dieser Dienst ist mit einer kaum tragbaren Verantwortung verbunden, und die Indios fürchten und verabscheuen ihn fast ebenso wie die Arbeitsverpflichtung in Potosí:
- Der Monatslohn von 5 Pesos ist äußerst niedrig, denn der monatliche Verbrauch jedes Indios ist ebenso hoch wie bereits im Kapitel über Potosí beschrieben, außer dass die Preise etwas niedriger liegen. [. . .]
- Sie müssen auf eigene Kosten die Isargas [Netze, in denen die Weinkrüge transportiert werden] und Seile aus Espartogras flechten.
- Jeder von diesen Indios führt zwei eigene Lamas mit, beladen mit seinen Lebensmitteln sowie einer Schlafdecke und einer Matte, mit der er sich nachts vor Kälte und Nässe schützt, denn die Indios schlafen immer im Freien.
- Der Auftraggeber verlangt von diesen Indios die vollständige Übergabe der Lasttiere zusammen mit den Weinkrügen und den Coca-Körben. Wenn nun etwas fehlt und der Indio keine klare und eindeutige Erklärung abgeben kann, dass er keine Schuld daran trägt, muss er den ganzen Schaden selbst bezahlen.
Zwar ist es nicht zu leugnen, dass die Indios manchmal etwas stehlen, vor allem, wenn sie meinen, dass es nicht auffallen wird. Der Normalfall ist aber, dass Weinkrüge gegeneinanderschlagen und ohne Verschulden der Indios zerbrechen, weil so viele Lasttiere eng beieinander gehen. In anderen Fällen ragen auf der Strecke Felsen in den Weg hinein, so dass die Krüge dagegenschlagen. Ein andermal stoßen sie gegen Häuserecken in den Orten, durch die sie ziehen. Sehr oft kommt es auch vor, dass das Lasttier aus irgendeinem Grund scheut, einen Satz tut, als erstes ein paar Krüge am Boden zerschellen und beim Nachbartier noch mehr zu Bruch gehen. Wenn die Indios diese Entschuldigungen vorbringen, hält man sie für erfunden, und sie müssen die fehlenden Krüge bezahlen, und zwar nicht zum Einkaufspreis, sondern zu dem höheren Preis, den sie in dem Dorf kosten, wo sie anscheinend zerbrochen sind. Wenn ein armer Indio 8 oder 9 Pesos für jeden zerbrochenen Krug zahlen muss, wird er verständlicherweise keinen Krug zerbrechen oder austrinken wollen, um nicht so viel Geld ausgeben zu müssen.
- Es kommt vor allem in der Nacht vor, dass eines von den Tieren, die ihnen für den Transport anvertraut wurden, ausbricht, wenn z. B. irgendein Raubtier in die Nähe kommt. Wenn der Indio das Tier am Morgen beladen will, hat es sich manchmal so weit verlaufen, dass er nicht einmal weiß, wo er es suchen soll. Oft wird auch eines der Tiere in der Nacht von anderen Indios gestohlen.
Wenn der arme zum Transport verpflichtete Indio keinen Beweis erbringen kann, dass das verlorengegangene Tier aus Erschöpfung, Alter oder Krankheit gestorben ist, muss er für den Verlust vollständig aufkommen. Der Spanier, dem das verlorengegangene oder verendete Tier gehörte, sagt natürlich immer, dass es das beste Tier der Herde gewesen sei und dass man es ihm als Zuchttier gestohlen habe, und so verlangt er für jedes Tier 10 Pesos. Dabei möchte man meinen, dass das eigentlich unangemessen ist, denn untereinander können sie ebensogute und bessere Tiere für weniger Geld kaufen. Allerdings gibt es einige, wenn auch wenige Spanier, die dies nicht so unerbittlich handhaben, sondern mehr Entgegenkommen und christliche Gesinnung zeigen.
- Diese Indios erleiden großen Schaden und Verlust an ihrem eigenen Vieh, das sie auf der Weide gelassen haben. Wenn die anderen nämlich sehen, dass der Besitzer abwesend ist, stehlen sie es und fürchten weder seine Frau noch seine Kinder. Solche Fälle sind oft vorgekommen und allseits bekannt. Außerdem muss man sich viel um das Vieh kümmern, damit es gedeiht und sich vermehrt. Wenn der Besitzer abwesend ist, kommt es herunter; ein Teil davon läuft auch weg. [. . .]
11. Kapitel: Es handelt davon, wie viele Indios wegen der beschriebenen Leiden und Nachteile in verschiedenen Gegenden geflüchtet sind und noch flüchten
Die oben beschriebenen Umstände und noch einige andere, die man verschwiegen hat, waren und sind der Grund, weshalb eine so große Zahl von Indios aus ihren Dörfern in die Täler und Schluchten (guebradas) geflohen sind. Dies hat dazu geführt, dass die Provinz Chuquito, die die beste und dichtestbevölkerte Provinz Perus ist oder vielmehr war, heute so leer und von Indios verlassen daliegt, dass jemand, der sie vor zehn oder sechs Jahren gesehen hat und heute wieder hinkommt, meinen könnte, es lebte überhaupt niemand mehr in den Ortschaften, die früher 1600, 2000 oder mehr als 3000 Einwohner hatten; heute sind nur mehr 150 davon übrig geblieben.
Als sich vor 20 Jahren die Patres der Gesellschaft Jesu in Juli, einem der beiden größten Orte, niederließen, zählte man 16000 bis 17000 getaufte Seelen, und jeden Sonntag wurden 27 bis 30 Kinder neu getauft. In den letzten Jahren, und besonders im laufenden Jahr 1596, gibt es dort kaum noch jemand, der zur Beichte kommt, höchstens noch Frauen und einige Alte, und an den Sonntagen werden nur noch etwa drei bis vier Kinder, oft nur zwei und manchmal gar keines getauft. Von 3200 Indios, die bei der letzten Zählung vor 16 Jahren zur Gemeinde gehörten, sind nur noch etwa 150 übriggeblieben, die nicht einmal die Patres mehr alle zusammenbringen können. [.. .]
Vor einigen Jahren hieß es, bei den Chunchos, den kriegerischen [Wald-] Indianern, befänden sich viele Indios, die aus allen Teilen des Landes Zuflucht hier finden, und inzwischen wird diese Behauptung allgemein als wahr betrachtet. Vor kurzem kam aus jener Provinz eine sehr vertrauenswürdige Person, die diesen Sachverhalt bestätigte und angab, dass die Zahl der hierher geflohenen Indios sehr groß sei und täglich stark zunehme; allerdings hatte dieser Gewährsmann sie weder selbst gesehen noch konnte er genaue Zahlenangaben machen. Er hatte dies von den Chunchos selbst gehört, mit denen er gut befreundet war; er weiß auch die Namen der betreffenden Volksgruppen, die dem Verband der Chunchos nicht angehören und auch nicht unter ihnen wohnen, sondern getrennt von ihnen durch einen kleinen Gebirgszug. Ihre Dörfer sind umgeben von einem dichten Wald, in den sie sich beim geringsten Anzeichen einer Gefahr oder bei Überfällen wie in eine uneinnehmbare Festung zurückziehen. Sie dort herauszuholen ist so gut wie unmöglich. Sie haben große Maispflanzungen sowie viel Bohnen, Maniok, Camotes [süße Kartoffeln] und Yucca, außerdem viel Obst wie Bananen, Guyavaäpfel, Ananas und andere Sorten, die m der Gegend gedeihen. Sie gehen viel in die Wälder auf die Jagd von hirschartigen Tieren, Pustelschweinen, Truthähnen und anderen Vögeln, und in der Savanne jagen sie die großen Rebhühner, von denen es dort viele gibt. Sie halten auch viele Enten und Hühner aus Kastilien, und in den Flüssen gibt es reiche Fischbestände. Auf diese Weise haben sie alles, was sie brauchen, im Überfluss und entziehen sich so all der Not, den Leiden und Entbehrungen, die sie hier [in Potosí] erleiden. Alle kleiden sich in Baumwollstoffe und sind große Bogenschützen und vorzüglich zur Jagd ausgerichtet. Wenn sie auf die Felder gehen, nehmen sie Pfeil und Bogen mit, um unterwegs Wild erlegen zu können, und Indiojungen und auch einige Erwachsene haben ihr Blasrohr dabei, mit dem sie viele Vögel erlegen, von denen sie sich ernähren - kurz, sie haben alles, was sie brauchen. [. . .]
Viele von denen, die in die warmen Täler gehen, ziehen sich in unzugängliche Schluchten zurück, wo es unmöglich ist, sie aufzuspüren; sie halten beständig Ausschau nach Verfolgern, um rechtzeitig fliehen und sich verstecken zu können. Da die Felder ihre Subsistenz sichern, geben sie Haus und Herden auf und entledigen sich so der unzähligen Pflichten und Zwänge, unter denen sie früher in ihren Dörfern zu leiden hatten. Alle diese Flüchtlingsgruppen leben und sterben wie wilde Tiere ohne Beichte und Kenntnis von Gott unserem Herrn.
Andere verdingen sich bei der Flucht in diese Täler bei spanischen Landbesitzern, die durch geschickt verfasste Berichte an die Audiencias15 Konzessionen (provisiones) erteilt bekommen, sie als Hörige (yanaconas perpetuos) zu behalten. [. . .]
Andere hingegen treffen Abmachungen mit Kaziken oder führenden Indios in diesen Tälern, die in den Ländereien kleine Häuser haben, wo die geflüchteten Indios leben, und wenn ihre eigenen Kaziken kommen, um sie abzuholen und zum Gehorsam zu bringen, sind sie nicht aufzufinden."
[Übersetzung: Wirtschaft und Handel der Kolonialreiche / hrsgg. von Piet C. Emmer .... -- München : Beck, ©1988. -- (Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion ; Bd. 4). -- ISBN 3406306616. -- S. 432 - 441. -- Dort Quellenangabe. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1598
Wirtschaftliche Bilanz der Regierung von Felipe II in Kastilien:
Entwicklung der Staatseinnahmen und Staatsverschuldung Kastiliens (trotz der amerikanischen Edelmetalle):
Jahr Staatseinnahmen Staatsverschuldung Jährlicher Schuldendienst 1560 3,1 Millionen Dukaten 2,5 Millionen Dukaten 1,6 Millionen Dukaten 1575 5,5 Millionen Dukaten 40 Millionen Dukaten 2,7 Millionen Dukaten 1598 9,7 Millionen Dukaten 85 Millionen Dukaten 4,6 Millionen Dukaten
|
1598 - 1621
|
1599
Es erscheint der Bericht des Landknechts Ulrich Schmidel (Schmidl) über seine Erlebnisse zwischen Buenos Aires und Santa Cruz in den Jahren 1534 - 1554:
Schmidel, Ulrich <1510?, Straubing -1581, Regensburg>: Warhafftige Historien einer wunderbaren Schiffart, welche Ulrich Schmidel von Straubing von Anno 1534 bis Anno 1554 in Americam oder Newenwelt bey Brasilia und Rio Plata gethan ... /, durch Levinum Hulsium. -- Noribergae : Impensis Levini Hulsij, 1599. -- 103 S. : Ill.
gleichzeitig erscheint die lateinische Ausgabe:
Schmidel, Ulrich <1510?, Straubing -1581, Regensburg>: Vera historia admirandae cuiusdam nauigationis, quam Huldericus Schmidel, Straubingensis, ab anno 1534, usque ad annum 1554, in Americam vel nouum mundum, iuxta Brasiliam & Rio della Plata, confecit quid per hosce annos 19 sustinuerit, quam varias & quam mirandas regiones ac homines viderit /, ab ipso Schmidelio Germanice descripta ... -- Noribergae : Impensis Levini Hulsii, 1599. -- 101 S. : Ill.
|
|
|
 Abb.: Alpaca |
|
[Vorlage der Abb.: Crespo Rodas, Alberto <1917 - >: Alemanes en Bolivia. -- La Paz [u.a.] : Los Amigos del Libro, 1978. -- Depósito legal La Paz 170/77. -- S. 17, 37]
"WAHRHAFFTIGE HISTORIEN EINER WUNDERBAREN SCHIFFART
Reisebericht von Ulrich Schmidel, erschienen 1567 [richtig: 1599!]. – Ulrich Schmidel ist neben Hans Staden (1525–1576?) einer der bekanntesten Deutschen, die an der Eroberung Amerikas im 16. Jh. teilnahmen. Er verließ 1534 auf einem Schiff der Nürnberger Kaufleute Sebastian Neidhart und Jacob Welser Spanien, um sich einer Expedition unter Leitung von Pedro de Mendoza im östlichen Teil Südamerikas anzuschließen. In dem Gebiet um den Rio de La Plata (span.: Silberfluss) wurden große Reichtümer vermutet. Der Landsknecht Schmidel war während seines fast zwanzigjährigen Aufenthalts in Südamerika an zahlreichen Expeditionen ins Landesinnere beteiligt, durchzog dabei das heutige nördliche Argentinien, den Gran Chaco bis zu den Anden (Paraguay, Bolivien) und den südlichen Teil Brasiliens. 1553 kehrte er nach Europa zurück, da sein Bruder Thomas im Sterben lag. 1562 konvertierte er zum evangelischen Glauben, weshalb er Straubing verlassen musste und sich in Regensburg niederließ.In den Historien einer wunderbaren Schifffahrt werden alle Phasen der beginnenden Kolonisierung des La-Plata-Gebiets und des Chaco chronologisch nachgezeichnet: die Gründung von Buenos Aires, die Expeditionen ins Landesinnere den Paraná hinauf, die Gründung von Asunción, Suche nach den legendären Amazonen, Vorstoß nach Peru (und Rückzug) und schließlich der Aufruhr gegen den von Spanien gesandten Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, der in der jungen Kolonie für Recht und Ordnung sorgen sollte, jedoch von Irala und seinen Anhängern vertrieben wurde.
Die zentralen Themen dieses schreibenden Soldaten, der die Dinge ganz unprätentiös beim Namen nennt, sind die Suche nach Reichtum und nach Abenteuer. Er macht keinen Hehl daraus, dass die Motive, die ihn veranlassen, an diesen mühsamen Erkundungs- und Eroberungszügen teilzunehmen, bei denen so viele ihr Leben verlieren, völlig eigennütziger Natur sind. Das Beschreibungsraster ist denn auch geprägt von den Fragen nach Verwertbarkeit des Fremden und dem Gewinn an Lust, den man daraus ziehen kann. In der Darstellung der verschiedenen Indianergruppen, gegen die die Eroberer Krieg führten, geht es immer wieder um folgende Elemente: Art und Menge der Lebensmittel, Aussehen der Frauen, Beschaffenheit des Schmuckes, Bekleidung, das Äußere allgemein (also auch das der Männer) und – so vorhanden – Waren.
Abenteuer erlebte Schmidel viele, doch von den großen Reichtümern ist er weit entfernt geblieben. Die befanden sich in den Händen der Eroberer Perus. Immerhin gelangten Iralas Truppen bis an die peruanische Grenze und waren bereit, in den reichen Andenstaat einzumarschieren. Doch dies wussten die neuen Machthaber in Lima zu verhindern: »Es machte aber gemelter Gubernator ein Pact mit unserm Hauptman/ und thet ihme grosse Geschenck damit er wol zu frieden war/ und sein Leben darvon bracht. Es ware aber diese verloffene Handlung uns Kriegsleuten unbewußt. Dann wan uns solches wissendt gewest were/ hetten wir unserm Hauptman alle viere zusammen gebunden/ und ihne nach Peru geführet.« Weitere Passagen, die Meinungsverschiedenheiten zwischen Hauptmännern und »Kriegsleuten« dokumentieren, sind keine Seltenheit. So findet man beispielsweise Unterschiede in der Beurteilung des Umgangs mit den Indianern. Schmidel zweifelte sicher nie an der Rechtmäßigkeit von Eroberung und Unterwerfung der Indianer, doch war er andererseits auch weitsichtig genug, nicht jeden Kriegszug gut zu heißen: »Es were unser Raht und Gutduncken/ er solte nicht wieder sie ziehen/ dann es möchte grossen Mangel [an Nahrungsmitteln] un Nachtheil im Landt bringen.« Der Konflikt zwischen Soldat und Anführer gibt diesem über weite Strecken trockenen und stilistisch kargen Bericht eine eigene Würze. Zum einen kommt hier (wie etwa auch bei Bernál Díz de Castillo) die Spezifik einer Geschichtsschreibung »von unten« besonders zum Tragen. Zum anderen findet man hier komische, ja nahezu burleske Momente, wie etwa im Bericht vom Hauptmann, dem drei indianische Frauen geschenkt wurden: »Alls es nach Mitternacht war hatte unser Hauptman seine drey Metzen verloren/ villeicht darumb/ dass er sie nit alle drey zu frieden stellen können/ dann er war ein Mann bey 60 Jahren/ und möchten sie vielleicht/ wann er sie uns Knechten gelassen hette/ nicht darvon gelauffen sein.«
Bislang wurde Schmidel zusammen mit Alvaro Nuñez Cabeza de Vaca vor allem als erster Geschichtsschreiber der La-Plata-Staaten und Paraguays wahrgenommen. Die Besonderheit dieser Geschichtsschreibung »von unten«, die Entwicklung einer bestimmten Beschreibungsstrategie, um die Anführer lächerlich zu machen, sind dagegen weitgehend unbeachtet geblieben.
AUSGABEN: Ffm. 1567 (Neue Welt). – Ffm. 1597 (Warhafftige unnd liebliche Beschreibung etlicher . . . Indianischer Landschafften). – Ffm. 1599. – Nürnberg 1599 (Warhafftige Historien einer wunderbaren Schiffart). – Nürnberg 1602 (Vierte Schiffart). – Ffm. 1612 (Vierdte Schiffart). – Oppenheim 1617 (Warhafftige und liebliche Beschreibung etlicher . . . Indianischen Landschafften). – Tübingen 1889 (Reise nach Süd-America in den Jahren 1534–1554). – Straubing 1893 (Reise nach Südamerika, Hg. J. Mondschein). – Lpzg. 1922; ern. 1926 (Abenteuer in Südamerika), Bearb. C. Cramer. – Buenos Aires 1934 (Der erste Deutsche am Rio de la Plata Utz Schmidl von Straubing, Hg. u. bearb. M. Tepp). – Graz 1962 (Warhafftige Historien einer wunderbaren Schiffart; Einl. H. Plischke). – Straubing 1962 (Erlebnisse in Südamerika).
LITERATUR: J. E. Mondschein, U. S. von Straubing und seine Reisebeschreibung, Straubing 1881. – B. Mitré, S. Viaje al Rio de la Plata, Buenos Aires 1903. – R. Lehmann-Nitsch, U. S., der erste Geschichtsschreiber der La-Plata-Länder. 1535–1555, Mchn. 21912. – C. Arciniegas, Los alemanes en la conquista de América, Buenos Aires 1941. – W. Kloster u. F. Sommer, Ulrico Schmidl no Brasil guinhentista, São Paulo 1942. – K. Schottenloher, Die Bayern in der Fremde, Mchn. 1950. – R. Quevedo, Einl. zu U. Schmidel: Derrotero y viaje al Río de la Plata y Paraguay, Asunción 1983. – L. E. López, Einl. zu N. Federmann u. U. Schmidl: Alemanes an América, Madrid 1985.
[Wehrheim-Peuker, Monika. -- In: Kindlers Neues Literaturlexikon. -- München : Kindler, ©1996. -- s.v.]
Einige Beispiele seiner Erlebnisse:
"Nun befahle unser Oberst Hauptmann in dieser seiner Krankheit. Es sollten sich 150 Christen Mann rüsten/und neben demsselben 2000. Carios, die schickte er mit 4. Brigantin Schiffen auf 4. Meil zu der Insel Surucusis, unndt befahle ihnen/sie sollen diese Völcker alle zu todt schlagen/und gefangen nehmen/.../und weiß Gott dass wir in solchem Ihnen groß unrecht gethan haben...: Es erhübe sich aber bald ein Lermen an zwischen den Carios und Surucusis, demnach Hessen wir Christen unsere Büchsen auff sie abgehen/und brachten irer sehr viel umb/fiengen auch biß in die 2000. Mansbild/Weiber/ Knaben und Meydlein/und namen alles was sie hatten unnd ihnen abzunehmen war/wie es dann in solchen Fellen pflegt zu gehen..."
"Unnd waren wir anderthalb Jahr auff dieser Reiß/dass wir anders nichts thetten/dan nur ein Krieg über den anderen fürten/und hatten von Weib/ Mann und Kind auff dieser Reiß/biß in 12.000 Menschen bekommen/die musten unsere Leubeigenen sein/und habe ich für mein Person von Weib/ Manne und Kindern in die Fuffzig Personen überkommen."
[Zitate in: Krekeler, Birgit <1956 - >: Historia de los Chiquitanos. -- La Paz, 1995. -- (Pueblos indigenas de las tierras bajas de Bolivia ; 2). -- Originaltitel: Weiße und Indianer : die Chiquitano in Ostbolivien 1542 - 1767 (unveröffentlichte Magisterarbeit, Univ. Bonn). -- S. 96f.]
17. Jahrhundert
Entwicklung der Lateinamerikaflotten (Carrera de Indias):
"Die Geschichte der Flotten der Carrera de Indias ist lang und ruhmreich. Im frühen 17. Jahrhundert hatten sie zeitweilig aus mehr als hundert Schiffen bestanden, aber gegen Ende des Jahrhunderts war der legale Handel stark zurückgegangen und mit ihm auch die Zahl der Schiffseinheiten. In einem guten Jahr kreuzten noch etwa zehn bis zwölf Schiffe den Ozean. In manchen Jahren lief überhaupt keines aus. Das Privileg, Schiffe mit Fracht für Westindien zu beladen, war auf eine kleine Gruppe höchst angesehener, konservativer andalusischer Handelshäuser beschränkt, die dem consulado, der Kaufmannsgilde von Sevilla, angehörten. Ihre Ladungsaufseher verständigten sich auf den Messen von Puerto Belo und Jalapa mit den Vertretern ähnlicher Firmen, die häufig Verwandte und Geschäftsfreunde und ihrerseits Mitglieder der entsprechenden consulados in Mexiko und Lima waren (14). An einer Erweiterung des Handelsvolumens war ihnen nicht sonderlich gelegen; wie die meisten derartigen Monopolisten zogen sie es vor, Fertigwaren in limitierten und vorhersehbaren Mengen zu künstlich gehaltenen Festpreisen auf einem protektionierten Markt abzusetzen. Im späten 17. Jahrhundert waren die verschifften Waren wegen der nicht wettbewerbsgerechten Struktur der spanischen Industrie und der mangelnden Kommunikation zwischen Cadiz und den spanischen Produktionszentren zumeist ausländischer — und zwar vorwiegend französischer — Herkunft, und die spanischen Verlader fungierten lediglich als Agenten. Sie übernahmen zwar gewisse koloniale Erzeugnisse; aber da eine Schiffsladung Fertigwaren den Gegenwert mehrerer Schiffsladungen Häute oder Zucker darstellte, waren die übernommenen Mengen sowohl durch die Kapazität der Handelsflotten als auch den geringen Bedarf der spanischen Industrie stark limitiert. Als Zahlungsmittel diente zumeist Silber, das — wie auch das königliche Silber — nach Ankunft in Spanien sogleich wieder nach Übersee zurückfloss. Die Flotten hatten den Markt de facto nie monopolisiert. Große Mengen Silber flössen über die kleineren westindischen Häfen als Entgelt für Waren ab, die von ausländischen — dänischen, französischen, überwiegend jedoch englischen — Schiffen eingeschmuggelt wurden. In normalen Zeiten mussten diese Schwarzhändler die größeren Häfen gewöhnlich meiden und ihre Geschäfte selbst in den kleineren mit drohend vorgehaltenen Spießen abwickeln und über die üblichen Bestechungspraktiken hinaus eine Demonstration vorgetäuschter oder echter Stärke veranstalten, um die örtlichen Behörden zu stillschweigender Duldung ihrer Machenschaften zu veranlassen. Im strikt kommerziellen Wettbewerb mit dem lizenzierten Handel waren alle Vorteile auf ihrer Seite; sie zahlten keine Steuern und konnten daher billiger verkaufen; und sie waren bereit, einen größeren Teil des geforderten Preises in Zucker, Häuten und anderen kolonialen Erzeugnissen entgegenzunehmen, die sie in Nordeuropa mit Gewinn verkaufen konnten. Während der offizielle Handelsschiffsverkehr zurückging, nahm der Schwarzhandel mit geschmuggelten Waren zu. Zugleich stiegen die Kosten für die koloniale Verwaltung und Verteidigung stetig, so dass ein immer geringerer Teil des kolonialen Steuerertrags zur Überweisung nach Spanien verfügbar war."
[Parry, John H. <1914 - >: Europäische Kolonialreiche : Welthandel und Weltherrschaft im 18. Jahrhundert. -- München : Kindler, ©1978. -- 683 S. : Ill. -- (Kindlers Kulturgeschichte des Abendlandes ; Band XVI). -- S. 51f. -- Originalausgabe: Trade and dominion: the European oversea empires in the eighteenth century (1971)]
um 1600
P. Diego de Ocaña OSH (1570, Ocaña - 1608, Mexiko) kopiert für Sucre das Gnadenbild Virgen de Guadalupe, dessen Original sich in Cáceres, Extremadura, Spanien befindet
Abb.: Diego de Ocaña: Kopie des Gnadenbildes Virgen de Guadalupe, mit Behang, Sucre, Capilla da Guadalupe
17. Jahrhundert

Abb.: Anonymus: Engel als Büchsenspanner (Detail, La Paz)
"Das Motiv der Engel (oder sogar Erzengel) als Büchsenschützen erfreute sich in Hochperu, von Cuzco bis Potosi, außerordentlicher Beliebtheit. Die Quelle für diese seltsame Ikonographie ist das Buch Henoch; sie erreichte die Region Hochperu durch unbekannte Vermittler. Das Einzigartige an der Behandlung des Themas besteht darin, dass die Erzengel nach der militärischen Mode des 17. Jahrhunderts gekleidet sind: breiter Spitzenkragen, weiter Rock mit geschlitzten Ärmeln, langes Unterhemd, Kniehosen, Strümpfe, Strumpfhalter, Schuhe mit Schnürsenkeln und Schnallen. Noch heute ahmen peruanische und bolivianische Künstler diese Vorbilder nach." [Benassar, Bartolomé ; Vincent, Bernard: Spanien : 16. und 17. Jahrhundert. -- Stuttgart : Klett-Cotta, ©1999. -- (Das goldene Zeitalter). -- ISBN 360894186X. -- Originaltitel: Le temps de l'Espagne. XVIe - XVIIe siècles (1999). -- S. 218. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
17. Jahrhundert
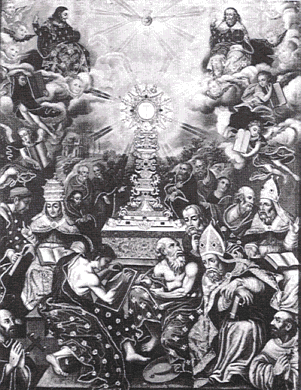
Abb.: Anonym (Andenschule): Verehrung der Hl. Eucharistie, 17. Jhdt.
Die Eucharistieverehrung war in Alto Perú allgemein sehr beliebt.
1600 - 1767
Der Jesuitenorden errichtet Missionen und Reservationen für die Indios in Südamerika und versucht die Indios vor den Conquisadores und Kolonisten zu schützen.
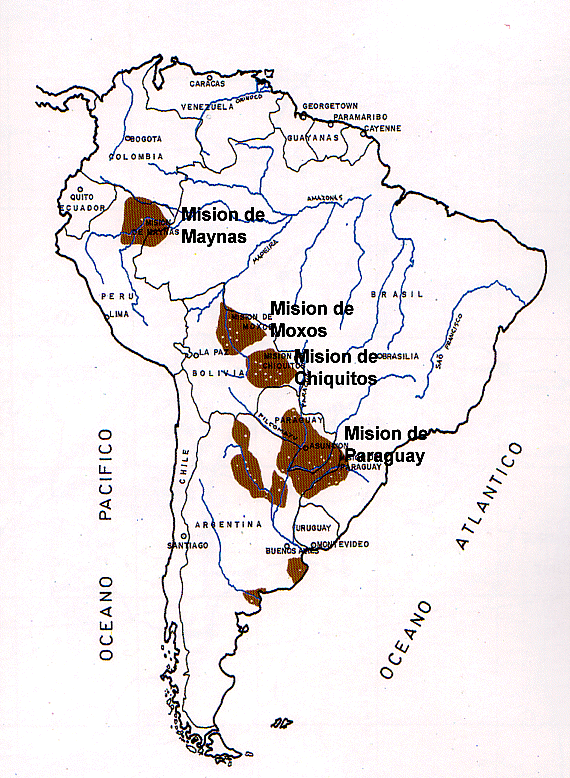
Abb.: Jesuitenmissionen in Südamerika 1600 bis 1767
[Quelle der Karte: Las misiones jesuíticas de Chiquitos / Pedro Querejazu (ed. y compil.) ... -- La Paz : Fundación BHN, ©1995. -- Depósito legal 4-1-637-94. -- S. 255]
Abb.: Idealplan einer Jesuitenmission[Bildquelle: Las misiones jesuíticas de Chiquitos / Pedro Querejazu (ed. y compil.) ... -- La Paz : Fundación BHN, ©1995. -- Depósito legal 4-1-637-94. -- S. 420]
"Jesuitenstaat: Bezeichnung für den von Spanien als Bollwerk gegen die portugiesische Expansion tolerierten Missionsstaat des Jesuitenordens in Paraguay im 17. und 18. Jahrhundert.
Ab 1609 fassten jesuitische Missionare hunderte von Dörfern der Guaraní am Río de la Plata zu so genannten Jesuitenreduktionen (Zufluchtsorten) mit jeweils rund 10 000 Einwohnern zusammen, um in ihnen in völliger Abgeschiedenheit von der Außenwelt einen „christlichen Kommunismus" zu praktizieren. Sie bekehrten die Guaraní (unter Zwang) zum Christentum, unterwiesen sie in der Landwirtschaft und ließen sie auf Plantagen arbeiten, deren Produkte für den Export nach Europa bestimmt waren. Um ihr Staatsgebilde nach außen abzusichern, errichteten die Ordensbrüder Festungen, stellten Truppen auf und unterhielten eine Flotte auf dem Río Paraguay. Nach der Abtretung ihrer Gebiete an Portugal ab 1750 leisteten sie den neuen Herren im Land, deren Autorität sie nicht anerkennen wollten, über ein Jahrzehnt lang Widerstand. 1761 unterlagen die Jesuiten den spanisch-portugiesischen Truppen und mussten 1768 Paraguay endgültig verlassen."
Encarta Enzyklopädie Plus 2001
1600
Jesuiten gründen die erste Marianische Kongregation in La Paz, es folgen solche in Potosí (1601), La Plata (heute: Sucre) (1602), Oruro (1611?).
1603
Zahl und Art der Indio-Arbeiter in Potosí nach einer anonymen Beschreibung aus dem Jahr 1603 Tributpflichtige Indios (mitayos), die in den Bergwerken das
Erz abbauen4.000 Freiwillige Indio-Arbeiter (mingas) in den Minen 600 Mingas, die mit der Reinigung der Erze beschäftigt sind —
junge Männer, die i Peso pro Tag verdienenüber 400 Indios - Männer und Frauen -, die das Erz von den Eingängen der Minen nach draußen schaffen 1.000 Mitayos, die in den Erzmühlen arbeiten 600 Mingas, die in den Erzmühlen für 7 Reales pro Tag arbeiten 4.000 Indios, die lamas [das Amalgam aus Quecksilber und Silbererz]
für 1 Peso pro Tag herstellen3.000 Indios, die mit Lamas arbeiten und das Erz von den Minen zu
den Mühlen schaffen320 Indios, die Salz nach Potosi bringen 180 Mingas, die Salz nach Potosi bringen 1.000 Indio-Händler, die Holz liefern 1.000 Indios, die Holz für die Feuerung schlagen 1.000 Indios, die Lamamist als Brennmaterial beschaffen 500 Indios, die Lamamist als Brennmaterial für das Schmelzen des Amalgams von Silber und Quecksilber liefern 200 Indios, die Holzkohle herstellen und liefern 1.000 Indios, die Kerzen herstellen 200 Gesamtzahl über 19.000 [Quelle: Wirtschaft und Handel der Kolonialreiche / hrsgg. von Piet C. Emmer .... -- München : Beck, ©1988. -- (Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion ; Bd. 4). -- ISBN 3406306616. -- S. 441f. -- Dort Quellenangabe. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1604 - 1606
|
1606
Lic. Manuel Castro de Padilla (1573, Andújar - 1622, Lima) gründet Villa de San Felipe de Austria (heute: Oruro, einheimischer Name: Uru Uru)
1607 - 1615
|
1609
Vega, Garcilaso de la <1539-1616>: Primera parte de los Commentarios reales, que tratan del origen de los Yncas, reyes que fueron del Peru, de su idolatria, leyes, y govierno en paz y en guerra: de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel imperio y su republica, antes que los Esoañoles passaran a el. -- Lisboa : Pedro Crasbeeck, 1609. -- 264 Bll. -- 26 cm.
Deutsche Übersetzung:
Vega, Garcilaso de la <1539-1616>: Wahrhaftige Kommentare zum Reich der Inka. -- 1. Aufl. -- Berlin : Rütten und Loening, 1983. -- 560 S. : Ill.
Abb.: Titelblätter des ersten und zweiten Bandes
"Garcilaso de la Vega: COMENTARIOS REALES, QUE TRATAN DEL ORIGEN DE LOS INCAS (span.; Königliche Kommentare, die von der Herkunft der Inkas handeln). Geschichtswerk von Garcilaso de la Vega (genannt El Inca).
Der erste Teil erschien 1608/09, der zweite postum 1617 aus Gründen der Zensur unter dem neutraleren Titel Historia general del Perú. – El Inca war Mestize: mütterlicherseits stammte er aus fürstlichem Inkageschlecht; sein Vater gehörte einer alten kastilischen Adelsfamilie an, die auf eine reiche literarische Tradition zurückblicken konnte (ihr entstammte der damals schon hochgeschätzte Lyriker Garcilaso de la Vega). Diese Position zwischen den Rassen, diese Mittlerstellung zwischen zwei Welten bestimmte sein ganzes Werk. Zwar ging er mit 21 Jahren nach Spanien, um nie wieder in seine Heimat Peru zurückzukehren, doch blieb er bis zu seinem Tode dem Volk, dem seine Mutter angehörte, zutiefst verbunden. Diesem Bewusstsein zweifacher Zugehörigkeit verdanken wir auch die Comentarios reales.
Im ersten Teil des Werkes behandelt El Inca Geschichte, Staatsform, Religion, Sitten und Gebräuche in Peru vor der conquista, der Eroberung des Landes durch die Spanier. Er tut das aus sehr genauer Kenntnis der indianischen Vergangenheit heraus, denn in seiner Jugend hatten die Mutter und die Verwandten mütterlicherseits ihm alles mitgegeben, was an mündlicher Überlieferung überhaupt mitteilbar war. Er besitzt einen natürlichen Blick für die Größe, aber auch für die Grenzen der Inkakultur. Eine der eindrucksvollsten Episoden des Werkes ist das Kapitel 15 des ersten Teils, in welchem Garcilaso berichtet, wie Mutter und Verwandte ihn mit der Kosmogonie der Inkas vertraut machen. Hier erhebt sich die rhythmisch bewegte, biegsame Prosa des Inca zu literarischer Vollendung. In diesem Kapitel zeigt sich besonders deutlich, mit welcher Anteilnahme und Fabulierfreude Garcilaso erzählt. – Der zweite Teil entstand vier Jahre später. Er behandelt die Geschichte Perus nach der conquista. Hier macht sich Garcilaso den Blickwinkel der Eroberer zu eigen, was angesichts der unausweichlichen Zensur nicht verwunderlich ist. So ist seine Sicht der conquista bei aller verborgenen Kritik eher orthodox: Den Spaniern kommt im Heilsplan die Rolle zu, die Neue Welt zu entdecken und zu christianisieren. Er geht also in seiner Kritik nicht so weit wie etwa Las Casas, der viele Jahre zuvor aus Abscheu vor den Übergriffen der Spanier den Wert der conquista überhaupt in Frage gestellt hatte. El Inca urteilt ganz und gar als Christ; er ist überzeugt davon, dass die Missionierung des Landes nur von Nutzen für die Bevölkerung sein kann, ja dass sie eine unabdingbare Voraussetzung für das Glück der Inkas ist. Trotzdem forderte er den zornigen Widerspruch der spanischen Kritiker heraus, ja 1782 zog der Hof das angeblich rebellische und antispanische Werk in Lateinamerika aus dem Handel, nachdem sich ein rebellierender Indio unter dem Namen Tupac Amaru II. aus den Comentarios die Legitimation für sein Handeln geholt hatte. Da ihm als hervorragendem Stilisten in literarischer Hinsicht wenig anzuhaben war, griff man ihn als Historiker an, zieh ihn der bewussten Geschichtsfälschung, nannte ihn unzuverlässig und allzu phantasiebegabt. War dieser Mestize nicht in Wirklichkeit ein verkappter Inka, der aus indianischem Nationalismus die Bedeutung seines Muttervolkes auf Kosten der spanischen Verdienste herauszustreichen bemüht war? El Inca selbst hat tief verletzt auf diese Vorwürfe geantwortet, er habe nicht etwa für die Inkas allein, sondern für Spanier und Inkas schreiben wollen, weil er beiden Nationen angehöre: »Es ist Lüge zu behaupten, dass ich mit Liebe über die Inkas schreibe, um die indianische Nation zu loben, weil ich selber ein Indio bin.«
Die neuere Forschung hat ihm längst recht gegeben. Zwar finden sich in den Comentarios, wie in fast allen Werken der Barockliteratur, novellistische Elemente und allegorische Exkurse. Auch an den Sagen und Märchen der indianischen Folklore geht El Inca nicht achtlos vorüber. Aber dieses in einer bewundernswert ausgewogenen Prosa geschriebene Werk ist nicht nur als Erlebnisbericht außerordentlich aufschlussreich. Man weiß heute auch, dass El Inca – im Rahmen seiner Möglichkeiten – ein verantwortungsbewusster Geschichtsschreiber war. So gelten die Comentarios reales mit Recht als das erste große Werk der hispanoamerikanischen Literatur.
AUSGABEN: Lissabon 1608/09. – Córdoba 1617 (2. Tl. u. d. T. Historia general del Perú). – Buenos Aires 1945, Hg. A. Rosenblat. – Lima 1959, Hg. J. Durand. – Madrid 1960 (in Obras completas, Bd. 2–4, Hg. C. Sáenz de Santa María, m. Einl.; BAE). – Caracas 1976, Hg. A. Miró Quesada.
ÜBERSETZUNG: Wahrhaftige Kommentare zum Reich der Inka, W. Plackmeyer, Berlin 1986."[Helmuth Faust. -- In: Kindlers Neues Literaturlexikon. -- München : Kindler, ©1996. -- s.v.]
"Atahuallpas Antwort auf die Rede des Mönchs Nachdem König Atahuallpa den Schluss der Rede vernommen, nämlich dass er gutwillig oder gezwungenermaßen auf seine Reiche verzichten und tributpflichtig werden würde und dass solches der Papst geböte und der Kaiser wollte, als er vernahm, wie man ihm mit blutigem Krieg drohte und dass Verderben über ihn und die Seinen kommen würde wie über den Pharao und sein ganzes Heer, ward er traurig, weil er sah, dass jene, die er und seine Indianer Viracochas nannten, in dem Glauben, sie wären Götter, zu seinen Todfeinden wurden, indem sie so harte Forderungen an ihn richteten, und er tat einen Seufzer und sprach: „Atac!", das bedeutet: Wehe mir!, und mit diesem Ausdruck gab er zu erkennen, welch großen Schmerz ihm bereitet hatte, was er im letzten Teil der Rede vernommen, und seine Leidenschaft zügelnd, erwiderte er das folgende: „Eine große Freude wäre es mir gewesen, wenn, da ihr mir schon alles andere, worum ich eure Gesandten gebeten, ausgeschlagen habt, ihr mir wenigstens eines gewährt hättet, nämlich durch einen klügeren, erfahreneren und treueren Dolmetsch zu mir zu sprechen, denn Gesittung und Stand der Menschen erkennt man schneller an der Sprache denn an ihren Gepflogenheiten, und wenn ihr auch mit großen Tugenden ausgestattet seid, so vermag ich diese, wenn ihr sie mir nicht mit Worten erläutert, durch Augenschein und Erfahrung nicht ohne Mühe zu erkennen, und wenn es dessen zwischen allen Menschen und Völkern bedarf, dann erst recht zwischen solchen, die einander so fern sind wie wir; wenn diese daher durch Gesandte und Dolmetsche miteinander verkehren und sprechen wollen, welche der einen wie der anderen Sprache nicht mächtig sind, dann ist das so, als spräche man durch den Mund von Haustieren; das sage ich, Mann Gottes, weil ich nicht verkenne, dass die Worte, die du gesprochen, anderes bedeuten, als was dieser Dolmetsch mir gesagt, denn die Sache selber erfordert es; während wir nämlich von Frieden und Freundschaft, von ewiger Brüderlichkeit, ja Zusammengehörigkeit sprechen sollten, wie es die anderen Sendboten getan, die mit mir gesprochen, klingt das, was dieser Indianer mir gesagt, ganz nach dem Gegenteil, indem du uns mit Krieg und Tod, mit Feuer und Schwert, mit Vertreibung und Vernichtung der Inka und ihrer Sippschaft drohst und dass ich gezwungen oder gutwillig auf mein Reich verzichten und einem anderen tributpflichtig werden muss. Daraus entnehme ich, dass entweder euer Fürst und ihr alle, die ihr umherzieht und die Welt zerstört, anderen ihre Reiche nehmt, diejenigen tötet und beraubt, die euch kein Leids getan und euch nichts schuldig sind, Tyrannen seid, oder ihr seid Diener Gottes, den wir Pachacámac nennen, der euch auserwählt hat, uns zu strafen und zu vernichten. Und wenn es so ist, bieten meine Vasallen und ich sich dem Tode und allem dar, was ihr mit uns machen wollt, nicht weil wir Angst vor euren Waffen und Drohungen hätten, sondern um zu erfüllen, was mein Vater Huaina Cápac in seiner Todesstunde geboten hat, dass wir nämlich bärtigen Menschen, wie ihr es seid, welche nach seinen Tagen kommen würden, von denen er Jahre, bevor sie an der Küste seines Reiches erschienen, Kenntnis hatte, Dienst und Ehre erweisen sollten. Er sagte uns, sie würden Menschen mit einem besseren Gesetz sein, mit besseren Sitten, klüger, tapferer als wir. Weshalb wir, meines Vaters Gebot und Testament erfüllend, euch Viracochas genannt haben, weil wir meinten, ihr wäret Sendboten des großen Gottes Viracocha, dessen Willen und gerechtem Zorn, Waffen und Macht man sich nicht widersetzen kann, aber er hat auch Gnade und Barmherzigkeit. Derhalben solltet ihr wie Gesandte und Diener Gottes handeln und nicht erlauben, dass Totschlag, Raub und Gräueltaten, wie in Túmpiz und seiner Umgebung geschehen, ihren Fortgang nehmen.
Außerdem hat mir euer Dolmetsch gesagt, dass ihr mir fünf große Männer nennt, die ich kennenlernen sollte. Der erste ist der Gott drei und eins, welches vier sind, den ihr Weltschöpfer heißet. Ist er vielleicht derselbe, den wir Pachacámac und Viracocha nennen? Der zweite ist derjenige, von dem du sagst, er sei Vater aller Menschen, auf den sie alle ihre Sünden geladen haben. Den dritten nennt ihr Jesus Christus, nur er habe seine Sünden nicht jenem ersten Menschen aufgebürdet, aber er sei getötet worden. Als vierten nennt ihr den Papst. Der fünfte ist Karl, den ihr, ohne die anderen zu bedenken, allermächtigst und Monarchen des Universums und allerhöchst nennt. Wenn dieser Karl Fürst und Herrscher der ganzen Welt ist, warum musste ihm dann der Papst erst Erlaubnis und Auftrag erteilen, Krieg gegen mich zu führen und diese Reiche an sich zu reißen? Und wenn es so war, dann ist also der Papst ein größerer Herr als er und mächtiger und Fürst der ganzen Welt? Ebenso wundere ich mich, dass ihr sagt, ich habe die Pflicht, Karl Tribut zu zahlen und nicht den anderen, denn ihr nennt keinen Grund für den Tribut, und ich fühle mich nicht verpflichtet, einen solchen in irgendeiner Weise zu entrichten. Denn wenn ich wirklich Tribut und Dienst zu leisten hätte, dann, so dünkt mich, jenem Gott, der, wie du sagst, uns alle geschaffen hat, und jenem ersten Mensch, dem Vater aller Menschen, und jenem Jesus Christus, der seine Sünden nie anderen aufgebürdet hat; schließlich müssten sie dem Papst geleistet werden, welcher meine Reiche und meine Person anderen geben und verleihen kann. Wenn du aber sagst, dass ich diesen nichts schulde, dann schulde ich Karl erst recht nichts, denn er war niemals Herr dieser Gebiete und hat sie nie gesehen. Und wenn er nach jener Erlaubnis ein Recht an mir hat, dann wäre es nur recht und billig, dass ihr mir das sagtet, bevor ihr mir mit Krieg, Feuer, Blut und Tod droht, damit ich dem Willen des Papstes gehorche, denn ich bin nicht so aberwitzig, dass ich einem, der nach Vernunft, Gerechtigkeit und Recht herrschen kann, nicht gehorchte. Außerdem möchte ich von jenem guten Menschen Jesus Christus hören, der seine Sünden nie anderen aufgebürdet, der, wie du sagst, gestorben ist. Starb er an einer Krankheit oder von Hand seiner Feinde? Ward er vor seinem Tode oder danach den Göttern beigesellt? Ebenso möchte ich wissen, ob ihr diese fünf, die ihr mir genannt, für Götter haltet, da ihr sie so ehret; denn wenn es so ist, habt ihr mehr Götter als wir, die wir nur den Pachacámac als höchsten Gott verehren und die Sonne als seinen Untergebenen und den Mond als dessen Schwester und Weib. Daher würde es mich höchlich freuen, wenn ihr mir diese Dinge durch einen besseren Dolmetsch zu verstehen gäbet, auf dass ich sie vernehme und eurem Willen gehorche. "
[Deutsche Übersetzung, S. 471 -473]
1609
Grotius, Hugo <1583, Delft - 1645, Rostock>: Mare liberum; sive, De iure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio. -- Lugduni Batavorum : Elzevirius, 1609. -- 66 S. [Das freie Meer, oder: Abhandlung über das Recht auf den Handel mit Indien, das den Holländern zusteht"]
"Das Gesetz, nach dessen Vorschrift zu richten ist, ist nicht schwer zu finden, denn es gilt bei allen Menschen; es ist schwer zu begreifen, denn es wird mit jedem geboren und ist der Vernunft jedes Menschen eingepflanzt. Das Recht, das wir fordern, kann kein König seinen Untertanen weigern, kein Christ einem Nichtchristen. Es stammt nämlich aus der Natur selbst, die aller Menschen gleiche, gütige Mutter ist und deren Herrschaft auch die Herrscher unterworfen sind und jeder Fromme sich ergeben fügt. . . Wir wollen beweisen dass die Vereinigten Niederlande das Recht haben, in bisher gewohnter Weise nach Indien zu fahren und dort Handel zu treiben. Wir wollen dabei die erste und gewisseste Regel des Völkerrechtes zugrunde legen, deren Beweiskraft klar und unumstößlich ist: Jedes Volk kann ein anderes aufsuchen und mit ihm Geschäfte machen. So spricht Gott selbst in der Natur: Er reicht nicht überall des Lebens Notdurft gleichmäßig dar, sondern will, dass die Völker sich hier durch diese, dort durch jene Vorzüge auszeichnen. Warum? Weil Gott wollte, dass der Mangel hier und die Fülle da die Menschen freundschaftlich zusammenführe, damit sie nicht glauben, jeder könne sich selbst genügen, und ungesellig würden . . . Dass die Portugiesen nicht Herren der Länder sind, welche die Niederländer aufsuchen, ergibt sich aus dem sicheren Satz, dass niemand Herr einer Sache ist, die weder er selbst noch ein anderer in seinem Namen jemals besessen hat. . . Herrschaft kann sich nicht auf den bloßen Anspruch gründen, es wird vielmehr nach dem wirklichen Besitz gefragt, denn ein anderes ist es, ein Ding haben, und ein anderes, nur das Recht, es zu erwerben. Aber die Portugiesen haben auf diese Gegenden überhaupt gar keinen Anspruch . . .
Wenn man sich auf die Teilung des Papstes Alexander VI. beruft, so ist vor allem zu erwägen, ob nicht der Papst etwa nur die Streitigkeiten zwischen Portugal und Kastilien schlichten wollte, was er natürlich als von ihnen erwählter Schiedsrichter konnte, wie auch die Könige selbst schon früher darüber gewisse Verträge abgeschlossen hatten. Wenn dem aber so ist, kann die Teilung als unter jenen Ländern vereinbart für die übrigen Völker gleichgültig sein; hätte man doch sonst jedem der beiden Völker beinahe ein Drittel der Welt überlassen.
Eine Schenkung hat bei Dingen, die dem Verkehr entzogen sind, keine Kraft. Denn da das Meer oder das Recht, auf ihm zu fahren, keinem Menschen zu eigen gehören kann, folgt daraus, dass es der Papst nicht schenken und Portugal nicht erhalten konnte. Da außerdem der Papst nicht weltlicher Herr der Erde ist, so ist er auch nicht Herr des Meeres, und so könnte er doch dies sein Recht als Papst nicht auf einen König oder ein Volk in irgendeiner Hinsicht übertragen . . . Dem Papst steht doch wohl das Recht über weltliche Güter nur soweit zu, als es die Notwendigkeiten geistlicher Rücksichten erfordert; das Meer und die Seefahrt aber haben nur Gewinn und Erwerb, kein Werk der Religion zum Ziele; sie stehen mithin nicht in seinem Machtbereich."
[Übersetzung: Schreiber, Hermann: Spanien aus erster Hand : die iberische Halbinsel in Berichten und Dokumenten. -- Würzburg : Arena, ©1974. -- S.149f.]
1612
Bertonio, Ludovico <S.J.> <1557, Italien - 1625, Lima>: Vocabulario de la lengua aymara. -- Juli <Chucuyto> : Francisco del Canto, 1612. -- 473, 397 S.
Abb.: Titelblatt
1613
Abb.: Papas Peruanorum -- die KartoffelAbbildung aus Besler, Basilius <1561 - 1629>: Hortus Eystettensis; sive Diligens et accurata omnium plantarum, florum, stirpium, ex variis orbis terrae partibus, singulari studio collectarum, quae in celeberrimis viridariis arcem episcopalem ibidem cingentibus hoc tempore conspiciuntuur delineatio et ad vivum repraesentatio. -- 1613. -- Nachdruck: Köln [u.a.] : Taschen,1999. -- ISBN 3822865761. -- Tafel 345. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]]
1615 - 1621
|
1615
Es stirbt die letzte Kamelstute von den Kamelen, die man aus Afrika importiert hatte, damit diese stärkeren Lasttiere die Lamas ersetzen. Dieser Versuch ist misslungen.
1615
Vollendung des grundlegenden Werkes
Guaman Poma de Ayala, Felipe: El primer nueva corónica y buen gobierno, 1615. -- Handschrift Gl. Kgl.S. 2232, 4°. der Königlichen Bibliothek, Kopenhagen. -- Online veröffentlicht: http://www.kb.dk/elib/mss/poma/. -- Zugriff am 2001-10-24
Das Werk bleibt bis ins 20. Jahrhundert unveröffentlicht.
Poma de Ayala, Felipe Guaman: EL PRIMER NUEVA CORÓNICA Y BUEN GOBIERNO (span.; Erste Neue Chronik und Gute Herrschaft). Geschichtswerk von Felipe Guaman Poma de Ayala (Peru), abgeschlossen 1615, erstmals erschienen 1936. – Guaman Poma war – eigenen Aussagen zufolge – väterlicherseits ein Abkömmling des nordperuanischen Adelsgeschlechts der Yarovilca, mütterlicherseits inkaischer Abstammung. Er bezeichnete sich als (indianischen) Prinzen, aber auch als Dolmetscher und Schreiber im Dienste des Kolonialherrn. Auf zahlreichen Wanderungen durch das Land hat er offenbar auch Cuzco, Lima, Huamanga und Huancavelica kennengelernt. Man hat oft genug darauf hingewiesen, dass er – um sich als indianischer Autor vor europäischen Lesern zu behaupten – seine Person ins rechte Licht setzen musste. Dabei mögen sich biographische Dichtung und Wahrheit vermischt haben. Ein Blick auf seinen Text zeigt jedoch, dass die Selbstbeschreibung nicht ganz und gar erfunden sein kann: Inhalt, Sprache und Schrift machen deutlich, dass es sich um einen relativ privilegierten Indianer aus der frühkolonialen Gesellschaft Perus handelt, der Lesen und Schreiben gelernt hatte, christianisiert worden war, eine kulturelle Mittlerrolle spielte, aus andinen und europäischen Traditionen gleichermaßen schöpfte und diese nicht nur miteinander zu verknüpfen, sondern auch gegeneinander auszuspielen verstand.
In der Nueva Corónica stellt Guaman Poma auf 1179 Seiten und in über 400 Federzeichnungen die Verhältnisse im Andenraum – vor und nach der Konquista – dar. Die ersten acht kapitelähnlichen Abschnitte handeln von den mythischen Ursprüngen der Indianer, von den vorinkaischen Bewohnern der Region und schließlich – in aller Ausführlichkeit – von der Genealogie, Verwaltung, Sozialstruktur und Kultur der Inka. Es folgt eine Schilderung der Konquista im Andenraum sowie – in weiteren zwölf Abschnitten – ein Panorama der Kolonialgesellschaft.
Die Nueva Corónica ist mehr als nur neutrale Enzyklopädie oder Geschichtsregistratur der andinen Welt. Gleich schon im Titel werden weitergehende Intentionen deutlich: »Neu« ist polemisch gemeint und betont den Gegensatz zur offiziellen spanischen Geschichtsschreibung, in der nur die europäische Sicht der Dinge zum Tragen kommt. Und »Gute Herrschaft« meint nicht etwa die lobende Beschreibung dessen, was ist, sondern etwas, das erst noch zu erreichen wäre – ein utopisches Fernziel also. Tatsächlich vermittelt Guaman Poma ein anderes, vielschichtigeres und kritischeres Bild der Zustände, als es in zeitgenössischen spanischen Chroniken enthalten ist. Die »Sicht der Besiegten« (N. Wachtel) findet sich bei ihm fast in jedem Bild und Textabschnitt, vor allem aber dort, wo er die Skrupellosigkeit, Unmoral oder Unchristlichkeit der Kolonialherren geißelt: »Manches Mal aßen sie nicht vor lauter Denken an Gold und Silber/ manches Mal feierten sie große Feste und taten so, als ob sie Gold und Silber schon in den Händen hielten/ und das war dann so wie bei einer Hauskatze/ erst wenn sie die Maus in den Krallen hat lässt sie von ihr ab/ solange sie sie aber noch nicht hat lauert sie ihr auf und ist tätig und all ihre Aufmerksamkeit und ihr Denken ist darauf aus/ bis dass sie sie fängt lässt sie nicht ab und kommt immer wieder darauf zurück/ genau so wie die ersten Spanier/ sie fürchteten nicht den Tod vor lauter Interesse an Gold und Silber/ und schlimmer noch sind die Leute aus heutiger Zeit . . ./ vor lauter Gier nach Gold und Silber fahren sie noch zur Hölle.«
Dass solches oder ähnliches von einem Indianer und ohne Berücksichtigung (oder Kenntnis) der in Spanien seinerzeit üblichen sprachlichen, stilistischen und literarischen Normen geschrieben wurde, hat für die Verbreitung des Texts unmittelbare Folgen gehabt: Auch wenn Guaman Poma ihn als »Brief an den König« konzipierte und in einem gesonderten Schreiben an Philipp III. um Drucklegung des Manuskripts bat, kann man nicht davon ausgehen, dass er mit dieser Bitte Erfolg gehabt hat. Statt als Buch zu zirkulieren, blieb die Nueva Corónica lange Zeit verschwunden. Erst 1785 tauchte sie in den Katalogbeständen der Königlichen Bibliothek von Kopenhagen auf. Die eigentliche »Entdeckung« des Manuskripts erfolgte erst 1908 durch den deutschen Bibliothekar Richard A. Pietschmann. Immerhin sollte es noch weitere dreißig Jahre dauern, bis das Werk als Faksimiledruck erstmalig Verbreitung finden konnte. Inzwischen ist es in mehreren Editionen erschienen und erfreut sich – weit über Peru und Lateinamerika hinaus – ähnlicher Popularität wie die Comentarios Reales des Inca Garcilaso de la Vega.
So überraschend wie die Manuskriptgeschichte verlief auch die wissenschaftliche Rezeption der Nueva Corónica. Zunächst tat man den Text als sprachlich und historiographisch fehlerhaft ab. Nach und nach erkannte man freilich, dass das, was man als Fehler sah, durch Interferenzen andiner Sprache und Weltsicht zustande gekommen war: Guaman Pomas Gebrauch des Spanischen verweist phonetisch (d. h. orthographisch) und grammatikalisch auf die ihm vertraute Quechuasprache. Sein scheinbar lockerer Umgang mit historischen Zeiten und geographischen Räumen wurzelt in andinen Traditionen der Zeit- und Raumsymbolik. – Seither hat ein ebenso breites wie intensives kulturwissenschaftliches Interesse an der Nueva Corónica eingesetzt. Ethno-, Sozial- und Mentalitätshistoriker sehen in dem Text eine wichtige (da indianische) Quelle zur Rekonstruktion andiner Verhältnisse und Denkweisen. Archäologen finden in ihm Beschreibungen, die das Dunkel ihrer Funde erhellen. Linguisten nehmen ihn (unter anderem) als Beispiel zur Herausbildung einer frühkolonialen Interimssprache (Spanisch/Quechua) und fragen sich, inwieweit man diese als Kreol betrachten kann. Semiotiker widmen sich dem vielschichtigen Spiel und Ineinandergreifen von Bild-, Sprach- und Schriftzeichen in der Chronik. Die größte Aufmerksamkeit ist ihr in neuerer Zeit freilich von seiten der Literaturwissenschaft zuteil geworden: Hier interessiert man sich vor allem für die narrative Verarbeitung oralkultureller und schriftkultureller Erfahrungen, für Fragen der Intertextualität und für die Konstitution des literarischen Subjekts im Spannungsfeld zwischen indianischer und europäischer Welt.
AUSGABEN: Paris 1936, Hg. P. Rivet (Faks. des Ms.; ern. 1968, Einl. R. A. Pietschmann). – La Paz 1944, Hg. u. Einl. A. Posnasky. – Lima 1955–1966, Hg. L. Bustios Gálvez, 3 Bde. [Transkription des Originaltexts]. – Caracas 1980, Hg. u. Einl. F. Pease, 2 Bde. – Mexiko 1980, Hg. J. V. Murra u. R. Adorno, 3 Bde. [Anm. zur Quechuasprache von J. Uriosto]. – Madrid 1987, Hg. dies., 3 Bde.
ÜBERSETZUNG: Das altperuanische Inkareich und seine Kultur, H. Langenberg, Lpzg. 1949."[Birgit Scharlau. -- In: Kindlers Neues Literaturlexikon. -- München : Kindler, ©1996. -- s.v.]
"Vorrede an die christlichen spanischen Leser Hier siehst du, Christenmensch, das ganze gute und böse Gesetz. Nun, christlicher Leser, teile in zwei Teile, das Böse tu es zur Seite, damit es zur Strafe werde, und mit dem Guten diene man Gott und seiner Majestät. Christlicher Leser, hier siehst du das ganze christliche Gesetz, denn ich habe weder Indios gefunden, die so gierig nach Gold und Silber sind, noch einen, der hundert Pesos schuldet, noch Lügner, noch Spieler, noch Faulenzer, noch Huren, noch Schufte, noch dass sie sich gegenseitig etwas wegnehmen.
Ihr dagegen habt alle Laster und lebt in Ungehorsam gegen Vater und Mutter und Prälat und König, und wenn ihr Gott verleugnet, so verleugnet ihr ihn ohne den Schatten eines Zweifels. Alles habt ihr, und alles lehrt ihr die armen Indios. Ihr sagt, wenn ihr euch gegenseitig schröpft, und viel mehr noch die armen Indios, sagt ihr, dass ihr es zurückgeben werdet. Ich sehe nicht, dass ihr es bei Leben noch im Tode zurückgebt. Mir scheint, Christenmensch, dass ihr alle auch zur Hölle verdammt. Seine Majestät ist ein so großer Heiliger, dass er allen Prälaten und Vizekönigen die armen Eingeborenen anempfiehlt, doch selbst die Prälaten, die weit über das Meer die Gunst zu den armen Indios bringen sollen, handeln, sobald sie an Land gegangen sind, wider die armen Indios unseres Herrn Jesus Christus. Erschreckt nicht, christlicher Leser, darüber, dass die althergebrachten Götzendienste und Irrlehren die alten Indios in die Irre geführt haben, denn sie verfehlten den wahren Weg als Heiden, so wie die Spanier auch Götzen hatten, wie der ehrwürdige Vater Fray Luis de Granada schrieb, dass ein heidnischer Spanier sein Götzenbild aus Silber besaß, das er mit eigenen Händen verfertigt hatte, und ein anderer Spanier beraubte ihn seiner, weshalb er weinend sein Götzenbild suchte; mehr weinte er um das Götzenbild als um das Silber, und so weinten auch die Indios als Barbaren und Heiden um ihre Götzenbilder, als man sie ihnen zur Zeit der Eroberung zerschlug. Und ihr habt euren Besitz und euer Silber auf der ganzen Welt zu Götzenbildern."
[Übersetzung: Die Neue Welt : Chroniken Lateinamerikas von Kolumbus bid zu den Unabhängigkeitskriegen / hrgg. von Emir Rodrúguez Monegal. -- Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1982. -- (Suhrkamp Taschenbuch ; 811). -- ISBN 3-518-37311-0. -- S. 215]
Tafel 503: "Corregimiento / El Corregidor y padre teniente anda rondando y mirando la vergüenza de las mujeres / provincias."
"Los padres y los corregidores andan mirando la vergüenza de las casadas y doncellas
Las dichas justicias y corregidores y padres de las doctrinas, y tenientes de las ciudades y villas y provincias de este reino, con poco temor de Dios y de la justicia y de la ley de cristiano, andan rondando y mirando la vergüenza de las mujeres casadas, y doncellas. Y hombres principales (y) andan robando sus haciendas, y fornican a las casadas y a las doncellas las desvirgan. Y así andan perdidas y sehacen putas, y parenmuchosmesticillos, y no multiplican los indios.
Y como no tienen salario, los dichos tenientes roban. De su parte, el sacerdote y sus fiscales y sacristanes y cantores, y los demás alguaciles, como ven esto, hacen otro tanto en todo el reino. Y no hay remedio.
Y hallando al amancebado le depositan [a la india amancebada] (a) [en] casa del padre [de doctrina] adonde pare mestizo. Y entre ellos son pan y agua, y se defienden entre ellos, lo cual (no usa) [no se acostumbra] esta ley en toda Castilla y Roma, en tierra de cristianos.
Como ven esta ladronería, también los religiosos andan a la ronda toda la noche, en hábito de [vestidos como] indios, sin dejar casa de los indios. Estando durmiendo las doncellas, abren la frazada y se la mira la vergüenza. Y para ellos los susodichos no piden auxilio a la justicia mayor, y así no hay remedio en todo el reino."
[Zitat in: Guaman Poma de Ayala / Francisco Carrillo. -- Lima : Horizonte, ©1990. -- (Enciclopedia historica de la literatura peruana ; 7)]
1618
Reise des aus Haunstetten bei Augsburg stammenden Jesuitenpaters Gaspar Ruiz (Caspar Rueß) (1585 - 1624) von Lima nach Santa Cruz de la Sierra, wo er bis zu seinem Tode weilte. Sein lateinischer Reisebericht Relatio toti itineris R. P. Gasparis Ruiz S.J. befinmdet sich mit anderen Dokumenten im Bayerischen Staatsarchiv München unter der Signatur Cod. lat. 26347
Abb.: Reiseweg des P. Gaspar Ruiz SJ, 1618
Reisebeschreibung der Reise von Juni bis Santa Cruz Von Juli nach Sucre »Nach dem Verlassen Julis besuchte ich einen Kleriker, den Bruder des Gouverneurs von San Laurentius, von dem ich eine mir nützliche Bekundung seines Zugetanseins erhielt. Er begleitete mich auch am folgenden Tage zu dem berühmten Wundertempel der Heiligen Jungfrau von Copacabana. Die Patres vom Orden des Heiligen Augustinus erwiesen mir die außerordentliche Ehre, dass ich nach der Enthüllung des Bildes der Heiligen Jungfrau an dem ihr geweihten Altar die Messe mit feierlicher Liturgie lesen durfte. Ich wurde auch zu Tisch geladen und stattlich traktiert. In dem Kloster lebt ein Pater von verehrungswürdiger Heiligkeit, dem der Dienst an dem wundertätigen Bild aufgetragen ist, nämlich den Schweiß vom Angesicht der Jungfrau, der vor aller Augen um diese Zeit reichlich floss, mit schneeweißer Wolle abzutrocknen. Partikel der vom Schweiße der Gott-gleichen getränkten Wolle teilt er als wunderwirkende Gnadengaben aus. Ein mit uns zum Gotteshaus gekommener Spanier, der an schwerer Epilepsie litt, wurde an Ort und Stelle gesund, und ich konnte mich in Chuquiabo, wo er mir nach einigen Wochen wieder begegnete, davon überzeugen, dass die Heilung von Dauer war. Eine Sehenswürdigkeit der Kirche ist ein silberner Kandelaber von ungeheurem Wert. Außer der Kunstfertigkeit, mit der er gearbeitet worden ist, besitzt er ein Gewicht von 600 Pfund, ein Werk, das in der Welt nicht seinesgleichen hat.
Unterwegs nach Chuquiabo brach die Krankheit meines Laienbruders erneut aus, so dass ich ihn nur mit Mühe dorthin bringen konnte. In der von Spaniern bewohnten Stadt haben wir ein gut fundiertes und geräumig gebautes Kolleg, dem eine Siedlung christlicher Indios angegliedert ist. Die Unseren unterrichten hier 30 Schüler in den Elementarkenntnissen der lateinischen Grammatik und Syntax, daneben sind sie in der Fürsorge für Spanier und Indios tätig.«
In die Zeit seines Aufenthaltes in La Paz, wo er 14 Tage vergeblich auf eine baldige Genesung seines Begleiters wartete, fiel die Feier des Fronleichnamsfestes, deren Beschreibung er sich nicht entgehen lässt:
»In den Straßen drängten sich Indios und Spanier, führten Reigen auf und musizierten, überall brennende Kerzen, an den Wänden der Häuser silber- und golddurchwirkte Teppiche, in die Bilder der Heiligen eingewebt waren. Die Stadtobrigkeit erwies mir die Ehre, zusammen mit den Häuptern der geistlichen Orden und des Weltklerus das bischöfliche Pallium über das Traggestell für den Leib und das Blut des Herrn zu breiten. Da das Holz an Stelle von Teppichen mit massivem Silber überkleidet war, konnte das Gestell von 20 Männern, die es teils unter dem Gerüst verborgen, teils in priesterlichem Gewande seitwärts trugen, nur mit größter Anstrengung fortbewegt werden. Eine Sehenswürdigkeit der Stadt, die meinem Gedächtnis fast entfallen wäre, ist ein Brunnen in unserem Kolleg: aus dem unteren Becken steigt eine Säule auf, die ein zweites, kleineres Becken trägt, und in der durch ein Hebewerk Wasser zu einer Fontäne emporsteigt, das von den Brunnenschalen aufgefangen wird. Sie sind aus einem schneeweißen und so durchsichtigen Stein gefertigt, dass eine Laterne, in dunkler Nacht an einer Seite aufgestellt, auf der anderen Seite eine Helligkeit erzeugt, dass man wie bei Tageslicht lesen kann.
Doch zurück zu meiner Reise, die ich nur von einem Indio begleitet fortsetzte. Am folgenden Tage fand ich am Wegrand einen sterbenden Indio, dürftig bekleidet, allein und verlassen. Ich nahm ihm die Beichte ab, die er unter Tränen begehrt hatte, und ermahnte ihn zur Geduld und wahren Reue über seine Sünden. Da mein Begleiter mit dem Gepäck und den Maultieren weitergeritten war, konnte ich für ihn nicht mehr tun, als ihm ein Stück aromatischen Konfekts zu schenken, das mir in Cuzco verehrt worden war. In der Nacht darauf, während ich in Pan Duro, der >Herberge zum harten Brot< nächtigte, wurde ich zu einem Spanier gerufen, der von Indios tödlich verwundet worden war. Auch ihm nahm ich die Beichte ab, doch ich war entsetzt, da seine Seele noch verlorener als sein Körper war.
Acht Tage später traf ich in Oruro ein. Die Stadt ist vor 70 Jahren wegen der dort gefundenen reichen Silbervorkommen gegründet worden und zu einer Einwohnerzahl von sechs- bis siebentausend Spaniern und Indios herangewachsen. Hier findet man Häuser und Kollegs aller in Peru zugelassenen Orden. Da unserem Kolleg die wirtschaftliche Grundlage fehlt, erbetteln die Väter und Brüder ihre Speise von Tür zu Tür. Selbst der Pater Superior schließt sich nicht aus und erbittet vor den armseligen Rundhütten der Indios ein und das andere für seine Söhne. Betritt man das Kolleg, findet man nur einen Pater oder Bruder vor, die anderen sind mit dem Bettelstab unterwegs.«
Für Caspar Rueß, den Bewunderer der Prachtentfaltung der Kirche, den stolzerfüllten Pater eines in Peru angesehenen Ordens, der ehrgeizig eine Spitzenstellung in der Bildungs- und Missionsarbeit anstrebte, erregte der Zustand im Kolleg kein Mitgefühl, sondern ablehnende Empörung. Er kann sie, zur Demut gegenüber seinen Ordensgenossen und Oberen verpflichtet, nicht direkt äußern. Hier in Oruro lag zweifellos ein schwerer Verstoß gegen die Forderung der Jesuitengenerale vor, nur dort Kollegs zu gründen, wo die wirtschaftliche Zukunft durch gesicherte Einnahmequellen gewährleistet war. Die Übung in Askese und Selbsterniedrigung als Lebensaufgabe war Sache anderer Mönchsorden.
Rueß musste sich 20 Tage an diesem Ort aufhalten, da er keinen wegekundigen Führer hatte und ein Pater, der ebenfalls nach Potosi reisen wollte, vorher nicht abkömmlich war. Während dieser Zeit scheint er dem Kolleg tunlichst aus dem Wege gegangen zu sein, er erwähnt nichts über das Zusammenleben oder eine Beteiligung an dem Betteldienst. Nach seinen Ausführungen wandte er sich dem Studium der Silbergewinnung in Oruro zu.
»An diesem Orte suchte ich ein Bergwerk auf, in dem gerade eine ergiebige Silberader gefunden worden war, die nur geringe Beimengungen von taubem Gestein enthielt. Dabei wurde ich mit einem deutschen Schreiner bekannt, der aus Wien gebürtig war. Seine Fertigkeit hatte ihm in diesem Gebiet im Laufe der Zeit mehr als 100000 Florentiner eingebracht, die aber, eine Leistung seiner deutschen Zecherbegabung, fast völlig verflüssigt worden sind.«
Zur Erklärung dieser fast unglaublichen Zahlenangabe sei vermerkt, dass sowohl Manufakturwaren wie auch der Wein das Tausendfache des Limaer Preises kosteten. Der Pater fährt fort:
»Ich ermahnte ihn, er solle doch sparsamer sein und mit seinem Gewerbe wieder so viel zusammenbringen, dass er als geachteter Mann in sein Vaterland zurückkehren könne. Aber wahrscheinlich habe ich das Lied für einen Tauben gesungen, denn das Laster des Trinkens war ihm schon zur zweiten Natur geworden. Übrigens habe ich hier und auch sonst im Hochland weitere Deutsche getroffen, um die es meist nicht besser bestellt war. Oft widmen sie sich dem Verkauf von Wein, den sie aber, ehe ihn andere kaufen, lieber sich selbst zugute kommen lassen. In den Verhüttungswerken wurde mir viel Geld angeboten, wenn ich eine Möglichkeit ausfindig machen würde, um die eisernen Rüttelsiebe mit Wasserkraft anzutreiben, mit denen aus dem zerstoßenen Rohmaterial das Silber vom Erdigen getrennt wird. Aus Deutschland mit dem Mühlenmechanismus vertraut, ist mir die Lösung des Problems nicht schwer gefallen. Doch die Kunst für Geld zu verkaufen, ist nicht unser Geschäft, und so teilte ich meinen Konstruktionsplan dem deutschen Schreiner mit, der sich im Mühlenbau gleichfalls auskannte. Er hielt ihn für gut und praktikabel und machte ihn sich bei meiner Abreise nicht wenig zunutze. Wenn er an einer einzigen Rüttelmaschine nur 300 Kronen verdiente, was hier als geringer Preis gilt, musste ein Geschäft von mindestens 6000 Kronen für ihn herausspringen.«
Die Nachricht, dass Rueß bereits Deutsche in Peru antraf, die gegen Ende des 16. Jahrhunderts eingewandert sein dürften, zeigt, dass das Silber und Gold Perus nicht nur die Spanier zur Auswanderung verlockte. Der Pater erwähnt neben den Deutschen auch Holländer und Engländer im Zusammenhang seiner kritischen Betrachtung über Misserfolge bei der Indiomission. Die spanische Gesetzgebung, die illegale Auswanderung mit der drakonischen Galeerenstrafe bedrohte, war machtlos, wenn in der Hafenbehörde Sevillas gegen eine entsprechende Handsalbe falsche Papiere ausgestellt oder akzeptiert wurden. War ein Mann, der ein Handwerk verstand, aber erst einmal an Bord oder in Peru, so behielt man ihn, auch wenn er durch unzureichende Sprachkenntnisse Verdacht erweckte. Eine andere Hintertür öffnete sich, wenn ein Kapitän eine getarnte Westindienfahrt aus anderen Häfen wagte.
Rueß lernte in Sucre einen holländischen Schiffseigner und Kapitän kennen, der mit seinem Schiff von Portugal aus nach Peru gekommen war. Konnte man den peruanischen Hafenbehörden glaubhaft versichern, Stürme hätten das Schiff vom ostindischen Kurs aus dem Atlantik an die pazifische Küste verschlagen, so ließen sich Schiff und Ware gut verkaufen. Die Besatzungsmitglieder waren, wenn sie sich der Sierra zuwandten, vor dem Zugriff der Inquisition und der Behörden sicher. Der holländische Kapitän, der unklug genug gewesen war, sich in Sucre, dem Sitz eines obersten Gerichtshofes, als reicher Mann niederzulassen, bot—zumal er aus einem portugiesischen Hafen ausgelaufen war — Misstrauischen und Neidern viele Angriffsflächen. Er wurde in Prozesse verwickelt, verlor sein Vermögen und verfiel dem Trübsinn. Was Rueß über die damalige Trunksucht unter Deutschen aussagt, war gewiss keine Übertreibung. Selbst unter den Jesuiten in deutschen Ordensprovinzen gab es ärgerliche Auseinandersetzungen über die Verordnungen, wieviel Wein oder Bier zu den Mahlzeiten verabreicht werden durfte. Nicht ohne Grund hatte der Provinzial in Lima gewitzelt, das Wasser sei doch ein Feind des deutschen Magens.
In Potosi traf Rueß ein Kolleg an, das nach seinem äußeren Eindruck, der von ihm entfalteten Tätigkeit und der dort gepflegten Umgangsformen wieder den Vorstellungen unseres Paters von einer Niederlassung seiner Sozietät entsprach. Der Rektor war ihm in Begleitung eines weiteren Paters zwei Meilen entgegengekommen, um ihn zu begrüßen, und im Kolleg wurde er von den Vätern und Brüdern herzlich und in liebevoller Gastlichkeit aufgenommen. Die Kirche war reich ausgestattet, prächtige Altarnischen, Reliquienschreine, Messgewänder. Auch hier wertet Rueß nicht nur die künstlerische Ausführung der Goldschmiedearbeiten, ihn beeindruckt immer wieder der hohe Schätzpreis: 30000 Florentiner für ein Traggestell, auf dem ein Standbild Marias bei Prozessionen mitgeführt wird, sieben- bis achttausend allein für das Kleid des Jesuskindes. Es mutet fast barbarisch an, mit welcher Massivität die im Reiche Gottes erwartete Herrlichkeit hier veranschaulicht wird. Zur gerechten Urteilsfindung über die Wertungsmaßstäbe des Caspar Rueß muss jedoch berücksichtigt werden, welchen Wert zur gleichen Zeit geistliche und weltliche Fürsten Europas, Jesuitenkollegs und Stadtobrigkeiten darauf legten, sich für repräsentative oder kirchliche Bauten ein Kolossalgemälde des Maler-Fürsten Peter Paul Rubens zu beschaffen. Das Sujet — etwa die Himmelfahrt Marias oder die Wunder eines Heiligen —, die künstlerische Qualität und der dem kundigen Betrachter erkennbare Schätzpreis spielten für die Hochschätzung eine gleichermaßen wichtige Rolle.
Im Besitz des überlieferten Könnens, das in der Zeit der kultischen Verehrung der Sonne und ihrer Söhne erworben worden war, ergriffen die indianischen Goldschmiede die vom Christentum gebotene Gestaltungsmöglichkeit offensichtlich mit phantasievoller Hingabe. Die Masse der Indios hatte nach der Zerstörung der goldenen Säle inkaischer Staatsheiligtümer wieder goldene Tempel, die christlichen Prozessionen waren nicht weniger großartig und festlich als die Umzüge alter Zeit, volkstümliche Musik und Reigen kamen zu ihrem Recht. Warum aber verharrten die Indios während des Alltags in einer dumpfen Unzugänglichkeit, warum zeigen ihre Gesichter eine ausdruckslose Verschlossenheit, wenn sie mit den einfachsten Argumenten der Vernunft zu einer fortschrittlichen Lebensweise aufgefordert werden? Diese Frage bereitete den Jesuiten viel Kopfzerbrechen, und in Augenblicken der Verzweiflung über mangelnde Fortschritte ihrer Arbeit suchten sie sich mit dem makabren Scherzwort zu trösten:
»Diese Indios wurden ja erst Glieder der Menschheit, nachdem sie der Papst als solche determiniert hatte.«
Rueß gibt bei der Beschreibung Potosis eine anschauliche Beschreibung ihrer Sitten:
»In der großen bergigen Stadt leben etwa 40000 Indios. Sie wohnen nach ihrer Weise in ärmlichen Rundhütten, deren Durchmesser fünf Schritte beträgt. Die Wände, aus Lehm gestampft, erreichen oft nicht die Höhe der menschlichen Statur. Die Tür ist äußerst eng und nur fünf Handflächen hoch. Bei Anbrach der Nacht kriechen sie mit ihrem ganzen Hausrat und ihrer Familie hinein, zusammen mit Schweinen, Hühnern, Hunden, Katzen und anderen unflätigen Mitbewohnern. Drinnen legen sie sich auf den nackten, höchstens mit einer Rindshaut oder Schaffellen bedeckten Erdboden nieder, um unter einem groben Tuch nach Art der Tiere eng nebeneinander zu schlafen: Eltern, Kinder und Gastfreunde. Was Wunder also, dass sich hier die schwersten Formen der Blutschande häufen. Doch alle Argumente versagen, um sie von dieser tierischen Lebensweise abzubringen. Selbst in Juli konnte das nicht erreicht werden, denn eher verlassen sie ihre Äcker und ihre Habe und irren als Flüchtige in den Bergen herum, als dass sie sich dazu bringen lassen, in einem Hause mit getrennten Kammern zu schlafen. Mit dem Trinken von Chicha, einem alkoholischen Getränk, verschwenden sie ähnlich den Deutschen im Laufe eines Monats Tausende von Kronen. Von der Widerlichkeit dieses Gebräus möge sich Euer Ehrwürden durch die Art der Zubereitung überzeugen. Ihr Getreide, in der Volkssprache Mais genannt, wird geröstet und zu Mehl vermählen. Dann lassen sie es von herbeigerufenen zahnlosen Vetteln, rotznasigen Jungen und Mädchen in den Backentaschen mit Salz mischen und zu einem dicken Brei verarbeiten. Mit Wasser versetzt und gekocht, gerät er in etwa zwei Tagen in Gärung, und dann wird unter den Nachbarn bekanntgemacht, dass Chicha zu verkaufen sei. Diese stellen sich ungesäumt Mann für Mann ein und trinken so lange, bis — selbst wenn es 100 Amphoren wären — kein Tropfen mehr übrig ist. Zwischendurch, damit auch Musik und Reigen nicht fehlen, überziehen sie einen irdenen Topf mit einer Tierhaut und bearbeiten sie mit einem beliebigen Stock ohne Melodie und erkennbaren Rhythmus. Zu diesem misstönigen Klang bewegen sich alle, junge Leute wie zahnlos gewordene Männer und Weiber im Kreise hin und her, mit unsicher werdendem Schritt, kunstlosen Gesten und Gesang, bis sie endlich, durch die Schwere des Kopfes zu Fall gebracht, umsinken. Dem Laster der Zügellosigkeit und Trunkenheit sind die Indios durchweg verfallen. Sie sind unfähig, an den anderen Tag, an die Bedürfnisse von morgen zu denken. So besteht denn ihr ganzer Hausrat und Besitz aus nichts als einem kleinen Äckerchen, das sie mit Mais bestellen, um ihn zu vertrinken, aus ein und dem anderen irdenen Topf zum Kochen gewisser Knollen und Kornfrucht, aus ein paar Fellen und ihrer Kleidung: einem ärmellosen quadratischen Umhang, der bis zu den Knien reicht. Die meisten besitzen weder Stiefel, Überrock oder Filzkappe, so dass Kopf, Arme und Beine selbst in Gegenden mit furchtbarer Kälte ungeschützt bleiben. Eine Habseligkeit, die für ihr säuferisches Dasein äußerst wichtig ist, hätte ich fast vergessen, nämlich den großen Topf zur Bereitung der Chicha und den hölzernen Becher. Ihr Gemütszustand ist labil, da sie von Ängsten und Wahnvorstellungen beherrscht werden. Überwacht man sie nicht sorgfältig, fallen sie, von Medizinmännern und Zauberern überredet, in ihren heidnischen Irrglauben zurück. Erst vor wenigen Monaten hat sich im Bistum Huamanga herausgestellt, dass alle Indios ohne Ausnahme mit den unter ihnen verborgen lebenden Magiern Götzendienst trieben. Um sie zur christlichen Lehre zurückzuführen, hat unser Pater Superior den Hochwürdigen Pater General um sechs zusätzliche Patres gebeten. Die geistigen und körperlichen Anstrengungen, die unsere Väter in Ausübung der Barmherzigkeit an diesem rohen und beklagenswerten Volk auf sich nehmen, lassen sich mit Worten nicht ausdrücken.«
Nach diesen Ausführungen über die Fragwürdigkeit der Bemühungen, die Indios zu christianisieren und auf eine höhere Zivilisationsstufe zu heben, bietet Rueß den Daheimgebliebenen noch eine anschauliche Skizze der Stadt Potosi.
»Hier«, schreibt er, »ist das Idol des ganzen Erdkreises, das Silber, in einem Berg angehäuft, der in seiner ebenmäßigen Kegelgestalt die umliegenden Bergkuppen wie ein Fürst überragt. Ich ritt eines Morgens zum Gipfel hinauf, zu der Stunde, als am Fuße des Berges das Morgengebet verrichtet worden war und sieben- bis achttausend Bergarbeiter von dem höchsten Richter der Indios zu den Besitzern der einzelnen Silberstollen abkommandiert wurden. In früheren Jahren waren es zeitweise 20 000, die das ganze Jahr über, außer den Festtagen, von den finsteren Eingängen verschluckt wurden. Unterhalb des Gipfels war der Hauptmarkt im Gange, auf dem alles für das Leben Notwendige feilgehalten wurde. Das vielstimmige Geschrei, das von dort und aus der Tiefe heraufdrang, glich dem Ausbruch der Sprachverwirrung in Babylon. Das Klima ist so bitterkalt, dass nur wenige Kinder der Spanier das Säuglingsalter überleben, denn Holz und Kohlen, die von weit herbeigeschafft werden müssen, sind kaum bezahlbar, wie alles, was zum Kauf angeboten wird.«
In der Beschreibung des Weges von Potosi nach Sucre tritt ein weiterer für Caspar Rueß und die katholische Christenheit seiner Zeit bezeichnender Wesenszug hervor: Das Bedürfnis und die Kraft der Phantasie, im weltlichen Geschehen das Handeln Gottes in sinnfälliger Gegenwärtigkeit zu erleben. Erzählungen, dass ein Jünger Jesu die Indios bereits aufgesucht habe, dass heiligmäßig lebende Patres vor den Augen der Eingeborenen zeitweise zum Himmel emporgehoben wurden, waren nicht nur pädagogisch wirksame Mittel für den Missionar, der es mit kindlich denkenden Menschen zu tun hat. Die schöpferische Phantasie und die konstruktive kritische Vernunft, die Rueß den Kern einer Legende und eine kausal begründete Klimalehre produzieren ließ, also etwas objektiv Unvereinbares, ist ein besonders auffälliges Zutagetreten der im Wesen des Menschen begründeten Zwiespältigkeit. Vor aller Augen zeigt sie sich heute weniger im religiösen als im politischen Bereich.
»Auf dem Wege nach Chuquisaca«, erzählt Rueß, »erlebte ich etwas, das des Aufhorchens wert ist. Wir kehrten in einem Tambo ein, einer Herberge, wie man sie im Abstand von jeweils einer Tagereise in dieser Gegend antrifft; denn Dörfer bekommt der Reisende über Strecken von 50, 60 und mehr Meilen nicht zu Gesicht. Der Tambero hatte offensichtlich sein Gewissen schon lange nicht mehr durch eine Beichte erleichtert, er lebte unbekümmert zusammen mit einer Frau, die man nicht nur für seine Geliebte hielt, sondern die es nach allgemeinem Urteil auch war. Ich habe mich ihm freundlich zugesellt, in das Gespräch manches über Gott, aber kein Wort über die Beichte einfließen lassen. Im Verlaufe meines nächtlichen Aufenthaltes setzte ihm Gott zu und verwandelte den vorher leichtfertig Daherredenden in einen Menschen, der unablässig nur den einen Satz hervorbrachte: >Mein Pater, ich muss Dich überzeugen, dass Du mir zur Errettung meiner Seele vor den Qualen der Hölle gesandt bist. Würdige mich, die Beichte abzulegen !< Ich willigte ein und zog mich mit ihm in den einzigen menschenleeren Raum, seine Vorratskammer, zurück. Die Indios machten sich schon daran, die Maultiere für die Weiterreise von der Weide zu holen. Doch das Sanfteste unter den Tieren floh, was noch nie geschehen war, und ließ sich nicht eher einfangen, bis der Tambero seine langdauernde Beichte beendet hatte. Als ich aus der Kammer heraustrat, erreichte der Indio, der die entwichene Mula am Halfter führte, gerade den Tambo. So waren meine indianischen Begleiter daran gehindert worden, die Beichte zu stören und vorzeitig aufzubrechen.«
Von Sucre nach San Laurentius
»Nach viertägigem Ritt«, berichtet Rueß, »bin ich in Chuquisaca eingetroffen, einer Stadt, die als Residenz eines Erzbischofs und Sitz eines königlichen Senats, den wir hier Audiencia nennen, Ansehen genießt. Die Unsrigen haben hier ein Kolleg, in dem 2 Patres Gymnasialkurse halten, ein dritter liest Philosophie und Moraltheologie und der vierte lehrt das Aymarä, die Sprache der Indios im südlichen Hochland. Das Klima der Stadt ist überaus angenehm, unter den Einwohnern gibt es viele Angehörige der spanischen Nobilität, doch wegen der Niedrigkeit der Häuser wirkt sie wie eine deutsche Kleinstadt. Ich fand einen portugiesischen Pater, der mich in die Sprache der Chiriguano einführen wollte, die von Bewohnern des Gouvernements San Laurentius gesprochen wird. Doch das Vorhaben kam über die ersten Anfänge nicht hinaus, zwei wichtige Geschäfte nahmen mich völlig in Anspruch: die Beseitigung der Widerstände, die sich meiner Weiterreise entgegenstellten, und der Beistand für den an Wahnvorstellungen leidenden holländischen Kapitän, der mit seinem Schiff aus Portugal gekommen war. Ich traf ihn auf dem Marktplatz, eine Gestalt von ehrwürdigem und edlem Aussehen. Als er in mir einen Deutschen erkannte, hellte sich sein Geist auf, die Schwermut schien wie mit einem Schwamm weggewischt. Am folgenden Tage suchte er mich im Kolleg auf, offenbarte mir mit von Schluchzen und Tränen gehemmter Stimme seine Pein und bat um meinen Rat. In der Behandlung von seelischen Komplexen völlig unerfahren, verließ ich mich auf Gottes Beistand und ersuchte ihn, am folgenden Tage wiederzukommen.«
Rueß wälzte inzwischen die im Kolleg vorhandene Literatur über den Exorzismus, die Kunst, Kranke von einer Besessenheit zu heilen, und wiederholte die Anweisungen seines Ordensstifters Ignatius von Loyola über die Methode der Gewissenserforschung. Die Therapie, zu der er sich entschloss, mutet geradezu modern an. In vieltägigen Sitzungen von drei bis vier Stunden stärkte er zunächst das Vertrauen des Patienten, indem er ganz allgemein derartige Krankheitsfälle, Heilmethoden und Erfolge unter Zitierung vieler Autoritäten schilderte. Darauf wandte er sich speziellen Wahnvorstellungen zu und zeigte, in welcher Weise sie den Geist irreführen.
»Es dauerte lange«, heißt es in der Rueßschen Schilderung sinngemäß, »bis wir die verschiedenen Erscheinungsformen und Anlässe seiner Verzweiflungsanfälle ermittelt hatten. Dann veranlasste ich ihn, sich zur Vorbereitung auf die Beichte jeder bedrückenden Einzelheit in seinem Leben zu erinnern, alles niederzuschreiben, es mit mir nochmals durchzugehen und zu ergänzen, damit nichts zurückbleibe, was seinen Geist später erneut bedrängen könnte. Vor der Absolution befahl ich ihm, in Zukunft niemals wieder an das Vergangene zu denken, darüber zu sprechen oder im Falle zukünftiger Beichten nochmals zu berühren, sondern fest darauf zu vertrauen, dass ich das Ganze vor dem obersten Richter vertreten werde. Er übergab mir sein ganzes Leben als mein Eigentum und fühlte sich befreit. Gott hat ihm sein Licht in eine Verfinsterung der Seele geschickt, die ich niemals vorher erblickt habe oder für möglich gehalten hätte.«
Noch ein anderer aus Flandern gebürtiger Einwohner Chuquisacas, ein Kleriker, schenkte Rueß seine besondere Zuneigung. Von ihm erhielt er ein Maultier, das er für die Weiterreise gut gebrauchen konnte.
»Lieber aber«, bekennt unser Landsmann im Bewusstsein seiner Verbundenheit mit den Philosophen in Ingolstadt, »wäre mir ein anderes Geschenk gewesen, nämlich zwei Backenzähne eines Giganten, die ein Freund des Klerikers besaß. Sie wurden mit den Skelettresten in Tarija gefunden, einem 30 Meilen entfernten Ort. Jeder einzelne der Zähne soll ein Gewicht von 8 Pfund haben. Damit Euer Ehrwürden die Nachricht nicht für eine Fabel halten, versichere ich, dass ich die Hälfte eines Fußknöchels in der Hand gehabt habe, dessen Größe dem Umfang eines menschlichen Kopfes nichts nachgibt. Der Schädel des Giganten ist nach den Aussagen von Augenzeugen so gewaltig, dass in der Höhlung ein Degen Platz findet. Ich habe inzwischen jenem Freund des Klerikers geschrieben, er möge mir wenigstens einen Zahn überlassen, damit er in Ingolstadt untersucht werden könne.«
...
In Chuquisaca erfuhr Rueß, wie schwierig es war, das Gouvernement San Laurentius zu erreichen. Der Weg führte zunächst noch durch befriedetes Gebiet bis zur Stadt Misque und den zwei Tagereisen entfernteren Hacienden von Santa Maria de la Guardia. Dann aber begann das zerklüftete Waldgebirge im Quellgebiet des Madeira am Osthang der Anden, für dessen Durchquerung man fast einen Monat benötigte. Wegen der feindseligen Haltung der kriegerischen Nomadenstämme fand der Reisende nirgends Unterkunft oder Verpflegung und musste stets auf Überfälle gefasst sein. Ohne Tragtiere für den notwendigen Proviant, die dazugehörigen Trossknechte und eine militärische Bedeckung gab es hier kein Weiterkommen. Das alles aber kostete Geld, viel Geld, allein ein einzelner Soldat erhielt für die Begleitung 100 Kronen. Rueß musste also auf die Gelegenheit warten, dass sich eine vermögende Persönlichkeit auf den Weg nach San Laurentius begab. Das schien in absehbarer Zeit möglich zu sein, da sich der Gouverneur in Chuquisaca aufhielt. Nach Erledigung seiner Geschäfte wollte er noch in Misque einige Tage bei seiner Schwester verweilen, dort sollte ihn Rueß aufsuchen und in seiner Gesellschaft Weiterreisen.
»Als ich«, schreibt Rueß, »nach Misque kam, hatte der Gouverneur einen schweren Podagraanfall erlitten und, in der Gewissheit, für lange Zeit reiseunfähig zu sein, dem Führer seines Begleitkommandos erlaubt, nach San Laurentius zurückzukehren, leider, ohne an mein Vorhaben zu denken. Ich war nicht wenig niedergeschlagen, begehrte ich doch nichts sehnlicher, als an das Ziel meiner Reise zu gelangen. Von dem Orte Misque, wo ich länger festgehalten wurde, will ich Euer Ehrwürden eine Schilderung geben. Die Stadt ist erst vor wenigen Jahren gegründet und umfasst noch nicht mehr als 40 Häuser spanischer Familien und die angrenzenden Hütten der hier arbeitenden Indios. Dennoch gibt es schon drei Niederlassungen von Mönchen: barfüßige Augustiner, Dominikaner und Franziskaner, die von Almosen leben. Neben Gönnern unserer Sozietät bot mir der Guardian der Franziskaner Gastfreundschaft an, die ich auch wegen der mir zusagenden Stille unter dem Dach ihres Klosters annahm. Für die Insassen war es etwas unerhört Neues, einen Theatiner — wie sie uns nennen — unter sich zu haben. Aber als sie gewahr wurden, dass ich mich völlig in ihre Lebensweise einfügte, mit ihnen das Göttliche Offizium rezitierte und ihnen während der vom Gebot des Schweigens freien Stunden — die sie nach unserer Sitte während der gesamten Tischzeit einführten — über ihnen unbekannte Weltgegenden und von meiner Reise erzählte, waren sie ganz beglückt. Wenn ich, anderen Einladungen folgend, einen ganzen oder auch nur halben Tag abwesend war, herrschte unter ihnen, wie mir anvertraut wurde, große Bekümmernis.«
Als anregender Gesellschafter wie auch als kluger Gewissensberater stand Rueß, was sich noch bezahlt machen sollte, bei Hoch und Niedrig der kleinen Stadt bald in hoher Gunst, die er noch dadurch vermehrte, dass er an verschiedenen Stellen Sonnenuhren aus Zedernholztafeln errichtete. Während dieser Geschäftigkeit suchte Rueß hartnäckig nach einer Möglichkeit für seine Weiterreise.
»Ich drehte jeden Stein um auf der Suche nach Soldaten, die mich begleiten könnten, und hatte schon durch Umfragen und Bitten einige aufgetrieben. Sie versicherten mir, dass der Dekan der Kathedrale von Sankt Laurentius, dem zwei Jahre zuvor wegen eines geistlichen Gerichtsverfahrens die Amtsbefugnis entzogen worden war, gern in die Stadt zurückkehren wolle, da ihn inzwischen das erzbischöfliche Tribunal von der ihm zur Last gelegten Schuld freigesprochen habe. Aber ich stellte bald fest, dass der bischöfliche Provisor, der sich in der Rolle des stellvertretenden Oberhirten gefiel, dem Dekan die Rückkehr verweigerte und mit einem neuen Prozess die weitere Verzögerung meiner Abreise bevorstand. In der Überzeugung, dass für uns in Santa Cruz auch ein gutes Einvernehmen mit dem Dekan des Kirchenbezirks sehr förderlich sein werde, entschloss ich mich, seine Sache zu der meinen zu machen. Ich suche also den altersschwachen Bischof auf, der sich von Misque nicht mehr fortbewegen konnte, stelle ihm die durch die Abwesenheit des Dekans im Kirchenbezirk San Laurentius verursachte Not vor, verbürge mich für den guten Ruf des Dekans unter allen Verständigen und Frommen und bitte ihn, da außer den rechtlich Gesinnten auch das erzbischöfliche Tribunal die Klage abgelehnt habe, kraft seiner bischöflichen Autorität dem Provisor zu verbieten, weitere Schwierigkeiten zu machen. Im Besitz seiner Zusage wende ich mich an den Gouverneur als höchsten weltlichen Würdenträger mit der Bitte, er möge unter Einsatz seines Ansehens und Einflusses den Provisor bewegen, seinen Widerstand gegen die Rückkehr des Dekans aufzugeben. Endlich verfüge ich mich zu diesem selbst und bitte ihn unter Anspielung auf die Hochachtung und Zuneigung, die er nach eigenem Bekenntnis von unserer Sozietät erfahren habe, meine Weiterreise zu fördern. Er versichert mir, dass er zu allem sofort bereit sei, aber keine Möglichkeit für die Gewinnung des Begleitschutzes sähe, da sich alle Soldaten bereits zerstreut hätten. Ich aber, so meine Entgegnung, sehe die Hilfe, deren Gewährung Eurer Magnifizenz nicht schwerfallen wird. Schicken Sie den Dekan nach San Laurentius, wenn er mit Reisegeld versehen ist, wird es an Söldnern nicht fehlen. Seine Miene verfinstert sich, er verliert den Gleichmut, doch hartnäckig nötige ich ihm die Summe von 1500 Kronen für dessen Reise ab. Dem Dekan erschien die Summe, die ich für ausreichend gehalten hatte, zu niedrig, doch angesichts der starrsinnigen Haltung des Provisors gab er sich mit dem Angebotenen zufrieden und machte sich reisefertig. Ich sammelte mit meinem Laienbruder — der inzwischen nach einem erneuten Krankheitsrückfall auf einer Hacienda gesundgepflegt worden war — den für uns erforderlichen Proviant, der mir von allen Seiten versprochen worden war. Der eine gab zweimal gebackenes, der andere für die ersten Reisetage frisches Brot, andere Wein, Fleisch, Süßigkeiten. Ein Freund unserer Sozietät stellte zwei Negersklaven und einen Indio zur Beförderung meines Gepäcks zur Verfügung, ein weiterer spendete 100 Kronen als Sold für einen Soldaten. Auch Waffen für mich und meinen Begleiter wurden angeboten, die ich aber, auf den Beistand Gottes vertrauend, ablehnte. Nachdem alles verpackt war, verabschiedete ich mich von dem Bischof, der mir seinen Segen für die lange, gefahrvolle Reise durch die Wildnis und Vollmacht für mein Wirken innerhalb seiner Diözese erteilte, sagte den anderen geistlichen und weltlichen Autoritäten Lebewohl und verließ am 17. September die Stadt. Euer Ehrwürden hätten die Trauer der Franziskanerpatres sehen müssen, die sich vor Tränen kaum verabschieden konnten, und auch ich bekenne, dass ich auf meiner ganzen Reise kein Kolleg mit solchem Schmerz verlassen habe. Wir reisten während der ersten Tage ohne Sicherheitsvorkehrungen, da die Indianer des Waldlandes nicht im Gebiet von Santa Maria de la Guardia herumstreifen. Durch Rodungen mit neu angepflanzten Weinbergen kamen wir schließlich zu dem Besitz eines Italieners, auf dem Rinder, Schweine und Ziegen in großer Zahl gehalten wurden. Der Besitzer, ein Freund des Dekans, der selbst auf Reisen war, hatte seine Söhne angewiesen, uns gastlich aufzunehmen und Reiseproviant zur Verfügung zu stellen. Während wir auf die noch nicht vollständig versammelten Soldaten warteten, wurden zwei Ochsen geschlachtet und ihr Fleisch zusammen mit dem von Ziegen und Schweinen in dünne Streifen geschnitten und in der Sonne getrocknet. Fast wäre uns hier noch ein großes Unglück zugestoßen. Unsere Indios mussten die Kälber von den Muttertieren trennen, die am anderen Morgen gemolken werden sollten. Das gelang bis auf eine
Kuh, die ihr Kälbchen nicht verlassen wollte. Der Kapitän unserer Soldaten eilte mit einem langen Stock zu Hilfe, wurde aber von dem erbosten Tier niedergeworfen und mit Hörnern und Hufen attackiert. Nur mit Steinwürfen und lautem Geschrei konnten der Dekan und ich die Kuh ablenken und den Verletzten befreien. Innerhalb von vier Tagen war er aber mit Umschlägen und Salben so weit kuriert, dass er, wenn auch unter Schmerzen, das Kommando für den Weitermarsch übernehmen konnte. Ein Teil der Soldaten, die über langen, dichtgewebten Baumwollgewändern Panzer und als Kopfschutz Helme tragen, bildeten die Vorhut. Während der ganzen Reise legten sie den Panzer und die geladenen Pistolen nicht ab, auch hielten sie die Lunten am Glimmen. An der Spitze des Haupttrupps marschierten der Dekan, ich und mein Laienbruder, dann folgte die Kolonne der Trossknechte mit den beladenen Maultieren und der aus Indios und Negern bestehenden Dienerschaft. Die Nachhut bildeten wieder nach Landessitte bewaffnete Soldaten. Zum Aufschlagen der Nachtlager wählten wir möglichst lichtes Gelände an einem Bach oder Fluss, dort wurde entsprechend unserer Marschordnung an drei Feuerstellen gekocht, während der Dekan und ich unser gottesdienstliches Amt versahen. Das Vorwärtskommen in dieser Region ist besonders schwierig, weil der Weg unausgesetzt von Dickicht und steilen Hängen so eingeengt wird, dass er einem beladenen Maultier kaum Platz bietet. An den engsten Stellen graben die Indianer Löcher in die Erde, in denen sie, ausreichend verproviantiert, den Reisenden auflauern und sie mit ihren Pfeilen durchbohren. Stoßen sie aber auf starken Widerstand, so entziehen sie sich dem Gegenangriff auf vorbereiteten Fluchtwegen. Die Soldaten haben mir eine Reihe solcher Schlupfwinkel gezeigt, von denen aus Reisende niedergemacht worden sind. Bevor wir uns derartigen Stellen nicht ohne Unruhe näherten, gaben sie als drohendes Warnzeichen eine ganze. Salve von Schüssen ab. Doch ohne einem Angriff der Wilden ausgesetzt zu werden und umsorgt von dem Dekan, der alles Erdenkliche tat, um mir die Strapazen erträglicher zu machen, gelangten wir am 10. Oktober nach Rosete. Es war um die vierte Nachmittagsstunde, das zwei Meilen entfernte San Laurentius wäre noch zu erreichen gewesen. Doch ich war dafür, dass der Dekan auf feierliche Weise in seine Kathedralstadt zurückkehren sollte. Wir blieben, und ich schickte zur Vesperzeit zwei Soldaten mit dem Auftrag in die Stadt, die Ankunft des Dekans zu melden, alle Bürger einzuladen, ihn mit Ehren zu empfangen, die Glocken als Zeichen der Freude zu läuten und für die musikalische Ausschmückung eines feierlichen Tedeums zu sorgen. Als die Boten zur Stadt kamen, schössen sie zunächst Salut und läuteten die Glocken, was die aufgeschreckten Bürger anfangs für ein Alarmzeichen hielten, bis sie durch das Weiterläuten begriffen, dass eine gute Nachricht eingetroffen sein musste. Unsere Väter, durch die Boten gleichfalls benachrichtigt, beschlossen, uns am anderen Morgen entgegenzuziehen. Aber siehe, wie leicht Gott den von uns ausgedachten Pomp im Winde verwehen lassen kann: Während der Nacht zogen dicke Wolken am Himmel auf, die am frühen Morgen, als der größte Teil der Maultiere beladen und wir beim Aufbruch waren, ihre Wassermassen über das Land ausschütteten. So kam bis auf wenige Bürger, die vor dem Wolkenbruch ausgezogen waren, niemand dem Dekan entgegen. Während des Einzugs in die Stadt bat ich das Gefolge, uns zur Kathedrale zu führen, um den Dekan nach dem Tedeum zu seinem Wohnsitz zu geleiten. Aber es war ohne mein Wissen schon etwas anderes befohlen worden, nämlich direkt zum Kolleg unserer Sozietät zu ziehen, so dass ich mich, durch diese freundschaftliche List getäuscht, unversehens von den Armen der Unseren umschlungen sah. Können sich Euer Ehrwürden vorstellen, welches tiefe Glück mich durchströmte, als ich begriff, dass ich im Hafen von Santa Cruz gelandet war, gelandet nach einer Reise von 2 Jahren und 8 Monaten voller Mühsal und Gefahren? Ich selbst konnte mich wahrhaftig vor Freude nicht fassen.«"
Abb.: Letzte Seite des Itinerariums von P. Gaspar Ruiz SJ"Nach dem Überschwang der ersten Tage zog sich Rueß zu den gebotenen geistlichen Exerzitien zurück und begann anschließend die Zusammenstellung seiner Reisenotizen für den Bericht an den Provinzial in Ingolstadt, dem er ein für Scheiner bestimmtes Expose über das Klima in den Tropen anfügte. Der Schlussteil des Reiseberichtes lässt erkennen, dass dem Überschwang eine starke Ernüchterung gefolgt war.
»Es bleibt mir noch übrig«, heißt es da, »dass ich Euer Ehrwürden die Örtlichkeit beschreibe, wegen der ich das Vaterland und die nützliche Arbeit aufgegeben habe, dem Glaubensabfall zu begegnen. Sankt Laurentius, mein jetziger Aufenthaltsort, ist eine Stadt mit etwa 80 spanischen Familien, deren Häuser man auch Hütten nennen könnte. Ringsum von feindseligen Stämmen umgeben, werden gleichsam vor der Türschwelle nicht wenige Spanier von den Indianern erschlagen, wie das zur Zeit meiner Ankunft einigen widerfahren ist, die am nahen Fluss dem Fischfang nachgingen. In der Nachbarschaft, 4 bis 8 Meilen entfernt, liegen Landgüter, auf denen gewaltige Mengen von Zuckerrohr und Mais geerntet werden. In den dazugehörigen Dörfern gibt es keinen Pfarrer, so dass die Bewohner auf unsere Patres angewiesen sind. Selbst bei Nacht und ohne Rücksicht auf strömenden Regen befinden sie sich unterwegs, um Sterbenden beizustehen und Beichten zu hören. Zu den Ortschaften, die der Seelsorge unserer Väter anvertraut sind, gehört auch die 4 Meilen entfernte Stadt Santa Cruz, die aber kleiner als ein mittleres deutsches Dorf ist, sowie San Franzisco de Alvaro. Dort, 40 Meilen von hier entfernt, residiert ständig ein Pater zusammen mit einem Laienbruder. Ihm obliegt es auch, die in der Umgebung lebenden Chiquitos-Indianer im christlichen Glauben zu unterweisen.« "
[Quelle: Lotz, Arthur: Der Weg des Caspar Rueß : frühe süddeutsche Kontakte mit Peru und Bolivien. -- München : Unverhau, ©1969. -- S. 44 - 62, 64]
1619
"Im Jahre 1619 schrieb der Marqués von Gondomar an Philipp III.: «Die Entvölkerung, die Armut, das Elend des heutigen Spanien sind derart, dass die Fremden berichten, das Reisen sei schwieriger und unbequemer als in irgendeinem verlassenen Land Europas, denn es gebe weder Betten, noch Herbergen, noch Mahlzeiten, und das infolge der zahlreichen Steuern und Bedrückungen, die auf Ihren Untertanen lasten ...» Und Gondomar fügt, im Vergleich des Zustands seines Landes mit dem Englands, hinzu: «In Spanien leisten mehr als fünf Personen auf sechs nichts für den Handel und die Erhaltung des menschlichen Lebens, während in England und in Holland auf hundert Menschen nicht einer müßig geht.» Die aus Amerika gekommenen Schätze haben Verheerungen zur Folge gehabt, das Land zugrunde gerichtet und die Arbeit getötet. «Jahr für Jahr fließen mehr als zwölf Millionen Gold und Silber aus Spanien hinaus, und wenn auch zehn Millionen eingehen mögen, müssen wir doch schlechtes Geld prägen, um zu leben, und ihm einen Wert beimessen, den es nirgends hat noch haben kann.»"
[Zitat in: Jacquet, Jean-Louis: Die spanischen Bourbonen. -- Lausanne : Rencontre, ©1969. -- (Die großen Dynastien Europas). -- S. 7f.]
1621 - 1665
|
| "Inzucht und Syphilis bedrohen das Erbgut der letzten Habsburger.
Der zarte Kronprinz wird von seinen Erziehern völlig eingeschüchtert.
Diese Erziehung macht aus ihm einen Finsterling und Angsthasen, einen
Sklaven seiner Sinne. Ein hemmungsloser Lüstling, ein methodischer
Wüstling, geizig und fleißig, gegen Ende seines Lebens von der
Hoffnung beseelt, durch die asketischen Übungen von Sor Maria de
Agreda seinen Lebenswandel wettmachen zu können, ist Philipp IV.
zeitlebens ein Spielball in den Händen seiner Umgebung." [Chaunu, Pierre<1923 - >: Europäische Kultur im Zeitalter des Barock. -- Zürich : Ex Libris, ©1968. -- (Knaurs große Kulturgeschichte). -- S. 107. -- Originaltitel: La civilisation de L'Eurpe classique (1966)] |
1621 - 1643
|
1621 - 1628
|
1621
Amsterdamer Kaufleute gründen die niederländische Westindische Kompanie. Diese hat sich zum Ziel "feindselige Akte gegen die Schiffe und das Eigentum" des spanischen Königs. Als Handlungsbevollmächtigten wählt man Kapitän Piet Hein. Piet Hein sieht es auf die spanische Schatzflotte aus Amerika ab. 1628-09-07 kommt er ans Ziel (siehe unter diesem Datum).
1622-06-22
In Rom richtet Papst Gregor XV. mit der Bulle Inscrutabili Divinae die Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Kongregation zur Verbreitung des Glaubens) ein. [Webpräsenz: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/. -- Zugriff am 2002-03-11] Dies ändert aber nichts an den kirchenrechtlichen Privilegien des spanischen Königs.
Abb.: Gedenkmarke der italienischen Post zur 300-Jahrfeier der Propaganda fide
1624-03-27
P. Juan de Frías Herrán S.J. (1563, Medina del Campo - 1634, Lima), Provinzial der Jesuiten in Perú, gründet im heutigen Sucre die Universidad Real y Pontificia de San Francisco Xavier. Heute ist das Gebäude der ehemaligen Universität die Casa de la Libertad
Aus der Gründungsurkunde von P. Frias:
La creación de la Universidad se hacía para "mostrar el amor que nuestra Compañía tiene a esta ciudad de La Plata y al aumento de su República dando a sus hijos doctrina y letras con que virtuosamente vivan y puedan" ser honrados y aprovechados y se logren sujetos de grandes esperanzas". "Señalo e ins tituyo seis cátedras
- las dos de teología escolástica,
- prima y de vísperas, una de teología moral,
- otra de artes y filosofía,
- dos de latinidad,
- la una de mayores y humanidades y
- la otra de medianos y menores.
- Y agrego juntamente a esta Universidad la cátedra de lengua aymara, que por merced de Su Majestad, tiene nuestro Colegio".
[Zitat in: Francovich, Guillermo <1901, Sucre - 1990, Brasilien>: La filosofia en Bolivia. -- 3. ed. -- La Paz : Juventud, 1987. -- Depósito legal 4-1-261/87. -- S. 21f.]
Die Theologie und Philosophie folgt dem jesuitischen "Kirchenvater" Francisco Suárez SJ (1548 - 1617).
1626
Abb.: Taucher bergen die Schätze eines gesunkenen spanischen Schiffes der Silberflotte, 1626[Bildquelle: Ships and shipwrecks of the Americas : a history based on underwater archaeology / edited by George F. Bass. -- 1. paperback ed. --New York, N.Y. : Thames and Hudson, 1996. -- 272 S. : Ill. -- ISBN: 050027892X. -- S. 95. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1628 - 1640
|
1628-09-07
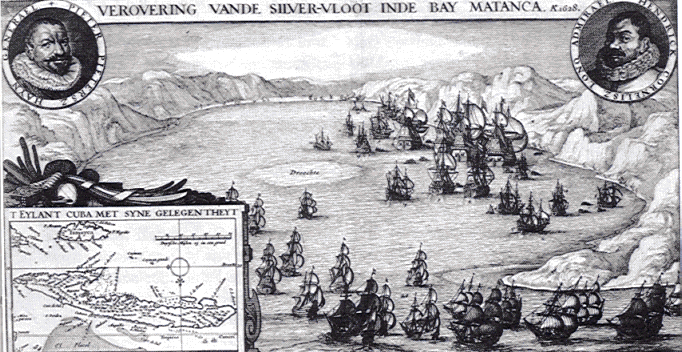
Abb.: Die spanische Silberflotte wird bei Havanna von der holländischen Westindiscehn Handelskompanie gekapert
1629
"Die Provinzialsynode von Charcas (= Sucre, Bolivien) von 1629 bestimmt ausdrücklich, dass in den Klöstern allen [Ordens-]Schwestern gleiche Rechte zuständen. Sie betont besonders, dass auch die Mischlinge unter die Chorschwestern aufgenommen werden mußten, »cum apud Deum fides non genus in pretio sit«" [=Da bei Gott der Glaube und nicht das Geschlecht gilt] [Handbuch der Kirchengeschichte / hrsg. von Hubert Jedin. -- Ausgabe auf CD-ROM. -- Berlin : Directmedia, 2000. --1 CD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 35. -- ISBN 3-89853-135-X. -- S. 9257 (vgl. HKG Bd. 5, S. 286)]
1632
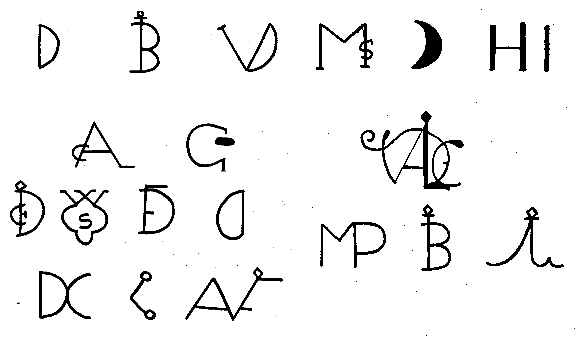
Abb.: Brandzeichen von Negersklaven, um 1632
[Crespo Rodas, Alberto <1917 - >: Esclavos negros en Bolivia. -- 2. ed. -- La Paz : Juventud, 1995. -- Depósito legal 4-1-173/77. -- S. 64f.]
1633
Mercator, Gerardus <1512-1594>: Atlas, das ist Abbildung der gantzen Welt mit allen darin begriffenen ländern vnd Provintzen, sonderlich von Teutschland, Franckreich, Niderland, Ost vnd West Indien, mit Beschreibung der selben. -- Amsterdam : Jansson und H. Hondius, 1633.
Abb.: Perú-Karte aus dem Atlas von MercatorGerardus Mercator (d.h. Gerhard Kremer) hat 1569 die später nach ihm benannte Mercator-Projektion entwickelt. Dabei wird der Erdglobus auf einen mit der Erdachse parallelen Zylinder projeziert. Dies fürhrt zwar zu Flächenverzerrungen, ist aber winkeltreu. Dies ist für die Seefahrt sehr hilfreich, da die Winkel, die man auf dem Wasser einschlägt mit den Winkeln auf der Karte übereinstimmen.
1633
Die Audiencia de Charcas erlaubt den Jesuiten von La Plata (heute. Sucre) die Mission bei den Chiriguanos.
1636
Ordenanzas del Consejo Real de Las Indias / nuevamente recopiladas y por el Rey Don Felipe Quarto N. S. para su govierno estbalecidas. -- 1636
Dies ist die letzte Sammlung von Gesetzen und Erlassen nach der alten (habsburgischen) Ordnung vor der bourbonischen Verwaltungsreform.
Abb.: Ausgabe von 1681
1634
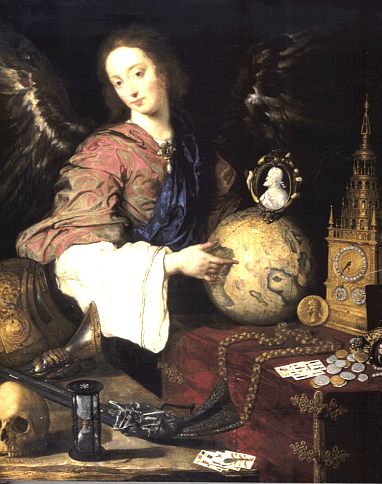
Abb.: Antonio de Pereda (1608 - 1678): Der Engel und die menschlichen
Eitelkeiten (Detail), um 1634 (Wien, Kunsthistorisches Museum)
1634-07-01
"In dieser wohlüberlegten Komposition hat der Künstler die Symbole der Macht -- Reichtum, Rüstung, Weltkugel mit den Territorien des spanischen Weltreichs -- zusammengestellt; die Herrscher sind in Medaillons zu erkennen. Er unterstreicht die Flüchtigkeit dieser weltlichen Dinge, den raschen Fortgang der Zeit (Uhr und Sanduhr), den Zufall (Spielkarten) und erinnert an den Tod, dessen endgültiger Sieg durch die Totcnschädcl symbolisiert ist. Die Entstehungszeit dieses Bildes entspricht recht genau dem politischen Niedergang Spaniens, der Ende der dreißiger Jahre des 17. Jahrhunderts nicht mehr aufzuhalten war." [Benassar, Bartolomé ; Vincent, Bernard: Spanien : 16. und 17. Jahrhundert. -- Stuttgart : Klett-Cotta, ©1999. -- (Das goldene Zeitalter). -- ISBN 360894186X. -- Originaltitel: Le temps de l'Espagne. XVIe - XVIIe siècles (1999). -- S. 136. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Deklaration König Ludwigs XIII. (1601 - 1643, König 1610 - 1643) von Frankreich über die Freundschaftslinien zur See:
"Die bedeutendsten Kaufleute Unseres Landes und andere Untertanen, die sich der Seefahrt widmen, haben Uns vorgetragen, dass seit einigen Jahren die Spanier und Portugiesen die Absicht erkennen lassen, innerhalb des Bereiches der Freundschafts- und Bündnislinien (lignes des amitiés et alliances) und sogar in den Küstengewässern und Häfen Spaniens ihre [der Kaufleute] nach Indien und Amerika ausfahrenden und von dort zurückkehrenden Schiffe anzugreifen, ohne Rücksicht darauf, dass Feindseligkeiten beiderseits nur jenseits des ersten Längengrades im Westen1) und des Wendekreises des Krebses im Süden gestattet sind2). Da aber Unseren Untertanen das Recht auf Selbstverteidigung nicht bestritten werden kann und ihnen durch Unsere Gesetze die Ermächtigung gegeben wurde, sich gegen diejenigen zu bewaffnen, die ihren freien Handel und ihre freie Schifffahrt hindern wollen, haben sie Uns um die Erlaubnis gebeten, die genannten Spanier und Portugiesen auf der Fahrt nach Indien und Amerika und zurück überall zur See, wo sie sie antreffen, anzugreifen. Wir wollen ihnen darauf Unseren Willen eröffnen. Um aber zu verhindern, dass sie durch irgendeine gewaltsame Handlung gegen Unsere Absicht das gute Einvernehmen stören, auf das Wir Wert legen, und sich so Unsere Ungnade zuziehen, tun Wir auf Rat Unseres teuren und sehr geliebten Cousin, des Kardinals Herzogs von Richelieu . . ., obersten Intendanten für Schifffahrt und Handel Frankreichs, folgendes zu wissen: Durch diese Unsere Verfügung und Erklärung, mit Unserer Hand unterzeichnet, verbieten und untersagen Wir ausdrücklich Unseren Untertanen, welchen Standes und Berufes auch immer, die zur See fahren, die Schiffe der Spanier und Portugiesen anzugreifen und zu überfallen, die sie diesseits des ersten Meridians im Westen und des Wendekreises des Krebses im Süden antreffen sollten. Wir wollen [vielmehr], dass Unsere Untertanen innerhalb der genannten Linien die Spanier und Portugiesen, auch auf der Fahrt nach Indien und Amerika und von dort zurück, ungehindert reisen, Handel treiben und segeln lassen, ohne sie bei ihrer Fahrt oder sonstwie zu stören oder zu hindern, vorausgesetzt, dass Unsere Untertanen von ihnen die gleiche Behandlung erfahren und die Spanier und Portugiesen sie diesseits der genannten Linien ungeschoren lassen. Dagegen steht es Unseren Untertanen wie bisher frei, jenseits der bezeichneten Grenzen die Spanier und Portugiesen nach ihrem Ermessen anzugreifen, und zwar solange, bis die Spanier und Portugiesen Unsere Untertanen den freien Handel in allen Land- und Seegebieten Indiens und Amerikas ungehindert ausüben lassen, ihnen zu diesem Zwecke freien Zugang zu allen genannten Ländern und deren Häfen und Buchten gewähren und sie dort ebenso frei handeln lassen wie diesseits der genannten Linien..." [F. Dickmann]
[Übersetzung: Renaissance, Glaubenskämpfe, Absolutismus / bearbeitet von Fritz Dickmann -- 3. Auflage. -- München : Bayerischer Schulbuch-Verlag, ©1982. -- (Geschichte in Quellen). -- ISBN 3762760845. -- S. 401f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1639 - 1653
Calancha, Antonio de la <1584, La Plata - 1654, Lima>: Coronica moralizada del Orden de San Augustín en el Perú con sucesos exenplares vistos en esta monarquia ... / Compuesta por el muvy reverendo padre maestro fray Antonio de la Calancha ... -- Barcelona : P. Lacavalleria, 1639-53. -- 2 Bde. : Ill. -- Titel von Bd. 2: Coronica moralizada de la provincia del Perv del Orden de San Avgvstin nvestro padre ... Lima, I. Lopez de Herrera, impressor de libros. -- Mitverfasser von Bd. 2: Bernardo de Torres.
Abb.: Titelblatt[Bildquelle: Enciclopedia de Bolivia / Carlos Gispert ... -- Barcelona : Oceano, ©2000. -- ISBN 84-494-1428-8. -- S. 447]
1639
Ramírez del Águila, Pedro <1581, Archidona - ca. 1640, Bolivien>: Notìcias políticas de Indias y relación descriptiba de la Ciudad de La Plata, metrópoli de las provincias de los Charcas y nuebo Reyno de Toledo en las occidentales del gran Imperio del Perú ... : Dirigidas al illmo. Sor. don fray Franco. de Borja Arpo de ella del Consejo de su Maj? y su predicador en La Plata primero de henero de 1639 /, Pedro Ramírez del Aguila ; transcripción de Jaime Urioste Arana. -- Sucre : División de Extensión Universitaria, 1978. -- 186 S. : Ill.
"En esta tierra, los españoles somos pocos devotos y humildes, todo es arrogancia, braveza y valentía y desprecio de estos pobres naturales; ... cada uno trata sólo de materia de mercaderías y su negocio, y los que vienen de España, de volverse a ella con el amor de la patria, para lo cual andan, anhelando en busca de sus comodidades temporales, sin hacer asiento en cosa alguna, que es la total ruina de su aumento y conservación, porque con esto, ni edifican ni rompen tierra; todo es disfrutarla y pelarla para llevar a la suya..." "... Los indios, con su pobreza y humildad, son los que nos sustentan y dan de comer, y ellos, mejor que nosotros, los actos de devoción, dándonos ejemplo, en los de su cargo..."
[Zitiert in: Calzavarini, Lorenzo G. <1939 - >: Nación Chiriguana : grandeza y ocaso. -- Cochabamba [u.a.] : Los Amigos del Libro, 1980. -- (Enciclopedia boliviana). -- Depósito legal L.P. 248/80. -- S. 135]
1640 - 1648
|
1640
Barba, Alvaro Alonso <1569 - >: Arte de los metales en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro, y plata por açoque el modo de fundir los todos, y como se han de refinar, y apartar unos de otros / compuesto por el licenciado Albaro Alonso Barba. -- Madrid : Imprenta del Reyno, 1640. -- 120 Bl. : Ill
Dieses Buch wird sehr wichtig für die Anwendung von Quecksilber (Amalgation) bei der Silbergewinnung in Potosí, aber auch für drn übrigen Bergbau in Alto Perú.
|
|
|
"MUERTE ANTES QUE METALES
Recién descubierto el rico asiento de San Cristóbal de los Lípez, fui yo a aquella provincia. En este tiempo en un hermoso alto y muy capaz cerro, que con otras lomas rodea el sitio en que se poblaron los mineros, descubrieron dos, de nación gallegos, una veta que al principio se llamó de su nombre y después hasta hoy, la Hedionda, por sus efectos.
Comenzóse a sacar metal muy rico, Tacana entre Calichal blanco, y a poco que se ahondó no se pudo pasar adelante, porque el mal olor que de allá salía lo impidió, con muerte de algunos indios de los que en ella trabajaban. Dejóse por más de cuatro o cinco años, al cabo de los cuales, estando yo también presente, intentó otro minero proseguir en la labor por la riqueza del metal y parccerle que en tanto tiempo ya se habría evaporado el olor; pero costóle la prueba dos indios que se le murieron luego, con que se dejó hasta hoy.
No me maravilló tanto esto, como el ver con ojos en el mismo cerro, que, dándose una cata en otra veta, algo apartada de lo que he dicho, habiéndose ahondado apenas una veta, no se pudo proseguir por la hediondez, que de la tierra salía; y volviendo yo por allí al cabo de pocos días, vi en el pozuelo, muertos algunos pajarillos y otras sabandijas, intoxicados del veneno que de su olor exhala. Por la otra banda de este prohibido y reservado cerro, para el tiempo que la Divina Providencia tiene señalado, se hicieron unas casas e ingenio de piedra para moler metales de plata, junto a una ciénega que de él se principia, y de cualquiera parte que en él se sacaba para señalar los breves cimientos, salía el mismo mal olor que queda dicho. Era semejante al que tiene una bodega llena de mosto, cuando está hirviendo, grave y pesado, que aún a los que gozábamos del aire libre nos ofendía.
En el mineral de Berenguela de Pacajes, famoso por haber tenido indios de cédula para la labor de sus minas, aún antes que Potosí, y que las riquezas de sus metales no le hicieran inferior a ninguno, si el agua en que luego dan sus vetas no estorbara el ahondarlas. En el cerro llamado de Santa Juana, seguía un minero una labor de plata muy abundante y rica, quiso por descubrir más, dar un barreno a una de las cajas, con esperanza de encontrar otra veta; diligencia ordinaria de los que se ocupan en este ejercicio. Acomodó dos indios en el lugar que le pareció y a pocos golpes que con la barreta dieron, se descubrió un vacio del que salió tan pestilencial olor, que instantáneamente murieron los dos indios. Otros que estaban más apartados salieron a prisa a avisar al amo; quiso entrar a ver lo que era y favorecerlos, pero mucho antes de llegar a ellos se quedó también muerto, atravesado en los callapos o escalera por donde se bajaba a la mina, y hasta mi tiempo se quedó allí su cuerpo, sin haber habido quien se atreviese a intentar sacarlo para darle sepultura.
En otro socavón del mismo cerro se descubrió, estando yo en aquellas minas, un pequeño agujero en lo más hondo de él, de que salía con un modo de ruido que atemorizaba, otra exhalación a vapor inficionado y grueso, bastante a quitar la vida a quien en él se detuviese. Apagábase la vela encendida que junto a él se ponía: señal cierta del mal que he dicho, y que los mineros experimentados y cuerdos observan, y todos deben advertir."
[Zitiert in: Cáceres Romero, Adolfo <1937 - >: Nueva historia de la literatura boliviana. -- La Paz [u.a.] : Los Amigos del Libro. -- Tomo II: Literatura colonial. -- 1990. -- ISBN 84-8370-093-X. -- S. 394f.]
Wie man die Öfen zur Gewinnung von Metallen aufbauen soll Wie immer man die Kessel erhitzt, so dass das Wasser darin heiß wird, erreicht man den erwünschten Effekt, nämlich den Erzen die Edelmetalle schnell zu entziehen, ohne Verluste an Quecksilber. Um aber Kosten zu sparen und Hindernissen vorzubeugen, die vorkommen können, soll man die Öfen folgendermaßen bauen:
Man soll einen Ofen aus kräftigem Lehm machen, aus Tonkreide, Sand und Kuhmist mit Salzwasser gemischt, in Form einer Truhe, in der Breite etwas größer als die Kesselböden, und so lang, wie es die Anzahl besagter Kessel erfordert, so dass zwei davon durch eine Öffnung gleichmäßig erhitzt werden; vier sollten genug sein, und so soll der Ofen viereinhalbmal so lang wie breit sein. In der Mitte soll man zwei kleine Wände errichten, etwa eine halbe Elle auseinander, und wenn man die fast eine Elle hochgezogen hat, soll das in Reverberieröfen sabalera genannte Gitter aus Eisen, Lehm oder Ziegelstein darauf gelegt werden, das wie ein Rost ist, auf dem das vom Holz und glühenden Kohlen unterhaltene Feuer gemacht wird, und das Herabfallen der Asche ermöglicht. In der Mitte dieses Rostes soll man zwei Öffnungen lassen, eine an jeder Seite, durch welche die Hitze und die Flamme zu den beiden Ofenkammern gelangt, deren Boden um ein Handbreit höher als die sabalera sein soll, getragen von so vielen Bögen wie Kesseln, und jeder so groß wie deren Basis, so dass jeder Kessel von einem Bogen getragen wird. In der oberen Wölbung des Ofens lässt man Platz genug, damit die Böden der Kessel hineinpassen, und an beiden äußeren Enden lässt man zwei Öffnungen oder Kamine zum Abzug des Rauches und zur Belüftung des Feuers. Der Boden, auf den die Kessel gestellt werden, soll konkav sein, zur Mitte hin abfallend, wo ein rundes Loch von drei bis vier Fingerbreiten Durchmesser gemacht wird, das zum Zwischenboden geht, der auch konkav und von reichlichem Fassungsvermögen sein soll.
Werden die Öfen so gebaut, spart man mehr als die Hälfte des Holzes beim cocimiento ein. Man kann auch viel sparen von dem zum Rösten des Erzes benötigten Holz, denn man kann die Erzbrocken in die Bogengänge des Ofens legen, und sie durch die beiden Öffnungen an den Stirnseiten leicht hineintun und herausholen, und diese können mit Lehm abgedeckt oder zugestopft werden, sofern es nötig sein sollte. Und wenn vielleicht mit der Zeit versehentlich der Boden eines Kessels einbrechen sollte, wenn gerade gearbeitet wird, und das Quecksilber herauslaufen würde (das durch das Feuer gefährdet ist), fließt es durch das obere Loch in den unteren Boden, wo die Hitze nicht hinkommt, und kann dort ohne großen Verlust aufgefangen werden.Wie man Silber durch cocimiento gewinnt
Das Erz wird so fein gemahlen und gesiebt wie es nur geht; und sollte man mit den Fingern im Gesteinsmehl noch Rauheiten fühlen, füllt man es in Bottiche, Fässer oder Wannen mit genügend Wasser, und rührt es gut durch, und nach kurzem Ruhen trennt sich das Feine vom Grobkörnigen, das sich am Boden absetzen wird. Die feine Wasseraufschlämmung füllt man in die großen Kessel, die man bereits seit kurzer Zeit befeuert, mit einem oder zwei Eimern klaren Wassers, je nach Fassungsvermögen, und so viel Quecksilber, wie der Gehalt des Erzes es erfordert; aber niemals weniger als nötig, um den Boden der Kessel zu bedecken, damit sich nirgendwo Erz absetzen kann, ohne in Kontakt mit dem Quecksilber zu kommen. Man rührt den Inhalt langsam mit dem Rührer durch, obwohl bei kochendem Wasser genügend Bewegung im gemahlenen Erz entsteht (wenn kein zu grober Satz vorhanden ist), um es mit dem Quecksilber zu vermischen, und damit sich der Silberanteil mit diesem verbinde, womit er bald herausgeholt werden kann. Das Wasser muss immer kochen, um das Verfahren nicht zu unterbrechen oder in die Länge zu ziehen, und das durch die Hitze verlorene Wasser füllt man mit heißem Wasser nach, oder fügt, ohne dass das Kochen unterbrochen wird, durch einen dünnen Schlauch ständig so viel Wasser nach, wie verloren geht, was leicht am Zunehmen oder Abnehmen des Wasserstandes gemessen werden kann. Man soll die Menge des Erzmehls, das auf einmal bearbeitet werden soll, nach dem Boden des Kessels bemessen, und auch die Wassermenge entsprechend, so dass nicht wegen zu wenigen Erzes sich die Arbeit vervielfacht, noch dass durch zuviel Erz das Wasser so stark verschlammt, dass die Bewegung des Erzes beim Kochen erschwert wird. Hin und wieder soll man mit einer langen Kelle Proben vom Bodensatz herausholen, um zu sehen, wie weit die Gewinnung geschritten ist, und ob noch Quecksilber nötig ist, oder um einen Teil des fertigen Amalgams herauszuholen, wenn man will, und den Teil an Schlamm, der mit herauskommt, gibt man wieder zu, bis man fertig ist und das Silber gänzlich gewonnen ist [... ].
Dass dies das einzig wirkliche Verfahren ist, um mittels Quecksilber aus Erzen Edelmetalle ohne Verluste und in kurzer Zeit zu gewinnen.
Es ist eine alte Erfahrung, dass durch die wiederholten Bearbeitungen, wozu die ständige Hitze und Bewegung und die Mischung mit Zutaten kommt, die Erzschicht gesäubert und aufgezehrt wird, und nach und nach je nach Vorgehen, das Silber und Quecksilber sich verbinden. Und wer würde es nicht glauben, selbst ohne praktischen Versuch, dass bei der Erzverarbeitung mittels cocimiento -Verfahren alle diese Vorteile mit den größten Verbesserungen verbunden werden. Das Erz wird beim dauernden Kochen in einer Viertelstunde öfter durchgearbeitet, als in vielen Tagen und sogar Monaten in den gängigen Holzkisten. Auch die günstige Eigenschaft, die das Kupfer, worin das Silber gekocht wird, auf Grund seiner natürlichen Eigenheit dem Wasser verleiht, ist wirksamer bei der Gewinnung des Silbers als die Vielfalt anderer Metalle. Ebenso ist die Hitze, durch welche alle Teile zu innigem Verhältnis und zur Wirkung gelangen, offenkundig größer, wie man sogar ohne Vergleich sieht, und so braucht es auf diese Weise nicht so viele Stunden wie üblicherweise Tage, um das Edelmetall zu gewinnen.
Das Quecksilber kann gar keine Gefahr laufen, bei diesem Vorgehen verloren zu gehen; denn die Annahme, es könnte sich durch die Hitze verflüchtigen, wäre mehr als Unwissenheit. Denn die Feuchtigkeit des Wassers, das es umgibt, schützt es, und Kinder wissen Öl auf einem Papier zum Kochen zu bringen, ohne dass das Papier verbrennt, und ein an einen Faden gebundenes Ei in die brennende Glut zu legen, ohne dass der Faden verbrennt. Wenn bei kräftigem Feuer das Wasser in einem Kessel kocht, ist der Boden nicht so heiß, dass eine ihn tragende Hand verletzt würde, und in Deutschland kocht man Salzwasser in großen Bleipfannen bis zur Verfestigung [des Salzes], und man kann es überall machen, ohne dass die Hitze dieses so weiche Metall schmelzen würde.
Die Fehlmenge an Quecksilber, die man Verbrauch und Verlust nennt, entsteht, wie schon bewiesen, durch die Verdünnung und Verteilung in winzige Teilchen bei ständigem Durchmischen, weshalb es mit dem Wasser oder dem Schlamm abgeht. Dieser Nachteil wird gänzlich bei dieser Gewinnungsmethode ausgeschaltet; denn das Quecksilber bleibt unten am Boden als ein ganzer Körper, ohne Bewegung, die es zerteilen würde, und so sieht man nie Ausschuss in diesem Verfahren, wenn man es richtig macht. Diese Tatsachen sind offenkundig und klar, und die Erfahrung stimmt immer mit ihnen überein."
[Übersetzung: Wirtschaft und Handel der Kolonialreiche / hrsgg. von Piet C. Emmer .... -- München : Beck, ©1988. -- (Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion ; Bd. 4). -- ISBN 3406306616. -- S. 449 - 452. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Die Methode der (süd-)amerikanischen Amalgation beschreibt
Reich der Erfindungen / hrsg. von Heinrich Samter ... -- Neue, bis Ende des XIX. Jahrhunderts verm,ehrte Aufl.. Jubiläumsausgabe. . -- 1901. -- S. 640
so:
"Nach der in Mexiko, Peru und Chile üblichen amerikanischen Amalgamation werden hauptsächlich Rotgilterz [Ag3SbS3 bzw. Ag3SbS3] und Fahlerze [Ag4Sb2S7] verarbeitet. Hierbei müssen die zu verarbeitenden Erze sehr gut zerkleinert sein, weshalb sie trocken gepocht und dann mit Wasser auf Erzmühlen, deren Steine aus Porphyr oder Basalt bestehen, sehr fein gemahlen werden. Das Wasser des so erhaltenen feinschlammigen Breies lasst man auf schräg liegenden Steinplatten abfließen und setzt nach einigen Tagen Kochsalz und gerösteten, fein gemahlenen >Kupferkies 'Magistral' genannt unter innigem Mengen und Kneten und schließlich Quecksilber in einzelnen Rationen hinzu, eine Manipulation, die die 'Inkorporation' genannt wird. Das Mengen wird hauptsächlich mitteld Durchtretens vorgenommen, was 2 bis 5 Monate lang jeden zweiten tag geschehen muss, bis man glaubtt, dass die Entsilberung beendet ist. Aus dem so erhaltenen 'Quickbrei' wird das Amalgam durch Waschen in ausgemauerten Zisternen geschieden, durch Pressen in Zwillichsäcken voom überschüssigen Quecksilber befreit und schließlich das im Silberamalgam befindliche Quecksilber abdestilliert. Der chemische Vorgang aller dieser Operationen ist folgender.
Die Wirkung des Magistrals beruht auf seinem Gehalt an schwefelsaurem Kupferoxyd (CuSO4), welches mit Kochsalz (NaCl) schwefelsaures Natron und Kupferchlorid bildet. Dieses wiederum gibt einen Teil seines Chlors and das Silber ab, indem es Kupferchlorür undChlorsilber bildet, von welchem das Chlorsilber in der überschüssigen Kochsalzlösung gelöst bleibt. Sobald das Chlorsilber mit dem Quecksilber in Berührung kommt, wird es unter Bildung von Quecksilberchlorür und Silberamalgam zersetzt.
Diese amerikanische Amalgamation hat die Nachteile eines sehr großen Zeitaufwandes und eines sehr hohen Quecksilberverbrauchs, welchen aber dals Vorteile der geringe Brennmaterialverbrauch gegenübersteht und vor allen Dingen der Umstand, dass nach dieser Methode, so silberarme Erze verarbeitet werden können, wie nach keiner anderen."
1640-12-15
Nach einem erfolgreichen Aufstand löst Portugal die Personalunion mit der spanischen Krone.
1641 - 1650
Spanische Exporte nach amerikanischen Häfen
Abb.: Spanische Exporte in amerikanische Häfen 1601 bis 1610 und 1641 bis 1650: man beachte den drastischen Rückgang[Quelle der Abb.: Chaunu, Pierre<1923 - >: Europäische Kultur im Zeitalter des Barock. -- Zürich : Ex Libris, ©1968. -- (Knaurs große Kulturgeschichte). -- S. 505. -- Originaltitel: La civilisation de L'Eurpe classique (1966)]
1641
Abb.: Valverde, Fernando <OSA> <gest. 1657>:Santuario de N[uestra] Señora de Copacabana en el Perú : poema sacro. -- Lima, 1641. -- 294 fol.
1645
In Sevilla ist die Kartoffel Volksnahrungsmittel:
Abb.: Ein Kessel Kartoffel für die Armenspeisung in Sevilla: Bartolomé Esteban Perez Murillo <1618 - 1682>: San Diego speist die Armen, Kinder und Alten, 1645
1646/47
"«Die Bodenbestellung wird vernachlässigt», schrieben die Cortes in den Jahren 1646-47 an den König, «und es bleibt heute nur der zehnte Teil des Weinbaus und der Olivenpflanzungen zurück, die früher vorhanden waren; überdies ist, infolge der übertriebenen Steuern und der Rekrutierung der Armee, eine große Anzahl von Familien zum Schaden des Ackerbaus nach Amerika ausgewandert.»" [Zitat in: Jacquet, Jean-Louis: Die spanischen Bourbonen. -- Lausanne : Rencontre, ©1969. -- (Die großen Dynastien Europas). -- S. 8f.]
1647
Escalona y Agüero, Gaspar de <1585, La Plata - 1650, Santiago de Chile>: Arcæ Limensis gazophilativm regivm perubicvm. I. Administrandvm. II. Calcvlandvm. III. Conservandvm / svb præsidiatv, et ope excellentissimi d.d. Garciæ de Haro, et Auellaneda, comitis de Castrillo ... Editvm a don Gaspare de Scalona, Agvero ...-- Con priuilegio en Madrid :Emprenta real, 1647. -- 199, 302, [59] S. -- [Über die Finanzverwaltung Perús]
1648 - 1655
|
1650-10
Münzskandal von Potosí: Aufgrund Problemen mit der Münzentwertung von in Potosí geprägten Münzen sendet Felipe IV 1648 den königlichen Inspektor Don Francisco Nestares Marin (1605, Arenzana - 1660, La Plata) nach Potosí zur Untersuchung. Er deckt auf, dass seit mindestens 1625 der Silbergehalt der Münzen gefälscht wurde. Daraufhin wird 1649 als neuer Münzmeister Juan Rodriguez de Rodas eingesetzt. Per Dekret vom Oktober 1650 wurden alle Münzen, die in Potosí seit 1625 geprägt worden waren zurückgerufen und per Punzierung abgewertet: 8 Realesmünzen wurden auf 6 Reales abgewertet, 4 Realesmünzen auf 3 Reales. Gute Reales (ab 1649) wurden bis 1652, als eine neue Prägung eingesetzt wurde, ebenfalls durch Punzierung gekennzeichnet.
Abb.: Ocho Reales mit Punzierung, geprägt in Potosí ("PB"), um 1650
1653

Abb.: Ocho Reales, geprägt in Potosí 1653 [Bildquelle:
www.thebritishmuseum.ac.uk/world/europe/western/coins.html. -- Zugriff am
2002-05-11]
1655 - 1661
|
1656/57
Villarroel y Ordóñez, Gaspar de <OSA> <1587, Quito - 1665, La Plata>: Govierno eclesiastico pacifico, y vnion de los dos cuchillos pontificio, y regio. -- Madrid : Domingo Garcia Morràs, 1656-1657. -- 2 Bde.
"Este es el primer servicio que he hecho en estos libros: ajustar las órdenes de nuestras leyes y que vean los obispos y los magistrados que no discuerdan los dos derechos, que pueden andar juntos los dos cuchillos."
[Zitat in: Francovich, Guillermo <1901, Sucre - 1990, Brasilien>: La filosofia en Bolivia. -- 3. ed. -- La Paz : Juventud, 1987. -- Depósito legal 4-1-261/87. -- S. 31]
1660
Die Silbereinfuhren aus Potosí haben die Bestände an Silber in Europa verdreifacht.
1661 - 1666
|
1665
Bericht, wie Silber geschmuggelt wurde
"Und so gibt es viele, die dafür sorgen, dass bei der Abfahrt [von Las Indias, wo ähnlich wie in Sevilla kontrolliert wurde] weder das Gold noch das Silber, das ihnen zukommt, registriert wird, und die auf diese Weise den König um das bringen, was ihm zusteht. Sie ziehen es vor, sich mit den Kapitänen ins Einvernehmen zu setzen, obwohl deren Gewinnanteil viel höher ist, weil sie das Risiko fürchten, außer schönen Worten überhaupt nichts zu bekommen. Bevor die Flotte die Höhe von Cädiz erreicht, wird sie von holländischen oder englischen Schiffen dort oder in San-lücar schon erwartet, und sowie man die Nachricht hat, dass sie sich nähert, laufen die Schiffe aus, um auf offener See mit ihr zusammenzutreffen. Dort nehmen die Kapitäne als Helfershelfer ihrer Auftraggeber deren Anteil an Bord und bringen ihn weiter nach England, Holland oder anderswohin, ohne dass er sich je in einem spanischen Hafen befunden hätte. Sogar die Kaufleute aus Sevilla schicken auf diesen Schiffen ihr gesamtes Bargeld in diese Länder, wo sie frei über ihr Geld verfügen können, ohne darum bangen zu müssen, dass man es ihnen abnimmt." [[Brunel, Antoine de <1622-1696>]: Voyage d'Espagne cvrieux, historique et politique. -- Paris : Charles de Sercy, 1665. -- Übersetzung: Wirtschaft und Handel der Kolonialreiche / hrsgg. von Piet C. Emmer .... -- München : Beck, ©1988. -- (Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion ; Bd. 4). -- ISBN 3406306616. -- S. 481. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
1655/1658
Wie sowohl die Spanier als auch die Engländer eine kriegerische Auseinandersetzung in der Karibik als jeweils eigenen großen Erfolg darstellen:
Abb.: Madrid: "feliz suceso"
Abb.: London: "great success"
Zu Teil 6: Von 1665 bis 1759