

mailto:payer@hbi-stuttgart.demailto: payer@hbi-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Materialien zur Forstwissenschaft. -- Kapitel 2: Das Ökosystem Wald. -- Anhang 1: Zur Bodenkunde. -- Fassung vom 14. September 1998. -- URL: http://www.payer.de/cifor/cif0201.htm. -- [Stichwort].Payer, Margarete <1942 -- >:
Erstveröffentlichung: 22. November 1997
Überarbeitungen: 22. Oktober 1998 (Entfernung einiger Abbildungen)
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
Anlaß: Lehrveranstaltung 1997/98 an der HBI Stuttgart: Informationsnetze, Projekt CIFOR
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Verfasserin.
Zur Inhaltsübersicht von Margarete Payer: Materialien zur Forstwissenschaft.
Ein Bodenprofil ist ein ver+tikaler Schnitt von der Bodenoberfläche bis ins Muttergestein.
Zur Erstellung von Bodenprofilen werden Profilgruben ausgehoben. Neben beschreibender, zeichnerischer und fotografischer Erfassung können auch konservierte Bodenprofile (Lackprofile) erstellt werden:
Fotografisches Bodenprofil |
Profilskizze dazu |
Erstellung eines Lackprofil |
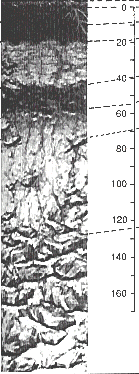 |
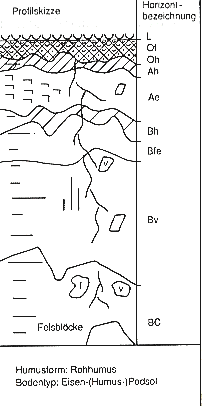 [Quelle der beiden Abb.: Bodenökologie / Ulrich Gisi ... -- 2., neu bearb und erw. Aufl. -- Stuttgart [u.a.] : Thieme, ©1997. -- ISBN 3-13-747202-4. -- S. 16] |
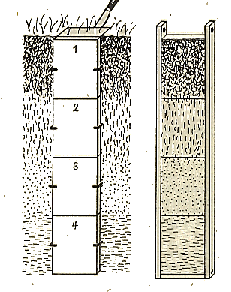 [Quelle der Abb.: Zabel, Erwin ; Neitzel, Heinz ; Ziebell, Elke: Bodenfruchtbarkeit. -- 2. Aufl. -- Berlin : Volk und Wissen, 1985 (©1976). -- S. 64] |
Bodenprofile bestehen oft aus annähernd parallel angeordneten Lagen, sog. Bodenhorizonten.
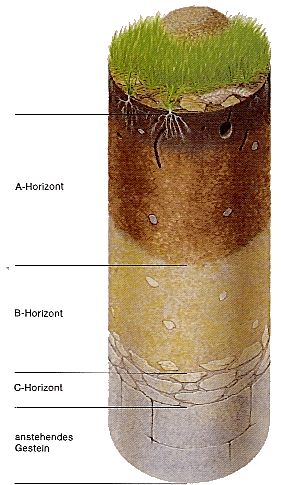
Abb.: Bodenprofil mit den Horizonten A, B, C
[Quelle der Abb.: Tiere, Pflanzen, Phänomene. -- München : Mosaik, ©1993. -- ISBN 3-576-10331-7. -- S. 30]
Die Horizonte werden nach folgendem Schema bezeichnet:
| Haupthorizonte sowie organische und mineralische Ausgangssubstanzen werden durch Großbuchstaben bezeichnet. Übergangshorizonte, die Merkmale von 2 (oder 3) Haupthorizonten aufweisen, werden durch 2 (oder 3) Großbuchstaben bezeichnet (z.B. AE). Haupthorizonte können durch kleine Zusatzbuchstaben näher definiert bzw. in Unterhorizonte unterteilt werden. |
Symbole und Definitionen für Haupthorizonte
(nach Dt. Bodenkundlicher Gesellschaft):Unterwasserhorizonte |
F |
am Gewässergrund |
Organische Horizonte |
H |
über 30% organische Substanz (Torf) aus Resten tonbildender Pflanzen, unter Einfluß von Grundwasser oder Stauwasser entstanden (H = Humus) |
L |
Streu, weitgehend unzersetzte Pflanzensubstanz an Bodenoberfläche (L = engl. litter) | |
O |
Humusansammlung über Mineralboden, sog. "Trockenhumus" (O = organisch) | |
Mineralische Horizonte (weniger als 30% organisches Material) |
A |
Mineralischer Oberbodenhorizont mit Akkumulation organischer Substanz und/oder Verarmung an mineralischer Substanz |
B |
Mineralischer Unterbodenhorizont. Farbe und Stoffbestand des Ausgangsgesteins verändert durch Akkumulation von eingelagerten Stoffen aus dem Oberboden und/oder durch Verwitterung und mit weniger als 75% Festgsteinsresten | |
C |
Mineralischer Untergrundhorizont; Gestein, das unter dem Boden liegt, in der Regel das Ausgangsgestein, aus dem der Boden entstanden ist | |
P |
Mineralischer Unterbodenhorizont aus Tongestein (P = Pedosol) | |
T |
Mineralischer Unterbodenhorizont aus dem Lösungsrückstand von Carbonatgesteinen, die über 75% Carbonat enthalten | |
S |
Mineralbodenhorizont mit Stauwassereinfluß, zeitweilig oder ständig luftarm (S = Stauwasser) | |
G |
Mineralbodenhorizont mit Grundwassereinfluß (G = Grundwasser) | |
M |
Mineralbodenhorizont des Kolluviums (zum Hangfuß durch Hangabtragung verfrachtetes Material), Äoliums (zusammengewehtes Material) und des durch den Fluß angelagerten Braunen Auenbodens (M = lat. migrare = wandern) | |
von Menschen gemachte Horizonte |
E |
aus aufgetragenem Plaggenmaterial (mit Spaten abgehobene Grasnarbe oder Heide) entstandener Horizont |
R |
Mischhorizont, durch tiefgreifenden bodenmischenden Umbruch entstanden (R = Rigosol) | |
Y |
durch künstliche Aufschüttung oder Aufspülung entstandener Horizont |
Kleinbuchstaben als Merkmalssymbole:
Kleinbuchstaben NACH Großbuchstaben des Horizonts:
Merkmale der Bodenbildung:a |
anmoorig |
b |
bandförmige Anreicherung |
c |
Carbonat |
d |
dicht (stauwasserstauend) |
e |
eluvial = ausgewaschen |
f |
Förmultningstiktet = |
g |
Haftnässe |
h |
humos |
i |
initial (beginnend) |
k |
Konkretion (massige Anreicherung) |
l |
lessiviert = an Ton verarmt |
m |
massiv |
n |
neu, frisch |
o |
oxidiert |
p |
gepflügt |
q |
Knickhorizont in Marschböden |
r |
reduziert |
s |
angereichert mit Sesquioxiden (Oxide und Hydroxide von Aluminium, Eisen, Mangan) |
t |
angereichert mit Ton |
u |
rubefiziert, ferralitisiert (gerötet) |
v |
verwittert |
w |
stauwasserleitend |
z |
Salz |
Kleinbuchstaben VOR Großbuchstaben des Horizonts:
Merkmale durch geologische oder von Menschen bedingte Prozesse:a |
Auenlage |
f |
fossil |
h |
Hochmoor |
j |
juvenil durch menschliche Tätigkeit |
l |
Lockersubstrat |
m |
Festgestein |
n |
Niedermoor |
o |
Windanwehung |
r |
reliktisch |
w |
wassertransportiert |
u |
Übergangsmoor |
y |
Kunstsubstrat |
z |
primär salziges Substrat |
In der Bezeichnung von Böden besteht international weiterhin Chaos.
Die wichtigsten Bodenklassifikationen sind:
Acrisol
Merkmale |
Bodenprofil |
Abbildung |
~ deutsche Systematiken |
~ anglo-amerikanische Systematiken |
| Saurer Boden mit niedriger Basensättigung (lat. acris = sehr sauer + lat. sol. = Boden) |
|
|
Fersiallitische Böden, Rotlehme, Braunlehme | Ultisols, Red-yellow podzolic soils, Leached ferralitic soils |
Alisol
(neu seit 1988)| ähnlich wie Acrisole, jedoch hohe Austauschkapazität, niedrige Basensättigung und hohe Aluminium-Sättigung |
|
Andosol
| Dunkler Boden aus vulkanischen Aschen mit schwarzem mullartigen Horizont (jap. an do = schwarzer Boden + lat. sol. = Boden) |
|
|
Anthrosol
(neu seit 1988)| Durch menschlichen Einfluß entstandener und/oder wesentlich umgestalteter Boden |
|
Anthropogene Böden, Kulturböden, Kultsole, Rigosole |
Arenosol
| Sandiger Boden mit grober Textur (lat. arena = Sand + lat. sol. = Boden) |
|
Entisols, Psamments, (red and yellow) Sands |
Calcisol
(neu seit 1988)| Boden mit Kalk-Anreicherungen in weniger als 1,25 m Tiefe | Acridisols, Calciorthids, Calcareeous soils |
Cambisol
| Boden mit Veränderungen in Farbe, Struktur und Textur als Ergebnis der Verwitterung (Verlehmte und verbraunte Landböden) (lat. cambiare = wechseln + lat. sol. = Boden) |
|
Braunerden, Kalkbraunerde, Terra fusca, Terra rossa | Inceptisols, Brown earths |
Chernozem
| Schwarzerde der Steppe (russ. chern = schwarz + russ. zemlja = Erde) |
|
|
(Steppen-) Schwarzerden, Tschernoseme | Mollisols, Black earths of temperate steppes |
Ferralsol
| Boden mit hohem Sesquioxidgehalt (Oxide und Hydroxide von Aluminium, Eisen, Mangan) (lat. ferrum = Eisen + Al[uminium] + lat. sol. = Boden) |
|
|
Tropische Roterden, Tropische Gelberden, Ferralitische Böden, Lateritische Böden | Oxisols, Weathered ferralitic soils, Latosols, red earths |
Fluvisol
| Auen- und Küstenboden mit geringer Profildifferenzierung (lat. fluvius = Fluß + lat. sol. = Boden) |
|
Auenböden, Alluviale Böden, Schwemmlandböden | Entisols: Fluvents, Alluvial soils |
Gleysol
| Boden mit starken hydromorphen (Wasser) Merkmalen (russ. Gley = feuchter schwerer Boden + lat. sol. = Boden) |
|
|
Gleye, Gley-Böden | Entisols: Aquents, Inceptisols: Aquepts, Meadow soils |
Greyzem
| Grauer Waldboden (engl. grey = grau + russ. zemlja = Erde) | Graue Waldböden | Mollisols, Grey forest soils |
Gypsisol
(neu seit 1988)| Boden mit Gipsanreicherungen in weniger als 1,25 m Tiefe |
|
|
Aridisols: Calciorthids, Soils with Gypsum |
Histosol
| Boden mit starker Anreicherung organischer Substanzen, Moorboden (griech. histos = Gewebe + lat. sol. = Boden) |
|
Moorböden, Torfböden | Bog soils, Peat soils, Organic hydromorphic soils |
Kastanozem
| Kastanienfarbiger Boden der trockenen Steppe (lat. castanus = Kastanie + russ. zemlja = Erde) |
|
|
Braune Steppenböden, Kastanienfarbene Böden, Buroseme | Mollisols: Ustolls und Aridic Borolls, Chestnut soils, Brown and dark brown soils |
Leptosol
(neu seit 1988)| Schwach entwickelter flachgründiger Boden, vorwiegend aus Festgesteinen |
|
Syroseme | Entisols |
Lithosol
(1988 gestrichen)| Schwach entwickelter Boden aus Festgestein (griech lithos = Stein + lat. sol. = Boden) | Syroseme, Gesteinsrohböden, Schutt- oder Skelettböden | Entisols: Orthents |
Lixisol
| Boden mit erungshorizont mit niedriger Austauschkapazität und hoher Basensättigung | Alfisols: Ustalfs, Xeralfs, Ferruginous soils |
Luvisol
| Boden mit Tonverlagerung (lat. luvi = auswaschen + lat. sol. = Boden) |
|
Lessivés, Parabraunerden | Alfisols: Udalfs, Boralfs, Grey brown podzolic soils |
Nitisol
| Boden mit Tonverlagerung und deutlichen Toncutanen (im Trockenzustand glänzende Tonhäutchen) (lat. nitidus = glänzend + lat. sol. = Boden) | Alafisols: Udalfs, Ultisols: Udulkts, Ustults, Ferrisols |
Phaeozem
| Degradierte Schwarzerde der Waldsteppe mit Entkalkung, Verbraunung, Humusverlagerung (griech phaios = dunkelgrau + russ. zemlja = Erde) | Brunizeme, Prärieböden, Degradierte Tschernoseme | Mollisols: Udolls, Dark grey soils, Brunizems |
Planosol
| Boden in flachen Senken mit Öberflächenwassereinfluß (lat. planus = flach + lat. sol. = Boden) | Pseudogleye, Stagnogleye |
Plinthosol
(neu seit 1988)| Eisenreicher, rostfleckiger, nicht verhärteter, tonreicher ferralitischer Boden |
|
Oxisols: Plinthaquox, Latosols |
Podzol
| Boden mit stark geschichtetem Horizont (russ. pod zola = unter Asche) |
|
Podsole, Bleicherden | Spodosols |
Podzoluvisol
| Boden zwischen Podsol und Luvisol |
|
Fahlerden | Alfisols, Glossic great groups |
Ranker
(1988 gestrichen)| Flachgründiger Boden aus Silikatgestein (österr. Rank = Hang) |
|
Ranker, Humussilikatböden | Inceptisols, Lithic Haplumbrepts |
Regosol
| Schwach entwickelter Boden aus Lockergestein über Festgestein (griech rhegos = Decke + lat. sol. = Boden) |
|
|
Lockersyroseme | Entisols:Orthents |
Rendzina
(1988 gestrichen)| Flachgründiger Boden aus Kalkstein (poln. rzedzic = Geräusch beim Pflügen über kalksteinhaltigem Boden) |
|
|
Rendzina, Humuskarbonatböden | Mollisols: Rendolls |
Solonchak
| Salzboden (russ. = salziger Boden) | Salzböden, Weißalkaliböden | Aridisols: Salorthids, Saline soils |
Solonetz
| Alkaliboden (Na+) (russ. = alkalischer Boden) |
|
|
Alkaliböden, Schwarzalkaliböden | Natric soils, Alkali soils |
Vertisol
| Boden mit starken Quellungs- und Schrumpfungserscheinungen infolge hohen Tongehalts (lat. vertere = wenden + lat. sol. = Boden) |
|
|
Pelosole, Smonitzen | Tirs, Black cotton soils, Regurs, Cracking clay soils, Grumusols |
Xerosol
(1988 gestrichen)| Halbwüstenboden (griech. xeros = trocken + lat. sol. = Boden) | Buroseme, Halbwüstenböden | Aridisols, Semi-desert soils |
Yermosol
(1988 gestrichen)| Wüstenboden (span. yermo = Wüste + lat. sol. = Boden) | Seroseme, Vollwüstenböden | Aridisols, Desert soils |
Die genannten ersten Gliederungseinheiten der FAO-UNESCO-Klassifikation werden durch Hinzufügung folgender Adjektive noch weiter untergliedert:
Albic |
gebleicht |
Calcaric |
kalkhaltiges Material vorhanden |
Chromic |
kräftig gefärbt |
Dystric |
unfruchtbar, niedrige Basensättigung |
Eutric |
fruchtbar, hohe Basensättigung |
Ferralic |
hohe Sesquioxidanteile (Oxide und Hydroxide von Aluminium, Eisen, Mangan) |
Ferric |
rostfleckig oder Eisenakkumulation |
Gelic |
Permafrost im Unterboden |
Haplic |
normale Horizontfolge |
Humic |
reich an organischem Material |
Luvic |
Tonakkumulation im Unterboden |
Orthic |
1988 durch Haplic ersetzt |
Plinthic |
eisenreiche (rostfleckige) Tone, verhärten irreversibel bei Austrocknung |
Rhodic |
rot bis dunkelrot |
Vorlagen für die Übersichten: die unten angegebenen Ressourcen sowie: Schultz, Jürgen: Die Ökozonen der Erde. -- 2., überarb. Aufl. -- Stuttgart : Ulmer, ©1995. -- (UTB ; 1514). -- ISBN 3-8252-1514-8. -- S.37 -40
Im Jahr 1845 machte H. S. Thompson, ein Gutsbesitzer in Yorkshire, folgenden Versuch:
"THOMPSON besprengte ein Stück Boden mit einer Lösung von Amoniumsulfat und versuchte dann, dieses auszuwaschen, indem er Wasser nachgoß. Er fand, daß die aus dem Boden ablaufende Flüssigkeit im wesentlichen nur Kalziumsulfat enthielt. Das Ammoniak blieb zurück; es hatte sich nach dem Austausch mit Kalzium des Bodens an Bodenteilchen angelagert. THOMPSONS Versuchsergebnisse wurden von einem anderen Engländer, J. T. WAY, einem Chemiker, der oft als der eigentliche Entdecker des Basenaustausches angesehen wird, bestätigt und ausgebaut."
[Nicol, Hugh <1898 - >: Der Mensch und die Mikroben. -- Hamburg : Rowohlt, 1956. -- (rde ; 32). -- Einheitssachtitel: Microbes and us. -- S. 177]
Dieser Austausch ist von zentraler Bedeutung für die Nährstoffaufnahme der Pflanzen.
"Im Boden finden viele chemische Vorgänge statt, die in hohem Maße an der Ernährung der Pflanzen beteiligt sind. Die meisten dieser Vorgänge vollziehen sich in der Bodenlösung, wie man das Bodenwasser nennt, in dem Salze, Säuren, Basen und feste Bodenteilchen enthalten sind.
Die feinsten, abschlämmbaren Teilchen des Bodens mit einer Korngröße von weniger als 0,001 mm nennt man Kolloide (kolloidal = feinzerteilt). Bodenkolloide sind keine chemisch einheitlichen oder eindeutig bestimmbaren Stoffe. Für ihre Einordnung als Kolloide ist ihre Teilchengröße entscheidend.
Für den Boden haben die Kolloide große Bedeutung, denn sie sind besonders reaktionsfähig. Sie verleihen dem Boden die Bindigkeit, schützen die Nährstoffe vor Auswaschungen und verbessern die Wasserkapazität und die Wasserführung im Boden. Da sie meist quellbar sind, können sie je nach Wassergehalt ihr Volumen verändern.
Die wichtigsten Bodenkolloide sind Ton und Humus. Bei Anwesenheit von Kalzium-Ionen entstehen Ton-Humus-Komplexe. Sie haben hohe Sorptionskapazität (Festhaltevermögen). An ihnen vollziehen sich Basenaustauschvorgänge (Austausch der Nährstoffe)."
[ Zabel, Erwin ; Neitzel, Heinz ; Ziebell, Elke: Bodenfruchtbarkeit. -- 2. Aufl. -- Berlin : Volk und Wissen, 1985 (©1976). -- S. 57]
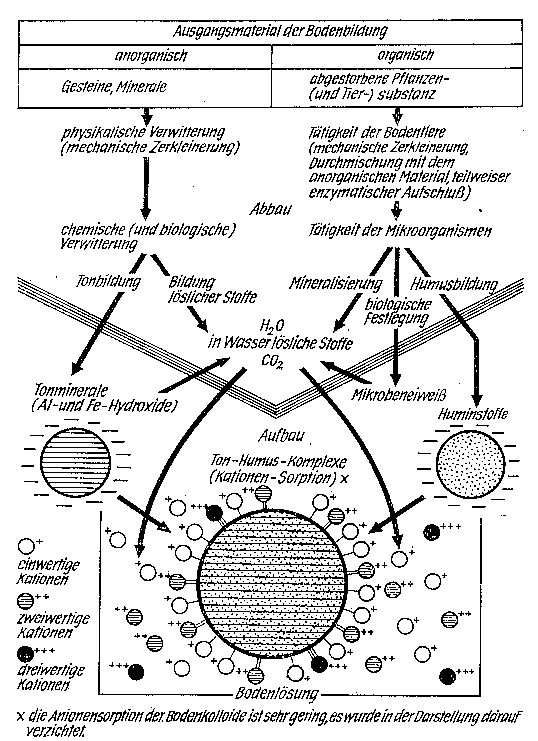
Abb.: Zusammenwirken von Umwandlungsvorgängen im Hinblick auf das Entstehen von Ton-Humus-Komplexen
[Quelle der Abb.: Zabel, Erwin ; Neitzel, Heinz ; Ziebell, Elke: Bodenfruchtbarkeit. -- 2. Aufl. -- Berlin : Volk und Wissen, 1985 (©1976). -- S. 58]
Für die Pflanzenernährung besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen:
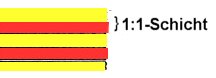
Deswegen besitzen Zweischicht-Tonmateriale kaum die Fähigkeit, Kationen (positiv geladene Ionen) zu binden und auszutauschen. Tropische Böden haben oft einen hohen Anteil an Kaolinit. Deswegen werden nach dem Abholzen tropischer Wälder Nährstoffe durch den Boden oft sehr schlecht gebunden und deswegen schnell ausgewaschen. Auf solchen Böden ist Landwirtschaft nur für kurze Zeit möglich. Tropische Wälder binden die Nährstoffe oft organisch und halten sie in einem sehr schnellen Kreislauf.
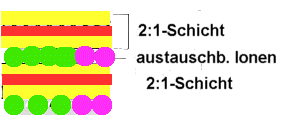
Als Humus bezeichnet man die im oder auf dem Boden befindliche abgestorbene Pflanzen- und Tiersubstanz, die einem stetigen Abbau, Umbau und Aufbau unterworfen ist.
An der Umsetzung dieser organischen Rückstände sind Bakterien, Pilze und niedere Tiere beteiligt, die im Boden leben. Sie bauen Rückstände nach und nach zu Stoffen ab, die von Pflanzen aufnehmbar sind. Chemisch ist Humus sehr kompliziert aufgebaut und setzt sich aus vielen verschiedenen Verbindungen zusammen.
Bestandteile des Humus:
Besonders wichtig für die Pflanzenernährung sind Huminsäuren und Humine. Sie gehen in die Ton-Humuskomplexe des Bodens ein. Huminstoffe können Ionen sehr gut adsorbieren, d.h. Nährstoffe im Boden speichern, und sie sind am Kationenaustausch beteiligt. In tonarmen Böden sind Huminstoffe zentral für Bindung und Austausch der Nährstoffe, in tonreichen Böden wird diese Funktion vorwiegend von den Tonteilchen (dreischichtige Tonminerale) übernommen.
Man unterscheidet folgende Humusformen:
Bodenkunde
/ Herbert Kunze ; Günther Roeschmann ; Georg Schwerdtfeger. -- 5., neubearb. und erw. Aufl. -- Stuttgart : Ulmer, ©1994. -- 424 S. : Ill. -- (UTB : Große Reihe). -- ISBN 3-8252-8076-4Bodenkundliche Kartieranleitung
/ hrsg. von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ... -- 4., verb. und erw. Aufl. -- Hannover, 1994. -- 392 S. : Ill. -- ISBN 3-510-95804-7Bodenökologie
/ Ulrich Gisi ... -- 2., neu bearb und erw. Aufl. -- Stuttgart [u.a.] : Thieme, ©1997. -- 350 S. : Ill. -- ISBN 3-13-747202-4Schroeder, Diedrich:
Bodenkunde in Stichworten. -- 5., rev. und erw. Aufl. / von Winfried E. H. Blum. -- Berlin [u.a.] : Hirt, ©1992. -- 175 S. : Ill. -- (Hirts Stichwortbücher). -- ISBN 3-443-03103-XVeränderung von Böden durch anthropogene Einflüsse
: ein interdisziplinäres Studienbuch / hrsg. vom Deutschen Institut für Fernstudienforschung an der Universität Tübingen. -- Berlin [u.a.] : Springer, ©1997. -- 663 S. : Ill. -- ISBN 3-540-61556-3Zabel, Erwin ; Neitzel, Heinz ; Ziebell, Elke:
Bodenfruchtbarkeit. -- 2. Aufl. -- Berlin : Volk und Wissen, 1985 (©1976). -- 95 S. : Ill. -- [Empfehlenswertes Schulbuch]