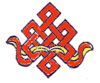
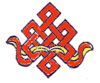
Wir sind miteinander verknüpft
mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Entwicklungsländerstudien / hrsg. von Margarete Payer. -- Teil I: Grundgegebenheiten. -- Kapitel 8: Tierische Produktion. --5. Elefanten / zusammengestellt von Alois Payer. -- Fassung vom 2018-10-08. -- URL: http://www.payer.de/entwicklung/entw085.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2000-02-27
Überarbeitungen: 2018-10-08 [grundlegend überarbeitet] ; 2001-02-08
Anlass: Lehrveranstaltung "Einführung in Entwicklungsländerstudien", HBI Stuttgart, 1998/99
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Bestandteil der Abteilung Entwicklungsländer von Tüpfli's Global Village Library.
Skript, das von den Teilnehmern am Wahlpflichtfach "Entwicklungsländerstudien" an der HBI Stuttgart erarbeitet wird.

Abb.: Mann verehrt Elefantenstatue mit Goldplättchen, Erawan, Bangkok, Thailand
(©Corbis)
Obwohl Arbeitselefanten meist Wildfänge sind und kaum gezüchtet werden, man sie auch nicht als domestiziert bezeichnen kann (sondern nur als zahm), man sie also nicht zur tierischen "Produktion" rechnen kann, wird den Elefanten hier trotzdem ein Kapitel gewidmet. Dies wegen ihrer Bedeutung für die Kultur und früher auch Wirtschaft weiter Teile Asiens.
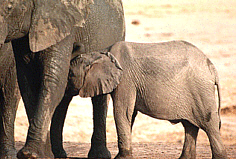
Abb.: Säugender Afrikanischer Elefant (©Corbis)
|
|
 |
| Abb.: Elefantenfuß, schematisch [Vorlage der Abb.: Gröning, Karl ; Saller, Martin: Der Elefant in Natur und Kulturgeschichte. -- Köln : Könemann, ©1998. -- ISBN 3829004486. -- S. 69. -- ] |
Abb.: Vorderfuß von Asiatischem Elefanten (©Corbis) |
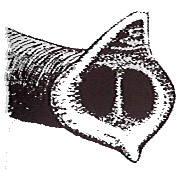 Abb.: Rüsselspitze Afrikanischer Elefant |
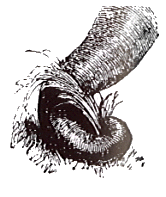 Abb.: Elefant reißt mit Rüssel Gras ab |
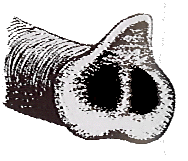 Abb.: Rüsselspitze Asiatischer Elefant |

Abb.: Asiatischer Elefant (©IMSI®)

Abb.: Afrikanischer Elefant (©IMSI®)
Ist der Arbeitselefant ein domestiziertes Tier? Der frühere Direktor des Zürcher Zoos, Heini Hediger klärt die Begriffe "zahm" bzw. "domestiziert":
"Die wichtigste Verhaltenseigenschaft fast aller Haustiere -- von der weißen Ratte bis zum Hund oder Pferd -- ist im Grunde genommen das Fehlen der Fluchttendenz. Das beste Pferd wäre unnütz, wenn es bei Annäherung eines Menschen auf 100 m losgaloppieren würde, ebenso die beste Milchkuh, wenn sie sich nicht annähern und berühren lassen würde. Es ist kein Zufall, dass so gut wie alle Haustiere Kontakttiere sind, denen neben der Fluchtdistanz auch die Individualdistanz fehlt, d. h. sie lassen sich im allgemeinen gern berühren, streicheln, tätscheln. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten für den Verlust der urtümlichen Fluchttendenz, nämlich den individuellen und den genetischen Verlust. Im ersten Fall spricht man von Zahmheit, im zweiten von Domestiziertheit. Das sind zwei wesentlich verschiedene Stufen der Tier-Mensch-Beziehung, die im allgemeinen zu wenig unterschieden werden."
[Hediger, Heini <1908 - >: Tiere verstehen : Erkenntnisse eines Tierpsychologen. -- München : Kindler, ©1980. -- ISBN 3-463-00795-9. -- S. 30f.]
Nach dieser Definition sind Arbeitselefanten zwar zahme Tiere, aber keine domestizierten Tiere.
"Vorausgesetzt, es gelingt, anstelle großflächigen Kahlschlags vermehrt zur selektiven Holzgewinnung zurückzukehren, dann besteht auch heute ein guter Markt für zusätzliche Arbeitselefanten, die aus dichten Wildbeständen rekrutiert werden. Ja, es ist sogar damit zu rechnen, dass selbst dort, wo die Haltung von Arbeitselefanten aufgegeben worden ist -- zum Beispiel auf Sumatra --, wiederum Arbeitslager entstehen. Zudem eröffnen sich neue Aufgabenbereiche. So, wie der Einsatz zahmer Elefanten bei der Holzgewinnung verhältnismäßig spät in großem Stil begonnen wurde, wurden Arbeitselefanten erst in den letzten Jahrzehnten zu unentbehrlichen Helfern im Naturschutz und bei der Erforschung bedrohter Tiere wie zum Beispiel des Tigers oder des Panzernashorns. Im völlig unwegsamen Grasdschungel des Brahmaputra und des Manas-Flusses lassen sich die Einhörner praktisch nur vom Rücken zahmer Elefanten aus beobachten - und dies aus nächster Nähe.
Doch die wohl wichtigste neue Aufgabe der Arbeitselefantenlager wird die Nachzucht der Tierriesen sein. Schon heute werden in Süd- und Nordostindien, in Thailand und in Birma regelmäßig Elefanten in Gefangenschaft geboren. In Birma, das einst wegen seiner hohen Nachwuchsrate in den Arbeitslagern bekannt war, sollen -- so John Blower von der FAO -- heute jährlich fünf von hundert fortpflanzungsfähigen zahmen Weibchen ein Junges zur Welt bringen. Bei einem natürlichen Geburtenintervall von vier Jahren müssten es aber fünfmal mehr sein. Die Verbesserung der Haltungsbedingungen wird zur Zeit auf Wunsch der birmanischen Regierung von ausländischen Fachleuten untersucht. Werden die Vorschläge berücksichtigt, so ist in Zukunft mit einer Steigerung der Nachwuchsrate zu rechnen. Ähnliches gibt es aus Thailand zu berichten.
Erhaltungszuchten sind in den Arbeitslagern deshalb von ausschlaggebender Bedeutung, weil der Nachschub aus Wildgebieten bald versiegen wird.Arbeitselefanten, die in den letzten kleinen noch vorhandenen Waldgebieten für die selektive Holzgewinnung oder in den vielen neu entstandenen kleinen Reservaten als Transporttiere eingesetzt werden, erobern gewissermaßen verlorenes Areal zurück. So etwa im Kanha-Nationalpark, wo noch um die Jahrhundertwende wilde Elefanten lebten. Dort -- wie auch anderswo -- arbeiten die Tierriesen nicht jeden Tag des Jahres, und wenn sie überhaupt arbeiten, dann nur während einiger Stunden täglich. Den Rest verbringen sie, ähnlich wie ihre wilden Artgenossen, im Dschungel, wo sie ihr Futter finden, trinken, baden, schlafen und hoffentlich bald sich fortpflanzen.
Regelmäßige Nachzuchten, die den eigenen Bedarf an zahmen Elefanten decken, sind ebenso wichtige Marksteine auf dem beschwerlichen Weg eines sinnvollen Naturschutzes in Südasien wie die Rettung großer Waldinseln, in denen wilde Elefanten leben können, weil sie das Verbreitungsgebiet des Elefanten nicht einschränken, weil sie ansässigen Menschen Arbeit bringen, weil sie billige Nutzung und Erschließungsarbeiten auch in Zukunft ermöglichen. Erreicht werden diese Ziele aber nur, wenn es in kurzer Zeit gelingt, aus dem Tierriesen das zu machen, was er bis heute nie war: ein Haustier."
[Kurt, Fred <1939 - >: Das Elefantenbuch : wie Asiens letzte Riesen leben. -- Hamburg [u.a.] : Rasch und Röhring, ©1986l. -- ISBN 3-89136-084-3. -- S. 237]
So weit die -- plausibel klingende -- Theorie. Die Praxis schaut leider etwas anders aus, wie folgende Agenturmeldung vom 16.2.2000 zeigt:
"Amoklauf in der Innenstadt. BANGKOK Ein hungriger und genervter Elefant ist in der Innenstadt Amok gelaufen und hat ein Chaos angerichtet. Erst nach mehrstündiger Jagd konnten Polizisten und Tierärzte den dreieinhalb Tonnen schweren Bullen mit einem Betäubungsschuss stoppen. Viele Thailänder aus den ländlichen Provinzen kommen mit ihren Arbeitselefanten nach Bangkok, um dort von Touristen Geld zu erbetteln. Die Urlauber dürfen die Tiere gegen Entgelt mit Bananen und grünen Bohnen füttern -- zu wenig für den Riesenappetit der Elefanten. Nachdem er stundenlang an den verkehrsreichen Straßen der Millionenstadt hatte auf und ab laufen müssen, riss dem 21 Jahre alten „Plai Rung-Rueng" der Geduldsfaden: Er warf seinen
Besitzer ab und suchte das Weite. Jetzt wird er mit einem Laster in seine Heimat zurück gebracht. AP"
"Der Elefant ist ein gewaltiger Fresser, aber ein schlechter Futterverwerter. 150 - 170 kg Pflanzennahrung benötigt er täglich. Er hat zwar eine Vorliebe für Beeren und Früchte, aber er ist nicht wählerisch. Alles stopft er flüchtig kauend in sich hinein: Gras und Wurzeln, Steppenheu am Halm und Kräuter aller Art, Buschwerk, Geäst und sogar Dornengestrüpp. Dazu trinkt er 70 - 150 Liter Wasser täglich. Nach einer Verdauungszeit von etwa 22 - 46 Stunden verlassen um 60 Prozent der aufgenommenen Nahrung den 35,5 m langen Darm unverdaut. Pferde und Schafe verwerten 60 - 70 Prozent. Der Dünndarm des Dickhäuters misst 25 m, 6,50 m der Dickdarm und 4 m der Enddarm. Anders als Wiederkäuer und Nager hat der Elefant in seinem Verdauungstrakt zu wenig 'symbiontische Bakterien': artverschiedene Organismen, die mit zelluloseabbauenden Zellulase-Enzymen bei der Aufschließung der pflanzlichen Zellwände zusammenwirken.
Eine Besonderheit im Verdauungssystem des Elefanten ist der 1,50 m lange Blinddarm, der größer ist als der Magen und in dem sich die Hauptmenge der für die Pflanzenverdauung erforderlichen Bakterien der Darmflora befindet. Im Blinddarm und Dickdarm werden auch Eiweiß, Stärke und Zucker verdaut.
Die zur Hälfte unverdauten Nahrungsreste im Elefantenmist -- etwa zwei Zentner täglich -- sind ein vorzüglicher Nährboden für die mitausgeschiedenen Baum- und Pflanzensamen sowie für die Eiablagen von Käfern und Insekten, die ihre besondere Funktion haben im Wundergarten der Natur. In neun von zehn Elefantendunghaufen fanden sich bei Tests irgendwelche Samen. So streut der unentwegt wandernde Rüsselriese weithin Aussaat von Gräsern, Kräutern, Büschen und Bäumen.
Die Samen von einigen Bäumen und Lianengewächsen der tropischen Regenwälder scheinen nur von Elefanten weiterverbreitet zu werden. So kommt in Afrika der Makore-Baum, dessen hartes Rotholz gesuchter Exportartikel ist und den man heute selten findet, nur längs der Elefantenstraßen vor. Bisher wurden Samen der tennisballgroßen, von anderen Tieren verschmähten Früchte des afrikanischen Holzapfel-Baums nur im Elefantenkot gefunden. Elefantenkiefer vermögen selbst die dicksten und härtesten Schalen von Tropenfrüchten aufzubrechen und die Samenkerne freizusetzen."
[Gröning, Karl ; Saller, Martin: Der Elefant in Natur und Kulturgeschichte. -- Köln : Könemann, ©1998. -- ISBN 3829004486. -- S. 67. -- ]
Ein Elefant braucht zum Fressen täglich 16 bis 18 Stunden. Dafür schlafen/dösen sie nur 4 Stunden.
"Mahoud und Kavedi Das alte Ceylon kannte drei Volksgruppen, die mit dem Fang und der Haltung von Elefanten vertraut waren:
- die Pannikiyas, die mit Hilfe von Schlingen Elefanten fingen,
- die Kuruve, die für die gefangenen Elefanten verantwortlich waren,
- und die Pannayas, die während der Fangaktionen das nötige Futter zu beschaffen hatten.
In Hinterindien stellen bestimmte Volksstämme die Elefantenfänger und -führer, so etwa die Karen in Burma und Thailand oder die Moi in Kambodscha. In Südindien sind es die seit Menschengedenken im Dschungel lebenden Kurumbas, welche heute, nachdem die Herrschaft der Maharadschas abgelöst wurde, für die staatliche Forstverwaltung Elefanten führen, pflegen und gelegentlich sogar noch fangen.
Die uralte Tradition der Elefantenführung verlangt nach wie vor, dass sich wenigstens zwei Männer um einen Elefanten zu kümmern haben,
- einmal der Mahoud, der den Tierriesen zur Arbeit führt, gewissermaßen der «Pilot», der bis ins kleinste Detail die Eigenarten seines Schützlings kennt und von ihm absoluten Gehorsam verlangen kann; schließlich hat er seinen Elefanten ja auch selbst gezähmt und dressiert.
- Ihm steht der Kavedi zur Verfügung, der «Kopilot», der den Elefanten zwar auch reiten und von ihm die Befolgung einfacher Kommandi verlangen kann. Er ist aber für den Unterhalt des grauen Riesen verantwortlich. Er holt ihn am Morgen im Dschungel, führt ihn täglich zweimal zum Bad im nahen Fluss und füttert ihm jeden Morgen vor und jeden Abend nach der Arbeit einige Kilogramme jener braunen, stundenlang gekochten Masse aus Reis, Kleie, Rohrzucker und Salz, die gemessen an der vom Elefanten täglich verzehrten Futtermenge wie ein unbedeutender Leckerbissen wirkt. Doch ohne diese regelmäßig verabreichte Zusatzration könnte der Tierarzt, der in keinem Arbeitselefantenlager fehlt, keine Medikamente verabreichen.
Noch vor einem halben Jahrhundert bezogen die Elefantenmediziner ihre Weisheiten aus uralten Elefantenbüchern. Heute bedienen sie sich immer mehr der Erkenntnisse moderner Tiermedizin.
Der Tierarzt im Elefantenlager hat sich nicht nur um die regelmäßige Impfung seiner Patienten und um die Behandlung gelegentlicher Verletzungen oder Krankheiten zu kümmern, sondern vor allem auch um die «Musthbullen», also jene geschlechtsreifen Elefantenmännchen, die während einigen Tagen oder Wochen, gelegentlich aber sogar während zwei oder drei Monaten, äußerst gefährlich werden und dann nicht einmal mehr von ihrem Mahoud berührt, geschweige denn zur Arbeit geführt werden können. Der Tierarzt, der nun die komplizierte Fütterung des während der ganzen Musthperiode an allen vier Füßen angeketteten Bullen überwacht, versucht, ihn mit Beigaben von Joghurt und allerlei Medizinalpflanzen, unter denen sich angeblich auch harte Drogen wie Opium oder Haschisch befinden sollen, zu beruhigen.
Dank der äußerst engen Beziehung zwischen Menschen und Elefanten werden in den asiatischen Elefantenlagern wenigstens gleich viele Bullen wie Kühe gehalten; oft überwiegen die Bullen sogar, denn sie gelten nicht nur als viel kräftigere Arbeiter als die Kühe, sie können mit ihren Stoßzähnen die schweren Stämme auch besser tragen oder auf Lastwagen laden.
Wie wir noch berichten werden, sind Elefanten nie zu eigentlichen Haustieren geworden. Fast jeder Arbeitselefant wurde aus einer wildlebenden Herde gefangen, da dies, wie bereits erwähnt, bisher viel billiger war, als die trächtigen Kühe im zweiten Jahr ihrer Schwangerschaft und während der Aufzucht des Säuglings von der Arbeit freizustellen. In den letzten Jahren geschah dies vor allem in großen Kraalanlagen, in welche Dutzende von Elefanten getrieben wurden. Doch die viel ältere eigentliche Kunst des Elefantenfanges bedient sich der Jagd mit Schlingen.Wenn die Elefantenmenschen einst in Ceylon oder in Burma zur Jagd auszogen, dann trugen sie außer ihrem Lendenschurz und einem Amulett, das sowohl vor Dschungelgeistern wie wilden Elefanten schützen sollte, nur noch ihr langes Messer auf sich. Die Pannikiyas, die Karen wie auch die Pawangs, die als Zauberer bekannten Dschungeljäger aus Nordsumatra, können wochenlang im tropischen Wald leben, weil sie seine Wege und Flüsse, seine Tiere und Pflanzen kennen und in ihm Nahrung und Unterschlupf finden.
Die Jagd auf den Elefanten -- wie übrigens auch auf alle anderen Tiere des Dschungels -- ist eine Jagd mit Fallen, denn der dichte Pflanzenwuchs verhindert ja meistens die Sicht. Das Wild wittert den Menschen und flieht, bevor er es überhaupt zu Gesicht bekommt. Das Baumaterial für ihre Fallen finden die Jäger im Wald: zähe, biegsame Luftwurzeln der Rotanpalme für Schlingen, Bambusstämme als Spannfedern, Rinden für Seile.
Eine Elefantenfalle, wie sie die Pannikiyas von Sri Lanka heute noch bauen können, funktioniert nach folgendem Prinzip: An einer günstigen Stelle auf einem Elefantenwechsel hebt der Fallensteller ein doppelt handtiefes Loch aus. Dessen Umfang passt er der Größe des Fußes des von ihm gewünschten Elefanten an. Er macht es also meist nur so groß, dass höchstens Halbwüchsige hineintreten können. Am Rand der kleinen, kreisrunden Grube legt er eine starke Seilschlinge aus. Das freie Ende dieses Lassos fixiert er an einem starken Baum in der Nähe. Hoch oben im Geäst dieses Baumes befestigt er einen Sack, den er vorher mit schweren Steinen gefüllt hat, und zwar an einem Seil, das mit dem freien Ende der Fangschlinge verbunden ist. Solange die Falle gestellt bleibt, kann der Sack nicht fallen und damit die Schlinge blitzartig zureißen, weil ihn ein drittes Seil festhält, das mit dem Auslösemechanismus verbunden ist. Dieser wird erst ausgelöst, wenn ein Tier in das gut getarnte Loch auf der Elefantenstraße tritt und dabei die Faser zerreißt, welche die Schlinge gespannt hält.
Früher oder später ist dies der Fall. Ein Elefant sinkt mit einem Bein ein und wird sofort gefesselt. Jetzt müssen aber die Jäger rasch handeln. Zuerst gilt es, die andern Herdenmitglieder mit Lärm und Feuer zu vertreiben. Dann müssen sie sofort versuchen, den Frischfang mit weiteren Seilen an allen vier Füßen zu fesseln. Gezähmt haben die mutigen Pannikyias ihre Elefanten meist gleich an Ort und Stelle. Und wenn sie nach meist monatelangen Fangaktionen glücklich wieder in ihre einfachen Dörfer einzogen, begleiteten sie Frischfänge, die schon den ersten Kommandoworten gehorchten.
Als in den beiden letzten Jahrhunderten die Nachfrage nach Arbeitselefanten stieg und man wegen der rasch wachsenden Plantagen der europäischen Kolonisatoren oft ganze Herden einfangen musste, verschwand die Kunst der Schlingenfänger wenigstens teilweise. Die Kraalfangmethoden, die Kheddas, kamen auf. Bei ihnen treten die Schlingenfänger erst dann in Aktion, wenn die Elefanten schon in den großen Pferch getrieben sind. Zwischen Januar und März 1968 fand in Südindien die letzte große Khedda statt. Ihren Verlauf schildert der folgende Text.
Khedda
Im kleinen Dorf von Mastinagudi herrschte plötzlich beinahe Großstadtleben. Eine tausendköpfige Menschenmenge war zusammengeströmt. Händler priesen ihre Waren an, Salz, Zucker, Tee aus dem Hochland, Stoffe und Schuhe. Die Menschen aus den Dschungeldörfern waren zusammengeströmt und trugen ihre schönsten Kleider. Wer sich keinen Silberschmuck leisten konnte, trug wunderbar geflochtene Anhänger aus Reishalmen, Zeichen der Fruchtbarkeit ihrer Felder.
Hie und da drängte sich die Menge um einen Geschichtenerzähler, der singend und auf einer Orgel spielend Sagen von Helden und Göttern vortrug. Vom Rande der Wüste kamen Zigeuner, die Kobras und sogar eine Riesenschlange in kleinen Körben versteckt hielten und den Leuten flötenspielend vorführten. Höhepunkt war dann jeweils, wenn ein um die Lenden gefesselter Mungo zum Kampf mit den Giftschlangen antreten musste, denen man aber zur Vorsicht die Giftzähne gezogen hatte. Das bevorstehende Ereignis bereitete vielen schlaflose Nächte.
Während Monaten hatten viele Hundertschaften von arbeitsfähigen Männern aus den Dschungeldörfern und gut drei Dutzend mächtige Arbeitselefanten die riesige Kraalanlage gebaut, hatten Bäume gefällt, sie durch Elefanten an den abgeflachten Hügel am Fluss tragen lassen und dort zur Palisade eingerammt, die sechs bis acht Meter hoch war. Um die Mauer toter Baumstämme zogen sie einen doppelt mannstiefen Graben und rodeten seinen äußeren Rand. Hier legten sie Holzvorräte an für Feuer, die zum richtigen Zeitpunkt auflodern sollte.
Hier in Mastinagudi waren allein dreißig Männer damit beschäftigt, Seile zu drehen, mit welchen die Tierriesen gefesselt werden sollten.
Dutzende von Schreinern hatten die beiden Tribünen für die Touristen fertiggestellt und mit belaubten Ästen getarnt. Die Priester befragten die Dschungelgottheit über den Ausgang der gefährlichen und kostspieligen Fangaktion und opferten Hühner. Die Zeichen ständen gut, meinten sie, und verwiesen auf die Späher, kleine, unscheinbare Männer, die plötzlich lautlos von irgendwoher aus dem Dschungel auftauchten und im Hauptquartier meldeten, dass sich etwa 140 Elefanten gegen Kakankote bewegten.
Am Fangtag war die Spannung fast unerträglich. Schon am frühen Morgen mussten die Touristen ihre teuren Sitzplätze beziehen. Alle Straßen wurden gesperrt. Im Dschungel fühlte man die unheimliche Stille, wie sie sonst nur vor den ersten Monsungewittern herrscht. Vierzig riesige Arbeitselefanten trugen bewaffnete Forstbeamte in den Wald. Sie sollten die Treiberlinien verstärken. Stunden vergingen. Dann plötzlich dröhnte der Dschungel. Tausendfach erscholl der Lärm der Bambusklappern. Schrill trompeteten die verängstigten Wildelefanten, die nun, gejagt von Tausenden von Menschen und zwanzig Reitelefanten, die schrotschießende Forest officers trugen, einen Ausweg durch den Fluss suchten. Dort versperrten ihnen Feuerboote, die sie erst im letzten Augenblick ausmachen konnten, den Weg. Sie mussten nach rechts ausbrechen. Dabei preschten sie dicht gedrängt in die große Stockade, ein fußballfeldgroßes Gehege aus eingerammten, vier Meter hohen Stämmen. Kaum schlug das mächtige Holztor hinter dem letzten zu, loderten die Feuer rund um die Stockade. Aneinandergepresst standen die Wildfänge in der Mitte ihrer Falle und erwarteten ihr Schicksal.
Einbrechen
Zwei Wochen dauerte es, bis man sie alle, Gruppe für Gruppe, in eine zweite zirkusarenagroße Stockade gelockt und dort gefesselt und schließlich in das Auffanglager geführt hatte. Nicht alle Elefanten ertrugen den Schock.
Wohl ein Dutzend starb «an gebrochenen Herzen», wie die Mahouds sagten, als ihnen die Männer im Schutz zahmer Arbeitselefanten Fesseln um Füße und Hals legten, sie zwischen Bäume gespannt stunden- und tagelang stehen
ließen, mit langen Ruten auf den Rüssel schlugen, wenn sie sich wehrten, und ihnen schließlich den Leib mit Seilen umschnürten, an denen die Mahouds später «ihren» Elefanten vom Hinterteil her bestiegen.Dann kam der Tag, an welchem die Gefangenen endgültig auseinandergerissen wurden. Nur die stärksten der Halbwüchsigen und Erwachsenen durften hier im Wald von Kakankote bleiben, wo sie nach der Zähmung als «Transporter» fronen sollten. Elefantenhändler, Gaukler und Tempelbesitzer feilschten um die Alten und Verletzten, deren Fußknochen trotz Wundpuder und Tierarzt in eitrigen Wunden sichtbar waren. Die Seile hatten ihnen Haut und Fleisch durchschnitten, als sie sich mit allen Kräften zu befreien suchten und dabei kopfüber stürzten. Andere hatten Leistenbrüche, die nie verheilen konnten.
Abseits stand der Tierhändler aus Europa. Für ihn war das Geschäft längst gelaufen. Er sollte alle weiblichen Kälber bis zu 150 Zentimeter Schulterhöhe kriegen. An andern Elefanten war er nicht mehr interessiert, denn für größere Elefanten ist die Schiffsfracht doppelt so teuer, und mit Bullen lassen sich keine Geschäfte machen.
Als die beiden Lastwagen mit den Kälbern auf der staubigen Straße davon ratterten, zerrten die Zurückgebliebenen zum letzten Mal an ihren Ketten, dann legte sich der Schleier dumpfer Resignation über das Lager der Gefangenen.
Die drei oder vier Koomkies (Arbeitselefanten), die sie täglich zweimal an den nahen Fluss führten, mussten nicht mehr an den armdicken Seilen reißen, um sie in der gewünschten Richtung zu bewegen. Die Neuen begannen sich zu fügen, sie fingen sogar an, ihre bereits gezähmten Artgenossen zu imitieren. Am deutlichsten sah man dies nachts, wenn man am Feuer der Mahouds in Decken gehüllt lag, umgeben von den gefesselten und den Arbeitselefanten, deren Vorderfüße gehobbelt waren, damit sie in der Nähe des Lagers blieben. Jetzt legten sich plötzlich auch die Frischfänge wieder hin zum kurzen Elefantenschlaf von wenigen Stunden, und sie schliefen -- nach Art wilder Elefanten -- alle zur gleichen Zeit. Kaum sank einer der großen Arbeitsbullen lautlos in die Seitenlage und begann kurz darauf zu schnarchen, folgten auch die Frischfänge dem Zeichen der Nachtruhe und legten sich hin.
Indem sie ihre ausgebildeten Artgenossen imitierten, lernten sie in drei Monaten Bäume umtreten, mit Rüssel und Stoßzähnen hochheben und auf Wagen laden. Sie legten sich hin, standen auf oder blieben stehen, wenn der barfüßige Mahoud auf ihrem Nacken die Zeichen gab.
Tierbücher sind zwar voll von rührselig-kitschigen Geschichten über die enge Freundschaft zwischen Elefant und Mahoud. In Wirklichkeit kann aber der Elefantenmann seinem Sklaven nicht den Artgenossen, sondern höchstens einen kleinen Teil des verlorenen Alltags im Dschungel ersetzen, wenn er ihm zweimal täglich am Badeplatz mit flachen Steinen oder halbierten Kokosnüssen die empfindliche Samthaut massiert. Futter dagegen besorgen die Mahouds in Indien ihren abgerichteten Kolossen nicht. Dieses dürfen sie sich allerdings auch während der Arbeit im Holzfällerlager selber suchen. Und wenn der kurze Arbeitstag von vier Stunden beendet ist, hobbelt der Mahoud seinem Elefanten die Vorderfüße mit einer Kette und entlässt ihn in den Dschungel. Dort findet er während der Nacht seine Nahrung. Dort trifft er gelegentlich wilde Artgenossen. Dort schläft er auch. Zu seinem Mahoud kehrt er am andern Morgen aber nicht allein zurück. Der muss ihn suchen. Da nun aber die großen Fußplatten das immense Gewicht der Elefanten verteilen, hinterlassen selbst erwachsene Bullen kaum sichtbare Spuren am Boden. Der Mahoud hätte deshalb Mühe, der Fährte seines Arbeitstieres zu folgen. Viel leichter findet er ihn aufgrund der Eindrücke der bis 6 Meter langen Spurkette, welche er am Abend an einem der Vorderbeine befestigt hat und vom Elefanten nachschleifen ließ.
Im Trainingslager von Mastinagudi durften die Elefanten, bis sie nach drei oder vier Wochen zahm waren, das Futter nur aus den Händen der Mahouds nehmen, die sie jetzt bei jeder Gelegenheit zuerst mit Stöcken, später mit den Händen zu berühren suchten. Nach und nach vertauschten die Elefantenleute die brutalen Methoden des Einbrechens mit der Strenge der Erzieher.
Zwei Eigenheiten der Elefanten nutzten die Mahouds nun für die Dressur: die Empfindlichkeit ihrer Haut -- Elefanten bluten bereits vom Stich einer Bremse -- und das ungeheure Futterbedürfnis. Elefanten brauchen täglich zwischen 300 und 500 Kilo Grünfutter, wovon sie zwar etwa 150 Kilo aufnehmen, aber nur 60 Kilo tatsächlich verdauen. Reagierten die Tiere richtig auf eines der zwölf Kommandi, dann wurden sie mit Zuckerrohrstücken belohnt. Widersetzten sie sich der Dressur, dann stachen ihnen die Männer mit dem unteren, spitzen Ende des Hakens, des Ankus, in Rücken und Nacken.Ist die Dressur abgeschlossen, verzichten die Mahouds auf Strafen. Ihre gesprochenen Kommandi und Gesten sind aber Drohlaute und -gebärden, die den Arbeitselefanten zeitlebens an die Qualen erinnern, die er beim Einbrechen und der Dressur erleiden musste. Nur in Momenten äußerster Gefahr, also etwa dann, wenn der Elefant Menschen annehmen oder ausbrechen will, treibt ihm der Mahoud die Spitze des Hakens oder die Klinge des kleinen Messers, das er stets bei sich trägt, unter die Haut. Nur durch den sparsamen Einsatz harter Strafen gelingt es ihm, seinen Koloss während Jahrzehnten unter Kontrolle zu halten. Diese Sitte sollten übrigens Zoowärter und Zirkusdompteure übernehmen, die ihren Elefanten oft ohne nennenswerten Grund die Bullenpeitsche über Gesicht und Rüssel ziehen.
Elefanten sind keine Haustiere
Im Ausbildungslager von Mastinagudi schenkten innerhalb von zehn Tagen fünf Kühe Kälbern ein kurzes, trauriges Leben. Ihre Brüste waren schlaff und nicht prallgefüllt, wie wir es bei Wilden gesehen hatten. Wenn die Neugeborenen zwischen ihren Vorderbeinen mit geöffnetem Mund nach Milch suchten, stießen sie sie zurück. Die Elefantenleute ließen die Kälber verhungern; denn niemand will hier Elefanten züchten, obwohl auch unter den Arbeitselefanten gleich viele Bullen wie Kühe zu finden sind.
Bei einigen Mahoudkasten in Asien, so etwa unter den Moi in Vietnam, bedeutet die Geburt eines Kalbes im Arbeitslager Unglück für das ganze Dorf. Ursache solchen Aberglaubens ist eine simple ökonomische Überlegung. Es ist nämlich billiger, halbwüchsige oder erwachsene Elefanten einzufangen und abzurichten, als trächtige Elefanten während ihres zweiten Schwangerschaftsjahres und während der sechs- bis zehnmonatigen Stillperiode von der Arbeit freizustellen und Elefantenkälber während neun Jahren bis ins arbeitsfähige Alter durchzufüttern. Die Kälber, welche allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz geboren werden, finden heute nicht mehr Eingang in die Menagerien der Maharadschas, sie werden jetzt von Tierhändlern aufgekauft.
Lediglich in Burma scheinen Elefanten in den letzten Jahrzehnten planmäßig gezüchtet worden zu sein. So verzeichnete die Steel Brothers and Co. in ihren Holzfällercamps 365 Geburten. In den fünfziger Jahren sollen von den sechstausend burmesischen Arbeitselefanten jährlich etwa sechshundert Kälber geboren worden sein.
Obwohl Elefanten schon ein Jahrtausend vor der Nutzbarmachung des Eisens für den Menschen Wälder rodeten, wurden die Urwaldriesen nie zu Haustieren. In den dem Menschen weichenden Wäldern hausten immer genügend, die sich fangen und zähmen ließen. Doch mit den letzten Wäldern werden auch die Elefanten verschwinden."
[Kurt, Fred <1939 - > ; Knie, Louis <1951 - >: Elefanten und Tiger im Zirkus Knie : Bilder und Notizen zu zwei Tiergestalten in Freiheit und in der Manege. -- Zürich [u.a.] : Ringier, ©1980l. -- ISBN 3-85859-153-X. -- S.18 - 24]
als Arbeitselefanten besonders zum Holzrücken und Holzflößen: Im Folgenden einige Bilder zur Nutzung als Arbeitselefanten
|
|
|
|
|
|
als Reittiere besonders für Touristen

Abb.: Touristensafari auf Elefanten, Simbabwe (©Corbis)
Daneben dienen Elefanten immer noch als Statussymbole und sogenannte weiße Elefanten als Garanten der staatlichen Legitimation (z.B. Thailand).
In Indiens Kulturen und Religionen spielen Elefanten eine zentrale Rolle. Als Einführung dazu sei empfohlen:
Zimmer, Heinrich <1890 - 1943>: Spiel um den Elefanten : ein Buch von indischer Natur. -- Neuausgabe. -- Düsseldorf [u.a.] : Diederichs, 1976. -- 213 S. : Ill. -- ISBN 3--424-00581-9
Als Beispiel sei nur genannt der sehr beliebte elefantenköpfige Gott Ganescha:
|
|
Lambodara, namas tubhyam satatam modakapriya nirvighnam kuru me deva sarvakâryeshu sarvadâ |
O Hängebauch, du Naschkatze Verehrung sei Dir! Gott, mache, dass alle meine Unternehmungen frei von Hindernissen seien |
| Abb.: Gott Ganescha, Devotionaldruck, Indien, um 1980 | Eines der vielen Gebete (Sanskrit) zu Ganescha, dem Beseitiger der Hindernisse | |
"Der Elefantenköpfige ist ... eine .. Gottheit des Wohlstandes und des ländlichen Gedeihens: dickbäuchig, Getreide und ein Mutterschaf im Arm, sitzt er von Schätzen umgeben; Reis klebt ihm am Stoßzahn. -- Er reitet auf einer Ratte. Der Gott in der Gestalt des größten Tieres (denn zum Elefantenkopf trägt er gern Elefantenleib mit Menschenarmen) bewegt sich auf dem winzigen Reittier. Aber es ist ihm in einem Wesenszuge verwandt ebenbürtig: die Hindernisse zu zerteilen, die es auf seinem Wege findet. Der Elefant tritt sie majestätischen Ganges nieder und erreicht sein Ziel; die Ratte weiß überall einen Spalt zu finden, ein Loch zu nagen, um an ihr Ziel zu gelangen. Das ist vielleicht nicht der letzte Sinn -- aber gewiss eine der Beziehungen --, die den kleinen Nager dem elefantengestaltigen Gotte gesellt." [Zimmer, a.a.O., S. 115f.]
Nutztiere der Tropen und Subtropen / Hrsg. Siegfried Legel. -- Stuttgart [u.a.] : Hirzel.. -- Bd. 3: Pferde/Esel, Schweine, Elefanten, Geflügel, Bienen, Seidenspinner. -- ©1993. -- ISBN 3777604976. --
Gröning, Karl ; Saller, Martin: Der Elefant in Natur und Kulturgeschichte. -- Köln : Könemann, ©1998. -- 448 S. : Ill. -- ISBN 3829004486. --
Kurt, Fred <1939 - >: Das Elefantenbuch : wie Asiens letzte Riesen leben. -- Hamburg [u.a.] : Rasch und Röhring, ©1986. -- 246 S. : Ill. -- ISBN 3-89136-084-3
Kurt, Fred <1939 - > ; Knie, Louis <1951 - >: Elefanten und Tiger im Zirkus Knie : Bilder und Notizen zu zwei Tiergestalten in Freiheit und in der Manege. -- Zürich [u.a.] : Ringier, ©1980. -- 111 S. : Ill. -- ISBN 3-85859-153-X
Zu Kapitel 8.6: Schweine