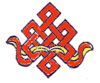
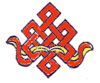
Wir sind miteinander verknüpft
mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Entwicklungsländerstudien / hrsg. von Margarete Payer. -- Teil I: Grundgegebenheiten. -- Kapitel 14: Verwandtschaft und Abstammung : Schwerpunkt Afrika / von Friederike Gerland und Sibylle Luptovits. -- Fassung vom 2001-02-21. -- URL: http://www.payer.de/entwicklung/entw14.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 000-05-22
Überarbeitungen: 2018-10-05 [grundlegend überarbeitet von Alois Payer] ; 2001-02-21 [Update]
Anlass: Lehrveranstaltung "Einführung in Entwicklungsländerstudien", HBI Stuttgart, 1998/99
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Bestandteil der Abteilung Entwicklungsländer von Tüpfli's Global Village Library.
Skript, das von den Teilnehmern am Wahlpflichtfach "Entwicklungsländerstudien" an der HBI Stuttgart erarbeitet wird.
| "Heuchelei gibt es jedoch auch auf der anderen Seite. In den Entwicklungsländern Asiens sind einige Politiker inzwischen dazu übergegangen, dem Westen seine dekadente Lebensweise vorzuhalten und »asiatische Werte« als moralisch überlegen und darüber hinaus produktiver hinzustellen. So wenn diese kulturellen Ansprüche auf den ersten Blick berechtigt erscheinen, erweisen sie sich bei näherer Betrachtung als sehr viel weniger nobel, ja sogar als heuchlerisch. Der angebliche Respekt der asiatischen Länder gegenüber der Familie zum Beispiel zeigt sich in den »Satansmühlen«, in denen Frauen und Kinder arbeiten müssen. »Familie« und »soziale Ordnung« sind oft nur Euphemismen für Hierarchie und Herrschaft. In einem System, das auf der rigiden Kontrolle von oben oder der grausamen Ausbeutung schwächerer Gruppen beruht, geht es nicht um Werte, sondern um Macht. Das ist jedoch nichts Besonderes. Die menschliche Gesellschaft versucht seit Jahrhunderten, solche Verhältnisse zu bezwingen." |
[Greider, William <1939 - >: Endstation Globalisierung : neue Wege in eine Welt ohne Grenzen. -- Ungekürzte Taschenbuchausgabe. -- München : Heyne, ©1998. -- (Heyne Business ; 22/1056). -- ISBN 3453155521. -- Originaltitel: One world, ready or not : the manic logic of global capitalism, ©1997. -- S. 640. ]
Die Kenntnis von Verwandtschaftsbeziehungen ist von unüberschätzbarer Wichtigkeit für das Verständnis der meisten Entwicklungsländer. Verwandtschaft hat nämlich wesentlich zu tun u.a. mit:
"In many societies, both primitive and sophisticated, relationships to ancestors and kin have been the key relationships in the social structure; they have been the pivots on which most interaction, most claims and obligations, most loyalties and sentiments, turned. There would have been nothing whimsical or nostalgie about genealogical knowledge for a Chinese scholar, a Roman citizen, a South Sea Islander, a Zulu warrior or a Saxon thane; it would have been essential knowledge because it would have defined many of his most significant rights, duties and sentiments. In a society where kinship is supremely important, loyalties to kin supersede all other loyalties, and for this reason alone kinship must be the enemy of bureaucracy. In our modern technocratic and bureaucratic age, the complexity of our social structure demands that ideally a man should fill a position because he is proved capable of filling it - not simply because he is the son of his father. Furthermore we demand that a man be loyal to his State and his office before his kin. But kinship is tenacious. In the developing countries bureaucratic rationality often loses out to kinship loyalties; an official selects his subordinates not on the criterion of ability to do the job, but on the basis of closeness of relationship. What to us is rank nepotism is to him a high moral duty. And even in our own enlightened and rational society the web of kinship and marriage around our 'great families' -- the Cecils, Devonshires, Churchills, etc. -- spreads into most corners of political and public life. In some working-class enclaves also, kinship networks seem to be important. It. is in the less conservative and more mobile middle-classes that kinship now seems to be of little relevance beyond the level of parent-child relationships, and even these have a looseness about them that would shock many of our primitive contemporaries. That old parents should be left by their children to live and eventually die in loneliness - or be put into homes -- would seem to many to be the depths of immorality; but our whole system of architecture and social welfare is geared to the elementary family of parents and dependent children. We may be a relatively 'kinshipless' society (although sociologists have probably exaggerated this tendency) but the sentiments of kinship still linger. Would we not, if a long-forgotten first cousin turned up having fallen on hard times, feel some obligation towards him simply because he was a cousin ? And if we could find out who our great-greatgreat grandfather was, would we not be pleased, in some irrational way, at the knowledge? It was Bertie Wooster's opinion that there were few of his acquaintances who were not living on remittances from uncles and aunts. This may be less true than it was, but do we not feel that we have some claim on uncles and aunts simply by virtue of their relationship to us? Blood, as the old adage has it, is thicker than water.
But why should it be? When the demands of our industrial civilization drive us towards an impersonal, bureaucratic, rational social-structure, why should these irrational sentiments of kinship still have a hold? 1 heard of a man who collected old family albums and pored over them, because he was fascinated by what he thought of as the Victorian ideal of the family: a group in which everyone was loyal to everyone else without question, simply because they were 'of the same blood'. The same feeling attaches to aristocratic codes of honour in which a true aristocrat should avenge the death or dishonour of a kinsman without question. In Mediterranean countries this code of honour is still a force to be reckoned with. These unthinking, familistic, kinship-centred loyalties run in opposition to the laws of church and state and the demands of an expanding industrial society. Whence their strength, and if not their strength then at least their fascination? Could it be the hangover of centuries not to say millenia, of kinshipcentred experience ? in societies less rationalistic, less governed by impersonal law, less dominated by the state, it was clearly of great importance to have, for example, automatic support in dispute. For the longer period of human development, mankind lived for the most part in societies in which kinship-based groups were the constituent units. A man's health and security, his very life and even his chance of immortality, were in the hands of his kin. A 'kinless' man was at best a man without social position: at worst, he was a dead man. Thus, even our relatively kinless society cannot throw off this slowly cumulated, almost innate wisdom of the blood. If it is basic in our natures to trust the familiar and fear the strange, then those who share our blood share part of ourselves, and so are by definition the most familiar of all."
[Fox, Robin <1934 - >: Kinship and marriage : an anthropological perspective. -- Harmondsworth : Penguin, ©1967. -- (Pelican books). -- [Sehr klare Einführung]. -- Nachdruck: Cambridge University Press. -- ISBN 0521278236. . -- S. 13 - 16]
Verwandtschaft und Abstammung sind aber keineswegs, wie man zunächst aufgrund der biologischen Grundlagen meinen könnte, klare "Gegenstände", sondern eher amorphe, vieldeutige Begriffe. Verwandtschaft bedeutet für das Individuum deshalb auch nicht ein geschlossenes System (wie es Darstellungen von Verwandtschaftssystemen manchmal suggerieren), sondern ein offenes Gewebe von Möglichkeiten und Beschränkungen.

Abb.: Ahnenverehrung in chinesischem Tempel, Malaysia (©Corbis)
"Die Erklärungen der Dowayos [in Kamerun] endeten immer in einer Kreisbahn, die ich nur allzugut kennenlernte. »Warum tut ihr das?« pflegte ich zu fragen.
»Weil es gut ist.«
»Warum ist es gut?«
»Weil unsere Vorfahren es uns geheißen haben.«
(Lauernd) »Warum haben es euch die Vorfahren geheißen?«
»Weil es gut ist.«An den »Vorfahren«, die das A und O jeder Erklärung waren, führte einfach kein Weg vorbei."
[Barley, Nigel: Traumatische Tropen : Notizen aus meiner Lehmhütte. -- Münchenn : dtv, 1997. -- (dtv ; 12399). -- ISBN 3423123990. -- Originaltitel: The innocent anthropologist (1986). -- S. 107. ]
"Im Unterschied zu europäischen Gesellschaften sind die Tradition und die Anwesenheit der Ahnen in Afrika lebendige Größen, auch wenn sie heute umstritten sind. Die Ahnen werden von vielen Menschen verehrt; sie sind die Gründer der Gruppe; ihnen hat Gott ein Stück Land gegeben, auf dem sie und ihre Nachfahren leben können. Sie haben mit der Natur einen Pakt geschlossen, damit diese sie ernährt und ihre Kräfte schützend über sie hält; sie haben diesen Pakt durch Riten und Verhaltensweisen gepflegt und sie mitsamt dem Wissen um Gott und die Kräfte der Natur an die folgenden Generationen weitergegeben. Sie haben aus ihrem Verhältnis zum Schöpfergott und zur Natur Regeln abgeleitet, die ein menschliches Leben in Frieden ermöglichen.
Aus einem solchen Grundmuster ergeben sich drei Dinge:
- Die Sterbenden treten in den Rang der Ahnen ein,
- die Alten sind die Hüter der Tradition, und
- die Tradition ist unangreifbar.
Die Sterbenden steigen auf in den Rang der Ahnen. Sie sind Fürsprecher oder Rächer der Lebenden, kennen deren Gewohnheiten, Vorlieben und Schwächen. Ihr Wohlwollen hängt vom Verhalten der Lebenden ab, von ihren Opfergaben, der Treue in den rituellen Vorschriften und der Einhaltung des Verhaltenskodex der Ahnen. Die Verstorbenen können auf diese Weise für die Lebenden bei den Gründerahnen, den Geistern und Göttern und beim Schöpfergott eintreten und ihr Schicksal mitbestimmen, was sich in der Wirkungsweise der Naturkräfte und -gewalten, im persönlichen Lebensweg mit Gesundheit und Krankheit, Kinderreichtum, Erfolg und Wohlstand oder aber Armut und Unglück ausdrückt. So sind die Ahnen in vielen Gesellschaften zu den Angelpunkten des Lebens geworden: Man ruft sie an, man bespricht sich mit ihnen, bittet sie um Rat, beachtet ihre Normen. Von den Lebenden stehen die Ältesten den Ahnen am nächsten. Die wichtigste Position haben die Alten inne, deren Abstammungsgruppe dem Gründerahn am nächsten steht. Dies ist häufig der Chief und seine Familie. Wie die Ahnen werden auch die Chiefs und die Alten mit besonderer Hochachtung behandelt: Sie verkörpern in sich das Wissen um die Ahnen und ihre Macht, stehen in ständigem Kontakt mit ihnen und können deshalb den Willen der Ahnen am besten interpretieren.
Die Alten, als Hüter der Tradition, sind so die Machtträger in der Gesellschaft, sind letztlich unangreifbare Autoritäten. Die Verhaltensregeln und Hierarchien in der Gesellschaft drücken ihrerseits den Willen der Ahnen aus und die positiven Erfahrungen, welche die Gemeinschaft mit der Befolgung dieser Normen gemacht hat. Was aus der Tradition heraus legitimiert ist, erhält auf diese Weise den Charakter des Heiligen und Unumstößlichen, wird zur Norm des Handelns und Denkens."
[Harding, Leonhard: Geschichte Afrikas im 19. und 20. Jahrhundert. -- München : Oldenbourg, ©1999. -- (Oldenbourgs Grundriss der Geschichte ; Bd. 27). -- ISBN 3486562738. -- S. 143f. ]
Dass diese Einstellung zu den Ahnen und zur Tradition dazu führt, dass ständig aus bestimmten Interessen heraus "Traditionen" manipuliert bzw. auch schlichtweg erfunden werden, ist nur allzu menschlich.
Es ist wichtig, zu unterscheiden zwischen:
So ist zum Beispiel ein Kind in einer patrilinealen (nur über männliche Vorfahren bestimmten) Gesellschaft über Abstammung nur mit seinem Vater, Vatersvater, Vatersvatervater usw. verbunden, nicht aber mit seiner Mutter, Muttersvater, Vatersmutter usw. Über die Filiation ist das Kind aber auch mit seiner Mutter verbunden (es ist seine Mutter und nicht eine x-beliebige Frau!). In einlinigen Verwandtengruppen spielt Abstammung vor allem im Bereich von Politik (Macht), Recht, Sitte die Hauptrolle, während Filiation im häuslichen und emotionalen Bereich von großer Bedeutung ist. Sowohl Abstammung als auch Filiation können verschiedene Folgen rechtlicher, wirtschaftlicher, moralischer oder verhaltensbestimmender Art haben; die Bildung von Verwandtschaftsgruppen ist nur eine mögliche Folge.
"Auch die Legitimationsbasis des afrikanischen Gemeinwesens ist nicht immer formalisierte Volkssouveränität. Macht, Durchsetzungsvermögen, militärische Stärke oder Intrige auf der einen Seite, der Anspruch, die Sicherheit und Wohlfahrt der Untertanen sichern zu können und dazu über die nötige magische Kraft zu verfügen, auf der anderen begründen in vielen Fällen die Legitimität. Aber oft spielen Verwandtschaftskriterien eine entscheidende Rolle, d.h. die im allgemeinen Konsens akzeptierte Legitimation durch Abstammung. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass eine Gemeinschaft neben den aktuellen Mitgliedern auch die schon verstorbenen umfasst. Die Vorfahren, allen voran der Gründerahn, die Geister und die Götter wirken zusammen und beeinflussen das Wohlergehen der gesamten Gruppe. Ihre Leitung ist das Bindeglied zwischen den Lebenden und den Ahnen, d.h. sie vertritt die Lebenden gegenüber den Ahnen und vermittelt deren Wünsche an die Lebenden; sie ist durch diese Verbindungslinie legitimiert und gleichzeitig durch sie gebunden. Einen Anspruch auf die Ausübung dieser Funktion hat derjenige, der in der Abstammungslinie dem Gründerahn der Gemeinschaft am nächsten steht. Als Vertreter der Ahnen muss der "Herrscher« ihre ganze Kraft verkörpern, er besitzt die force vitale seiner Gemeinschaft.
Dies legitimiert ihn, stellt seine Regierungszeit aber auch unter hohe Anforderungen und entzieht ihm die Beauftragung durch die Ahnen, wenn er altert oder Zeichen von Krankheit und Schwäche zu erkennen gibt.Die doppelte Legitimation von Herrschaft, durch Abstammung und Bewährung, ist durchaus auf die Souveränität des Volks zurückzuführen, wobei Volk hier für Gemeinschaft im generationenübergreifenden Sinne steht, als Hüter der Tradition."
[Harding, Leonhard: Geschichte Afrikas im 19. und 20. Jahrhundert. -- München : Oldenbourg, ©1999. -- (Oldenbourgs Grundriss der Geschichte ; Bd. 27). -- ISBN 3486562738. -- S. 131f. ]
Verwandtschaftsbeziehungen sind nicht identisch mit biologischen Zeugungsbeziehungen; sonst würden ja Verwandtschaftsbeziehungen bei allen Menschen gleich sein. Schon auf der elementarsten Ebene muss man unterscheiden zwischen:
soziale Eltern: mater und pater
als biologische Eltern angesehene Eltern: genetrix und genitor (hängt u.a. von den jeweiligen Vorstellungen über Zeugung und Entstehung neuen menschlichen Lebens zusammen)
wirkliche biologische Eltern, d.h. diejenigen, deren Ei bzw. Samen zur Entstehung des neuen Menschen zusammenwirkten
Verwandtschaft kann sein
biologisch, durch Fortpflanzungsverhalten begründet
rein sozial:
Verwandtschaft durch Heirat
Verwandtschaft durch Adoption bzw. Pflegekindschaft
Verwandtschaft durch Surrogatzeugung:
Kinder, die ein anderer Mann gezeugt hat, die aber als eigene Kinder des Ehemannes angesehen werden nach dem Grundsatz: "Wem das Feld gehört, dem gehört das darauf gewachsene Getreide unabhängig davon, wer gesät hat."
Levirat: bzw. Sororat: Verpflichtung zur Zeugung von Nachkommen für ein verstorbenes Geschwister
Frauenehe: eine Frau "heiratet" eine andere Frau und wird damit Mutter von all den Kindern, die diese Frau von einem Mann bekommt
Geisterehe: "Heirat" mit jemand kinderlos Verstorbenem, der dann Elter aller Kinder wird, die die lebende Braut bzw. der lebende Bräutigam von einem lebenden Partner erhält
Kinder von einem Samenspender bzw. einer Eispenderin
Verwandtschaft durch Patenschaft oder andere rituelle Beziehungen
Verwandtschaft hat verschiedene Aspekte:
kategorische Aspekte: Verwandtschaftsbezeichnungen und Verwandtschaftsklassifikationen
Aspekte von Recht, Moral und Brauch (Sitte): Regeln und Normen für Verhalten zwischen und von Verwandten
Aspekte des Verhaltens: das tatsächliche Verhalten zwischen und von Verwandten
Verwandtschaft ist zwar ein wichtiges soziales Ordnungsprinzip, aber wohl nie das einzige.
In der wissenschaftlichen Behandlung von Verwandtschaft gibt es historisch gesehen drei verschiedene Weisen des Zugangs:
Abstammungstheorie
Allianztheorie
kulturelle Sichtweise
Verwandtschaftspraxis
Die Abstammungstheorie sieht Verwandtschaft in erster Linie im Lichte von Abstammungslinien (Eltern -- Kinder). Wichtigste Vertreter sind die Völkerkundler A. R. Radcliffe-Brown (1881 - 1955), Meyer Fortes (1906 - 1983) und Jack Goody (1919 - ). Eine wichtige Unterscheidung bei dieser Betrachtung ist:
Verwandtschaft durch Abstammung (Blutsverwandte)
agnatische Verwandtschaft: Verwandte durch Abstammung von einem gemeinschaftlichen Vorfahren durch nur männliche (jeweils väterliche) Linie
uterine (maternale) Verwandtschaft: Verwandte durch Abstammung von einem gemeinschaftlichen Vorfahren durch nur weibliche (jeweils mütterliche) Linie
cognatische Verwandtschaft: Verwandtschaft aufgrund der Abstammung sowohl in mütterlicher als auch väterlicher Linie
Auch bei agnatischer oder uteriner Verwandtschaft ist die jeweils andere Verwandtschaftslinie nicht ohne Bedeutung: Heirat verbindet auch durch Blutsverwandtschaft verschiedene Verwandtschaftsgruppen
Verwandtschaft durch Heirat (angeheiratete Verwandte)
unilineare (unilineale) Abstammung: Zugehörigkeit zu Abstammungsgruppe nur durch mütterliche bzw. väterliche Linie:
matrilineale (matrilineare) Abstammung: Zugehörigkeit zu Abstammungsgruppe nur durch jeweils weibliche Vorfahren
patrilineare (patrilineale) Abstammung: Zugehörigkeit zu Abstammungsgruppe nur durch jeweils männliche Vorfahren
Man muss aber beachten, dass keine Gesellschaft in jeder Hinsicht durch nur ein einziges Abstammungsprinzip beherrscht wird. Man muss also angeben, in welcher Hinsicht patrilinear bzw. matriliear:
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. zu Lineage)
Erbe für Besitz und Eigentum
Nachfolge in bestimmtem Titel oder Amt
ambilineale (ambilineare) Abstammung: Zugehörigkeit zu Abstammungsgruppe entweder durch väterliche Linie oder durch mütterliche Linie
bilineale (duolineale, doppelte unilineale) Abstammung: Zugehörigkeit zu sowohl einer mütterlichen als auch einer väterlichen Abstammungsgruppe
Zur besseren Übersicht bei Verwandtschaftsbeziehungen verwendet man graphische Symbole. Die wichtigsten zeigt folgende Graphik:
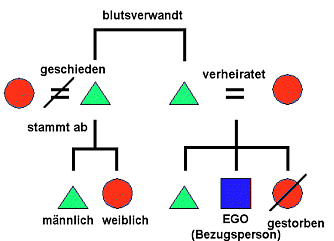
Abb.: Symbole der Darstellung für Verwandtschaft
Die Allianztheorie sieht Verwandtschaft (und hier wieder besonders Heirat) in erster Linie als Prinzip, das die Gesellschaft durch Austausch strukturiert: der Austausch von Bräuten bzw. Bräutigamen schafft Allianzen (Bündnisse und Verbindungen) zwischen Gesellschaftsgruppen (Familien usw.). Hauptvertreter der Allianztheorie sind die Völkerkundler Claude Lévi-Strauss (1908 - ), Louis Dumont (1911 - ), Edmund R. Leach (1910 - 1989) und Rodney Needham (1923 - )
Die kulturelle Sichtweise von Verwandtschaft betrachtet das Ineinanderspiel von biologischen, kulturellen und sozialen Faktoren bei Verwandtschaftsbeziehungen, z.B. was man alles als notwendig findet für das Enstehen eines neuen Menschen (z.B. Geschlechtsverkehr + richtiger Zeitpunkt + Person, die wiedergeboren werden muss)
Eine weitere Betrachtungsweise von Verwandtschaft betont die Verwandtschaftspraxis, da die offiziellen Regeln (die "Sonntagsmoral") oft von der tatsächlichen Praxis abweicht. So werden z.B. Oberschicht-Inder im Normalfall von sich behaupten, dass für sie Kaste bedeutungslos sei. Wenn es aber zur Suche nach einem Bräutigam für ihre Tochter kommt, zeigt sich, dass die Auswahl faktisch noch ganz nach dem alten Kastenmuster verläuft.
Nur kurz kann hier darauf hingewiesen werden, dass die Möglichkeiten der neuesten Medizin vermutlich zu einem Umdenken inbezug auf Verwandtschaft führen werden:
Samenspender
Eispenderin
Leihmutter
sind neue Verwandtschaftsbegriffe.
Die Möglichkeiten der Vaterschaftsbestimmung durch DNA-Analyse führen zu einer Gewissheit bezüglich des biologischen Vaters wie sie früher nur bezüglich der biologischen Mutter möglich war.
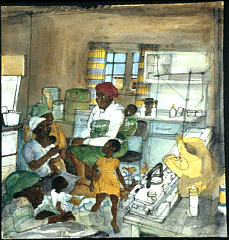
Abb.: Franklin McMahon: "South African family at home" (©Corbis)
Wir alle glauben zu wissen, was eine Familie ist. Doch bei näherem Hinsehen, erkennen wir, dass der Begriff "Familie" keineswegs eindeutig ist:
"Deshalb muss man, wenn man sich eingehend mit der Familie beschäftigen will, erst einmal einige Klarheit darüber schaffen, was eine Familie überhaupt ist. Das Wort ist im täglichen Sprachgebrauch mehrdeutig: Spricht jemand von seiner Familie, so kann er damit die Angehörigen seines engsten Haushalts meinen, aber auch einen ganzen Clan samt Großeltern und entfernten Vettern -- oder sogar eine vierhundertjährige Abfolge von Generationen. Insofern sind alle Verallgemeinerungen über die Familie gefährlich. Eine Möglichkeit, zu einer Definition zu gelangen, besteht darin, diejenigen Funktionen auszusondern, die sich zwar in einigen, aber nicht in allen Familien finden.
- Man geht im allgemeinen davon aus, dass eine Familie auf der Blutsverwandtschaft zwischen Eltern und Kindern beruht; das trifft in der Regel zu. Aber in fast allen Gesellschaften gibt es die Möglichkeit der Adoption von Kindern, die aus ganz anderen Verhältnissen kommen können als ihre Pflegeeltern und dennoch als ihre Nachkommen und Erben betrachtet werden. Daraus ergibt sich, dass die Blutsverwandtschaft kein entscheidender Bestandteil der Familie ist.
- Dass Eltern und Kinder eine gemeinsame Wohnung haben, ist in den meisten Familien üblich, aber durchaus nicht in allen. Die Anthropologin Ruth Benedict berichtet, dass bei einigen Völkern in Neuguinea die Mutter von ihrem Ehemann getrennt lebt und dieser sie verstohlen zu Hause oder im Busch besucht. Die Kinder werden unter Aufsicht der Familie ihrer Mutter erzogen; sie wissen zwar genau, wer ihr Vater ist, bekommen ihn aber kaum zu Gesicht. In anderen Kulturen kann der Ehemann fast ständig abwesend sein, etwa wenn er Seemann ist oder Handelsvertreter; die Kinder können in Internaten leben; in früheren Jahrhunderten wurden sie nicht selten vom Tag ihrer Geburt an von Ammen aufgezogen.
- In der Vergangenheit bildete die Familie eine wirtschaftliche Einheit, die sich fast selbst unterhalten konnte. Auf dem Lande, wo bis vor einigen Generationen die meisten Menschen lebten, arbeiteten Eltern und Kinder gemeinsam für die Beschaffung des Lebensnotwendigen. In der modernen Industriegesellschaft dagegen erzeugt die Familie Nahrung, Kleidung und Werkzeug nicht mehr selbst. Mann, Frau und heranwachsende Kinder können völlig unterschiedlichen Berufen nachgehen; zwar kommen die Einkünfte der Eltern fast immer wenigstens zum Teil in einen Topf, aber die Familie ist keine straffe wirtschaftliche Einheit mehr: Erzeugung und Verbrauch sind nicht mehr gekoppelt.
- Man geht im allgemeinen davon aus, dass die Familien eine, wie die Soziologen es nennen, "affektive Funktion" erfüllen, ob sie nun, im besten Fall, ein Born der Liebe sind oder lediglich ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln. Eine typische Familie bildet in der Regel eine festgefügte Einheit, in der jeder Angehörige einigen Trost und Schutz vor den unerwarteten Gefahren der Außenwelt findet. Sie entwickelt ihre eigenen Abwehrkräfte, ihre Eigentümlichkeiten und Besonderheiten, die ihre Angehörigen von anderen Leuten unterscheidet; all das trägt dazu bei, sie gefühlsmäßig in einer Art nestwarmer Verschwörung aneinander zu binden. Häufig hat eine Familie ihre privaten Scherze, ihre privaten Rituale, ihre privaten Mythen, an denen nur die Familienmitglieder teilhaben können. Die meisten Menschen hegen die tiefsten und dauerhaftesten Gefühlsbindungen zu ihren Angehörigen; wenn sie von Unheil betroffen sind, wenden sie sich an die Familie. "Zuhause ist der Ort, wo man dich aufnehmen muss, wenn du hinkommst", sagt Robert Frost.
Dennoch gilt in einigen Kulturen die Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau nicht als wesentliches Element der familiären Beziehung. Selbst in der westlichen Welt, in der die Liebesheirat das Ideal darstellt, gibt es, wie jedermann weiß, in vielen Ehen mehr Hass als Zuneigung. Einige Experten schätzen, dass allenfalls in 25 Prozent aller amerikanischen Ehen eine befriedigende emotionale Atmosphäre herrscht, und die Soziologen sprechen von "Fassadenfamilien", wenn die Angehörigen weiter beisammen leben, auch wenn kaum Gefühlsbindungen und vielleicht sogar keinerlei Kommunikation zwischen ihnen bestehen.
- Manche Familien erfüllten in der Vergangenheit noch weitere Funktionen und erfüllen sie noch heute. Sie können religiöser Art sein wie zum Beispiel im alten Rom, wo der Vater in jedem Haushalt zugleich eine Art Priester und dafür verantwortlich war, dass es den Hausgöttern nicht an Verehrung fehlte. In Teilen des Orients steht noch heute der Ahnenkult im Mittelpunkt des Familienlebens; man ehrt die Menschen, die das Geschlecht in weit zurückliegender Zeit begründeten. Freilich sind religiöse Funktionen solcher Art überall im Niedergang begriffen. In der Durchschnittsfamilie der westlichen Welt gibt es nur spärliche Überreste von Ritualen - man spricht bei Tisch ein kurzes Gebet oder stellt einen Weihnachtsbaum auf. Allem Anschein nach kann die Familie auch überleben, wenn sie keine religiöse Einheit darstellt.
- Auch politische Funktionen braucht sie nicht zu haben, obwohl sie sie in vielen Gegenden der Welt noch hat. In Feudalgesellschaften können Familien zusammen mit ihrem Besitz auch Ehren und Staatsämter vererben. Angehörige großer Adelsfamilien in England hatten Generation um Generation hohe Staatsämter inne: ... Selbst in den Vereinigten Staaten, in einer besonders stark individualisierten Gesellschaft, kennen Politiker durch Familien gebildete Wahlblocks. Dennoch können überall in der modernen Welt Männer und Frauen, Eltern und Kinder eine harmonische Familie bilden, ohne der gleichen politischen Partei angehören zu müssen.
Was bleibt, nachdem alle Funktionen ausgeschieden wurden, die nicht zum Wesensbestand der Familie gehören? Nur dies: Eine Familie ist eine kleine Gruppe von Menschen, die sich durch dauerhafte Bande miteinander verbunden fühlen und die Verantwortung für das Aufziehen von Kindern auf sich nehmen.
Für die Kinder erfüllt die Familie zwei entscheidende Funktionen.
- Einmal sorgt sie für sie in leiblicher Hinsicht, damit sie nicht sterben, sondern gesund und kräftig heranwachsen.
- Zum zweiten sorgt sie dafür, dass sie sich aus bloßen biologischen Organismen in menschliche Wesen verwandeln, die ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen können, in die sie hineingeboren wurden.
- Die erste Funktion ist ohne weiteres zu begreifen und ruht auf einer soliden biologischen Basis. Ein Neugeborenes ist nicht imstande, aus eigenen Kräften zu überleben; der Mensch bleibt länger abhängiges Kind als die Jungen jeder anderen Tiergattung. Erst im Alter von ungefähr sechs Jahren kann er produktive Arbeit leisten, und die volle Verantwortlichkeit des Erwachsenen wird ihm in den meisten Gesellschaften frühestens zu Beginn der Pubertät, zum Teil erst wesentlich später, zuerkannt. Bis das Kind diese Verantwortlichkeit übernehmen kann, ist es auf ältere Menschen angewiesen.
Abb.: Akha Mutter, ihr Kind säugend, Nordthailand (©Corbis)
Das Naheliegendste und Logischste ist, dass die Eltern die Pflege des Kindes übernehmen. .. Dieses Modell hat jedoch keine universale Gültigkeit: Vater und Mutter in einer Familie können auch irgendein Mann und irgendeine Frau sein, denen die Gesellschaft die Elternrolle zuweist. Nur die Rollen an sich sind universal. Ein Kind kann von jedem beliebigen Vater und jeder beliebigen Mutter aufgezogen werden; es müssen nicht unbedingt seine leiblichen Eltern sein, vorausgesetzt, dass sie das Kind als Teil der Familie betrachten und ihm die leibliche und seelische Pflege zukommen lassen, die es ihm ermöglicht, ein Mitglied der Gesellschaft zu werden, zu der sie gehören.
- Die zweite Funktion der Familie, nämlich etwas, das anfangs nicht mehr ist als ein herziges kleines Ding aus Fleisch und Blut, in einen Menschen im wahren Sinne des Wortes zu verwandeln, ist wesentlich vielschichtiger. Die Verhaltensforscher bezeichnen diese Umwandlung als Sozialisation; der Soziologe René König spricht von der "zweiten Geburt" des Menschen. Gemeint ist damit der Prozess der Belehrung und Schulung, durch den die Modelle menschlichen Verhaltens von einer Generation auf die nächste weitergegeben werden. Ohne ihn würden die Kulturen sterben, und die Menschen wären Tiere."
Abb.: Ifugao-Mutter mit Kind, Luzon, Philippinen: das Kind lernt auf dem Rücken der Mutter die Welt kennen (©Corbis)
"So hat es den Anschein, als unterscheide sich der Sozialisationsprozess von Kultur zu Kultur beträchtlich und sei dennoch im Grunde der gleiche: die Methoden sind verschieden, das Ziel jedoch bleibt unverändert: die Heranbildung eines erwachsenen Menschen. Überall ist die Familie eine relativ kleine Gruppe von Leuten, deren Aufgabe es ist, Kinder aufzuziehen. Das ist bisher nur kleinen Gruppen gelungen, obwohl sich größere Gruppen in zunehmendem Maße darum bemühen. Und auf ähnliche Weise leisten solche Gruppen nur dann etwas, wenn es um das Aufziehen von Kindern geht. Von diesem Ziel abgesehen, gibt es für die Familie keine Normen. Die Gruppe kann fast jede Form haben, und sie kann ihre Aufgabe, Kinder heranzuziehen, auf zahllose Arten erfüllen.
Besteht die Gruppe, die eine Familie bildet, nur aus einem Mann, einer Frau und ihren Nachkommen, so bezeichnet man sie als Kernfamilie. Diese Form ist heute in der westlichen Welt am weitesten verbreitet. Haben sich auch Angehörige einer dritten oder vierten Generation der nur zwei Generationen umfassenden Kernfamilie angeschlossen, spricht man von der Großfamilie. Ist die Gruppe noch größer oder anders zusammengesetzt, wird sie Clan, Sippe oder Familienverband genannt; im Mittelpunkt kann eine Mutter stehen oder mehrere, ein Vater oder mehrere, ebenso Onkel, Brüder oder Tanten. Anthropologen und Historiker haben festgestellt, dass es zwei- bis dreitausend Völker gibt, die sich in ihrer Lebensweise hinreichend unterscheiden, um als Träger eigener Kulturen gelten zu können. Und in jeder dieser Kulturen gibt es eigene Ausprägungen des Familienlebens mit eigenen Zielen, Organisationen, Zeremonien, Spannungen und Reaktionen. Unter der Vielzahl von Formen, die das Familienleben auf der ganzen Welt aufweist, nimmt die moderne Familie in der westlichen Welt eine fast exzentrische Sonderstellung ein.
Aber welche Form die Familie auch hat, sie existiert um der Kinder willen, die sie zeugt und aufzieht. Dies erklärt vielleicht die Dauerhaftigkeit der Familie: Sie sorgt für das Fortbestehen der Gattung Mensch."
[Wernick, Robert: Die Familie / von Robert Wernick und der Redaktion der Time-Life-Bücher. -- Amsterdam : Time-Life, ©1976. -- (Menschliches Verhalten). -- S. 9 - 12, 21 (Hervorhebungen von mir)]
"Und trotzdem ist die Institution der Familie mancherorts in größter Gefahr. In den Ländern der Dritten Welt gibt es nämlich eine wachsende Zahl von Menschen, die zu arm und elend sind, um zu heiraten, beziehungsweise, um ein einigermaßen geregeltes Familienleben zu führen. Sie können weder lesen noch schreiben, schlafen auf der Strasse, nähren sich von Abfällen, haben keinen Beruf und keine Adresse, kennen weder ihr Geburtsdatum noch ihren Heimatort. Ein Gang zum Standesamt muss in den 300 Slums von Kalkutta deshalb bereits als ein Zeichen von Wohlstand erscheinen. Die wirklich Armen finden sich irgendwo in einem dunklen Winkel zusammen, hungern eine Weile zu zweit, bekommen vielleicht ein oder auch mehrere Kinder. Doch eines Tages wird es dem Mann meist zuviel, er zieht in ein anderes Slum-Quartier. Oder ein heftiger Monsunregen zwingt die Frau, mit ihrem Baby einen neuen Unterschlupf zu suchen. Vielleicht findet sie dort nochmals einen Partner, bringt nochmals Kinder zur Welt, wird wieder verlassen...
Abb.: Obdachlose schlafen auf Straße Kalkuttas (©Corbis)
«Wenn die Slum-Frauen sich selber überlassen bleiben, haben sie nicht die geringste Chance», sagt Lintoe Chatterty, eine Urenkelin des Dichters Tagore, die im bengalischen Hilfswerk «Topsia» mitarbeitet. «Schenkt man ihnen in der kühlen Jahreszeit eine Decke, so verkaufen sie diese, sobald es warm wird, denn sie können nicht bis zum nächsten Winter denken.» Ebenso wenig können sie mit der Antibaby-Pille umgehen oder gar ihre Kinder zu einem regelmäßigen Schulbesuch anhalten. Dazu müsste man zumindest eine «Hundehütte» besitzen eine aus Blechkanistern, Pappkarton und Bambus gebastelte Notunterkunft, die zu niedrig ist, als dass man in ihr aufrecht stehen könnte.
Viele der obdachlosen Mütter sind schon mit dreißig kraftlos und verbraucht, so dass sie nichts mehr für die Kinder tun können und diese davonlaufen. Viele sterben sehr früh, nicht selten mit einem Baby in den Armen. Die Säuglinge und Kleinkinder der toten Mütter werden von der Polizei eingesammelt und bei Hilfswerken abgeliefert. Die etwas älteren Kinder, vor allem die Knaben, rotten sich zu Gruppen oder Banden zusammen. Sie haben ihre Anführer, ihr Revier, ihre Freunde und Feinde, sie spezialisieren sich in der Regel auf eine bestimmte, mehr oder weniger legale Tätigkeit, zum Beispiel auf Betteln, Lumpensammeln, Stehlen oder Alkoholschmuggel. Besonders die letzte Beschäftigung kann recht lohnend sein, denn in manchen indischen Bundesstaaten besteht strenge Prohibition. Schon Vier- und Fünfjährige werden dort gerne zum Austragen der verbotenen Whiskyflaschen angeheuert. Wenn sie von der Polizei geschnappt werden, kann nicht viel passieren. Vom Auftraggeber wissen sie kaum mehr, als dass er ihnen für den leeren Bauch zwei Chappaties [Fladenbrot] versprochen hat; die Empfänger aber können leicht behaupten, der Kleine müsse sich in der Adresse geirrt haben.
Im Netz der Staatsgewalt bleibt nur das kleinste Fischchen hängen. In Bombay gibt es daher ein großes Knabengefängnis, in dem fast ausschließlich minderjährige Alkoholschmuggler sitzen. Für die schuldigen Buben fast ein Glücksfall, denn endlich haben sie einen trockenen Schlafplatz und ausreichend Nahrung, sie erhalten im Gefängnis sogar einigen Unterricht. Kein Wunder, dass sie zwischen den grauen Mauern so fröhlich herumtollen, als wären sie in einer Ferienkolonie."
[Kinder unserer Welt / Charlotte Peters, Kurt Ulrich, Rolf D. Schürch, Michael Merz. -- Neuenburg : Avanti, ©1984. -- S. 48 - 50]
Zu einem Stamm gehören alle, auch noch so weit miteinander entfernt Verwandten. Sie gehen auf einen sehr weit entfernten Urahn zurück, der eigentlich fast schon in der geistigen Welt angesiedelt ist.
"Als Stamm bezeichnet
- der Historiker in der europäischen Geschichte eine durch Sprache und Brauchtum zusammengehaltene Siedlungsgemeinschaft,
- der Ethnologe eine homogene und in politischer und sozialer Hinsicht autonome Gruppe, die ihr eigenes Territorium bewohnt.
Die in beiden Definitionen genannte Struktur der Homogenität und die mitgemeinte Konnotation der verwandtschaftlichen Bande als Ordnungskriterium werden in der neueren Forschung für Afrika zunehmend in Frage gestellt, nachdem deutlich geworden ist, dass viele Stämme eine Kreation der Kolonialzeit und der Kolonialmächte sind, die zur leichteren Regierbarkeit einheimische Herrschaftsbereiche mit eigenen Traditionen sowie eigenem Bewusstsein brauchten. In Wirklichkeit aber erfolgte die Identifikation der Menschen nach mehreren gleichzeitigen oder wechselnden Kriterien der verwandtschaftlichen oder sprachlichen Zusammengehörigkeit, der geographischen Nähe, der politischen Unterordnung bzw. Schutzsuche, der religiösen Überzeugung, der ökonomischen Absicherung, der Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationen oder Gruppen und vielen anderen. Deshalb waren diese Identifikationen auch einem ständigen Wandel unterworfen. Gruppen bildeten sich schnell, die Zugehörigkeitsgrenzen verschoben sich häufig, ebenso ihre Ursachen. Gruppen lösten sich auf, gingen in größeren Bezugsrahmen/Herrschaftsbereichen auf oder behielten einige Eigenheiten bei.
Kurz, viele Gesellschaften waren bis zur Kolonialzeit beweglicher, weniger uniform und fixiert als europäische Gesellschaften. Der Begriff Stamm für eine solche sich kontinuierlich verändernde, neu formierende Gruppe mit wechselndem Selbstverständnis hilft also bei der Beschreibung afrikanischer Gesellschaften nicht weiter. Er fixiert vielmehr Entwicklungen, bricht sie ab und interpretiert sie aus einer statischen Fremdperspektive. Allerdings sind in dem Prozess des Zusammenwirkens von Kolonialmächten, Missionen, afrikanischen Intellektuellen und Herrschaftsträgern auch stammesmäßige Identitäten und stammesmäßiges Selbstbewusstsein entstanden.
Die Ausweichbegriffe Ethnie oder Volk für eine Gruppe von Personen, die derselben Kultur angehören, stellen nur Hilfskonstruktionen dar, die dem Problem inhaltlich nicht gerecht werden. Sie legen ein einzelnes Kriterium der Zugehörigkeit zugrunde. Dennoch bedient man sich heute vielfältig dieser Termini, um den Begriff Stamm zu vermeiden, der zunehmend als diskriminierend empfunden wird. Dem steht nicht entgegen, dass manche afrikanische Politiker und Journalisten weiterhin von Stämmen sprechen, um Unterschiede in der Bevölkerung zu markieren. Allerdings geschieht dies häufig im Zusammenhang von internen Konflikten oder von Wahlkampfsituationen, in denen Vereinfachungen, aber auch der Appell an Gemeinsamkeiten zur Mobilisierung von Anhängern üblich sind."
[Harding, Leonhard: Geschichte Afrikas im 19. und 20. Jahrhundert. -- München : Oldenbourg, ©1999. -- (Oldenbourgs Grundriss der Geschichte ; Bd. 27). -- ISBN 3486562738. -- S. 136. ]

Abb.: Nelson Mandela begrüßt einen "tribal chief" in Soweto, 1990 (©Corbis)
"Unter "Häuptling" (chief, chef) oder Häuptlingstum (chiefdom, chefferie) versteht man nicht einfach einen traditionellen Herrscher und seinen Machtbereich oder einen 'Stammesherrscher', der in unkontrollierter Willkür Macht ausübt, sondern im Unterschied zu einem König eine Person, die über eine im weitesten Sinne des Wortes verwandtschaftlich bestimmte größere Gruppe politische Autorität ausübt. Weil sich die Macht des Häuptlings also auf seine Verwandtschaftsgruppe begrenzt und die Organisation ihres Überlebens zum Inhalt hat, basiert sie auf un orde symbolique de la parenté et des échanges matrimoniaux. Dabei greift sie weniger auf eine Fachbürokratie als auf Personen im eigenen Umkreis und auf persönliche Herrschaftsformen zurück. Die Herrschaft erstreckt sich nicht auf alle Bereiche, die in einem Staatswesen von der politischen Macht erfasst werden. Wegen des verwandtschaftlichen Grundmusters dieser Gesellschaften beschränkt sich die Macht eines Häuptlings auf die Belange, welche die Autorität der kleineren Familieneinheiten überschreiten und alle Mitglieder der Gemeinschaft angehen. Sie konzentriert sich auf die Redistribution von Gütern sowie die Reproduktion der Gesellschaft durch Heiratsalliancen. Der Häuptling findet seine Legitimation zur Herrschaft -- in den Kategorien von Max Weber -- in der Tradition, d.h. in der in Generationen gewachsenen Überzeugung, dass der Älteste aus der Abstammungslinie des Gründerahnen dessen Erbe als Verwalter der gesamten Gemeinschaft weiterführen soll und dazu von den Ahnen berufen ist. Seine Macht findet in der Überlieferung auch ihre Grenzen, indem Ältestenräte oder andere Kontrollinstanzen das Verhalten des Machtträgers an der Tradition messen. Weil es in der afrikanischen Wirklichkeit aber eine sehr große Bandbreite unterschiedlich straff organisierter, mit unterschiedlichen Kompetenzen ausgestatteter und von verschiedenem Selbstverständnis getragener Häuptlinge und Häuptlingstümer gegeben hat, bleibt auch dieses Konzept so mehrdeutig, dass es im Einzelfall der Klärung bedarf." [Harding, Leonhard: Geschichte Afrikas im 19. und 20. Jahrhundert. -- München : Oldenbourg, ©1999. -- (Oldenbourgs Grundriss der Geschichte ; Bd. 27). -- ISBN 3486562738. -- S. 134f. ]
Zunächst eine Mahnung zur Vorsicht im Umgang mit dem Begriff "Tribalismus":
"Noch weniger hilfreich [als der Begriff Stamm] ist Tribalismus, ein Begriff, mit dem Konflikte in oder zwischen afrikanischen Gesellschaften als Stammeskonflikte oder Stammeskriege erklärt werden. Dass Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen auftreten können, wird von niemandem geleugnet. Die Frage ist nur, wo deren Ursachen liegen, ob sie von der ethnischen Zugehörigkeit ausgehen, ob sie überhaupt damit zusammenhängen oder ob streitende Parteien sich lediglich zur Gruppensolidarisierung in primär politisch oder ökonomisch motivierten Auseinandersetzungen ethnischer, sprachlicher oder religiöser Schlagwörter bedienen. Letzteres scheint der Regelfall zu sein, wie der Biafra-Krieg, die Machtkämpfe zwischen schwarzen Gruppen in Südafrika und vor allem der Völkermord in Ruanda gezeigt haben." [Harding, Leonhard: Geschichte Afrikas im 19. und 20. Jahrhundert. -- München : Oldenbourg, ©1999. -- (Oldenbourgs Grundriss der Geschichte ; Bd. 27). -- ISBN 3486562738. -- S. 136f. ]
"Vielleicht mag etwas vom Renommee Afrikas als Kontinents der »Stämme« und des »Tribalismus« auf den Umstand zurückgehen, dass auch seine politische Geschichte zu einem weit größeren Anteil als die Geschichte etwa des Balkans oder Zentralasiens von Ethnographen geschrieben wurde. Dieser Umstand ist seinerseits historisch bedingt und zunächst der Sache äußerlich. ... Außer der späten Öffnung zur Außenwelt sind es Fülle und Vielfalt an Stoff, was dem großenteils wenig wirtlichen und dünn besiedelten Makrokosmos südlich des Mittelmeers das moderne ethnologische Interesse an zeitloseren Aspekten der conditio humana eingebracht hat.
Abb.: König der Calabar, Nigeria (©Corbis)
Versuche einer Zählung von Afrikas ethnischen Gruppen wären absurd. In Äthiopien werden aufgrund von linguistischen Kriterien etwa 70 Völkerschaften unterschieden, in Kenia spricht man von 40, aber schon die Luyia mit vielleicht fünfzehn Prozent der Bevölkerung zählen siebzehn Stämme, für deren Identität und Differenz immerhin ein Endogamieverbot aufkommt. Ein wissenschaftliches Kartenwerk identifiziert allein in Nigeria 395 Sprachen, was einer entsprechenden, aber noch keineswegs vollzähligen Menge ethnischer Gruppen entspricht. Im Nachbarstaat Kamerun, der etwa ein Achtel der Bevölkerung Nigerias beheimatet, werden ungefähr 200 Sprachen gezählt. Ein offiziöses Who's who schätzt die Anzahl von Zaires Ethnien auf 450, und eine länderkundliche Monographie, welche sie namentlich auflistet, weist rund 320 Volksgruppen rund 80 größeren Familien zu, was wiederum etwa mit der linguistischen Vielfalt korrespondiert. Das Orakel eines Handlexikons gibt -- bei 2500 bis 3500 lebendigen und überlieferten Sprachen weltweit -- als Gesamtzahl der afrikanischen Sprachen die runde Ziffer von 1000. Diese Schätzung setzt tief an. Anthropologen gehen davon aus, dass die genetische Vielfalt der Gattung etwa zur Hälfte auf Afrika entfällt.
Die Ethnologie mahnt zu Recht, Termini wie Nation, Stamm und Clan nicht in jedem Kontext austauschbar zu verwenden. Allzuweit gelangt sie nicht über den Duden hinaus, der unter »Stammesbewusstsein« auf »Nationalbewusstsein« verweist. Die Ethnologie kann vor Mehrdeutigkeiten warnen. Ein Begriff wie Stamm und seine Komposita, die implizit einen Gesellschaftstypus charakterisieren und zugleich ein Entwicklungsstadium anzeigen, begünstigen unzulässige Schlüsse vom einen auf das andere. In den Anfängen der Völkerkunde -- etwa zur Zeit Karl Mays -- schien der Begriff Stamm beinahe definiert. Er stand für eine Vorstellung primitiver Miniaturgesellschaften quasi ohne Kontakt zur Mitmenschheit, für Assoziationen von »Wilden«, die es seit geraumer Zeit nirgends mehr gibt. Wer darüber unterrichtet ist, mag mehr geneigt sein, mit der Wortwahl Ethnie oder ethnische Gruppe einer Belangung für den weltanschaulichen Ruch von Archaismen wie Stamm -- oder auch nur einem Naivitätsverdikt -- vorzubeugen. Doch diese Sensibilität mit ihrem eurozentrismuskritischen Zeigefinger führt kaum weiter. In Afrika heißt der Gegenstand der Debatte auch im gebildeten Volksmund tribe, oder tribu, tribalism oder tribalisme. Dass damit nur zu Vertrautes gemeint ist, unterliegt keinem Zweifel.
Chinua Achebe [geb. 1930], der nigerianische Schriftsteller, erinnert sich daran, wie das souveräne Nigeria zur Geburtsstunde -- nach der Feder einer britischen Lady -- die neue Nationalhymne sang:
»Though tribe and tongue may differ
In brotherhood we stand!«Ein »höchst ominöser Beginn«, wie Achebe anmerkt. Der Biafra-Krieg mit einer Million Todesopfern bescherte der »größten schwarzen Nation« schließlich nochmals eine neue Hymne, deren einheimischer Autor vor dem Wort tribe gewarnt war. Doch in der Politik hat sich, schließt Chinua Achebe, die Ächtung von Worten meist als vergeblich erwiesen, denn: »A word will stay around as long as there is work for it to do.«
Was wäre demnach -- falls das Anschauungsmaterial im Balkan nicht genügt -- ein Stamm? »Ethnische Einheit, die Menschen gleicher Sprache und Kultur sowie mit gemeinsamem Siedlungsraum umfasst«, gibt das oben zitierte Handlexikon an. Wie das Beispiel der kenianischen Luyia zeigt, kann eine Sprachgemeinschaft auf ihre tribale Untergliederung mehr Gewicht legen als auf ihre Einheit, die ihr nicht selten -- wie auch im Falle der Luyia -- ursprünglich von außen attestiert worden ist. Besser bekannt ist das Beispiel der Hutu und Tutsi, die zwar einträchtig die nahe verwandten Nationalsprachen Rwandas und Burundis sprechen, sich aber dennoch als äußerst distinkt wahrnehmen und, was die Zahlen der Opfer betriff. in der jüngeren Chronik von Afrikas ethnischen Konflikten eine herausragende Stellung einnehmen. Sprache gibt gewöhnlich ein zureichendes, aber kein notwendiges ethnisches Unterscheidungskriterium.
Ein Merkmal, das gegenüber dem weitergefassten Begriff der Ethnie jenen der stammesartigen Gruppe spezifizieren und solche Gemeinschaften in gewissen Fällen etwa von Nationalitäten unterscheiden kann, liegt in dem hohen Grad an Immunität, welchen die gemeinsame Identität als politische Loyalitätsbasis gegen die spaltenden Kräfte sozialer Schichtung aufrechtzuerhalten vermag. Damit ist ein Element gesellschaftlicher und politischer Autonomie im Blick, das in Afrika sowohl im Verhalten dominanter Gruppen wie auch in der Stoßrichtung von Gefolgschaftsverweigerung und Widerstand immer wieder unverkennbar zutage tritt. In beiden Fällen handelt es sich um einen Aspekt, der von den »Stämmen« des Kontinents rasch zu seinen Problemen führt. Hinweise auf jenes Element von Autonomie greifen oft -- wenn auch nur per negationem -- auf den Begriff des Staates zurück, führen aus, was Stammesgesellschaften kennzeichne, seien nichtstaatliche Organisationsformen, und fügen etwa hinzu, mit dem Bestand solcher Gesellschaftsformen sei staatliche Präsenz nicht vereinbar.
Diese ethnologische Trouvaille eines spezifisch afrikanischen Antagonismus zwischen Gesellschaft und Staat gibt der politischen Analyse Hinweise. Mehr als vielleicht der politische Begriff des Tribalismus legen scheinbar neutral beschreibende Wortbildungen wie Stammesproblem oder auch ethnischer Konflikt -- ob präzis oder vage -- die Vorstellung nahe, in Afrika treffe der Staat auf ein präexistentes gesellschaftliches Substrat besonderer Art: auf das präexistente Konfliktpotential der Stämme. Scheitert unter solchen Voraussetzungen der Staat, in seinen Wohltaten womöglich noch offenkundiger als in seinen Untaten, dann lägen demnach die Ursachen zutage und weit weniger bei ihm als bei der Gesellschaft.
Bei ihrer Entlassung in die Unabhängigkeit kannten die meisten Länder des Kontinents keinen präkolonialen Vorgänger der neuen zentralen Verkörperung ihrer Souveränität. Es handelt sich bei den modernen afrikanischen Staaten bekanntermaßen um eine importierte, zwielichtige Erbmasse. Von besonderen Fällen abgesehen, war die so oft beschworene koloniale Grenzziehung für die weiteren Geschicke der ehemaligen Besitzungen von weit geringerer Bedeutung als andere Voraussetzungen. Afrikas demographische Heterogenität und die Intensität der Migration müssten jede Grenzziehung als willkürlich erscheinen lassen. Außerdem kranken die kleinsten Länder an den gleichen Gebrechen wie die größten, und der Sprengstoff von zwei Ethnien kann an den von zweihundert heranreichen.
Der geerbte Staat litt, entgegen einem ebenso häufig vorgetragenen Glaubenssatz, auch weniger unter dem Manko einer organisch gewachsenen Nation als unter seinen unvermittelten Bestrebungen, sich ein solches Fundament nachträglich unterzuschieben. Auf dem Kontinent der Stämme kaschierte Nationalismus oft schon bei den Befreiungsbewegungen ideologische Falschmünzerei oder auch nur ein Selbstmissverständnis, worin kaum weniger gefährliche usurpatorische Neigungen schlummerten. Motivation und Legitimation der Unabhängigkeitskämpfe waren antikolonial und sozial, national höchstens insofern, als die Metropolen mit ihren Rezepten des divide et impera in den Besitzungen von einer multiethnischen Basis profitierten und daher tribale Partikularismen gern kultivierten. Die Politik der neugeborenen Regime, die dagegen das aus der Westentasche gezauberte Konstrukt der Nation verordneten, stärkte zentrifugale und staatsfeindliche Tendenzen, wo immer sich diese trotz allen Repressalien nicht aus der Welt schaffen ließen. ...
Für eine überwältigende Mehrheit der Afrikaner -- seien es Opfer oder Täter -- repräsentiert bis heute ihr Zentralstaat nur drei Erfahrungen:
- willkürlicher Freiheitsentzug,
- bürokratische Ineffizienz und
- radikale Ausplünderung durch jene besonders partikulären Kräfte, die ihrerseits den Staat repräsentieren.
Trotz der Machtkonzentration in einer faktischen Einheitspartei bedeutet das multiethnische Modell der neuen äthiopischen Führung Meles Zenawis [geb. 1955, Regierungschef 1991 - 1995] einen Fortschritt gegenüber dem parteistaatlichen Monopol auf die »Nation«. Es ist die Absicherung dieses Monopols, welche die Bezeichnung Tribalismus verdient und die darauf abzielt, im staatlichen Namen der Allgemeinheit die übrigen ethnischen Gruppen durch Verleugnung ihrer Existenz zu marginalisieren. Dazu bedarf es keiner administrativen Erfassung tribaler Identität etwa nach rwandischem Muster. Chinua Achebes Definition reicht für das, was er »praktische Zwecke« nennt: »Tribalismus ist Diskriminierung von Staatsangehörigen aufgrund ihres Geburtsortes.« Diese besinnen sich auf die eigene Partikularität, und ihre Reaktion gräbt faute de mieux ethnische Fundamente aus. Den ökonomischen Rahmen bilden oft knappe Ressourcen, deren ungerechte Verteilung die Spannungen entsprechend verschärft.
Ob die Inhaber der Staatsmacht einer ethnischen Minderheit oder der ethnischen Mehrheit angehören, ist gewöhnlich von untergeordneter Bedeutung. Machterhaltung einer Minderheit kann einerseits massivere Repression, andererseits vielfältigere Rücksichten und feineres Fingerspitzengefühl verlangen. In vielen afrikanischen Ländern gibt es keine ethnischen Mehrheiten, nur größere und kleinere Minderheiten. Ein Beispiel wie Rwanda lehrt, dass auch mit vermeintlich majoritär abgestützten Regimen nicht Ethnien, sondern Cliquen an der Macht sind, welche die Vorstellung tribaler Loyalität gehörig relativieren können. ...
Afrikas Suche nach Demokratie gilt nicht einem übermorgen schon makellos funktionierenden Parlamentarismus. Sie gilt einem Mechanismus, welcher Macht an Rechenschaft binden und einen Führungswechsel ohne Bürgerkrieg ermöglichen sollte. Weniger die ethnischen Konfliktherde sind dabei das Problem als der Zunder von Diskriminierung und Repression, mit dem Regime sie stets neu entfachen. »Afrika mit seinen Stammesproblemen«: Natürlich wurden schon im vorkolonialen Afrika Konflikte mit Waffengewalt ausgetragen -- wie auf allen Kontinenten. Sklavenjagd und Viehraub waren die beiden Kriegsgründe Afrikas, und bei den Konflikten handelte es sich nicht um zwischenstaatliche im modernen Sinn, sondern durchaus um tribale Rivalitäten. Was demgegenüber heute in der Tagespublizistik als »Stammesprobleme« geläufig ist und oft arglos so verstanden wird, als wäre es Afrika in die Wiege gelegt worden, erfordert eine Berichtigung, die mehr als nur Nuancen betrifft. Afrika »hat« diese Probleme in dem Maße, in dem es sie hervorbringt; und wer sie, wenn nicht hervor-, so doch zu gegenwärtiger Virulenz gebracht hat, sind Afrikas autoritäre Staaten. Diese politische Leistung wird als Tribalismus bezeichnet; er ist keine Eigenart afrikanischer Gesellschaften, sondern eine Strategie autoritärer Regime."
[Brunold, Georg <1953 - >: Afrika gibt es nicht : Korrespondenzen aus drei Dutzend Ländern. -- Reinbeck : Rowohlt, 1997. -- (rororo ; 22113). -- ISBN 3499221136. -- S. 406 - 419]
|
Abb.: Lage Ugandas (©Mindscape) |
Abb.: General Idi Amin, 1975 (©Corbis) |
"Als Uganda im Herbst 1962 unabhängig wird, ist [Idi] Amin bereits -- dank der Beförderung durch die Engländer -- General und stellvertretender Armeeführer. Er schaut sich um. Er hat zwar einen hohen Rang und eine Position, aber er ist immer noch ein Kakwa -- Mitglied eines kleinen Stammes, der noch dazu nicht wirklich als ugandisch gilt. Die Mehrheit in der Armee stellen Männer vom Stamm der Lango, dem Premierminister [Milton] Obote [geboren ca. 1912, Regierungschef von Uganda 1966 - 1971 und 1980 - 1985] angehört, und von dem mit ihnen verbrüderten Stamm der Acholi. Lango und Acholi behandeln die Kakwa von oben herab, weil sie diese als ungebildet und rückständig betrachten. Wir bewegen uns hier in einer paranoiden, obsessiven Welt von Vorurteilen, Hassgefühlen und innerafrikanischen ethnischen Ressentiments -- alle diese Rassismen und Chauvinismen existieren ja nicht bloß entlang der großen Trennlinien, etwa zwischen Weißen und Schwarzen, nein, diese Linien werden oft sogar noch schärfer, verbissener und erbarmungsloser innerhalb ein und derselben Rasse gezogen, zwischen Menschen derselben Hautfarbe. So ist nicht zu leugnen, dass die Mehrheit der Weißen in der Welt nicht von Schwarzen umgebracht wurde, sondern von anderen Weißen, und ebenso wurde die Mehrheit der Schwarzen in unserem Jahrhundert von anderen Schwarzen getötet, und nicht von Weißen.
Ethnische Verblendung hat zur Folge, dass es zum Beispiel in Uganda niemanden interessiert, ob XY klug ist, gut und freundlich, oder ob er, im Gegenteil, bösartig ist und verschlagen -- es interessiert nur, ob er dem Stamm der Bari, Toro, Busoga oder Nandi angehört. Einzig nach dieser Zugehörigkeit wird er klassifiziert und eingeschätzt."
[Kapuscinski, Ryszard <1932 - >: Afrikanisches Fieber : Erfahrungen aus vierzig Jahren. -- Frankfurt a. M. : Eichborn, ©1999. -- (Die andere Bibliothek). -- ISBN 3821844833. -- S. 141f.]
Den Clan bilden alle Nachkommen, die von einem weit entfernten (manchmal auch fiktiven) Urahn abstammen. Die Generationenfolge lässt sich bis zu diesem Vorfahr nicht lückenlos nachvollziehen, wenn es ihn überhaupt gab.
Die Anzahl der Clans bleibt meist konstant, im Clan leben mehrere Lineages. Die Mitglieder eines Clans halten zusammen und helfen sich untereinander, aber die Solidarität ist nicht so stark und die Pflichten gegenüber den Mitgliedern sind nicht so festgelegt, wie in einer
Lineage.
Clans sind Konstrukte. Sie haben meist Exogamie-Regeln, d.h. untereinander im Clan darf nicht geheiratet werden, die Frauen werden zwischen den Clan ausgetauscht.
Man kann sich das so vorstellen, dass der Clan ein Dorf ist und in diesem Dorf leben verschiedene Familien, die Lineages. Es ist klar, dass man der Familie gegenüber mehr Verpflichtungen hat, als den übrigen Bewohnern des Dorfes, trotzdem fühlt man sich mit ihnen verbunden und ist ihnen gegenüber auch hilfsbereit und solidarisch.
Die Aschanti (Asante) sind ein Volk im südlichen Ghana. Ab spätestens dem 16. Jhdt. waren sie Träger eines mächtigen Staates.
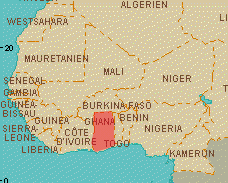
Abb.: Lage von Ghana (©Mindscape)
"»Wir [Aschanti] glauben«, sagte mir Kwesi, »dass sich der Mensch aus zwei Elementen zusammensetzt. Aus dem Blut, das er von der Mutter erbt, und aus dem Geist, den ihm der Vater verleiht. Das stärkere Element ist das Blut, daher gehört das Kind zur Mutter und ihrem Klan -- nicht zum Vater. Wenn der Klan der Mutter dieser befiehlt, den Mann zu verlassen und in ihr Heimatdorf zurückzukehren, nimmt sie alle Kinder mit (denn die Frau wohnt zwar im Dorf und Haus des Mannes, doch sie ist dort gleichsam nur zu Gast). Weil sie zu ihrem Klan zurückkehren kann, steht die Frau, die von ihrem Mann verlassen wird, nicht heimatlos da. Sie kann auch selbst ausziehen, wenn er sich als Despot erweist. Doch das sind Ausnahmefälle, denn für gewöhnlich ist die Familie eine starke und lebendige Zelle, in der alle die ihnen zugewiesenen Rollen ausfüllen und jeder einzelne seine Pflichten genau kennt. Die Familie ist immer zahlreich -- ein paar Dutzend Personen. Mann, Frau (Frauen), Kinder, Cousins und Cousinen. Die Familie kommt so oft wie möglich zusammen und verbringt die Zeit gemeinsam. Gemeinsam die Zeit zu verbringen ist einer der höchsten Werte, den alle zu achten versuchen, Es ist wichtig, gemeinsam oder in großer Nähe zueinander zu wohnen: Es gibt viele Arbeiten, die man nur gemeinsam bewältigen kann -- andernfalls hat man keine Chance, zu überleben.
Das Kind wächst innerhalb der Familie auf, doch je größer es wird, um so deutlicher sieht es, dass die Grenzen seiner Gesellschaft viel weiter gesteckt sind, dass neben der eigenen Familie auch noch andere leben, und dass viele dieser Familien zusammen einen Klan bilden. Den Klan bilden alle diejenigen, die daran glauben, dass sie einen gemeinsamen Ahnen besitzen. Wenn ich glaube, dass du und ich irgendwann denselben Vorfahren hatten -- dann gehören wir demselben Klan an. Aus dieser Überzeugung ergeben sich ganz wichtige Konsequenzen. So dürfen zum Beispiel Frauen und Männer desselben Klans keine sexuellen Beziehungen unterhalten. Das ist mit dem strengsten Tabu belegt. In der Vergangenheit wurden bei Verletzung dieses Tabus beide Personen zum Tode verurteilt. Aber auch heute noch ist es ein schweres Vergehen, das die Geister der Ahnen erzürnen und jede Menge Unheil über den Klan bringen kann.
Abb.: Ashanti-Führer (Bildquelle: Smithonian)
An der Spitze des Klans steht sein Führer. Dieser wird von einer Versammlung des Klans gewählt, welcher der Rat der Ältesten vorsteht. Die Ältesten sind die Dorfhäuptlinge, Führer der Unterklans, Funktionäre jeglicher Art. Es kann mehrere Kandidaten und zahlreiche Abstimmungen geben, weil diese Wahl von Bedeutung ist: Die Position des Führers ist sehr wichtig. Mit dem Augenblick seiner Wahl wird der Führer zur heiligen Person. Von diesem Zeitpunkt an darf er nicht mehr barfuss gehen, noch darf er sich direkt auf den nackten Boden setzen. Man darf ihn nicht berühren und kein böses Wort über ihn sagen. Dass der Führer kommt, sieht man schon von weitem an einem aufgespannten Schirm. Ein großer Führer hat einen riesigen, imponierenden Schirm, den ein eigener Diener trägt; ein kleinerer Führer trägt einen gewöhnlichen Schirm, den er bei einem Araber auf dem Markt gekauft hat.
Dem Führer des Klans kommt eine Funktion von größter Bedeutung zu. Im Mittelpunkt des Glaubens der Aschanti steht der Kult der Ahnen. Der Klan umfasst eine riesige Zahl von Personen, von denen wir nur einen Teil sehen und treffen können, jene nämlich, die auf der Erde leben. Die anderen -- die Mehrheit -- sind die Ahnen, die zwar von uns gegangen sind, in Wirklichkeit aber weiter an unserem Leben teilhaben. Sie sehen uns und beobachten unser Verhalten. Sie sind überall und beobachten alles. Sie können uns helfen, uns aber auch bestrafen. Uns Glück bringen oder uns ins Verderben stürzen. Sie entscheiden alles. Daher ist es eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Klans und unserer eigenen Person, dass wir gute Beziehungen zu den Ahnen unterhalten. Und für die Qualität und Intensität dieser Beziehungen ist eben der Führer des Klans verantwortlich. Er ist der Mittler und das Verbindungsglied zwischen den beiden integralen Teilen des Klans: der Welt der Ahnen und der Welt der Lebenden. Er übermittelt den Lebenden den Willen und die Entscheidung der Ahnen in einer bestimmten Angelegenheit und erfleht auch deren Vergebung, wenn die Lebenden die Sitten oder Gesetze verletzt haben.
Diese Vergebung kann man erlangen, indem man den Ahnen Opfer darbringt: Man besprüht den Boden mit Wasser oder Palmwein, schlachtet ein Schaf, um Essen für sie hinzulegen. Doch das alles kann sich als unzureichend erweisen und die Ahnen zürnen vielleicht immer noch, was für die Lebenden weiteres Unglück und Krankheiten bedeuten kann. Den größten Zorn rufen hervor: Blutschande, Mord, Selbstmord, Raub, Beleidigung des Führers, Zauberei.«
»Selbstmord?« fragte ich verwundert. »Wie kann man jemanden bestrafen, der Selbstmord verübt hat?«
»Unser Gesetz verlangte, dass ihm der Kopf abgeschnitten wurde. Der Selbstmord war eine Verletzung des Tabus, und es ist das oberste Prinzip im Kodex des Klans, dass jedes Vergehen bestraft wird. Wenn ein Vergehen nicht bestraft wird, steuert der Klan auf die Katastrophe zu, droht ihm die Vernichtung.« ...
»Der Führer hat noch eine Menge anderer Pflichten«, fuhr Kwesi fort. »Er entscheidet Streitigkeiten und schlichtet Konflikte, er ist also auch ein Richter. Von großer Bedeutung, vor allem in den Dörfern, ist die Tatsache, dass der Führer den Boden an die Familien verteilt. Er kann ihnen den Boden nicht schenken oder verkaufen, weil der Boden Eigentum der Ahnen ist -- diese wohnen im Boden, in seinem Inneren. Der Führer kann ihn nur zur Bearbeitung verteilen. Wenn ein Feld unfruchtbar wird, teilt er der Familie ein anderes Stück Boden zu, und das unfruchtbare Feld kann sich erholen und neue Kräfte für die Zukunft sammeln. Der Boden ist heilig. Der Boden gibt den Menschen das Leben, und was Leben gibt, ist heilig.
Der Führer erfreut sich der höchsten Achtung. Ihm steht der Rat der Ältesten zur Seite, und er darf keine Entscheidung treffen, ohne dessen Meinung und Einverständnis einzuholen. Das verstehen wir unter Demokratie. Am Morgen besucht jedes Mitglied des Rates das Haus des Führers, um den Hausherrn zu begrüßen. Das ist für ihn der Beweis, dass er gut regiert und Unterstützung genießt. Wenn diese morgendlichen Besuche ausbleiben, bedeutet das, dass er das Vertrauen verloren hat und abtreten muss. Das geschieht, wenn er sich eines von fünf Vergehen schuldig macht. Diese sind:
- Trunksucht,
- Fresssucht,
- Kungelei mit Zauberern,
- schlechtes Verhalten gegenüber den Menschen und
- Regieren, ohne die Meinung des Ältestenrates einzuholen.
Der Führer muss auch abtreten, wenn er erblindet, an Lepra erkrankt oder den Verstand verliert.
Abb.: Aschanti-König (1970) (Bildquelle: Smithonian)
Mehrere Klans bilden eine Einheit, die von den Europäern Stamm genannt wird. Die Aschanti sind die Vereinigung von acht Klans. An der Spitze steht der König -- Aschantehene, dem der Rat der Ältesten zur Seite steht. So eine Verbindung wird nicht nur durch die gemeinsamen Ahnen geschaffen. Sie ist auch eine territoriale, kulturelle und politische Gemeinschaft. Manchmal ist so ein Volk riesig groß, zählt viele Millionen, mehr als so manches europäische Volk.«"
[Kapuscinski, Ryszard <1932 - >: Afrikanisches Fieber : Erfahrungen aus vierzig Jahren. -- Frankfurt a. M. : Eichborn, ©1999. -- (Die andere Bibliothek). -- ISBN 3821844833. -- S. 34 - 37. ]
In Somalia, einem der ärmsten Länder der Erde, kämpfen Clan-Führer oder Stammeshäuptlinge um die Macht. Es gibt keine allgemein anerkannte Regierung!
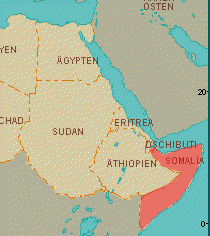
Abb.: Lage von Somalia (©Mindscape)
"Die Somalier sind eine einheitliche, mehrere Millionen zählende Nation. Sie besitzen eine gemeinsame Sprache, Geschichte und Kultur. Ein gemeinsames Territorium. Und eine gemeinsame Religion -- den Islam. Ungefähr ein Viertel der Gesellschaft lebt im Süden und beschäftigt sich mit Landwirtschaft, mit dem Anbau von Sorghum, Mais, Bohnen und Bananen. Doch die Mehrheit sind Herdenbesitzer, Nomaden, Wanderhirten. Mit solchen ziehe ich jetzt dahin, durch ein weites, wüstenähnliches Gebiet irgendwo zwischen Berbera und Las Anod. Die Somalier zerfallen in ein paar große Klans (wie die Issaq, Daarood, Dir, Hawiye), diese in kleinere Klans, von denen es Dutzende gibt, und die wiederum in Hunderte, ja Tausende von Sippen. Die Bindungen, Bündnisse und Konflikte zwischen diesen Verbänden und Sippschaften machen die Geschichte der somalischen Gesellschaft aus. Der Somalier wird irgendwo unterwegs geboren, in einer jurtenförmigen Hütte oder auch unter dem nackten Himmel. Er kennt den Ort seiner Geburt nicht, dieser wird nie irgendwo aufgezeichnet. Ähnlich wie seine Eltern stammt er aus keinem Dorf und keiner Stadt. Er besitzt nur eine Identität und das ist seine Verbindung mit der Familie, mit der Sippe, mit dem Klan. Wenn einander zwei Unbekannte begegnen, dann lautet die erste Frage: -- Wer bist du? -- Ich bin Soba, aus der Familie des Ahmad Abdullah, und diese Familie gehört zur Sippe Mussa Araye, und diese Sippe gehört wieder zum Klan Hasean Said, und dieser Klan ist ein Teil des Klanverbandes der Issaq usw. Nach dieser Vorstellung zählt auch der andere der Reihe nach alle Details seiner Zugehörigkeit auf, benennt die eigenen Wurzeln, und dieser Austausch von Informationen dauert lang und ist ungeheuer wichtig, weil die beiden Unbekannten herausfinden wollen, ob sie etwas verbindet oder trennt, ob sie einander um den Hals fallen, oder sich mit Messern aufeinanderstürzen sollen. Wobei den persönlichen Gefühlen dieser Menschen, ihren privaten Sympathien oder Antipathien, keine Bedeutung zukommt; ihre Beziehung zueinander, ihre Freundschaft oder Feindschaft, hängt von den Obereinkommen ab, die gerade zwischen ihren beiden Klans existieren. Der einzelne Mensch existiert nicht, er zählt nur als Mitglied dieser oder jener Sippe."
[Kapuscinski, Ryszard <1932 - >: Afrikanisches Fieber : Erfahrungen aus vierzig Jahren. -- Frankfurt a. M. : Eichborn, ©1999. -- (Die andere Bibliothek). -- ISBN 3821844833. -- S. 205. ]
"Bei [Captain Richard] Burton finden sich [1854/55] auch schon ausgreifende Stammbäume der Somal-Clans, einschließlich des rührenden Mythos, wonach Araber die Urkunden entführten, um das Volk mit der edlen Abkunft in den Rang des Halbbluts herabzustufen. Die divergenten Angaben zu Somalias Bevölkerung treffen sich in der Annahme, dass noch 1990 rund die Hälfte in Transhumanz, in nomadischer Weidewirtschaft, lebte. Diese Mobilität blieb demnach quantitativ nicht allzuweit hinter der kriegsbedingten zurück, für die das Kinderhilfswerk Unicef 1992 eine Schätzung von 4,5 Millionen Vertriebener gab. Hohe Mobilität stellt besonders hohe Anforderungen an soziale Bindungen. Im somalischen Clansystem findet sich keine Spur ethnischer Unterscheidungsmerkmale, es handelt sich um Verwandtschaftsverhältnisse im engen Wortsinn. Burton seinerzeit bezeichnete diese Genealogie als »ein modernes Phänomen«, denn die Poesie ihrer Stammbäume greift nur ungefähr ein halbes Jahrtausend zurück. Die fünf großen somalischen Clanfamilien definiert dabei einzig der unstrittige Befund, dass die Ahnenreihen doch an einem bestimmten Punkt abbrechen.
Ein Unikum sind solche kollektiven Verwandtschaftsverhältnisse vielleicht in ihrem somalischen Gesamtumfang, aber nicht der Art nach. Auf der Arabischen Halbinsel, zum Beispiel in den Vereinigten Emiraten mit ihrer Bevölkerung von vielleicht einer Million Autochthoner, überblicken die Beduinensöhne in ihrem Geblüt vergleichbare Verästelungen. Es handelt sich zugleich um einen Kode für die geographische Gliederung des gemeinsamen Lebensraums, denn die Linien des nomadisierenden Geschlechts folgen den Wegen, auf denen die Namen Markierungen zurücklassen. Als Assoziation drängen sich die Kel Tamacheq auf, die von den westafrikanischen Arabern den Namen Tuareg erhielten -- das Volk der tawariq, der Wege. Und auch in der westlichen Sahara ist der Name des großen Hoggar-Gebirges der Name eines Stammes.
In alphabetischer Folge sind Somalias große Familien:
- Darod mit den Harti (Dolbahante, Majerteeni, Warsengeli) aus dem Nordosten und den Absame (Abas Gul, Bartere, Leylkase, Marehan, Ogadeni, Ortoble) aus dem Süden und Westen;
- Digil mit den Issa und Gadabursi aus dem Nordwesten;
- Dirr mit den Issaq aus dem Nordwesten und kleineren Verwandten im Süden;
- Hawiyeh mit Abgal, Habrgidr, Hawadle, Murusada und vielen anderen in den zentralen Landesteilen um Mogadiscio,
- Rahawein, vorwiegend zwischen den Hawiyeh-Gebieten und der Westgrenze.
Gemäß italienischen Schätzungen, die aus erwähnten Gründen mit Vorsicht aufzunehmen sind, halten sich Darod, Hawiyeh, Issaq, Rahawein und die übrigen mit etwa je zwanzig Prozent die Waage. Alle zerfallen sie in ungezählte Sub-Clans, allein die Issa Djiboutis nennen 40. Zum Zeitpunkt von Barres Flucht waren alle Clans in allen Landesteilen vertreten. Angaben zur Herkunft bieten oft nicht viel mehr als historische Anhaltspunkte. Eine ethnographische Karte hätte nicht Siedlungsgebiete, sondern Wanderbewegungen zu verzeichnen. Wie die Wege sich kreuzen, überschneiden sich die Stränge der Überlieferung, welche die Hoheitsansprüche begründen. Die Annahme wäre naiv, der Streit darum sei durch historisches Wissen entscheidbar. Dennoch werden unter dieser fiktiven Voraussetzung achtzigjährige Rechnungen revidiert, die mit dem Abzug Barres wieder auf den Tisch kamen.
Die vordergründige Plausibilität in der Rede vom Krieg der Clans kann irreführen. Sicher hat es ein Darod in der Hawiyeh-Hauptstadt Mogadiscio nicht weniger schwer als ein Hawiyeh in der südlichen Darod-Hochburg Kismayo. Doch die Konstellationen der Konfliktparteien folgen nicht umstandslos den Clangliederungen. Der Weg zur Staatsspitze setzt unangefochtene Herrschaft über den eigenen Clanverband voraus. In den Bürgerkriegswirren der letzten Jahre traten deshalb drei der fünf großen Familien politisch als jene Einheiten in Erscheinung, über welche die Führung so hart umkämpft blieb. Seit Siad Barres Sturz [1991] bekämpften sich am blutigsten die Hawiyeh des Wasserkopfs Mogadiscio, während im Süden Darod-Zweige um Kismayo rangen. In »Somaliland« sorgten die Issaq ganz allein dafür, dass 1992 der abtrünnige, ehemals britische Nordwesten beinahe in ungezügelten Wirren versank.
Abb.: Folge der Clankämpfe: Somalische Flüchtlinge in Äthiopien (Quelle: UNHCR)
Die Bürgerkriege griffen ineinander über und vernetzten sich. Mit [Muhammad Farah] Aidid [1934 - 1996], dem Stärkeren der Hawiyeh im Zentrum, verbündete sich Omar Jess, der Schwächere der Darod im Süden, wo Said Hersi Morgan die Oberhand gewann. Mit diesem wiederum verbündete sich Interimspräsident Ali Mahdi, der sich unter den Hawiyeh der Hauptstadt dem Eroberer Aidid gegenüber als der Schwächere erwies. Mohamed Abshir, der starke Mann unter den Darod im Nordosten, schloss sich der Allianz zwischen Ali Mahdi und Morgan an, als diese der Allianz zwischen Aidid und Jess zu unterliegen drohte. Entlang der Schlaufen derselben Logik, derzufolge das familienübergreifende Bündnis dem Kleinen der Sippe Schutz gegen die Schwergewichte verheißt, lässt sich das Geflecht somalischer Allianzen entwirren.
Abb.: Pro-Aidid-Demonstration 1993 (©Corbis)
Das wegweisende Vorbild lieferte bereits Siad Barres [1910 - 1995; Somalischer Ministerpräsident von 1969 bis 1991] Zauberformel MOD: Marehan, Ogadeni, Dolbahante. Die ersten Opfer des Terrors, auf den er seine Macht baute, waren in den siebziger Jahren die Majerteeni, die Darod-Elite, die überall im Land Schlüsselstellen besetzte. Barre, der Spross des winzigen Marehan-Clans aus dem südwestlichen Grenzkaff Garba Harre, hatte zuerst die erfolgreichen Vettern zu eliminieren, um in der eigenen Großfamilie zu einer Stimme zu kommen. In seinen Reden nannte er seine Herrschaftsform fortan »Somalismus«."
[Brunold, Georg <1953 - >: Afrika gibt es nicht : Korrespondenzen aus drei Dutzend Ländern. -- Reinbeck : Rowohlt, 1997. -- (rororo ; 22113). -- ISBN 3499221136. -- S. 123 - 126]
Eine hervorragende Darstellung der Verwandtschaftsbande bei den Somalis und ihrer Auswirkungen ist:
Lewis, Ioan M.: Blood and bone : the call of kinship in Somali society. -- Lawrenceville, NJ : Red Sea Press, ©1994. -- 256 S. -- ISBN 0932415938.
Danach (S. 19ff.) steht ein Somali in folgenden Abstammungsbanden (man beachte im Beispiel die patronyme Namensgebung):
| Abstammungsgemeinschaft | Beschreibung | Anzahl der Generationen vom Ego aus | Beispiel für Mahammad Faarah | |
|---|---|---|---|---|
| Genera- tion |
Name des Vorfahren | |||
| Klan-Familie (clan-family) | Höchste Gruppierungen der Klans:
|
20 oder mehr Generationen | 17 |
Kablallah Daarood |
| 16 | Koombe Kablallah | |||
| 15 | Harti Koombe | |||
| Klan (clan) | Größte, effektive patrilineare Verwandtschaftsgemeinschaft mit 20000 bis 130000 Mitgliedern. Im Norden gibt es neun solche Klans (neben einigen kleineren) | 15 bis 20 Generationen | 14 | Si'id Harti (Dulbahante) |
| 13 | Muuse Si'id | |||
| 12 | 'Abdalle Muuse | |||
| 11 | Habarwaa 'Abdalle | |||
| 10 | Shirshoore Habarwaa | |||
| 9 | Faarah Shirshoore (Faarah Garaad) | |||
| 8 | Ahmad Faarah | |||
| Primäre Lineage (primary lineage) | Verwandtschaftsgemeinschaft, für die Exogamie gilt: Heirat zwischen Angehörigen der gleichen primären Lineage ist verboten, gilt aber nicht als Inzest. | 6 bis 10 Generationen | 7 | 'Ali Geri Ahmad |
| Blutrachegruppe (dia-paying group von arabisch diiya = Blutrache) | Verwandtschaftsgruppe, deren Mitglieder gegenüber Außenstehenden gemeinsam verantwortlich sind und vor allem zur Blutrache für ein Einzelmitglied bzw. Ablösung der Blutrache verpflichtet sind. Die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten dieser Verwandtschaftsgruppen sind in schriftlichen Verträgen (heer) festgelegt, die zu Zeiten der Nichtanarchie bei den zuständigen District Offices hinterlegt sind. Es ist wichtig, dass die Loyalität innerhalb solcher Verwandtschaftsgruppen nicht einfach durch die Verwandtschaft begründet sind, sondern ebenso durch formale Verträge. Diese Verwandtschaftsgruppen sind die eigentlichen rechtlichen und politischen Einheiten Somalias. | 4 bis 8 Generationen | 6 | Suubaan 'Ali Geri |
| 5 | Khayr Suubaan | |||
| 4 (Urgroßvater) | 'Igaal Khayre | |||
| 3 (Großvater) | Heyri 'Igaal | |||
| 2 (Vater) | Faarah Heyri | |||
| Ego (Mann) | 1 | Mahammad Faarah | ||
In der Lineage stammen alle Mitglieder von einem nachweisbaren Ahnen ab. Die Anzahl der Lineage ändern sich. Werden sie zu groß, teilen sie sich auf und die neue Gruppe sucht sich einen anderen bedeutenden Ahnen und bildet eine neue Lineage mit eben diesem Ahn als nachweisbarer Vorfahr. Sie teilen sich deshalb auf, damit die Machtverhältnisse gleich bleiben und nicht an Wirkung verlieren. Denn wird sie zu groß, ist nicht mehr gewährleistet, dass die "Häuptlinge" ihren Machteinfluss behalten und die Lineage wird zu unübersichtlich.
Die Abstammung vom Ahnen ist in afrikanischen Vorstellungswelten ein lebenswichtiger Bezug. Der Ahne bedeutet die Quelle und Fruchtbarkeit seiner Nachkommen, er wird von einem Zwischenglied der Abstammungskette auf das nächste übertragen. Der Älteste stellt für das Leben ein notwendiges Relais dar, weil er einst gezeugt hat und weiterhin ein Bindeglied ist, das die Lebenskraft der vergangenen Generationen auf die weiteren Generationen übertragen wird.
In den Lineages besteht ein enges Netz unter den Mitgliedern und es herrschen strenge Regeln, die das Zusammenleben, einander helfen und den Älteren Respekt zu zollen, betreffen.
In Krisensituationen kann man sich voll auf die Unterstützung der Mitglieder seiner Lineage verlassen, aber man ist ihnen im Gegenzug auch zu Hilfe verpflichtet. Die kollektive Sicherheit, die die Lineage dem Einzelnen bietet, bildet auch ein Druckmittel, da sie von entscheidender Bedeutung für dessen Existenz ist.
Die Macht übt eine Gruppe von Ältesten aus, dieser Gruppe steht einer vor. Dieser Älteste muss nicht unbedingt tatsächlich der Älteste sein, aber der angesehenste unter den Ältesten. Er wählt seinen Nachfolger aus, wenn seine Zeit gekommen ist. Der Älteste leitet Versammlungen, wird mit Respekt angehört und besitzt die Fähigkeit, zu verfluchen und auszustoßen. Die Entscheidungen, die die gesamte Lineage betreffen, werden nicht alleine von dem Ältesten getroffen, sie werden in der Gruppe so lange diskutiert, bis man gemeinsam zu einer Lösung gekommen ist. Ist der Häuptling ein geschickter Redner und Stratege, weiß er natürlich die anderen in seinem Sinne zu beeinflussen, dass seine Gegner am Ende doch für seine Entscheidung sind. Deshalb werden die einflussreichsten und geschicktesten auch Häuptling, sonst würde man nie zu Entscheidungen kommen. Der Häuptling muss das Vertrauen seiner Untertanen haben, sonst wird er boykottiert. Es gibt Situationen, in denen die Ältesten ein Druckmittel einsetzen, wenn sich jemand widersetzt, sich gegen die Regeln verhalten hat usw. Diese Druckmittel sind im schlimmsten Fall Verbannung aus der Lineage oder Tod. Die weniger drastische Methode, aber durchaus auch sehr wirksame ist die soziale Verbannung, man redet nicht mehr mit demjenigen, er wird bei Entscheidungen nicht mehr zu Rate gezogen usw.
Was ein Individuum veranlasst, sich einem Beschluss seiner Lineage zu fügen, sind die religiöse Furcht, das Gewissen und vor allem die Angst vor der kollektiven Missbilligung: die Furcht vor der Unzufriedenheit der Ahnen, die sich unmittelbar, ohne Eingreifen des Oberhaupts, in Strafen, die von Ahnengeistern gesandt werden, wie schlechte Ernte, Krankheit, Unfruchtbarkeit, äußern kann, das Gewissen, das ein unangenehmes Schuldgefühl hervorruft, falls man sich nicht an die Beschlüsse hält, die Angst vor der kollektiven Missbilligung, die sich in mehr oder weniger bösartigen Spötteleien äußern kann, die Weigerung, den Betreffenden anzureden oder ihm zu antworten, und schließlich zum Abbruch jeglicher Kooperation mit ihm führen kann, so dass das widerstrebende Individuum gezwungen ist, den Ort zu verlassen.
Die Lineages sind sehr wichtige Gruppen in Afrika. Wenn man die Verwandtschaft in den Lineages verstanden und den Zusammenhang, ist es leichter, die Gesellschaften Afrikas und ihre Probleme heute zu verstehen.
Um es verständlicher zu machen, ist noch einaml auf die Verwandtschaftsbeziehungen hinzuweisen. In Afrika herrscht überwiegend das Patriarchat, d.h. die Männer bilden die Gruppe, die die Entscheidungen trifft, bezüglich der Lineages. Man kann auf zwei Arten miteinander verwandt sein, entweder über die Mutter, Muttersmutter, Muttersmuttersmutter, usw. = matrilinear, oder über den Vater, dessen Vater, dessen Vater, usw. = patrilinear. Matrilinear ist aber nicht mit Matriarchat zu verwechseln, die Männer treffen hier immer noch die "politischen" Entscheidungen, sie erben nur die Macht über ihre Mutter, nicht vom Vater. Da man immer mit Sicherheit sagen kann, dass das Kind von der Mutter ist, nicht aber ob der Vater auch wirklich der biologische Vater ist, ist es sicherer die Macht und den Besitz über die Mutterlinie zu vererben (matrilinear). Ist man patrilinear verwandt, so ist man mit den Verwandten des Vaters blutsverwandt, nicht aber mit denen der Mutter und umgekehrt, man ist also immer nur über eine Seite verwandt.
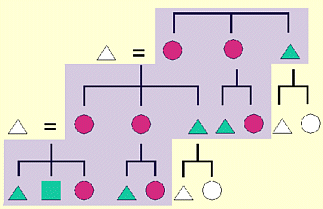
Abb.: Matrilineare Verwandtschaftsgruppe
Eine patrilieare Verwandtschaftsgruppe erhält man aus obiger Graphik indem man die Symbole für männlich und weiblich austauscht.
Eine Lineage bilden die Blutsverwandten und nur ihnen gegenüber ist man verpflichtet und umgekehrt. Diese Solidarität beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod, sie hält bedingungslos ein ganzes Leben lang, es sei denn, man verstößt gegen wichtige Gesetze und wird ausgestoßen, was aber nur äußerst selten vorkommt. Ist ein Mann im heiratsfähigen Alter und hat sich eine Frau gesucht, bekommt er von seiner Lineage ein Stück Land zur Verfügung gestellt, dass er bearbeiten kann, um seine Familie zu ernähren. Man kann sich auf die Hilfe und Unterstützung der anderen Mitglieder seiner Lineage in Krisenlagen hundertprozentig und immer verlassen. Es gibt nur wenige Dinge, die man einem Verwandten abschlagen kann. Unter Umständen kann sich das auch negativ auswirken oder als Druckmittel verwendet werden. Wenn ich Hilfe von jemandem in Anspruch genommen habe, kann der natürlich diese Hilfe von mir in Anspruch nehmen, sei der Zeitpunkt auch noch so ungelegen oder man könnte eigentlich nicht helfen, weil man selber nichts hat, ist aber dazu verpflichtet. Dieses Problem wurde natürlich größer, als die Kolonialisation begann und das Geld als Zahlungsmittel auftrat. Es ist natürlich, wenn jemand in einer Lineage Geld hat, welches etwas besonderes ist, das die anderen nicht haben, die anderen daran Anteil haben wollen. Er muss es teilen, wenn jemand etwas davon braucht, weil es die Solidarität verlangt. Heute ist dieses Problem sehr verbreitet und unter dem Schlagwort "Clanparasitismus" bekannt. Meist läuft es so ab, dass ein junger Mann einer Lineage in die Stadt geht, um Geld zu verdienen. Er bekommt Arbeit und erlangt nach unseren Gesichtspunkten einen bescheidenen Wohlstand. Eines Tages kommt einer seiner Lineage in die Stadt und will auch Arbeit, hat aber noch keine Wohnung usw. Der Erste muss ihn unterstützen, ihn ernähren und ihm Arbeit verschaffen, oder einfach sein Geld mit ihm teilen. Unter Umständen geht der zweite erst gar nicht arbeiten, weil es sich ja so ganz gut leben lässt. Nach und nach kommen aus den verschiedensten Gründen immer mehr, die an dem Wohlstand teilhaben wollen. Mit der Zeit verliert der erste, der in der Stadt war natürlich seinen bescheidenen Wohlstand und verarmt, mit ihm auch die anderen. Da sie aber selten in ihr Dorf zurückkehren, bleiben sie in der Stadt und verarmen in Slums, Squatter Camps usw. Früher, als sie noch kein Geld hatten und sich weitgehend von der Erde und dem Tausch ernähren konnten und alle ungefähr das gleiche hatte, gab es dieses Problem natürlich nicht. Da tritt dann die Frage auf, ob sie nicht besser im Dorf leben würden, aber man kann die "einheimischen" Afrikaner nicht aus der Geldgesellschaft ausschließen und sie an keinen Entscheidungen und nicht am "zivilisierten" Leben teilhaben lassen. Es ist auch natürlich, dass die "einheimischen" Afrikaner sich heute als vollwertige Bürger ansehen und das sich schlecht mit dem traditionellen Leben im Dorf vereinbaren lässt. Oder kann man sich einen Afrikanischen Stammeshäuptling gleichzeitig als politisches Oberhaupt einer Stadt vorstellen?
Die Lineage und die damit verbundene Solidarität spielt auch noch in einem anderen Sektor eine Rolle, wenn es um Macht geht, politische und andere. Die Mitglieder einer Lineage berufen sich auch auf die Solidarität, wenn es darum geht, irgend etwas zu erreichen, an ein Amt zu kommen, oder an einen Job. Was bei uns "Vitamin B", also Beziehungen, genannt wird, gibt es dort auch. Ein Mitglied einer Lineage versucht über ein anderes z.B. an einen Job zu kommen, oder es zu bestechen usw. Man tut einem Mitglied aus seiner Lineage lieber einen Gefallen, als jemand Fremden, oder man drückt eher mal ein Auge zu.
Also haben Lineages im heutigen Afrika immer noch Bedeutung, wenn sich das Zusammenleben auch geändert hat.
"Die meisten Menschen in der Stadt arbeiten nur von Zeit zu Zeit, eher selten, über lange Zeiträume hinweg haben sie überhaupt keine Beschäftigung. Das größte Rätsel der afrikanischen Städte besteht tatsächlich darin, wovon diese vielen Menschen leben. Wovon und wie? Denn sie sind ja nicht gekommen, weil die Stadt sie braucht, sondern weil die Armut sie aus ihrem Dorf vertrieb. Die Armut, der Hunger, ihre hoffnungslose Existenz. Sie sind also Flüchtlinge, die Rettung und Heil suchen, Ausgestoßene des Schicksals, Vertriebene. Wenn wir eine Gruppe von Menschen beobachten, die aus einer von Dürre und Hunger heimgesuchten Gegend endlich an die Grenze der Stadt gelangen, können wir in ihren Augen Furcht und Panik erkennen. Hier, zwischen diesen Slums und Lehmhütten, müssen sie nun ihr Eldorado finden. Was sollen sie jetzt tun? Wie werden sie das anstellen? Nehmen wir Edu und ein paar Cousins seines Klans. Sie gehören dem im Landesinneren lebenden Stamm der Sangu an. Früher arbeiteten sie im Dorf, doch ihre Böden wurden unfruchtbar, daher sind sie vor ein paar Jahren nach Daressalam gezogen. Ihr erster Schritt: Sie machten sich auf, andere Sangus zu suchen. Oder Mitglieder anderer Stämme, mit denen die Sangus Freundschaft verbindet. Ein Afrikaner kennt ganz genau diese Geographie von Freundschaften und Hassgefühlen zwischen den Stämmen, die ebenso lebendig sind wie jene, die es heute noch auf dem Balkan gibt.
Nach einigem Suchen kommen sie schließlich zum Haus eines ihrer Landsleute. ...
Dann beginnt eine lange Litanei ritueller Begrüßungen. Gleichzeitig ist das auch die Stunde, in der man einander abtastet. Denn beide Seiten sind bemüht festzustellen, welcher Verwandtschaftsgrad sie eigentlich miteinander verbindet. Gespannt und ernst treten sie nun in den dichten Wald der Stammbäume, aus denen sich jede Gemeinschaft eines Klans und eines Stammes zusammensetzt. Für einen Außenstehenden ist es unmöglich, sich dann zurechtzufinden, doch für Edu und seine Genossen ist das ein wichtiger Moment der Begegnung: Ein naher Cousin bedeutet viel Hilfe, ein entfernter schon bedeutend weniger. Aber auch in diesem zweiten Fall werden sie nicht mit leeren Händen weggeschickt. Mit Sicherheit finden sie hier ein Dach über dem Kopf Auf dem Boden gibt es immer noch ein wenig Platz, denn obwohl es warm ist, ist es beinahe unmöglich, im Freien, im Hof zu schlafen -- dort quälen einen noch mehr Moskitos, stechen einen noch mehr Spinnen, Laufkäfer und alle möglichen anderen tropischen Insekten."
[Kapuscinski, Ryszard <1932 - >: Afrikanisches Fieber : Erfahrungen aus vierzig Jahren. -- Frankfurt a. M. : Eichborn, ©1999. -- (Die andere Bibliothek). -- ISBN 3821844833. -- S. 72f. ]
"Es war das Jahr 1962, ein paar Monate zuvor hatte Tanganjika die Unabhängigkeit erlangt, und viele Engländer aus dem Kolonialdienst verloren ihre Beschäftigung, ihre Posten und sogar ihre Häuser. ... Diese durch die Umstände bedingte Wachablöse nennt man Afrikanisierung. Die einen begrüßen sie als Symbol der Befreiung mit Applaus, andere bringt dieser Prozess in Rage. Man braucht nicht lange zu raten, wer sich freut und wer dagegen ist. Um ihre Beamten zur Arbeit in den Kolonien zu ermutigen, hatten London und Paris für die Willigen die besten Bedingungen geschaffen. Ein kleiner, bescheidener Postbeamter aus Manchester bekam nach seiner Ankunft in Tanganjika eine Villa mit Garten und Swimmingpool, Autos, Diener, Urlaub in Europa usw. Die Kolonialbürokratie lebte tatsächlich in Saus und Braus. Und dann erlangten die Bewohner der Kolonien von einem Tag auf den anderen die Unabhängigkeit. Sie übernahmen den Kolonialstaat in unveränderter Form. Sie waren sogar darauf bedacht, nicht zu verändern, weil dieser Staat den Bürokraten die herrlichsten Privilegien einräumt, auf welche die neuen Besitzer natürlich nicht gerne verzichten wollen. Gestern noch arm und erniedrigt, sind sie heute Auserwählte des Schicksals, haben hohe Positionen und einen prall gefüllten Geldbeutel. Diese koloniale Genese des afrikanischen Staates hatte zur Folge, dass der Kampf um die Macht im unabhängigen Afrika von Anfang an ungeheuer verbissen und erbarmungslos geführt wurde. In einem Augenblick, mit einem Staatsstreich, entsteht eine neue herrschende Klasse, eine bürokratische Bourgeoisie, die nichts hervorbringt, nichts produziert, nur über die Gesellschaft herrscht und Privilegien genießt. Das Gesetz des zwanzigsten Jahrhunderts, das Gesetz der rasenden Beschleunigung, galt auch in diesem Fall -- früher einmal brauchte es Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte für das Entstehen einer gesellschaftlichen Klasse, und hier genügten ein paar Tage. Die Franzosen, die diesen Kampf um die Plätze innerhalb der neuen Klasse mit einem Augenzwinkern beobachteten, nannten dieses Phänomen la politique du ventre (Politik des Bauches), weil die politischen Posten so eng mit unermesslichen materiellen Vorteilen verbunden waren.
Aber wir sind in Afrika, und der glückliche Neureiche darf nicht die alte Klanstruktur außer acht lassen, deren oberstes Gesetz lautet: Teile alles, was du hast, mit deinen Brüdern, mit den anderen Mitgliedern des Klans, oder, wie man hier sagt, mit den Cousins (in Europa ist die Bindung zwischen Cousins ziemlich lose und schwach, in Afrika ist ein Cousin mütterlicherseits wichtiger als der eigene Ehepartner). Das heißt, wenn du zwei Hemden hast, gib ihm eines ab, wenn du eine Schüssel Reis hast, gib ihm davon die Hälfte. Wer gegen dieses Prinzip verstößt, verurteilt sich selbst zum Außenseiter, dazu, aus dem Klan ausgestoßen zu werden, zum Status des einsamen Individuums, ein Zustand, der jeden mit Schrecken erfüllt. In Europa wird der Individualismus hoch geschätzt, in Amerika sogar höher als alles andere; in Afrika hingegen ist der Individualismus ein Synonym für Unglück, ein Fluch, eine Tragödie. Die afrikanische Tradition ist kollektivistisch, weil man den hier ständig auftretenden Widrigkeiten der Natur nur in der Gruppe die Stirn bieten kann. Und eine Bedingung für das Überleben der Gruppe ist eben, dass ich alles, was ich besitze, bis zum Letzten teile. Einmal umringte mich hier eine Schar Kinder. Ich hatte nur ein Bonbon, das ich auf meine Handfläche legte. Die Kinder standen reglos da und wandten keinen Blick ab. Schließlich nahm das älteste Mädchen das Bonbon, zerbiss es vorsichtig und verteilte die Stückchen gerecht an alle.
Wenn jemand an Stelle eines Weißen Minister wird und dessen Villa mit Garten, Gehalt und Autos erhält, verbreitet sich die Kunde davon rasch bis zu dem Ort, von wo dieser Glückspilz stammt. Die Nachricht eilt wie ein Lauffeuer durch die umliegenden Dörfer. Freude und Hoffnung machen sich in den Herzen seiner Cousins breit. Und wenig später setzt ihre Wanderung in die Hauptstadt ein. Hier finden sie den glücklichen entfernten Verwandten ohne viel Mühe. Sie tauchen vor dem Tor seines Hauses auf, begrüßen ihn, besprühen den Boden der Sitte zufolge mit Gin, um den Ahnen für diese glückliche Wendung des Schicksals zu danken, und dann machen sie es sich in der Villa, im Hof und im Garten bequem. Bald darauf sehen wir, wie es in der ruhigen Residenz, die vorher ein älterer Engländer mit seiner wortkargen Frau bewohnt hatte, eng und laut wird. Vor dem Haus brennt Tag und Nacht ein Feuer, Frauen zerstoßen in hölzernen Mörsern Kassawa, eine Schar Kinder tobt durch Beete und Rabatten. Am Abend hockt sich die ganze Familie zum Essen auf den Rasen. Denn obwohl ein neues Leben angebrochen ist, sind die Gewohnheiten die alten geblieben, aus den Zeiten der ewigen Armut: Man isst nur einmal, am Abend.
Wer einen mobileren Beruf besitzt und die Tradition weniger achtet, versucht seine Spuren zu verwischen. So traf ich einmal in Dodoma einen Straßenhändler, der Orangen verkaufte (damit lässt sich nicht viel verdienen), der mir vorher in Daressalam diese Früchte ins Haus gebracht hatte. Ich war erfreut und fragte ihn, was er hier mache, fünfhundert Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Er musste vor seinen Cousins fliehen, erklärte er. Er hatte lange alles mit ihnen geteilt, bis er das am Ende gründlich satt hatte und sich aus dem Staub machte. »Für einige Zeit werde ich ein paar Cents mein eigen nennen«, freute er sich. »Bis sie mich auch hier aufstöbern!«"
[Kapuscinski, Ryszard <1932 - >: Afrikanisches Fieber : Erfahrungen aus vierzig Jahren. -- Frankfurt a. M. : Eichborn, ©1999. -- (Die andere Bibliothek). -- ISBN 3821844833. -- S. 38 - 40. ]
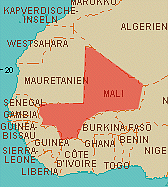
Abb.: Lage von Mali (©Mindscape)
"Unsere Begrüßungszeremonie hatte in den Händen Wagatiges gelegen, weil er das älteste Mitglied und so das Oberhaupt desjenigen Geschlechts [= Lineage] war, dem Dogulu angehörte -- einer Gruppe von etwa einem Dutzend Familien, die sich über vier oder fünf Generationen zurück auf einen gemeinsamen Ahnherrn berufen konnten. Das Geschlecht, so erfuhr ich, wurde nicht nach seinem gemeinsamen Ahnherrn benannt, sondern nach dem ältesten lebenden Mitglied; also handelte es sich bis zu Wagatiges Ableben um das Wagatige-Geschlecht. Die Ehrerbietung, die jüngere Männer wie Dogulu Wagatige entgegenbrachten, war nicht zu übersehen, doch fand ich es zunächst schwierig, seinen Status richtig einzuschätzen. Erst allmählich wurde mir klar, dass er seiner großen Familie in vielfältiger Weise ein Vater war: Seine Rechte und Verantwortlichkeiten entsprachen seiner Stellung als Oberhaupt eines sehr umfangreichen Haushaltes. Als aufschlussreich erwies es sich dabei, das Leben der jüngeren Mitglieder des Geschlechtes -- der Oberhäupter einzelner Familien -- zu beobachten. Schon bald entdeckte ich, dass der Vater auf dem Grundstück, wo er mit seiner Frau beziehungsweise seinen Frauen und den unverheirateten Kindern lebt, als ungekrönter König gilt. Er bewahrt die Schlüssel für die Speicher der Familie auf, trifft alle Entscheidungen bezüglich des Familiengrundbesitzes, und die Kinder haben seinen Anweisungen strikt Folge zu leisten. Seine Söhne bleiben ihr gesamtes Leben über mit dem Familiengrundstück, auf dem sie geboren wurden, in enger Verbindung. Im Alter von zehn oder elf Jahren beginnen sie zwar außerhalb dieses Bereiches zu schlafen, in Hütten, die sie vielleicht mit Freunden teilen, doch kehren sie zu den Mahlzeiten stets dorthin zurück. Sexuellen Aktivitäten während der Pubertät wird kaum ein Riegel vorgeschoben, obwohl man übermäßiger Promiskuität ablehnend gegenübersteht. Mit 18 Jahren hat ein junger Mann meist schon seine erste Frau gewählt, doch bis sie ihm zwei oder drei Kinder geboren hat, lebt er weiter in seinem Junggesellenquartier, und sie bleibt bei ihren Eltern. Wenn das junge Paar schließlich einen eigenen Hausstand gründet, wird es sich nach Möglichkeit dafür einen Platz in der Nähe des elterlichen Grundstücks aussuchen. Solange sein Vater lebt, arbeitet der junge Ehemann auf dessen Land und nimmt auf dessen Grundstück die Mahlzeiten ein; seine Frau wird der Schwiegermutter beim Kochen behilflich sein.
Außer für das Familiengrundstück und die Bodennutzungsrechte trägt das Oberhaupt des Haushaltes die Verantwortung für einen transportablen Familienaltar, wie er praktisch auf jedem Grundstück zu finden ist. Es handelt sich dabei um ein abgerundetes, kegelförmiges Lehmgebilde von etwa 15 Zentimeter Höhe, auf dem den Vorfahren der Familie, Gott und den Geistern der Pflanzen, des Wassers, der Bäume und Felsen, die von den Dogon als Gottes Kinder angesehen werden, Bittgaben und Trankopfer dargebracht werden. Solche religiösen Zeremonien obliegen dem Oberhaupt des Haushaltes, und er kommt diesen Pflichten mit der gleichen Selbstverständlichkeit nach, mit der er seine Speicher in Ordnung hält.
Ähnlich wie das Oberhaupt eines Haushaltes erbt auch das Oberhaupt eines Geschlechts ein Grundstück, verwaltet in begrenztem Umfang Land und trägt Sorge für einen Altar. Der Stammsitz des Geschlechts ist oft ein Anwesen mit langer Tradition, manchmal das Grundstück des gemeinsamen Ahnherrn der betreffenden Gruppe von Familien. Da man die ersten Häuser in Tireli und anderen Hangdörfern stets dicht bei den Klippen errichtet hatte, lag der Stammsitz für gewöhnlich oberhalb des Dorfes. Rückt ein Dogon als Oberhaupt des Geschlechts nach, so muss er sein Familiengrundstück verlassen und sich, etwa ein Jahr nach dem Tod seines Vorgängers, im Stammhaus des Geschlechts einrichten. Der Altar des Geschlechts, mächtiger als die einzelnen Familienaltäre, befindet sich in der Regel auf dem Gebiet des Stammsitzes. Der Grundbesitz eines Geschlechts, den zu kontrollieren dem Oberhaupt beachtliche Autorität verschafft, besteht aus kleinen Feldern im Tal unmittelbar unterhalb des Dorfes und am Geröllhang.
Abb.: Dogon-Dorf, Mali (©Corbis)
Einen Teil dieser Felder wird das Oberhaupt des Geschlechts für seine engere Familie beanspruchen. Den Rest verteilt er nach eigenem Gutdünken auf die einzelnen Oberhäupter der Haushalte. Es kann aber auch vorkommen, dass er Nutzungsrechte an Personen eines anderen Geschlechts überträgt, vor allem an die Söhne seiner Schwestern, die von den Dogon als "besondere Neffen" angesehen werden. Der Sohn einer Schwester hat vor allen anderen Verwandten, außer Eltern und Kindern, Anspruch auf Hilfe, und er genießt besondere Vorrechte. So kommen Onkel und "besondere Neffen" blendend miteinander aus.
Das mag für andere Verwandte nicht unbedingt zutreffen, doch niemand kann es sich leisten, sich mit dem Oberhaupt des Geschlechts zu überwerfen. Als besonders heikle Angelegenheit erweist sich die Nachfolgefrage, da in einem solchen Fall die Ansprüche auf Land neu geregelt werden. Die Führungsposition innerhalb des Geschlechts geht nicht vom Vater auf den Sohn über, sondern sie wird immer auf den jeweils ältesten Mann übertragen, und so kommt es in einer Generation zu häufigen Veränderungen. Ein Dogon kann davon ausgehen, im Laufe seines Lebens Dutzende weit auseinanderliegender Felder bearbeiten zu müssen, ohne je eines davon länger in seinem Besitz zu haben.
Für Dogulu war die Amtszeit Wagatiges als Oberhaupt des Geschlechts nicht von Vorteil. Dessen Vorgänger war Dogulus Großvater gewesen, und obwohl dies Dogulu damals wegen seiner Jugend noch keinen direkten Nutzen brachte, so hatte doch sein Vater einige der besten Felder sein eigen nennen können. Jetzt, mit Wagatige, einem entfernteren Verwandten, an der Spitze des Geschlechts, stand Dogulus Familie weniger gut da. Doch war Dogulu bei der Vergabe von Land im Tal nicht allein auf Wagatige angewiesen. Er zeigte mir ein Feld, das ihm sein "besonderer Onkel" hatte zukommen lassen.
Dieser Onkel war nicht nur selbst Oberhaupt eines Geschlechts, sondern nahm auch eine hervorragende Stellung in einer noch größeren Gruppierung ein -- einem Clan. Mitglieder aller zehn in Tireli ansässigen Clans führen ihre Abstammung über sieben oder acht Generationen auf einen gemeinsamen Ahnherrn zurück. Die zwei oder drei ältesten Angehörigen eines Clans können Land für sich beanspruchen, und der älteste gibt dem Clan seinen Namen, lebt in einem Clan-Haus und zelebriert die Opferfeierlichkeiten an einem Clan-Altar. Oberhaupt des Clans, dem Wagatige und Dogulu angehörten, war ein Achtzigjähriger namens Amono, der älteste Mann überhaupt im Dorf. Die alten Männer, die unserer Begrüßung durch Wagatige beigewohnt hatten, waren sämtlich selbst Oberhäupter eines Geschlechts und gleichzeitig Angehörige des Amono-Clans.
Da die Söhne sich stets in unmittelbarer Nähe ihrer Väter niederlassen, ergibt es sich zwangsläufig, dass bestimmte Geschlechter und Clans auch in ganz bestimmten Teilen Tirelis angesiedelt sind. So ist jeder Bewohner von Tireli in ein Familiengefüge eingebunden, das sich von seinem Lebensraum im engeren Sinne weiter nach außen entfaltet: von der am klarsten bestimmten Einheit, seinem Grundstück, zu den engeren Verwandten, die anliegende Grundstücke bewohnen, und schließlich zu den Mitgliedern des Geschlechts und des Clans.
Allein die beiden Schmiede und ihre Familien befinden sich außerhalb dieses Netzes verwandtschaftlicher Beziehungen. Überall in Westafrika besitzen die Schmiede einen besonderen Status, da sie über die geheimnisvolle Fähigkeit verfügen, Erde -- das heißt, eisenhaltige Erze -- in nutzbringend zu verwendendes Eisen zu verwandeln. Selbst heute noch, wo die meisten Metallgegenstände aus Teilen alter Autos hergestellt werden, schreibt man bei den Dogon den Schmieden geradezu alchimistische Zauberkräfte zu. Die Schmiede pflegen den Mythos, der ihre Arbeit umgibt, so dass sie ihren Ruf als Spezialisten behalten und es zu beträchtlichem Wohlstand bringen. Die Schmiede in Tireli lebten besser als alle anderen und gehörten zu den wenigen Auserwählten, die einen Motorroller besaßen. Die Dogon bringen ihre Ehrfurcht vor den Schmieden dadurch zum Ausdruck, dass sie ihnen übersinnliche Kräfte zusprechen. Bleiben beispielsweise einer Frau Kinder versagt, so wendet sie sich an einen Schmied, von dessen Gebeten sie sich mehr Hilfe als von ihren eigenen erhofft. Als besonders exponierte Persönlichkeiten gelten die Schmiede auch als unparteiisch bei Streitigkeiten im Dorf und werden in solchen Fällen häufig als Vermittler eingeschaltet.
Der Sonderstatus eines Schmiedes fordert aber auch seinen Preis. Teils aus Neid auf seinen Wohlstand, teils aus einem tiefverwurzelten Gleichheitsgefühl meiden die anderen Dorbewohner den Kontakt mit dem Schmied. Hinter seinem Rücken pflegt man sich über seine Rastlosigkeit, das zwanghafte Verhalten, stets Geld verdienen zu müssen, lustig zu machen. Man verachtet seine geschäftlichen Aktivitäten, und man vergisst nie, dass der Schmied -- auf Landbesitz im Gegensatz zu den anderen Bewohnern nicht angewiesen -- im eigentlichen Sinne der Dorfgemeinschaft nicht angehört. Unter den Dorfbewohnern kann allein der Schmied als ungebunden bezeichnet werden. Tatsächlich bleibt dem Sohn eines Schmiedes gar keine andere Wahl, als sich in einem anderen Dorf anzusiedeln, wenn er sich in seinem Gewerbe selbständig machen will.
Für die anderen Dorfbewohner hat die Welt jenseits von Tireli weniger Bedeutung. Noch nicht einmal das Dorf Tireli in seiner Gesamtheit spielt für ihren Alltag eine Rolle, vielmehr identifiziert man sich wesentlich stärker mit Teilbereichen des Dorfes. Als ein solcher Teilbereich kann der Abschnitt oder Bezirk eines Dorfes gelten, in dem ein oder zwei Clans angesiedelt sind. Jeder dieser Bezirke hat einen eigenen Altar, einen Versammlungsplatz und ein Gemeinschaftshaus -- ein strohgedecktes, offenes Gebäude, das als Rathaus und als Treffpunkt für die Männer dient. Bestimmte Gemeinschaftsaufgaben wie die Ernte werden auf Bezirksebene organisiert. Doch als entscheidende soziale Größe stellt sich in Tireli und in vielen anderen Dogon-Dörfern die Dorfhälfte dar. Eine unsichtbare Grenzlinie zieht sich den Geröllhang hinunter und teilt Tireli in die Sodanga-Hälfte, wo wir lebten, und in die Teri-Ku-Hälfte. Praktisch alle Dorfangelegenheiten wurden für jeweils die beiden Hälften, nur selten für Tireli insgesamt, getroffen.
Die gesamte Organisation des Dorfes spiegelt diese Untergliederung in Hälften, Clans und Geschlechter wider. Dies verdeutlicht insbesondere eine merkwürdige Institution, die man als yonu oder als "Bruderschaft der Diebe" bezeichnet. Sie weist zwei unabhängige Untergliederungen auf, eine für jede Dorfhälfte, und dazu einen Vertreter aus jedem der 12 bis 15 Geschlechter einer Dorfhälfte. Man kommt hauptsächlich zusammen, um anderen Dorfbewohnern Ziegen zu stehlen. Der Besitzer eines Tieres erhält das Fell zurück, doch beanspruchen die Diebe das Fleisch für sich. ...
Die Ziegendiebe hatten nur eine einzige Frau in ihren Reihen, die Schwester eines der männlichen Mitglieder ihrer Vereinigung. Sie spielte zwar nur eine untergeordnete Rolle - hauptsächlich schenkte sie den yonu-Männern das Bier aus -, doch genoß sie großes Ansehen, durfte sogar beinahe als Glücksbringerin der Gruppe gelten. Auch viele andere Institutionen der Dogon bedienen sich in ähnlicher Weise einer Frau als Symbolfigur. Doch zumindest offiziell haben die Frauen bei Dorfangelegenheiten kein Mitspracherecht, ob nun in der Dorfhälfte, auf der Ebene eines Bezirks oder eines Clans, und Besitz darf auf sie nicht weitervererbt werden.
Die Ehe in der Dogon-Gesellschaft ist weniger ein geheiligtes Gut als vielmehr eine praktische Einrichtung, die sicherstellt, dass die täglich anfallenden Arbeiten erledigt werden und Nachfahren vorhanden sind. Natürlich legen die Dogon Wert darauf, dass sich Mann und Frau verstehen, doch vor allem erwartet der Mann, dass seine Frau ihm Kinder gebiert und ihren Pflichten nachkommt. Also braucht eine Frau Kinder, um sich als Frau anerkannt zu fühlen, und deshalb heiratet sie. Normalerweise ist sie mit jedem Mann zufrieden, solange er nur den Lebensunterhalt sicherstellt. Bis zur Geburt des ersten Kindes kann sie sich auch durchaus anderen Männern zuwenden. Danach, besonders wenn sie mit ihrem Mann zusammenlebt, erwartet man Treue von ihr, doch gilt Ehebruch nicht als Verstoß gegen eine gottgewollte Ordnung. Eine Frau muss aber stets gewärtig sein, dass sie bei einer Auflösung der Ehe die Kinder bei ihrem Mann zurücklassen muss.
Es kommt häufig zu Trennungen, und viele Kinder wachsen bei Stiefeltern auf. Dies dürfte theoretisch keine allzu schwerwiegenden Folgen haben, da die Dogon den Begriff der Verwandtschaft sehr weit fassen: jedes Kind lebt inmitten einer Vielzahl von Tanten, Vettern und Basen, Angehörigen des Geschlechts und des Clans, deren gemeinsame Fürsorge das Fehlen der Mutter vergessen lässt. Es fiel mir aber auf, dass die junge Tochter von Dogulus zweiter Frau, die ihn verlassen hatte, einigermaßen verbittert schien: Sie wirkte in ihrem gesamten Auftreten aggressiv und abweisend. Damit unterschied sie sich sehr stark von den anderen Kindern. Dogulu mochte nicht eingestehen, dass es hier Schwierigkeiten gab. "Meine anderen Frauen kümmern sich um alle Kinder, sie behandeln alle gleich", sagte er. Doch offensichtlich hatte ich hier ein heikles Thema berührt.
Während die erste Ehe im Regelfall von den Eltern arrangiert wird, spielt bei späteren Heiraten die Liebe eine größere Rolle. Die meisten Männer haben aber selten mehr als zwei Frauen, denn, so sagen sie, "man braucht Kraft für drei". Oft habe ich Männer danach gefragt, ob sie eine Frau der anderen vorziehen, doch ließen sie sich bei diesem Thema nie aus der Reserve locken. Ich vermute, dass hier, wie bei der Frage von Kindern ohne Mütter, eine Diskrepanz zwischen allgemein anerkannten Normen und einer nicht ganz problemlosen Wirklichkeit bestand.
Bei der Wahl einer Frau gilt es, verschiedene Einschränkungen zu beachten. Zunächst dürfen weder Angehörige desselben Clans heiraten, noch dürfen dies Vettern und Basen ersten oder zweiten Grades aus verschiedenen Clans. Außerdem erscheint es für einen Mann nicht ratsam, eine Frau aus einem anderen Dorf zu ehelichen; abgesehen von den Schwierigkeiten, die sie hätte, sich in die neue Gemeinschaft einzufügen, gäbe es für den Mann da noch das praktische Problem, sie zu besuchen, solange sie noch nicht mit ihm zusammenlebt. Und schließlich existiert ein absolutes Verbot, in die Familie von Schmieden einzuheiraten. Da in diesen Familien nur untereinander geheiratet werden darf, müssen Schmiede automatisch außerhalb des eigenen Dorfes nach einer Braut Ausschau halten. Abweichungen von der Norm sind aber insofern möglich, als die Schmiede, anders als die übrigen Dogon, auch engere Verwandte heiraten dürfen.
Im Normalfall heiratet ein Bewohner von Tireli, da es ihm verboten ist, um eine Frau aus dem eigenen Clan anzuhalten -- und es als unerwünscht gilt, eine Frau von außerhalb zu ehelichen --, eine entfernte Verwandte, die oft aus der anderen Dorfhälfte stammt. Heiraten bilden also ein wichtiges Bindeglied zwischen den beiden Teilen der Dorfgemeinschaft.
Man weiß, wie wichtig es ist, solche Bindungen lebendig zu halten und zu pflegen, und begeht eigens zu diesem Zweck alljährlich ein Fest von nicht weniger als einer Woche Dauer. Als Anlass nimmt man eine Feier, die buro genannt wird was soviel wie Verjüngung durch Opfer bedeutet. Sie findet im Juni statt, ehe der Regen einsetzt und die schwere Zeit der landwirtschaftlichen Arbeit beginnt. Das buro ist ein Fruchtbarkeitsfest, wie die Wahl des Zeitpunktes und die praktizierten Gebräuche verraten. Doch gleichzeitig werden auch die verwandtschaftlichen Bande gefeiert. Vor Beginn des buro sollten alle Schulden bezahlt und alle anderen wichtigen Angelegenheiten geregelt sein. Sind so sämtliche sozialen und finanziellen Dispute aus der Welt, können sich die Bewohner von Tireli gegenseitig besuchen, zusammen trinken und eine Fülle ritueller Danksagungen durchführen, die sich nicht auf spezielle Ereignisse oder Leistungen beziehen, sondern eine generelle Würdigung des gemeinschaftlichen Lebens darstellen. Unser Dolmetscher Nanema konnte als Christ das buro zwar nicht billigen, doch brachte er die allgemeine Stimmung treffend zum Ausdruck: "Buro-Leute sagen Ah! Ich bin in Tireli. Hier leben meine Leute. Ich bin glücklich, bei ihnen zu sein!...
Dogulu und ich befanden uns auf dem Weg zu Batonyon, einem der jungen Männer, die am vorangegangenen Abend aus Abidjan zurückgekehrt waren. Batonyons Vater war der "besondere Onkel", der Dogulu überdurchschnittlich fruchtbare Felder hatte zukommen lassen; auf Grund ihrer engen Beziehung hieß es für Dogulu, auch den Kontakt mit dem Sohn des Onkels zu pflegen. Wir hatten das Grundstück erreicht und wurden dem jungen Mann vorgestellt. Er war ungefähr 22 Jahre alt, von hühnenhaftem Wuchs und trug ein T-Shirt mit einem Porträt des Staatspräsidenten der Elfenbeinküste. Batonyon war damit beschäftigt, an seine zahllosen Verwandten, die sich auf dem Grundstück aufhielten, Geschenke zu verteilen -- Stoffe, Sonnenbrillen, Socken und Plastikschuhe. Ebenso bereitwillig würde er erspartes Geld aufteilen -- an seinen Vater und die älteren Brüder, seine Onkel und den Schwiegervater und an das Oberhaupt seines Clans und seines Geschlechts. In Tireli bringen es die jüngeren Männer kaum zu Wohlstand; sie verdienen zwar das Geld, doch die Alten halten es unter Verschluss."
[Pern, Stephen: Maskentänzer von Westafrika : die Dogon. -- Amsterdam : Time-Life, ©1982. -- (Völker der Wildnis). -- S. 45 - 56 (dort auch hervorragende Abbildungen)]
John Ryle schildert anschaulich die Verhältnisse bei den Dinka:

Abb.: Lage der Stammesgebiete der Dinka (Sudan) (©Mindscape)
"Die komplexen Rechte und Pflichten der Verwandtschaft sind in der Gemeinschaft der Dinka von entscheidender Bedeutung. Ohne seine Familie ist der Dinka nichts -- allen Krisen und Gefahren gegenüber steht er völlig allein. Die Gewissheit, dass Verwandte einander beistehen, bedeutet darüber hinaus, dass in Notfällen rasch eine große Streitmacht auf die Beine gestellt werden kann. Wenn beispielsweise ein Mann von einem Außenstehenden verletzt oder sein Vieh gestohlen wird, so kann er nicht nur auf die Hilfe seiner Brüder und Vettern, sondern jedes verfügbaren Mitglieds seines Clans zählen -- der größten Vereinigung von Verwandten, die die Dinka kennen. In einem der großen Lager können mehrere Clans vertreten sein, und die Stärke eines Clans kann sich auf mehr als hundert Menschen belaufen. Ähnlich den einst mächtigen Clans von Schottland -- den MacDonalds, den Stuarts, den Campbells schließen die Clans der Dinka theoretisch sämtliche Nachkommen eines einzigen Vorfahren aus der fernen Vergangenheit ein. Pinyakum, Pacong, Makuei, Ater und Mayen waren allesamt Angehörige des Patiop-Clans und wären trotz ihrer gelegentlichen Unstimmigkeiten untereinander jederzeit bereit gewesen, gemeinsam gegen einen anderen Clan zu kämpfen.
Den großen europäischen Familien des Mittelalters vergleichbar, die heraldische Tiere -- Löwen, Einhörner, Bären -- zu ihrem Wahrzeichen machten, wird jeder Dinka-Clan mit einem Tier, einem Vogel, einer Pflanze oder einem anderen Symbol identifiziert, das ihre Mitglieder als geistigen Ahnen betrachten. Der Patiop-Clan erklärt zum Beispiel, er sei mit dem Fuchs verwandt, und so hält sich jeder Patiop ein Schaf, dessen langer, wolliger Schwanz nicht gestutzt ist: Die Clanmitglieder sagen, ein solcher Schafsschwanz gleiche der Lunte eines Fuchses. Alle Mitglieder eines Clans erweisen ihrem eigenen Symbol besondere Achtung; ist es ein Tier, so vermeiden sie es, gerade dieses zu töten oder zu essen; ist es ein Baum, so fällen sie ihn nicht; ist es eine andere Pflanze, so hüten sie sich, damit ihr Feuer zu nähren. ...
Dinka-Kinder werden so erzogen, dass sie auf ihren Clan stolz sind. Sobald ein Dinka-Junge sprechen kann, lässt man ihn die Namen seiner Vorfahren väterlicherseits auswendig lernen. Alle Kinder können die Namen ihrer Ahnen bis zur zwölften Generation zurück hersagen. Der volle Name eines Kindes -- und gleichzeitig eine lückenlose Aussage über seine Identität -- besteht aus dem vollständigen Katalog seiner Vorfahren in der umgekehrten Reihenfolge der Abstammung vom Gründer des Clans.
Dieser Brauch ermöglicht es den Dinka auch, verwandtschaftliche Beziehungen zu Freunden und Nachbarn ausfindig zu machen. So war beispielsweise Zakaria Manyang der Sohn von Malual, dessen Vater Rok hieß, dessen Vater wiederum den Namen Reec trug; also begann Zakarias Dinka-Name mit Manyang Malual Rok Reec. (Zakaria war ein Vorname, der mit seinem Dinka-Namen nichts zu tun hatte und hauptsächlich von seinen gebildeten Freunden benutzt wurde.) Diese kurze Aufzählung reichte schon aus, um sein Verwandtschaftsverhältnis zu seinem Vetter Marial Dongrin Rok Reec klarzustellen, der ebenfalls ein Enkel von Rok und ein Urenkel von Reec war. Im täglichen Leben war Marial Dongrin der Einfachheit halber natürlich nur unter seinen ersten zwei Namen bekannt -- seinem eigenen und dem seines Vaters.
Es ist für die Dinka von entscheidender Bedeutung, ihre Abstammung zu kennen, weil die Heirat zwischen Mitgliedern desselben Clans, die in derselben Gegend leben, untersagt ist. Dieses Inzest-Tabu ist -- wie die Verpflichtung, Clanangehörige bei einer Fehde zu unterstützen -- ein Grundprinzip im Leben der Dinka. Als ich einem alten Mann auseinandersetzte, dass wir in England nicht mehr in Clans organisiert sind, wollte er wissen, wie wir Inzest vermieden. "Oder seid ihr wie die Araber", fragte er, "die ihre Vettern heiraten?" Ich erklärte ihm, dass dies zwar möglich, jedoch ungewöhnlich sei. "Aber das ist doch unsinnig", begehrte er auf. "Wenn wir das täten, würden wir ja uns selbst Kühe geben!"
Der alte Mann bezog sich auf den bei den Dinka üblichen Brautpreis: Wenn ein Dinka-Mädchen heiratet, erhalten seine Verwandten Rinder vom Clan des Bräutigams. In der Tat ist dies das wichtigste Mittel, durch das die Dinka zu Vieh kommen, und eine Familie mit vielen Töchtern wird daher reich an Kühen. Aus diesem Grund ist die Ehe wirtschaftlich gesehen zu bedeutsam, um einfach dem Mann und der Frau, die betroffen sind, überlassen zu bleiben. Über den Brautpreis muss eingehend verhandelt werden, und alle interessierten Parteien müssen ihm zustimmen, bevor eine Heirat stattfinden kann. ...
Abb.: Dinka-Frau (©Corbis)
Alle Dinka heiraten, und Männer, die in der glücklichen Lage sind, viele Rinder zu besitzen, nehmen möglicherweise mehrere Frauen. Sie sind entschlossen, ihr Geschlecht fortzusetzen, das sie mit der Vergangenheit und mit der Zukunft verknüpft; und dazu brauchen sie männliche Nachkommen, weil die Clans in der männlichen Linie weitergeführt werden. Töchter sind stets willkommen, weil sie Brautpreise einbringen; aber sie sichern das Geschlecht nicht, da ihre Kinder im Clan des jeweiligen Ehemannes aufwachsen.
Ohne einen Sohn, der die Erinnerung an ihn wachhält -- indem er seinen Namen trägt und wiederum eigene Söhne zeugt --, fällt ein Dinka-Mann der Vergessenheit anheim; bei seinem Tod bleibt nichts von ihm zurück. Dieses Geschick ist für die Dinka so unannehmbar, dass die Familie eines Mannes, der ohne männliche Erben geblieben ist, nach Möglichkeit einen Sohn für ihn hervorbringt. Dies kann auf zweierlei Weise geschehen. Wenn der Verstorbene bereits verheiratet war, nimmt ein naher Verwandter die Witwe zur Frau, und die Kinder, die aus dieser Verbindung hervorgehen, werden unter dem Namen des Toten großgezogen. Wenn dagegen der Verstorbene noch nicht geheiratet hatte, so nimmt ein Verwandter in seinem Namen eine Frau.
Während unseres Aufenthalts in Majak Ajok saßen Marial und ich eines Abends am Feuer und sprachen über die Vorzüge der Herde eines Nachbarn. In einer Gesprächspause verkündete er plötzlich: "Wir heiraten morgen." Da er bereits acht Frauen hatte, die jeweils ihre eigene Hütte und einige Rinder besaßen, war ich erstaunt -- bis ich begriff, dass er für den ganzen Patiop-Clan sprach.
Es stellte sich heraus, dass seine Halbschwester Ding einen jungen Mann namens Mabor heiraten sollte, der in Wut Ju lebte. Mabor heiratete jedoch nicht um seiner selbst willen, sondern für seinen Bruder Ador, der einige Monate zuvor unverheiratet gestorben war. Der Ältestenrat -- des Paduer-Clans, dem Mabor angehörte, hatte ihn ausgewählt, die Stelle seines Bruders einzunehmen. Alle Kinder aus dieser Ehe sollten als Adors Kinder aufgezogen werden, seinen Namen tragen und die Erinnerung an ihn im Clan wachhalten. Später würde sich Mabor dann auch noch eine eigene Frau nehmen.
Ich wusste, dass derartige Ehen bei den Dinka ziemlich häufig vorkommen, weil niemand, selbst wenn er als Kind oder Säugling stirbt, einem anonymen Schicksal überlassen wird; auch in solchen Fällen wird im Laufe der Zeit für eine Frau und Kinder gesorgt. Die Kindersterblichkeit ist bei den Dinka verhältnismäßig hoch; und die Gefahren, die obendrein durch wilde Tiere, tödliche Krankheiten und gelegentliche Kämpfe drohen, fordern regelmäßig das Leben junger Männer und Knaben. Dennoch war ich einigermaßen verblüfft, als mir Marial beiläufig erzählte, dass sein Großvater Rok nicht weniger als 31 Frauen gehabt habe! Rok war offenbar ein kluger und wohlhabender Mann gewesen, der genug Rinder besaß, um sich zahlreiche eigene Frauen leisten zu können; ihre Zahl war jedoch im Laufe der Zeit noch weiter gestiegen, weil er verständlicherweise wiederholt dazu ausgewählt worden war, die Witwen seiner Verwandten zu ernähren und mit ihnen Kinder zu haben.
Es kommt so gut wie nie vor, dass Dinka über ein bestimmtes Alter hinaus unverheiratet bleiben; bei Frauen liegt dieser Zeitpunkt bei 25 Jahren, bei Männern etwas später. Infolgedessen fiel es unseren Gastgebern schwer zu akzeptieren, dass sowohl Sarah als auch ich noch ledig waren. "Warum heiratet ihr nicht?" fragten sie. "Stammt ihr aus dem gleichen Clan?" Oder aber sie nahmen an, wir seien Bruder und Schwester, da kein Dinka-Vater seiner Tochter gestatten würde, mit einem Fremden umherzuziehen. Dann fingen natürlich die Hänseleien an: junge Männer fragten mich immer wieder, wie viele Kühe ich für Sarah haben wolle, oder drängten mich, Dinka-Mädchen den Hof zu machen.
Dinka-Männer müssen mit der Heirat warten, bis ihre älteren Brüder eine Frau genommen haben. Die jüngeren Männer besitzen wenig eigenes Vieh und sind daher auf das Wohlwollen ihrer Familien angewiesen, um einen Brautpreis zusammenzubringen. Tatsächlich kann nach dem Gesetz der Dinka ein Mann ohne Rücksicht auf seine eigenen Wünsche von seiner Familie verheiratet werden, obgleich dies selten vorkommt, da eine solche Ehe allzuleicht mit einer Scheidung endet -- was die komplizierte und beschwerliche Aufgabe zur Folge hat, alle Rinder des Brautpreises zurückzugeben. (Unverträglichkeit ist ein anerkannter Grund für die Beendigung einer Ehe, die dadurch erreicht wird, dass eine der beiden Parteien Klage beim Häuptlingsgericht einreicht. Weitere gültige Gründe sind Unfruchtbarkeit und Ehebruch. Der Scheidung wird stattgegeben, wenn es dem Häuptling nicht gelingt, eine Aussöhnung zu erreichen.)
Für den Brautpreis gilt die folgende einfache Regelung: Die Familie des Bräutigams gibt der Familie der Braut eine Viehherde von vereinbarter Größe und erhält dafür die Braut und eine kleinere Anzahl von Kühen, mit denen das junge Paar einen Hausstand gründen soll. In der Praxis kann es allerdings Jahre dauern, eine Heirat zu arrangieren, weil die Rinder des Brautpreises nicht nur von den Eltern des Mannes aufgebracht werden, sondern auch von seinen Onkeln und noch entfernteren Verwandten. Da die Kette der Verpflichtungen derart weitgespannt ist, kann es äußerst schwierig sein, Verwandte dazu zu überreden, ihren Anteil beizutragen -- insbesondere wenn sie selbst unverheiratete Söhne haben.
Daher haben die jungen Männer oft eine ganze Reihe von Freundinnen, bevor sie sich ernsthaft nach einer Frau umsehen. Das Leben der jungen Leute ist angenehm, frei und sehr gesellig. Gruppen junger Männer und Mädchen treffen sich völlig zwanglos bei den Tänzen in den Lagern und Dörfern und können ihre Bekanntschaft vertiefen, indem sie sich abends besuchen -- manchmal in Gruppen, manchmal allein -- oder miteinander auf den vielen Pfaden am Fluss spazierengehen. Im täglichen Gespräch werden sexuelle Angelegenheiten zwar offen erwähnt, doch das Verhalten der jungen Leute ist meist sittsam, ja sogar prüde. Sexuelle Beziehungen werden nicht aus moralischen Gründen missbilligt, sondern weil eine Schwangerschaft die Heiratschancen eines Mädchens ernsthaft beeinträchtigen würde. Die Nacht miteinander in der Hütte des Mädchens zu verbringen, entweder allein oder zusammen mit Freunden, ist ein anerkannter Bestandteil einer intimen Freundschaft. Das bedeutet aber keineswegs, dass die beiden auch ein Liebespaar sind; oft liegen sie einfach die ganze Nacht lang wach und unterhalten sich in der erhabenen, poetischen Sprache der flirtenden Dinka. ...
Wenn ein junger Mann ein Mädchen kennengelernt hat, das er heiraten möchte, und feststellen konnte, dass es zu einem anderen Clan gehört, dass also Inzest vermieden wird, muss er seine Familie zu Rate ziehen, um deren Genehmigung zu erlangen. Findet er dort Unterstützung, so besteht sein nächster Schritt darin, die Familie des Mädchens aufzusuchen, um zu zeigen, dass er ernste Absichten hat. Er muss sie mit ehrerbietigem Benehmen beeindrucken und erkennen lassen, dass seine Familie ebenfalls Ehrerbietung verdient. Aus diesem Grund wird er gewöhnlich zwei oder drei Freunde mitnehmen, die seine Werbung unterstützen, und vielleicht sogar seinen Lieblingsochsen.
Wenn ein Mann von der Familie seiner Auserwählten als Bewerber akzeptiert worden ist, besucht er seine Liebste häufig und verbringt auch oft die Nacht mit ihr, erzählt stundenlang Geschichten und ergötzt das Mädchen mit Beteuerungen seiner Liebe, Prahlereien über seine Männlichkeit und dem Versprechen von Wohlstand. "Das Liebeswerben", sagte mir ein Dinka, "besteht aus Unwahrheiten und phantastischen Versprechungen. Wenn du nur die Wahrheit sagst, gehen dir schnell die Worte aus."
Ein Mädchen aus guter Familie hat im allgemeinen viele Bewerber, richtet sich jedoch bei der Wahl normalerweise nach den Wünschen der Familie. Ein Mann aus einer armen Familie, der bei einer reicheren um eine Braut anhält, kann rasch entmutigt und einfach abgewiesen werden, um dann früher oder später eine anspruchslosere Familie zu finden, der sein bescheidener Brautpreis genügt. Die Eltern eines Mädchens geben vermutlich einem Mann aus dem gleichen Dorf oder Lager den Vorzug vor einem Mann aus einer entfernteren Gegend, weil es für sie dadurch nicht nur leichter ist, die liebevollen Bande zu ihrer Tochter zu bewahren, sondern weil dadurch auch zwei Sippen aus der gleichen Siedlung verbunden werden, was die Loyalitäten und die Stabilität der dörflichen Gemeinschaft naturgemäß außerordentlich stärkt.
Wenn der Antrag angenommen worden ist, suchen Repräsentanten der Familie des Mannes die Eltern des Mädchens auf und geben eine feierliche Absichtserklärung ab. Die Familie des Mädchens macht sich nun Gedanken über den Ruf des Bewerbers: Wird er ein zuverlässiger Ehemann sein, der genug besitzt, um seine Kinder zu ernähren? Marial verriet mir einmal, welchen Rat er von Rok Rec bekommen hatte: "Halte dich an den Charakter des Jungen. Bezahle nicht zuviel und verlange andererseits nicht zu viele Rinder." Die Anzahl und die - ebenso wichtige - Qualität der angebotenen Kühe spielen jedoch bei den unverheirateten Brüdern des Mädchens vermutlich die wichtigste Rolle, deren eigene Aussichten auf eine gute Partie unter Umständen davon abhängen, dass sie einen hohen Brautpreis für ihre Schwester erhalten.Selbst wenn beide Familien einer möglichen Verbindung wohlwollend gegenüberstehen, kann es noch Monate dauern, ehe der Bewerber seine Verwandten dazu bringt, großzügig Rinder beizusteuern. Er wird vielleicht sogar Lieder komponieren, die ihre Knauserigkeit anprangern oder ihre Freigebigkeit preisen, und singt sie vor aller Ohren. Aber bis der Brautpreis hoch genug ist, um die Verwandtschaft des Mädchens zufriedenzustellen, ist eine Heirat ausgeschlossen. Wenn sich dann auf dem Höhepunkt der langwierigen Prozedur die beiden Familien treffen, um die Sache zum Abschluss zu bringen, wird der Heiratskandidat selbst praktisch ignoriert.
Jetzt sind die Sippenältesten an der Reihe, und es besteht Anlass zu harten Verhandlungen und gegenseitigen Beschuldigungen, zu flehentlichen Bitten und emotionaler Erpressung. Die Dinka haben ein langes Gedächtnis dafür, wer Vieh besitzt und noch Vieh schuldet, für frühere Verpflichtungen, Gefälligkeiten und Enttäuschungen; und im Zusammenhang mit einer so wichtigen Entscheidung wie einer Heirat wetteifern sie geradezu darum, einander an Gerissenheit und Geschäftstüchtigkeit zu übertreffen.
Diese abschließenden Verhandlungen werden stets in aller Öffentlichkeit abgehalten, an einem geeigneten Platz im Lager oder Dorf von einer der beiden Familien."
[Ryle John: Krieger des Weißen Nils : die Dinka. -- Amsterdam : Time-Life, ©1982. -- (Völker der Wildnis). -- ISBN 906182611X. -- S. 48 - 58 (dort auch hervorragende Abbildungen)]
|
|
|
Alois Payer kennzeichnet Kaste in Südasien so:
"1. Begriffsbestimmung
Es gibt viele Versuche, Kaste so zu definieren, dass die Definition die mit »Kaste« bezeichneten sozialen Phänomene insbesondere in Südasien abdeckt. Die entsprechende indische Bezeichnung ist
Dschâti (Dschât), nicht varna. Varna ist die Bezeichnung für die vier Kategorien Brahmane,
Kschatriya, Vaischya, Schûdra, die oft fälschlich als Kasten bezeichnet werden. Es sind Grobkategorien einer
Hierarchie, denen in gewisser Weise die eigentlichen Kasten zugeordnet werden können. Dazu treten die unterhalb der
Schûdras stehenden Kasten, zu denen verschiedene Kasten von Unberührbaren (heute
Haridschan »Kinder Gottes« genannt) gehören. Diese werden aufgrund der Verwechslung von
Dschâti und Varna oft irrtümlich Kastenlose genannt.
Die klarste Definition lässt sich im Anschluss an Max Weber geben. Weber grenzt Kaste von sozialen Phänomenen insbesondere des Abendlandes ab:
Wolfgang Schluchter definiert im Sinne Webers:
»Kaste ist eine durch rituelle Kommensalitäts- und Konnubialschranken nach außen abgegrenzte, durch positive oder negative Privilegierung und Kaste durch ökonomische Sondergebarung nach innen zusammengeschlossene erbliche Gemeinschaft innerhalb eines sozialen Gesamtverbandes.«
Damit ist »Kaste« als religionssoziologischer Begriff bestimmt. Er erfasst nicht die jüdischen, muslimischen, christlichen und auch die hinduistischen Kasten, in denen die Schranken untereinander nicht »ritueller« Art sind: auf sie könnte man den Kastenbegriff nur insofern anwenden, als sie von außen als Kasten gesehen werden, nicht aber in ihrem Selbstbild.
Fasst man den Begriff Kaste so, dass er den allgemeinen Sprachgebrauch wiedergibt und Dschâti entspricht, wird man kaum einen allgemeingültigen Begriff bilden können. Es empfiehlt sich, Kaste nicht isoliert zu beschreiben, sondern das Kasten»system«.
2. Merkmale des Kastensystems in Südasien
Man kann verallgemeinernd das Kastensystem durch folgende Merkmale kennzeichnen:
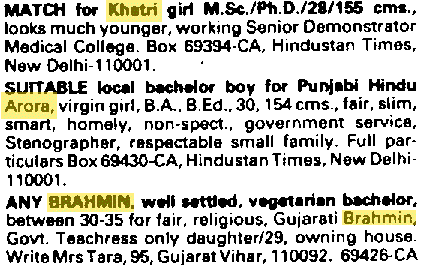
Abb.: Kastenendogamie bzw. Standesendogamie "moderner" Inder: Partnersuchanzeigen in der Hindustan Times, 90er Jahre
Diese beiden Prinzipien, als feststehende moralische Weltordnung akzeptiert, neutralisieren individuelle Aufstiegsmotivationen für dieses Leben. Ein sozialer Aufstieg im Lauf der Wiedergeburten ist hingegen eine wesentliche Motivation für die gute Erfüllung des auch kastenspezifischen dharma: ein solches Leben ist Voraussetzung für einen höheren Status in zukünftigen Geburten. In den einzelnen Hindureligionen ist die Einstellung zum Verhältnis von Kastenzugehörigkeit und der Möglichkeit der Erlösung in diesem Leben unterschiedlich: Neben der Ansicht, dass die Kastenzugehörigkeit für die Erlösung unerheblich ist, gibt es Anschauungen, dass bestimmte niedere Kasten von der Erlösung noch in dieser Existenz ausgeschlossen sind. Dies berührt aber nicht die Einstellung zur Rolle der Kastenordnung im Lauf der Wiedergeburten: Obwohl beispielsweise für die Theravâdabuddhisten Sri Lankas die Kastenzugehörigkeit in Hinsicht auf die Erlösung gleichgültig ist, ist es Lehre des Theravâdabuddhismus, dass ein Buddha jeweils in der sozial höchststehenden Gruppe geboren werden muss, da dies aus dem großen Verdienst, das man angesammelt haben muss, um ein Buddha werden zu können, notwendig folgt.
[Payer, Alois <1944 - >: Kaste. -- In: Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe / hrsg. von Hubert Cancik ...-- Stuttgart [u.a.] : Kohlhammer. -- Bd. III. -- ©1993. -- ISBN 3170095552. -- S. 335 -338]
|
"Jeder Stamm braucht Leute, die er verachten kann." |
[Barley, Nigel: Traumatische Tropen : Notizen aus meiner Lehmhütte. -- Münchenn : dtv, 1997. -- (dtv ; 12399). -- ISBN 3423123990. -- Originaltitel: The innocent anthropologist (1986). -- S. 212. ]
Rasse ist ein Begriff, der in die Tierzucht gehört und dort bleiben sollte:
"Rasse ist eine Untergruppe der Arten [Species], die sich durch erblich bedingte Eigenschaften unterscheiden, z.B. in Größe, Haarfarbe, Milchfettgehalt."
[Lexikon Landwirtschaft / Ingrid Alsing ... -- 3. Aufl. -- München [u.a.] : BLV, ©1995. -- ISBN 3405145708. ]
Trotzdem wenden immer wieder Menschen "Rasse" sowohl in ihren Einstellungen und Verhaltensweisen wie praktisch ("Menschenzüchtung") auf Menschen an. Rassismus ist in der Menschheit fast universal verbreitet!
"Es besteht kein Grund, der Ansicht romantisierender Liberaler aufzusitzen, derzufolge alles Gute in Afrika aus einheimischen Traditionen kommt und alles Böse eine Erbschaft des Imperialismus ist. Selbst für gebildete Afrikaner ist es offenbar unmöglich zu akzeptieren, dass man Schwarzer und doch ein Rassist sein kann, obwohl die gleichen Leute, gemessen an unseren Maßstäben, Sklaverei praktizieren und ausspucken, weil sie sich den Mund durch die bloße Nennung des Namens Dowayo [ein Volk in Kamerun] verunreinigt haben. Für diese doppelte Moral war die Haltung eines Collegestudenten beispielhaft, mit dem ich mich über das Massaker an den Weißen in Zaire unterhielt. Es sei ihnen recht geschehen, meinte er; sie seien Rassisten gewesen. Dass sie Rassisten gewesen seien, gehe daraus hervor, dass es sich bei allen um Weiße gehandelt habe. Wolle er damit sagen, dass er auch eine Dowayo-Frau heiraten würde? Er sah mich an, als sei ich von Sinnen. Ein Fulbe könne keine Dowayo heiraten. Das seien Hunde, bloße Tiere. Was habe das mit Rassismus zu tun?" [Barley, Nigel: Traumatische Tropen : Notizen aus meiner Lehmhütte. -- Münchenn : dtv, 1997. -- (dtv ; 12399). -- ISBN 3423123990. -- Originaltitel: The innocent anthropologist (1986). -- S. 198f. ]
Die International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination [/ Adopted and opened for signature and ratification by [UNO] General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965 ; entry into force 4 January 1969] definiert racial discrimination so:
"Article I
1. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life."
[Quelle: URL: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm. -- Zugriff am 2001-02-21]
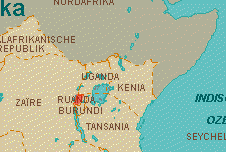
Abb.: Lage von Ruanda (©Mindscape)
Einige Daten zum Verständnis:
| 1899 | Die Königreiche Ruanda und Burundi werden Teil des deutschen Kolonialgebietes in Ostafrika |
| 1920 | Belgien erhält vom Völkerbund das Mandat über das Gebiet |
| Ende der 50er Jahre | Innere Unruhen führen in Ruanda zur Zerschlagung des von den Tutsi beherrschten Feudalsystems. In Burundi hält sich die Tutsi-Elite an der Macht |
| 1962 | Ruanda wird unabhängig. Erster Präsident: Grégoire Kayibanda (1924 - 1976) |
| 1972 | In einem unblutigen Putsch übernimmt Juvénal Habyarimana (1937 - 1994) die Regierung Ruandas. Der Hutu-Klan Habyarimanas reißt alle Schlüsselpositionen des Landes an sich |
| ab 1990 | Bewaffnete der von Tutsi dominierten Ruandischen Patriotischen Front (RPF) dringen von Uganda her in Ruanda ein. |
| 1992 | Waffenstillstand von Arusha (Tansania) |
| 1994 | Ermordung Habyarimanas: Startsignal für minuziös vorbereiteten Genozid an allen angeblichen Regimegegnern. Mehr als eine halbe Million Menschen, vor allem Tutsi, die oft in Kirchen Schutz gesucht hatten, werden bestialisch ermordet Gegen zwei Millionen Hutu flüchten vor der anrückenden Ruandischen Patriotischen Front (RPF) nach Tansania und Ostzaire |
| 1996 | Die Mehrheit der Flüchtlinge kehrt nach Ruanda zurück |
"Während sich nämlich die Bevölkerungen afrikanischer Staaten in der Regel aus zahlreichen Stämmen zusammensetzen (im Kongo leben dreihundert Stämme, in Nigeria zweihundertfünfzig usw.), lebt in Ruanda nur eine Gemeinschaft, die Nation der Banyaruanda, die traditionell in drei Kasten zerfällt:
- die Kaste der Besitzer der Rinderherden - die Tutsi (14 Prozent der Bevölkerung),
- die Kaste der Bauern - die Hutu (85 Prozent) und
- die Kaste der Knechte und Diener - die Twa (1 Prozent).
Dieses Kastensystem (mit gewissen Analogien zu Indien) entstand vor Jahrhunderten, es ist übrigens bis heute strittig, ob das nun im 12. oder erst im 15. Jahrhundert war, weil keine schriftlichen Quellen darüber existieren. Es mag genügen, dass es hier seit Jahrhunderten ein Königreich gab, das von einem Monarchen, mwami genannt, regiert wurde, der aus der Kaste der Tutsi stammte. ...
»Ein Tutsi?« bekam ich oft in Ruanda zu hören. »Ein Tutsi hockt auf der Schwelle seiner Hütte und schaut zu, wie seine Herde auf den Berghängen weidet. Dieser Anblick erfüllt ihn mit Stolz und Glück.«
Die Tutsi sind keine Hirten und keine Nomaden, sie sind nicht einmal Rinderzüchter. Sie sind Herdenbesitzer, eine herrschende Kaste, Aristokraten.
Die Hutu hingegen bilden die viel zahlreichere, den Tutsi untergeordnete Kaste der Bauern (in Indien werden diese Vaishyas genannt). Zwischen Tutsi und Hutu herrschten Lehensbeziehungen, der Tutsi hatte das Seniorat gegenüber dem Hutu, seinem Vasallen. Die Hutu waren die Klientel der Tutsi. Sie waren Bauern, die vom Ackerbau lebten. Einen Teil der Erträge lieferten sie dem Herrn ab, der sie dafür beschützte und ihnen eine Kuh zum Gebrauch überließ (die Tutsi besaßen das Monopol auf die Kühe, ein Hutu konnte diese nur von seinem Herrn pachten). Alles wie im Feudalismus -- dieselbe Abhängigkeit, dieselben Sitten, dieselbe Ausbeutung.
In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelt sich zwischen diesen beiden Kasten langsam ein dramatischer Konflikt. Gegenstand dieses Konflikts ist der Boden. Ruanda ist klein, gebirgig und sehr dicht besiedelt. Wie das in Afrika oft der Fall ist, kommt es auch in Ruanda zum Krieg zwischen Viehzüchtern und Ackerbauern. ...
Zwischen der Offensive vom Oktober 1990 und dem Massaker im April 1994 liegen dreieinhalb Jahre. In dem in Ruanda herrschenden Lager kommt es in dieser Zeit zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen den Befürwortern eines Kompromisses und der Einberufung einer nationalen Koalitionsregierung (die Leute Habyarimanas plus Partisanen) auf der einen Seite und dem fanatischen, despotischen Klan der Akazu, unter Führung von Agathe und ihren Brüdern, auf der anderen. Habyarimana selbst ist unentschlossen, er zaudert, er weiß nicht, was er machen soll, und verliert dadurch zusehends den Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse. Rasch und unerbittlich setzt sich die chauvinistische Linie des Akazu-Klans durch. Dieses Lager besitzt seine Ideologen -- Intellektuelle und Gelehrte, Professoren der Abteilungen für Geschichte und Philosophie der ruandischen Universität in Butare [Webpräsenz: http://www.nur.ac.rw/. -- Zugriff am 2001-02-21]: Ferdinand Nahimana [geboren 1950], Casimir Biziniungu, Leon Mugesira und einige andere. Sie formulieren eine Ideologie, die den Völkermord als einzig möglichen Ausweg, als einzige Form des eigenen Überlebens rechtfertigt. Der Theorie Nahimanas und seiner Kollegen zufolge sind die Tutsi ganz einfach eine fremde Rasse. Sie sind Niloten, die von irgendwo am Nil nach Ruanda kamen, die autochthonen Bewohner dieser Gebiete, die Hutu, unterwarfen und damit begannen, diese auszubeuten, zu versklaven und von innen heraus zu zersetzen. Die Tutsi rafften alles an sich, was es in Ruanda Wertvolles gab: den Boden, die Rinder, die Märkte, und im Verlauf der Zeit den ganzen Staat. Die Hutu wurden in die Rolle eines unterjochten Volkes gedrängt, das jahrhundertelang in Elend, Hunger und Erniedrigung dahinvegetierte. Doch nun muss das Volk der Hutu seine Identität und Würde zurückgewinnen, muss gleichberechtigt seinen Platz unter den übrigen Nationen der Welt einnehmen.
Was aber lehrt uns die Geschichte, fragt Nahimana in Dutzenden Auftritten, Artikeln und Broschüren. Ihre Lehren sind tragisch, sie erfüllen uns mit dem schwärzesten Pessimismus. Die ganze Geschichte der Beziehungen zwischen Hutu und Tutsi ist eine einzige tragische Kette von Pogromen und Massakern, der gegenseitigen Vernichtung, der erzwungenen Auswanderung, des grenzenlosen Hasses. Im kleinen Ruanda ist kein Platz für zwei Völker, die einander in einer solch tödlichen Feindschaft gegenüberstehen, die einander völlig fremd sind. Dazu kommt, dass die Bevölkerung Ruandas rasant wächst. Um die Mitte des Jahrhunderts hatte das Land zwei Millionen Einwohner, und nun, fünfzig Jahre später, sind es schon knapp neun Millionen. Was für einen Ausweg gibt es also aus diesem Teufelskreis, aus diesem grausamen Fatum, an dem übrigens die Hutu selbst nicht schuldlos sind, wie Mugesira selbstkritisch feststellt: »Im Jahre 1959 begingen wir einen fatalen Fehler, als wir den Tutsi erlaubten zu fliehen. Damals hätten wir handeln, sie vom Erdboden vertilgen müssen.« Der Professor ist der Ansicht, nun biete sich die letzte Gelegenheit, diesen Irrtum zu korrigieren. Die Tutsi müssten in ihre wahre Heimat zurückkehren, die irgendwo am Nil sei. Schicken wir sie dorthin zurück, ruft er: »lebendig oder tot«. Die Gelehrten aus Butare sehen also nur einen einzigen Ausweg -- die Endlösung: Einer muss vernichtet werden, muss für immer aufhören zu existieren. ...
Das wichtigste Instrument für die Propaganda und die Verbreitung der Weisungen an eine schließlich weitgehend analphabetische Bevölkerung ist die Rundfunkstation Radio Mille Collines, die später, während des Massakers, mehrmals am Tag den Aufruf verbreiten wird: »Tod! Tod! Die Gräber sind erst zur Hälfte mit den Leichen der Tutsi gefüllt. Beeilt euch, sie ganz aufzufüllen!«"
[Kapuscinski, Ryszard <1932 - >: Afrikanisches Fieber : Erfahrungen aus vierzig Jahren. -- Frankfurt a. M. : Eichborn, ©1999. -- (Die andere Bibliothek). -- ISBN 3821844833 -- S. 179 - 181. ]
Einen guten Überblick über Ruanda heute gibt:
Im Herzen Afrikas. -- NZZ Folio Nr. 6 (Juni 1997). -- 82 S. -- ISSN 1420-5262. -- URL: http://www-x.nzz.ch/folio/archiv/1997/06/cover.html. -- Zugriff am 2001-02-21
Eine große Anzahl von westlichen Lineage-Organisationen (Familienverbände) findet man unter:
http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/History/Genealogy/Lineages_and_Surnames/Organizations/. -- Zugriff am 2001-02-21
Beispiel einer indischen brahmanischen Organisation:
Iyer Heritage Foundation. -- URL: http://WWW.BHARATAVARSHA.COM/IYER.HTML.. -- Zugriff am 2001-02-21. -- ["The Iyers constitute one of the last surviving pockets of ancient Indo-Aryan (Vedic) culture. They have retained this Indo-Aryan legacy for over 5000 years. It is interesting that this is the case despite them having lived in the heart of Dravida country for over a thousand years! Perhaps this is due in no small measure to the magnanimity of Dravidian rulers (and indeed the dravidian people themselves) century after century, who not only permitted, but even encouraged Iyers to settle in south India."]
Schwimmer, Brian: Kinship and social organization : an interactive tutorial. -- URL: http://www.umanitoba.ca/anthropology/kintitle.html. -- Zugriff am 2001-02-21
Africana : the encyclopedia of the African and African American experience / editors: Kwame Anthony Appiah ... -- New York, NY : Basic Civitas, ©1999. -- 2095 S. : Ill. -- ISBN 0465000711. -- [Unentbehrlich!].
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology / ed. by Alan Barnard ...-- London [u.a.] : Routledge, ©1996. -- 658 S. -- ISBN 041520318X. -- [Empfehlenswert!].
Fox, Robin <1934 - >: Kinship and marriage : an anthropological perspective. -- Harmondsworth : Penguin, ©1967. -- 271 S. : Ill. -- (Pelican books). -- [Sehr klare Einführung]. -- Nachdruck: Cambridge University Press. -- ISBN 0521278236.
Kinship : selected readings / ed. by Jack Goody. -- Harmondsworth : Penguin, ©1971. -- 395 S. -- (Penguin books). -- [Reader]
Lexikon Dritte Welt / hrsg. Dieter Nohlen. -- Vollständig überarbeitete Neuausgabe. -- Reinbeck : Rowohlt, ©2000. -- (rororo ; 16527). -- 869 S. -- ISBN 3499606844. -- [sehr empfehlenswert]. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Lewis, Joan M.: Blood and bone : the call of kinship in Somali society. -- Lawrence, NJ : Red Sea Press, ©1994. -- 256 S. -- ISBN 0932415938. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Maquet, Jaques: Herrschafts- und Gesellschaftsstrukturen in Afrika. - München : Kindler, 1971. -- (Kindlers Universitätsbibliothek)
Pasternak, Burton ; Ember, Carol R. ; Ember, Melvin: Sex, gender and kinship : a crooss-cultural perspective. -- Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, ©1997. -- 324 S. : Ill. -- ISBN 0132065339. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Reproducing reproduction : kinship, power, and technological innovation / ed. by Sarah Franklin and Helena Ragoné. -- Philadelphia : University of Pennsylvania Press, ©1998. -- 245 S. -- ISBN 0812215842. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Van den Berghe, Pierre L.: Human family systems : an evolutionary view. --- Prospect Heights, IL : Waveland, 1980. -- 254 S. : Ill. -- ISBN 088133510X
Vivelo, Frank Robert: Handbuch der Kulturanthropologie: eine grundlegende Einführung. - - München : dtv, 1988. - 357 S. : Ill. -- ISBN 3-423-04470-5. -- Originaltitel: Cultural anthropology : a basic introduction (1978)
Wernick, Robert: Die Familie / von Robert Wernick und der Redaktion der Time-Life-Bücher. -- Amsterdam : Time-Life, ©1976. -- 176 S. : Ill. -- (Menschliches Verhalten)
Zu Kapitel 15: Frau und Mann