Internationale Kommunikationskulturen


mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - >: Internationale Kommunikationskulturen. -- 6. Kulturelle Faktoren: Lehr- und Lernstile. -- 2. Teil III: Beispiele. -- Fassung vom 2011-03-03. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur063.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2001-01-07
Überarbeitungen: 2011-03-03 [kleine Korrekturen]
Anlass: Lehrveranstaltung, HBI Stuttgart, 2000/2001. MBA der HdM und der Westsächsischen Hochschule Zwickau 2011
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Länder und Kulturen von Tüpfli's Global Village Library
In diesem Teil sollen an einigen Beispielen einige der mit Lehr- und Lernstilen als kulturellem Faktor verbundenen Probleme im Zusammenhang dargestellt werden.
In einer hochinteressanten Studie verglichen James W. Stigler und Michelle Perry den Mathematikunterricht in Grundschulen in Japan, Taiwan und den USA:
Stigler, James W. ; Perry, Michelle: Mathematics learning in Japanese, Chinese, and American classrooms. -- In: Children's mathematics / ed.Geoffrey B. Saxe ; Maryl Gearhart. -- San Francisco : Jossey-Bass, ©1988. -- (New directions for child development ; no. 41). -- ISBN 1555428843. -- Wieder abgedruckt in: Cultural psychology : essays in comparative human development / ed. by James W. Stigler ... -- Cambridge : Cambridge University Press, ©1990. -- ISBN 0521378044. -- S. 328 - 353. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Das Folgende ist eine freie Wiedergabe der Zusammenfassung (a.a.O., S. 350 - 352).
Japanische und taiwanesische Kinder lernen in der Grundschule mehr und besser Mathematik als Grundschüler in den USA. Ein wichtiger Grund sind die Unterschiede in den Lehr- und Lernmethoden und den kulturellen Unterschieden, die diese Methoden mitbedingen.
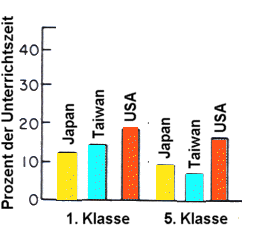
Abb.: Anteil der Unterrichtszeit, während derer die Kinder
unterrichtsfremden Beschäftigungen nachgehen (Allotria treiben) (Quelle:
a.a.O., S. 339)

Abb.: Anteil des durch Lehrer angeleiteten Unterrichts und des Unterrichts
ohne Anleitung am Gesamtunterricht in Mathematik (Quelle. a.a.O., S. 338)
|
|
|
| Abb.: Klassen 6 bis 9 in einem einzigen Klassenraum mit einer einzigen Lehrkraft, Péry, Kanton Bern, 1933 | Abb.: Schülerin, Kanton Bern, um 1990 |
[Quelle der beiden Abb.: a.u.a.O., S. 715, 655]
Wie rasch sich das Rollenverständnis der Lehrer wandeln kann, zeigt der sprichwörtlich konservative Kanton Bern.
Das Folgende ist ein Auszug aus:
Scandola Pietro ; Rogger, Franziska ; Gerber, Jürg: Lehrerinnen und Lehrer zwischen Schule, Stand und Staat : die Geschichte des Bernischen Lehrerinnen- und Lehrervereins (BLV). -- Bern : Bernischer Lehrerinnen- und Lehrerverein, ©1992. -- S. 645 - 654
"Der Lehrer, die Lehrerin der vierziger Jahre: berufene Autorität für Norm und Sitte, verantwortlich für Bildung und Kultur.
Die tiefgreifende Verunsicherung über das Versagen von Erziehung, Schule und Bildung im Zweiten Weltkrieg und im Nationalsozialismus hatte zur Folge, dass dem Erzieher die Aufgabe überbunden wurde, in erhöhtem Masse für Frieden und Humanität zu wirken. Der Berner Lehrer der Nachkriegsjahre war sich der Schwere dieser Verantwortung und der hohen Bedeutung seiner Bürde bewusst: «Il n'est pas d'activite humaine plus lourde de responsabilites que l'education.» Innerhalb der Lehrerschaft, die sich im Schulblatt zu Wort meldete, war die Rolle des Lehrers als Verantwortlicher, als Autorität erstaunlich intakt. «Wir wollen», schrieb voll Inbrunst der Berichterstatter der Sektion Nidau, «Menschen bilden, Menschen, Menschen, tief überzeugt, dass wir dadurch auch die bessern Berufsleute und Bürger erziehen. [...] Sollte es nicht möglich sein, durch eine so sorgfältige Erziehung den Krieg endlich zu beseitigen und eine gesegnete Welt des Friedens und der Kultur aufzurichten? Das herrliche Werk aber müsste in unsern, der Erzieher Hände liegen und vielfach gegen den Willen des breiten Volkes vollbracht werden, und ohne Kampf und ohne Verzicht auf ein ruhiges und bequemes Leben mit viel kluger Anpassung könnte es nicht gelingen.» Die zielsichere Führung betrachtete auch Jules Cueni als Hauptaufgabe der Lehrerschaft in der «Arglist» der Zeit: «Mit Zuneigung allein ist es nicht getan, ist das Erziehungsproblem noch nicht gelöst. Unnachgiebige Strenge, gepaart mit Liebe, tiefem Verantwortungsbewusstsein und nie ermüdender Kraft zu begeisterndem Vorbild, ein unbeugsamer Wille endlich zu zielsicherer Führung, das sind die Forderungen, die jederzeit an den Erzieher gestellt werden müssen.» Die Lehrerschaft fühlte sich also für die Jugend verantwortlich und darüber hinaus berufen, auch für die Gesellschaft eine moralische Instanz, eine Autorität für Norm und Sitte zu bilden. Lehrer und Lehrerinnen, die sich schließlich in der «konjunkturgeschädigten» Zeit zu Wort meldeten, hatten den Willen, als normative und sittliche Kraft über das Schulzimmer hinaus zu wirken. Dass diesem Anspruch gesetzliche Schranken entgegenstanden, wurde bei der Behandlung des Primarschulgesetzes 1951 ausdrücklich bedauert: «So erlaubt zum Beispiel die Bundesgesetzgebung nicht die Strenge, mit der viele unserer Mitglieder die verderblichen Einflüsse bekämpft wissen möchten, welche das öffentliche Leben auf die Jugend ausübt. Das Aufsichtsrecht der Lehrerschaft über das sittliche Verhalten der Schüler außerhalb des Unterrichtes wurde aus den gleichen Gründen nicht erweitert. » Lehrer war man «aus innerem Drang», und die forcierte Ankurbelung der Lehrerproduktion Ende der vierziger Jahre bedrückte Erziehungsdirektor Markus Feldmann, den späteren BGB-Bundesrat, sehr: «Die Gabe des geborenen Lehrers hat man, oder man hat sie nicht. Wir brauchten mehr Lehrer, als uns zur Verfügung stünden, wenn wir nur diese Elite ausbilden würden. Damit deute ich die Grenze unserer Maßnahmen an. Hier geht es letzten Endes um eine innere Einstellung zum Beruf, zum Leben überhaupt.»
In den vierziger Jahren war man Lehrer, Lehrerin aus innerer Berufung. Ziele und Grundsätze der Erziehung waren im Wesentlichen ungebrochen. Der Lehrer war noch immer eine sittliche und moralische Instanz. Von hohen Idealen getragen, schwebte er geistig weit über dem breiten Volk, was nicht seiner finanziellen Stellung in der Gesellschaft entsprach.
Der Lehrerberuf der fünfziger Jahre: zwischen unvergänglichem Ideal und irdischem Luxus
Die Selbstsicherheit der wissenden Mentoren nahm in den fünfziger Jahren zusehends ab. Zwar wollte die Lehrerschaft den Schüler oder die Schülerin noch immer zu den «unvergänglichen Idealen der Menschheit führen und in ihm das leidenschaftliche Ringen um begriffliche Klarheit und großzügige Toleranz gegenüber der andern Meinung entfachen» oder ihnen «in Stürmen des Verfalls und der Auflösung Wege zeigen, die lichtwärts führen». Doch der Ideale waren wenige, die Grenzen des Berufes sichtbar geworden. Das Bewusstsein, eine «Kulturaufgabe» erfüllen zu müssen, war geschwunden und mit ihm der Gemeinschaftssinn: «Stehen wir im Begriffe, das Ideale zu verlieren, oder sind wir bereits solche Subjektivisten geworden, dass uns nur noch einzelpersönliches Streben, eigene Ausbildung und Liebhaberei [...] interessieren?» fragte 1950 ein besorgter Lehrer rhetorisch. Das Ziel der Erziehung war umstritten und «in den wilderregten Kampf der Lebens- und Weltanschauungen» gezogen. Das Resultat blieb ungewiss: «In weiser Erkenntnis unserer Grenzen müssen wir aber der Zukunft überlassen, wie unsere Jugend diese Kräfte einsetzt. »
Für Lehrer und Lehrerin hingen nun ihr persönliches Fortkommen, das Ansehen und die Verbesserungen für die Schule eng zusammen. Jules Cueni meinte nach Annahme des Lehrerbesoldungs- und Schulgesetzes durch das Volk: «Das Vertrauen der Bevölkerung in Erziehungs- und Schulfragen ruht offensichtlich auf dem Lehrerstande. Dieses Vertrauen ist abhängig von dem innern Werte unserer Arbeit, unserer sozialen Stellung, unserer Bildung und unserer Wirksamkeit im öffentlichen Leben. Es gibt für uns keinen andern Weg aufwärts, als den durch die innere und
äußere Entwicklung unseres Standes und der Schule.» Einige Schritte in Richtung finanzieller und gesellschaftlicher Besserstellung wurden in den fünfziger Jahren getan. In dieser Zeit des verstärkten Lehrermangels schien die Stellung der Verbliebenen für «Wünsche und Bedingungen» nicht schlecht, und das Besoldungsgesetz der Primar- und Mittelschullehrer von 1956 versprach der Lehrerschaft denn auch insgesamt eine
Besserstellung. Den finanziellen Forderungen folgte das Begehren nach einer standesgemäßen
Wohnung. Schulhäuser und Lehrerwohnungen wurden stattlicher, 1953 stellte sich die Frage, ob wohl auch ein Schwimmbad, 1958 ob die Garage der Lehrerwohnung subventioniert werden sollte. Im Grossen Rat allerdings wurden die «Luxuseinrichtungen» kritisiert. Einige Missgriffe finanzieller und ästhetischer Art erregten ein berechtigtes Aufsehen. Um einer beginnenden Malaise abzuhelfen, griff die Staatswirtschaftskommission ein, und die Regierung sah sich genötigt, Höchstsummen festzusetzen. Nebst diesen Begehrlichkeiten schadeten die Schnellbleichen und Seminaristeneinsätze dem Image der Lehrer und Lehrerinnen. Unwillen erregte die Landflucht, die für die Schulkinder vielfach eine Katastrophe bedeutete. Sie machte den Stand, kaum dass er sich in der sozialen gesellschaftlichen Stellung zu etablieren gedachte, vor allem bei der Landbevölkerung verhasst.
Innerhalb der Gesellschaft wie auch in seinem Selbstverständnis verlor der Lehrer Zug um Zug seine sittlich-moralische und normsetzende Autorität. Im Gegenzug wuchs das Bewusstsein für eine wirtschaftliche Besserstellung seines Standes. «Der Lehrerstand gehört zu den aufstrebenden Ständen. Er musste seine soziale Stellung und seine finanzielle Sicherung erkämpfen. Wer von der heutigen Lage auf die Anfänge zurückblickt, dem muss der gewaltige Fortschritt in die Augen springen», erklärte Jules Cueni stolz im Mai 1950; und zwei Jahre später gab Hans Egg vom SLU den Seminaristen zu bedenken, «dass noch vieles erreicht werden muss, um [. . .] dem Stande ein Gewicht zu geben, das der Aufgabe und der Bedeutung der Schule angemessen» ist.
Lehrersein war in den fünfziger Jahren ein Beruf und keine Berufung. Mit der Individualisierung der Lehrperson schwanden die standesverbindenden Ideale und normsetzenden Erziehungswerte. Parallel zum Niedergang als moralisch-sittliche Autorität wuchs das gesellschaftliche Ansehen des Lehrers als finanziell potenter Bürger.
Der Lehrerjob der sechziger Jahre: ohne Idealismus, aber mit Annehmlichkeiten
An der Schwelle zum sechsten Jahrzehnt war der Lehrermangel das vordringliche standespolitische Problem: «Allenthalben wurde und wird noch von einer Verbreiterung der Basis zur Gewinnung vermehrter Lehrkräfte gesprochen, die Türen zu den Seminaren werden möglichst sperrangelweit aufgerissen, und die Schulgemeinden haben zur Anlockung von Lehrkräften den Werbestil unserer Kurorte übernommen.» Der Erfolg all dieser Bemühungen war jedoch gering. Die mit Mühe und Not «gewonnenen» Lehrer und Lehrerinnen liefen ihren Arbeitgebern davon, der Primarlehrerberuf war bloß noch Durchgangs-, nicht Zielberuf. Man jobbte in seinem oder häufig auch in einem andern Beruf.
Nachdem die Erziehungsdirektion in ihrer Verzweiflung erfolglos eine Lehrverpflichtung einzuführen versucht hatte, forschte der BLV im Berner Schulblatt schließlich selbst nach Gründen der Abwanderung. Es erschienen lange Abhandlungen und soziologische Untersuchungen über das «Berufsethos des Lehrers», über Gefahren und Krisen des Lehrerberufes. «Zweifellos sind Erziehung und Unterricht schwerer, aufreibender, kräftezehrender geworden. Nicht aber ist im gleichen Masse auch die soziologische Position des Lehrers in der Gesellschaft gestiegen. Im Gegenteil. Die Hochkonjunktur mit ihrer Überbewertung des materiellen, des messbaren Erfolges, der Karriere, hat den Lehrer eher aus seiner Mittelpunktposition heraus verdrängt, die er im Dorf früher, zusammen mit dem Pfarrer, dem Arzt und dem Apotheker, immerhin einnahm. Der Lehrer ist -- nicht in den Augen vieler Familien, aber in der Gesellschaft -- zu einem vertauschbaren Beamten degradiert», hieß es im September 1965. Als Ursache für diesen Imagewandel wurde später auch die oftmals unbefriedigende Stellung einer nur provisorisch angestellten Wanderlehrkraft genannt, die an ihren Schulorten keine Wurzeln schlage und nicht mehr bereit sei, «sich im Dorfleben, am Vereinsleben usw. zu engagieren». Auch seien «die Zeiten, da der Lehrer zu den wenigen Dorfhonoratioren gehörte, die über Wissen und Bildung verfügten», endgültig vorbei. So stellte ein Großrat fest: «Gemessen am allgemeinen Bildungsstand ist heute die Überlegenheit des Lehrers auf dem Gebiete des Wissens gering. [. . .] Der Lehrer wird sich nur dann seinen ihm gebührenden Platz in der Gesellschaft erobern können, wenn aus dem Schulmeister von gestern ein Lebensmeister geworden ist! Der Sachkenner muss zum Menschenkenner und zum menschlich souveränen Erzieher werden.»' Doch die Verunsicherung über Werte und Normen des Lebens nahm in den sechziger Jahren eher zu, Lehrer und Lehrerinnen standen zumeist hilflos der zerbröckelnden Autorität und Disziplin gegenüber.
Schließlich klagte das Schulblatt 1966 über das schlechte Image des Lehrerstandes. Es könne wohl nicht bezweifelt werden, dass der Lehrerberuf schlecht angesehen sei. «Irgendein nicht leicht zu bestimmender, aber eindeutig vorhandener Missklang sei mit dem Wort Lehrer verbunden.» In Anspielung auf das Kinderbuch von Friedrich Dürrenmatt meinte er: «Wie ist es möglich, [. . .] dass ein in aller Welt bekannter Schweizer Dichter und Landsmann Jeremias Gotthelfs ein Buch für die Jugend zeichnet, worin er dieser den Lehrerstand als den verabscheuungswürdigsten aller Berufsstände vor Augen führt? Was ist aus dem Lande Pestalozzis geworden, wenn es Dichter hervorbringt, die seinen Erziehern ins Gesicht spucken?» Die Frage nach dem Sozialprestige des Lehrers oder der Lehrerin dürfe nicht diskutiert werden, ohne die versteckten Ressentiments gegen die Lehrerschaft anzuschneiden: Die meisten Leute sähen den Lehrer als «natürlichen Feind» und könnten «sein gleichsam zum Beruf gehörendes Besserwissen», «das Geschulmeistertwerden auf den Tod nicht leiden».
Die Lehrerschaft forderte entschiedene Anstrengungen, um den Status und das Prestige des Lehrers und der Lehrerin zu verbessern. Zukunftsweisende Arbeits-, Urlaubs- und Weiterbildungsmöglichkeiten -- nebst finanziellen Anreizen -- sollten den ganzen Stand heben. Fehlende Aufstiegschancen wollte man mit einem zweiten Besoldungsmaximum ausgleichen. «Das Sozialprestige des Lehrers ist in erster Linie eine Funktion der rein materiellen Verhältnisse. Wir müssen uns [.. .] unbedingt von der Vorstellung lösen, ein Pädagoge besitze mehr Idealismus als wir selbst je aufzubringen imstande sind. [. . .] Die Annehmlichkeiten dieses Lebens sind ihm ebenso willkommen wie jedem anderen seiner Mitmenschen», gab das Berner Schulblatt 1966 zu verstehen .
Lehrersein war weder Berufung noch Beruf, Lehrersein war ein Job geworden. Jenseits jeglicher Ideale und weit entfernt davon, ein Lebensmeister sein zu können, suchte der Stand sein Heil im -- finanziell bewerkstelligten -- gesellschaftlichen Aufstieg, in der Hoffnung, auf diese Weise sein früheres moralisches und
bildungsmäßiges Prestige zurückgewinnen zu können.
Der Lehrer, die Lehrerin der siebziger Jahre: gut bezahlte Fachkraft für Erziehung und Wissen?
Nebst der Hebung des Sozialprestiges und dem Besoldungssprung suchte der Lehrerstand in den siebziger Jahren auch bildungsmäßig aufzuholen. Er versprach sich viel von einer Verlängerung der Seminarausbildung. Als der Grosse Rat 1978 nach 50 Jahren Kampf endlich das fünfte seminaristische Ausbildungsjahr für Lehrer und Lehrerinnen einführte, erfüllte er damit das vordringlichste standespolitische Postulat. Mit dieser Verlängerung der Seminarzeit sollte gleichzeitig die Berufs- und Allgemeinbildung verbessert werden. Das Augenmerk wurde auch vermehrt auf die Fortbildung der Lehrerschaft gerichtet, da sie in einer Zeit, «geprägt durch ein rasantes Tempo der Entwicklung in Wissenschaft, Technik und Wirtschaft», unumgänglich geworden war: «Was heute Gültigkeit hat, kann morgen überholt sein. Die Erscheinungen fordern [. . .] auch Eingang in die Lehre und damit Eingang in die Schule. » Dass zusätzlich das Lehrerpatent nun den prüfungsfreien Zugang zur Hochschule erlaubte, wurde von den Lehrern und Lehrerinnen begrüßt, rückte ihr Stand doch nun in die Nähe der Akademiker. In den siebziger Jahren wandelte sich mit der Lehrerarbeitslosigkeit das Verständnis für die Dauerhaftigkeit des Lehrerberufs. Er wurde nicht mehr so schnell aufgegeben, und man mühte sich, ihn -- nebst der finanziellen Aufwertung -- mit verbesserter Ausbildung, Professionalisierung und Spezialisierung aufzurichten. Das Prestige als unfehlbarer moralischer Mentor war nicht wiederzugewinnen, im Gegenteil. In den siebziger Jahren wurde den Lehrkräften gesagt, was neu an Werten und Zielen zu übernehmen sei. Dafür suchte man das Image als Fachkraft für Erziehung, Lehrstoffe und stufengerechte Methodik zu retten.
Die verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen der achtziger Jahre: weder Befehlsempfänger noch Vorbild
Mit den öffentlichen Sparanstrengungen und dem noch nicht überwundenen Lehrermangel wehte in den achtziger Jahren ein rauerer Wind. Die hohe Anzahl der stellenlosen, teilzeitlich oder nur provisorisch gewählten Lehrer und Lehrerinnen stellte große Probleme. Sie waren in jeder Beziehung nur eine halbe Portion. Auch die voll arbeitenden Lehrkräfte hatten Sorgen. Mit der Ausdifferenzierung des Schulsystems und der Professionalisierung der verschiedenen Lehrerkategorien wurde zwar das Image als Fachkraft gestärkt, gleichzeitig aber die Differenzierung zwischen den Lehrkräften betont. Die Spannungen innerhalb des Lehrerstandes wurden stärker; man war nicht mehr Lehrer oder Lehrerin, sondern Arbeitslehrerin, Sekundar- oder Primarlehrer und suchte vor allem seine Kategorie vorwärtszubringen. Sowohl die Primar- als auch die Sekundarlehrerschaft lebte in der Angst, ihre Stufe werde von der jeweils anderen demontiert, ausgepowert, aufgefressen. Mit der Einführung des Schulmodells 6/3 fühlte sich auch die Sekundarschule auf drei Jahre hinunter demontiert und damit richtiggehend ausgehöhlt. Und die Primarlehrerschaft hatte «Angst, aufgefressen zu werden». Sie sah sich wegen der teilweise überdurchschnittlichen Übertrittsquoten in die Sekundarschule «in ihrer Existenz bedroht». Oberstufenreformen, wie sie in der Stadt Bern erprobt wurden, stellten eine Bedrohung dar. Sie brächten der Primarschule nicht die erwartete Aufwertung, vielmehr würden «der Primarschule die Flügel gestutzt, man könnte auch sagen wegmanuelisiert'», wurde behauptet. Die Lehrerschaft am Untergymnasium fürchtete, zur Hälfte auf der Strasse zu stehen, wenn das UG «fort-entwickelt» würde. Die Arbeitslehrerinnen und Hauswirtschaftslehrerinnen hatten mit den Folgen der gleichberechtigten Erziehung zu kämpfen: der Abschaffung des Fünfwöchelers und mit dem neuen Fach Handarbeiten/Werken. Die Kindergärtnerinnen spürten schmerzlich ihre lohnmäßige Unterprivilegierung, und auch die andern Lehrerkategorien verdächtigten sich gegenseitig, verhältnismäßig zuviel vom Besoldungs- und öffentlichen Finanzkuchen wegzufressen.
Das Vakuum, das der Verlust gesellschaftlich dominanter -- auch autoritärer und wenig hinterfragter -- Werte und Konsense hinterlassen hatte, war nicht zu füllen. Zweck und Ziel werden in einer pluralistischen Gesellschaft nicht mehr einheitlich und eindeutig gewertet. Anstelle eines einhelligen Konsenses nahm die Lehrerschaft eine Vielzahl von Verordnungen und Vorschriften wahr, die Ausdruck einer pluralistischen, offenen Gesellschaft und Bildungsstruktur sind. Diese Erlasse schienen die Selbstverständlichkeit, was der Lehrer zu tun und lehren hatte, zu ersetzen. Die Vorstellung, nicht mehr eigener Herr und Meister im Schulzimmer zu sein, sondern das Schulleben verordnet zu bekommen, ängstigte denn die Lehrerschaft schon lange, bevor in der Debatte um Bildungsreservoire, Nachwuchsförderung, Chancengleichheit, um Schulmodelle, Schulversuche, Schulinhalte und um Selektion, Koordination und Kooperation der Zugriff auf den Lehrer verstärkt wurde. Sie fürchteten, immer mehr zu Befehlsempfängern, zu reinen Funktionären degradiert zu werden. Auch das neue Volksschulgesetz, das auf die neunziger Jahre verweist, wurde bereits als « -- gelinde gesagt -- nicht lehrerfreundliches [. . .] 'Volksschulverwaltungsgesetz'» apostrophiert .
Trotzdem kommen Lehrerschaft und Bildungspolitiker nicht ohne Wertaussagen aus. Die «Grundsätze zur Entwicklung des Bernischen Bildungswesens» aber brauchen zum Beispiel etliche Schreibseiten, um die Grundlagen von allgemeiner Gültigkeit für die Reformen -- die Grundsätze eines Menschenbildes und zu einem Menschbild, Zielsetzung von Erziehung und Bildung - festzuhalten. Die Lehrerschaft in den achtziger Jahren hingegen, die sich angesichts der Jugendunruhen -- notabene «auf Wunsch der Erziehungsdirektion»! -- zu den Erziehungswerten zu äußern hatte, kam auf die fundamentale Einfachheit: «Vorbild und Liebe, sonst nichts. » Als der neue Volksschulgesetzesentwurf aber festhielt, der/die Lehrer/in habe die Schüler/innen nach den in Artikel 2 festgelegten Grundsätzen und durch gutes Beispiel zu führen, beantragte der BLV «und durch gutes Beispiel» zu streichen. Zwar stecke im Satz «Erziehung ist Vorbild und Liebe, sonst nichts» viel Wahrheit. «Trotzdem [...] wieviel Missbrauch kann damit getrieben werden, insbesondere noch gestützt auf die Bemerkung betreffend 'die äußere Erscheinung' im Vortrag. Woran kann man messen, ob ein Beispiel 'gut' sei?»
Vormals Verkörperung von Sitte und Norm, mag heute der Lehrer und die Lehrerin nicht einmal mehr als Beispiel und Vorbild dienen. «Gut» sei in der heutigen pluralistischen Gesellschaft nicht mehr von «schlecht» zu unterscheiden. Vormals den -- wohl auch nicht ganz klar definierten Idealen verpflichtet, weiß die Lehrkraft heute nicht mehr, wofür sie steht. Immerhin: Der soziale und gesellschaftliche Aufstieg des Berner Lehrerstandes ist zweifellos gelungen, und die Lehrerschaft macht sich daran, ihn ungeachtet des inneren Gerangels um die Positionen zu festigen."
Da eine der wichtigsten Aufgaben interkultureller Kommunikation in Deutschland die Kommunikation ist zwischen Menschen, die in der alten Bundesrepublik aufgewachsen sind, und Menschen, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, soll hier etwas ausführlicher auf Erziehung und Bildung in der DDR eingegangen werden.
Aufgaben und Grundsätze von Erziehung und Bildung

Abb.: Plakat der Freien Deutschen Jugend (FDJ) zu den Weltfestspielen der
Jugend, 1951
"Nach Auffassung der marxistisch-leninistischen Pädagogik (Pädagogische Wissenschaft und Forschung), wie sie gegenwärtig in der DDR -- darin vor allem der sowjetischen Pädagogik und Bildungspolitik folgend -- offiziell vertreten wird, ist die sozialistisch-kommunistische Bildung und Erziehung und darin besonders die Herausbildung eines sozialistischen Bewusstseins bei allen Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen eine notwendige Voraussetzung für die Errichtung und Sicherung der sozialistischen bzw. kommunistischen Gesellschaftsordnung. Für die sozialistische Bildungskonzeption wird aus der Sicht des Marxismus-Leninismus, d.h. aus der sozialistischen Persönlichkeitstheorie, vor allem gefolgert, dass alle Bildungs- und Erziehungsprozesse (Sozialisationsprozesse) unlösbar in lebendige geschichtliche Prozesse eingebettet sind und von den materiellen Lebensprozessen, den politischen Kämpfen der Klassen und ihren ideologischen Reflexionen in bezug auf Ziele, Inhalte und Methoden entscheidend bestimmt werden. Sie können nur im Rahmen revolutionärer gesellschaftlicher Veränderungen unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) voll wirksam und zu einem bedeutenden Faktor des gesellschaftlichen Fortschritts werden. Dabei müsse aufgrund der Dialektik der äußeren und inneren Entwicklungsbedingungen und -ursachen die Entwicklung des Menschen als ein »ununterbrochener Prozess der aktiven Aneignung und Verinnerlichung der historisch-konkreten Umwelt«, der menschlichen Kultur in ihrer Gesamtheit, in der Arbeit, im Lernen und in weiteren »kulturschöpferischen Tätigkeiten« verstanden und verwirklicht werden.
Nach dem Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25.2.1965, das die bildungspolitischen Beschlüsse des Parteiprogramms der SED von 1963 rechtlich regelte und das auch nach Verabschiedung des neuen Parteiprogramms (1976) weiter Geltung hat, ist es das Hauptziel der Bildung, alle Bürger zu
»allseitig und harmonisch entwickelten sozialistischen Persönlichkeiten, die bewusst das gesellschaftliche Leben gestalten, die Natur verändern und ein erfülltes, glückliches, menschenwürdiges Leben führen«,
zu bilden und zu erziehen. Insbesondere sollen sie befähigt werden, »die technische Revolution zu meistern und an der Entwicklung der Sozialistischen Demokratie mitzuwirken«. Dazu sollen sie eine moderne Allgemeinbildung und eine hohe Spezialbildung sowie »Charakterzüge im Sinne der sozialistischen Moral« erwerben. Durch die gemeinsame, einheitliche Bildungs- und Erziehungsarbeit des sozialistischen Staates und aller gesellschaftlichen Kräfte sollen die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen befähigt werden,
Dazu sichern Verfassung und Bildungsgesetz allen Bürgern das gleiche Recht auf Bildung zu, das gleichermaßen die gesellschaftliche Pflicht zur Bildung einschließt.
Diese programmatischen Forderungen und gesetzlichen Bestimmungen sagen allerdings noch nichts über die individuelle Möglichkeit der Verwirklichung des Rechtes auf Bildung für alle aus.
Maßgeblich für den Aufbau des Bildungssystems und für die inhaltliche Gestaltung der Bildung und Erziehung sind die Grundsätze
Unter Berücksichtigung der Einheit, also der praktischen Untrennbarkeit von Bildung und Erziehung, wird unter Bildung jene Komponente der Gesamtheit der pädagogischen Prozesse und ihrer Ergebnisse verstanden, in der die Aneignung des vor allem in den Lehrplänen und anderen curricularen Materialien aufbereiteten Bildungsgutes unter dem Gesichtspunkt der Kenntnisse, Erkenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten usw., akzentuiert wird.
Der Begriff »Erziehung« (im engeren Sinne) meint jene Seite aller pädagogischen Prozesse und ihrer Ergebnisse, die sich auf die Herausbildung ideologischer (politischer, weltanschaulicher, ethischer und ästhetischer) Wertmaßstäbe, Normen und Einstellungen und auf die Entwicklung von Überzeugungen, Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen beziehen.
Der Grundsatz der Einheit von hoher wissenschaftlicher Bildung und »klassenmäßiger sozialistischer« Erziehung beruht einmal auf der Erkenntnis der Unteilbarkeit der pädagogischen Prozesse, zum anderen aber auf dem marxistisch-leninistischen Grundaxiom der Einheit bzw. Identität von Wissenschaft und sozialistischer Ideologie und von Wissenschaftlichkeit und Parteilichkeit auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus; er findet seinen inhaltlichen Niederschlag in allen Bereichen der Bildung und Erziehung, sei es nun in
Der Grundsatz der Allseitigkeit und Permanenz von Bildung und Erziehung schließlich ist vor allem bezogen auf die Realisierung eines ihrer wichtigsten Ziele, nämlich auf die Herbeiführung und langfristige Sicherung der beruflichen Disponibilität möglichst aller Bürger unter Berücksichtigung sowohl ihrer Befähigungen und Neigungen als auch der jeweiligen wechselnden volkswirtschaftlichen Erfordernisse.
Eine möglichst weitgehende Übereinstimmung zwischen individuellen Neigungen und gesellschaftlichen bzw. volkswirtschaftlichen Erfordernissen zu erreichen, ist eine zentrale Aufgabe aller Bildungseinrichtungen, speziell aber der umfassend angelegten Berufsberatung und Berufslenkung. Umfassende sozialistische Bildung und Erziehung, verstanden und gestaltet als gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
lässt kaum bildungs- und erziehungslose Freiräume zu und versucht darüber hinaus, auch die Familienerziehung und die außerschulische und
außeruntersichtliche Bildung und Erziehung intentional-inhaltlich und organisatorisch-institutionell möglichst genau zu reglementieren und zu kontrollieren. Auf diese weitgreifende gesellschaftspolitische Zielstellung
lässt sich partiell zurückführen, wenn heute in der DDR die Merkmale einer ausgeprägten Lern- und Leistungsgesellschaft zu beobachten sind."
[DDR-Handbuch / Bundesministerium des Innern. -- 1985. -- In: Enzyklopädie der DDR -- Berlin : Directmedia, 2000. -- 1 CD-ROM. -- (Digitale Bibliothek Band 32). -- ISBN 3932544447. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}. -- S. 1936ff.]
Aus den verschiedenen Bereichen von Bildung und Erziehung sei die Politisch-ideologische bzw. Staatbürgerliche Erziehung herausgegriffen
"Erziehung, Politisch-ideologische bzw. Staatsbürgerliche: Die Politisch-ideologischen bzw. Staatsbürgerlichen Erziehung -- die Begriffe »politisch-ideologisch« und »staatsbürgerlich« werden synonym gebraucht -- gilt als das Kernstück der gesamten sozialistischen Bildung und Erziehung in der DDR, und zwar auf allen Stufen und in allen Bereichen des Bildungswesens; ihre Realisierung erfolgt einmal und vor allem als bereich- und fachübergreifendes, alle Ziele und Inhalte determinierendes Prinzip; zum anderen in einem speziellen Unterrichtsfach, dem Staatsbürgerkundeunterricht, und zwar in besonders enger Beziehung zur

Abb.: Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR (©Corbis)
Die Aufgaben und Ziele der Politisch-ideologischen bzw. Staatsbürgerlichen Erziehung wurden im Parteiprogramm der SED (1963) festgelegt, im Bildungsgesetz (1965) kodifiziert sowie in den »Aufgabenstellungen für die staatsbürgerliche Erziehung« (1966 und 1969) und in den Beschlüssen des VII. Pädagogischen Kongresses (1970), des VIII., IX. und X. Parteitags der SED (1971, 1976, 1981) weiter aktualisiert.
Als Grundlage, Gesamtzielstellung und oberstes Kriterium aller anderen Bildungs- und Erziehungsmomente hat sie die generelle Aufgabe, durch die Vermittlung der Ideologie des Marxismus-Leninismus und in enger Verbindung mit einer entsprechenden Charakter- und Verhaltenserziehung den entscheidenden Beitrag zur Formung sozialistischer Persönlichkeiten zu leisten. Die theoretische Grundlage für die Zielstellung der Politisch-ideologischen bzw. Staatsbürgerlichen Erziehung bildet das langfristig gültige »sozialistische Menschenbild« der marxistisch-leninistischen Philosophie, das Stellung, Standort, Wirkungsfeld und Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen in der sozialistischen Gesellschaft und die damit verbundenen gesellschaftlichen Anforderungen an ihn sowie die wesentlichen Merkmale, Eigenschaften und Verhaltensweisen der angestrebten sozialistischen Persönlichkeiten umreißt und zugleich die Orientierungsgrundlage für die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft darstellt.
Die auf dem »sozialistischen Menschenbild« gründende »sozialistische Persönlichkeit« wird durch 4 wesentliche Merkmale gekennzeichnet:
Das Sozialistische Bewusstsein wird durch 7 sozialistische Grundüberzeugungen definiert, die das Handeln und Verhalten der sozialistischen Persönlichkeit bestimmen, als Maßstäbe für die Bewertung von Situationen und Verhaltensweisen dienen sollen und denen entsprechende Kenntnisse, Erkenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen sowie entsprechende Gefühle, Erfahrungen und Verhaltensweisen zugeordnet sind; in der Formulierung der »Aufgabenstellung des Ministeriums für Volksbildung und des Zentralrates der FDJ zur weiteren Entwicklung der staatsbürgerlichen Erziehung der Schuljugend der DDR« (1969) sind dies:
Durch die Verinnerlichung dieser ideologischen Grundsätze als eines nicht in Frage zu stellenden Glaubenskanons soll »die Erziehung der jungen Menschen zum sozialistischen Patriotismus und zum Proletarischen Internationalismus...« bewirkt werden.
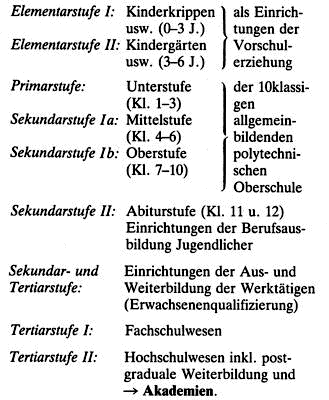
Abb.: Das Bildungswesen der DDR
Sind die Ziele der Politisch-ideologischen bzw. Staatsbürgerlichen Erziehung von grundlegend-prägender Bedeutung für Ziele und Inhalte der Bildung und Erziehung in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen Stufen des Bildungssystems der DDR einschließlich der außerschulischen Einrichtungen und Veranstaltungen und bestimmen sie insbesondere als politisch-ideologische Leitlinien Ziele und Inhalte der Lehrpläne aller Fächer und Klassen, so hat der Unterricht in dem Fach Staatsbürgerkunde, der in den Klassen 7-10 (mit 5 Gesamtwochenstunden), 11 und 12 (mit 3 Gesamtwochenstunden) und in der Berufsausbildung (mit insgesamt mindestens 74 Stunden) erteilt wird, speziell die Aufgabe, die politisch-ideologischen Kenntnisse der Schüler systematisch zu entwickeln. Gemäß den neuen Lehrplänen für dieses Fach ab Schuljahr 1983/84 (Klassen 7 und 9) bzw. 1984/85 (Klassen 8 und 10) wird den Schülern in Klasse 7
erläutert.
Ziel der Klasse 8 ist es, »den Schülern ihre Stellung und Rolle als Staatsbürger der DDR bewusst zu machen«. Dabei soll »die Wissensaneignung eng mit dem praktischen Leben und den praktischen Erfahrungen der Schüler verbunden« werden. »Die klassenmäßige Haltung zum sozialistischen Staat... soll sich in wachsender politischer Aktivität der Schüler vor allem in den Wohngebieten und Gemeinden zeigen«. »Hauptanliegen« des Unterrichts ist es, »dass die Schüler... die Überzeugung gewinnen, dass der sozialistische Staat eine wahre Volksmacht ist, weil er von allen Bürgern unter Führung der SED getragen wird und den Interessen der Arbeiterklasse und aller anderen Werktätigen dient«.
Den Abschluss des Staatsbürgerkundeunterrichts in den Klassen 7 und 8 bildet eine Stoffeinheit, »mit der die prinzipielle Auseinandersetzung mit Wesenszügen und der Politik und Ideologie vor allem des BRD-Imperialismus zu führen ist«. Den Schülern ist »überzeugend vor Augen zu führen, dass der BRD-Imperialismus von Anfang an mit allen ihm zur Verfügung stehenden politischen, ökonomischen, militärischen und ideologischen Mitteln versucht hat, den Sozialismus in der DDR zu vernichten«. Der Unterricht soll die Schüler »zu der Einsicht führen, dass diese imperialistische Politik ihre tiefste Ursache in den Macht- und Eigentumsverhältnissen in der BRD hat. Sie sollen erkennen, dass diese Politik menschenfeindlich und eine ständige Gefahr für den Weltfrieden ist, dass sie zum Scheitern verurteilt war und auch heute nicht erfolgreich sein kann.«
In Klasse 9 erfolgt eine verstärkte Beschäftigung mit der Weltanschauung des Marxismus-Leninismus, bei der
im Vordergrund des Unterrichts stehen. In Klasse 10 sollen vornehmlich »Grundfragen der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR« behandelt werden. (Zitate aus: Siegfried Piontkowski: Die ideologisch- theoretische und methodische Konzeption des Staatsbürgerkundeunterrichts und der überarbeiteten Lehrpläne der Klassen 8 und 10, in: Geschichtsunterricht und Staatsbürgerkunde, Berlin [Ost], H. 2/3 1984, S. 115 ff.)
Die ständig wiederholte und zunehmend forcierte Forderung nach -- dringend notwendiger -- Intensivierung und Verstärkung der Politisch-ideologischen bzw. Staatsbürgerlichen Erziehung der Schüler und Lehrlinge macht deutlich, dass ihre Ergebnisse erheblich hinter den gesteckten Zielen zurückbleiben; gerade bei dem »Kernstück der gesamten sozialistischen Bildung und Erziehung« besteht offensichtlich eine Diskrepanz zwischen Bedeutung und Aufwand einerseits sowie Breiten- und Tiefenwirkung andererseits. Angesichts der fundamentalen Bedeutung, die der Politisch-ideologischen bzw. Staatsbürgerlichen Erziehung für die gesamte Bildung und Erziehung, vor allem aber für die besonders dringend geforderte politisch-ideologische Abgrenzung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland beigemessen wird, bedeutet dies eine erhebliche Einschränkung."
[DDR-Handbuch / Bundesministerium des Innern. -- 1985. -- In: Enzyklopädie der DDR -- Berlin : Directmedia, 2000. -- 1 CD-ROM. -- (Digitale Bibliothek Band 32). -- ISBN 3932544447. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}. -- S. 2129ff.]
Der unten wiedergegebene Bericht aus dem Jahr 1971 stammt von Yue Daiyun. Ihr Leben spiegelt das Auf-und-ab von (parteitreuen) Intellektuellen in China beispielhaft.
|
|
|
Einige wichtige Daten aus ihrem Lebenslauf:
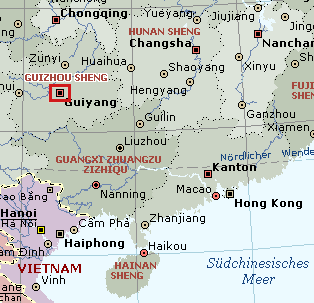
Abb.: Lage von Guiyang (©MS-Encarta)

Abb.: Lage von Guangxi (©MS-Encarta)
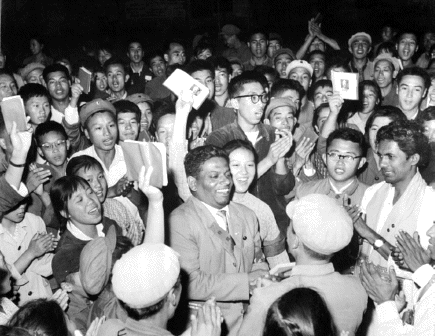
Abb.: Studenten und Rotgardisten mit dem "Roten Buch", den Worten des
Vorsitzenden Mao / hsg. von Lin Biao, zwischen 1966 und 1971 (©Corbis)

Abb.: Studenten und Professoren marschieren auf Tienanmen Platz in Beijing. Auf
den Schrifttafeln steht: "Haltet die große rote Fahne der Mao Zedong-Ideen
hoch!", "Es lebe der Vorsitzende Mao!" während Kulturrevolution (©Corbis)
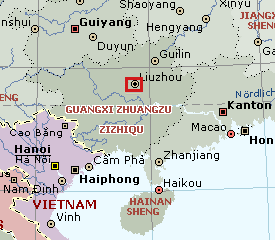
Abb.: Lage von Liuzhou (©MS-Encarta)

Abb.: Richard Nixon bei seinem Besuch Beijings 1972 mit Studenten vor
Wandzeitung (Überschrift: "Beherrscht den Marxismus-Leninismus und die Mao
Zedong-Ideen!") (©Corbis)
"Zum vierten Mal kehrte ich nun [1971] vom Land zurück, doch als der Laster mich diesmal mit meiner Habe vor dem Zentralen Speisesaal absetzte, schaute ich voll Unbehagen und Entsetzen auf die überall sichtbaren Zeichen von Verfall und Vernachlässigung. Noch nie hatte das Universitätsgelände so schäbig und ungepflegt gewirkt. Die rote Fahne, die einst als Symbol der Hoffnungen meiner Studienkameraden für die Zukunft unseres Landes stolz im Wind geweht hatte, war nirgends zu sehen, und von dem verloren dastehenden, nackten Fahnenmast blätterte die Farbe ab.
Die Gebäude des Chingkang-Gebirge-Korps, auf dem Höhepunkt der Belagerung durch die Neue-Peita-Gruppierung per Tunnels verbunden, waren jetzt von Unrat und Schmutzhaufen umgeben. Als der Befehl ergangen war, die Räume im ersten Stock von den Überresten der Kämpfe freizumachen und für neue Bewohner herzurichten, hatte man kurzerhand alles auf die Gehwege geworfen. Seit zwei Jahren standen die Häuser nun leer; sie hatten im Zuge der Auseinandersetzungen solchen Schaden gelitten, dass die Propagandatrupps sie einfach ignorierten. Die Entscheidung, mehr als hundert Studenten von der Kaderschule an die Peita zu holen, machte jedoch die Bereitstellung zusätzlicher Unterkünfte nötig, und so beschloss man einfach, die studierenden Arbeiter, Bauern und Soldaten in diesen arg mitgenommenen Räumen unterzubringen.
Auf vielen Dächern ragten die dicken Stangen, die als Befestigung für die Schleudern gedient hatten, ominös in den Himmel, und auf dem hohen Schornstein des Heizwerks stand die verblasste, aber noch immer lesbare Drohung: «Wenn sich die Feinde nicht ergeben, machen wir sie alle nieder.» Auf einigen Hauswänden prangten neue Schlagworte, die unter anderem verkündeten: «Peita heißt die Propagandatrupps herzlich willkommen», und: « Kehrt in die Hörsäle zurück und macht weiter Revolution!» Auch Zeugnisse der Grausamkeit vergangener Kampagnen fanden sich noch. «Wir müssen Lu Pings Hundeschädel zerschmettern», las ich und dachte an den Schrecken, in den uns seinerzeit die Bekanntgabe von Namen angeblicher Verbrecher und das große rote X darüber versetzt hatten.
Das Podest an der Schmalseite des Philosophiegebäudes stand jetzt leer da, meine Erinnerung bevölkerte diese improvisierte Bühne jedoch erneut mit verängstigten, in die schmerzhafte Düsenflughaltung gezwungenen Lehrern und Kadern, von denen viele meine Freunde und Kollegen gewesen waren. Überall wucherte das wegen des heißen Frühlingswetters bereits braune Gras. Kaum eine Fensterscheibe war ganz, die gezackten Glasscherben in den Rahmen schimmerten grau von Staub und Spinnweben. Gedankenverloren stand ich in dieser an die düstere Vergangenheit gemahnenden Szenerie und fragte mich, ob der Alptraum, der 1966 begonnen hatte, endlich vorüber sei.
Langsam machte ich mich auf den Weg zu meinem einstigen Heim, um nach [meinem Gatten] Lao Tang und meinem Sohn zu schauen. Meine Schwiegermutter, die sich von einer Hüftfraktur erholte, wirkte mitleiderregend alt und schwach. Sie begrüßte mich weinend und sagte, sie sei sehr erleichtert über meine Rückkehr und wolle sofort zu uns ziehen. Ich beruhigte sie, so gut ich konnte, dann begrüßte ich endlich meine Tochter, die zu einem Wiedersehen mit ihren Eltern aus Heilungkiang [Heilongjiang] auf Urlaub gekommen war. Mit düsterem Gesicht schilderte sie die Schwierigkeiten des Lebens auf der Militärfarm.

Abb.: Lage von Heilongjiang (©MS-Encarta)
Ich hatte sie vor fast zwei Jahren, bei ihrer Abfahrt in den Nordosten, zum letzten Mal gesehen. Voller Optimismus und Eifer war sie gewesen, entschlossen, wie ein Adler zu schweben und bei der Entwicklung des Grenzlandes zu helfen. Jetzt sprach sie nur noch davon, nach Peking zurückkehren zu wollen. Sie beschrieb die Niedergeschlagenheit der einst so begeisterten jungen Leute, die in den vergangenen Monaten mit der harten Realität von Bestechung, Erpressung und Vergewaltigung konfrontiert worden waren. Mich beunruhigte, dass sie in den zwei Jahren kein Stück gewachsen war; ich fürchtete, dass die Erfahrungen dort oben im Nordosten sie körperlich und seelisch zerstört hatten.
Mein Schwager und seine Frau gaben sich viel höflicher als bei unserem letzten Zusammentreffen, denn Lao Tang und ich waren unter allen Fakultätsmitgliedern als Lehrer ausgewählt worden, bekleideten also wieder ehrenvolle Posten. Trotzdem war ich heilfroh, dass wir in der ganzen Zeit die Miete für unsere Wohnung bezahlt hatten, denn dank dieser Tatsache besaßen wir nun ein Heim, in das wir zurückkehren konnten. Viele andere hatten geglaubt, für den Rest ihres Lebens auf dem Land bleiben zu müssen, und darum ihre Wohnungen aufgegeben. Man quartierte sie nun in den Studentenschlafsälen ein, manchmal zu fünft oder sechst in einem einzigen Zimmer.
Während ich zum Zentralen Speisesaal zurückeilte, um meine dort
abgestellten Habseligkeiten zu holen, versuchte ich, die verwirrenden ersten
Eindrücke zu verarbeiten. Ein Junglehrer aus meiner Abteilung sah, dass ich
einen Karren suchte, kam heran und bot mir seine Hilfe an. Diese unerwartete
Geste von Seiten eines Parteimitglieds gab mir die Hoffnung, dass mich die
anderen vielleicht jetzt auch als zum Volk gehörig behandeln würden. Ein neues
Gefühl der Gleichrangigkeit und die Aussicht, wieder Lehrerin sein zu dürfen,
halfen mir über die Traurigkeit hinweg, in die mich der schlimme Zustand des
Universitätsgeländes und die gedrückte Stimmung meiner Schwiegermutter und
meiner Tochter versetzt hatten.
Ich hatte das Gefühl, dass nach den schlimmen Prüfungen nun etwas Neues
beginne für unser Land, über das so schwere Stürme hinweggegangen waren, für
die Universität mit ihren veränderten Erziehungszielen und auch für meine
Familie, nachdem man Lao Tang und mich wieder als Lehrer eingesetzt hatte.
Obwohl die Menschen um mich herum bedrückt wirkten und das Universitätsgelände
schrecklich aussah, stieg in mir unbezähmbare Hoffnung auf.
Trotzdem war mir natürlich klar, dass der Prozess des Wiederaufbaus langwierig und schwierig sein würde. Allein die Renovierung der Gebäude und sonstigen Anlagen würde viel Zeit kosten. Nach dem Auspacken besuchte ich die Studentinnen, die in Liyu-chou [Liyuzhou] meine Zimmergenossinnen gewesen waren, und lud sie zum Essen ein. Ihre Unterkunft befand sich in einem schlimmen Zustand. Der Betonboden hatte Löcher, die fehlenden Fensterscheiben ersetzte Zeitungspapier, das im Wind raschelte, und die einst weißen Wände waren rußgeschwärzt von den Koch- und Heizfeuern, die den größten Teil des Mobiliars verschlungen hatten. Auf dem Schrank, hinter dem sich ein Tunneleingang verbarg, thronte ein Tisch, zum Glück aber standen die Bettbretter und Bänke aufgestapelt in einer Ecke auf dem Boden. Es sollte zwei Monate dauern, bis die Unrat- und Schmutzhaufen unter den Fenstern mit Lastwagen abtransportiert wurden.

Abb.: Standbild des Vorsitzenden Mao Zedong auf dem Gelände der Beida (Beijing-Universität), Beijing, o.J. (©Corbis)
Die vergangenen fünf Jahre hatten jedoch nicht nur an den Baulichkeiten der Universität verheerende Veränderungen bewirkt. Auf dem Gelände befanden sich heute nur noch studierende Arbeiter, Bauern und Soldaten, weil die ganze Rotgardistengeneration in den Jahren 1968 und 1969 weggeschickt worden war, der Großteil auf Militärfarmen in den fernsten Gebieten Kansus [Gansu] und Kweichous [Guizhou].
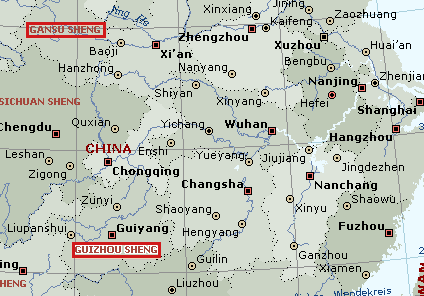
Abb.: Lage von Gansu und Guizhou (©MS-Encarta)
Im Schicksal dieser ehemaligen Studenten, die der Vorsitzende Mao vor noch gar nicht langer Zeit als die Hoffnung für Chinas Zukunft hingestellt hatte, sah ich den Inbegriff der von der Kulturrevolution betriebenen Vergeudung. Für mich verdienten diese jungen Menschen nach wie vor unseren Respekt, schließlich hatten sie ihren Mut, ihre Entschlossenheit, Findigkeit und Flexibilität hinlänglich bewiesen. Ihr Idealismus, ihre Begeisterung, ihr Wunsch, zum Wohl ihres Landes beizutragen, und ihre Treue zum Vorsitzenden Mao standen außer Frage. Doch inzwischen hatten sie ihren guten Ruf verloren, und ich fragte mich, wie ihre Zukunft wohl aussehen würde. Es fehlte ihnen an Fachkenntnissen ebenso wie an Allgemeinbildung, außerdem waren sie an Disziplinlosigkeit und Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten gewöhnt, deshalb galten sie bei den führenden Funktionären in der Armee und den Fabriken gleichermaßen als unerwünscht. Also schickte man sie einfach zur körperlichen Arbeit in abgelegene Winkel des Landes.
Die Kulturrevolution hatte sich seinerzeit zwar die Erneuerung der chinesischen Kultur zum Ziel gesetzt, aber nun schien statt dessen von unserem kulturellen Erbe nicht mehr viel übrig zu sein. Das Bildungsniveau der jetzigen Studentengeneration war zweifellos niedriger als je zuvor. Die studierenden Arbeiter, Bauern und Soldaten, durchaus intelligent und lernbegierig, ließen sich wegen ihrer begrenzten Vorbildung schwer unterrichten. Viele hatten nur Grundschulen besucht, einige konnten nicht einmal die chinesische Schrift mühelos schreiben. Mir bereitete die Erkenntnis Sorge, dass beide Gruppen - sowohl die Arbeiter, Bauern und Soldaten, die jetzt eine Chance zu höherer Bildung bekamen, als auch die «gebildeten» Jugendlichen, die auf dem Land geblieben waren, um eine neue Generation von Bauern ins Leben zu rufen - kaum etwas von der chinesischen Kultur wussten. Das «Heute und Gestern, Chinesisches und Ausländisches» war ihnen weitgehend unbekannt; sie schätzten ihr kulturelles Erbe so wenig, dass ich für die Zukunft meines Landes fürchtete. Es gab also nicht wenige Dinge, die meinen grundsätzlichen Optimismus verfehlt erscheinen ließen.
Viele teilten mein Unbehagen über die gegenwärtige Politik und meine Sorgen im Hinblick auf die Auswirkungen der vergangenen fünf Jahre, aber darüber durfte man nicht reden. Presse und Rundfunk unterstrichen täglich die Wichtigkeit der Kulturreform, die vom Vorsitzenden Mao selbst angeführt wurde, mit Schlagworten wie: «Lang lebe die Kulturrevolution!» - «Nieder mit jedem, der sich der Kulturrevolution widersetzt!» Doch trotz dieser bemühten Propaganda begann die junge Generation, die sich vor kurzem noch leidenschaftlich für revolutionäre Ziele eingesetzt hatte, nun über ihre veränderten Lebensumstände nachzudenken und ein neues Bewusstsein für Fehler und Fehlschläge zu entwickeln.
Eine weitere Veränderung an der Peita bestand darin, dass man 1970 Chi Ch'un, einen ehemaligen Politkommissar der VBA-Eliteeinheit 8341, zum Vorsitzenden des Revolutionskomitees der Ch'inghua [Tsinghua-Universität, Beijing] ernannt und ihm die Verantwortung für Erziehungsreformen an beiden Universitäten übertragen hatte. Er war davor schon im Erziehungsministerium mit ähnlichen Aufgaben betraut gewesen. Obwohl erst Mitte Dreißig, genoss dieser selbstbewusste, willensstarke Mann allgemeine Achtung. Ich hatte ihn an einem trüben Regentag in Liyu-chou [Kaderschule in Liyuzhou, Provinz Guangxi] kennengelernt, als er in unseren Schlafsaal gekommen war, bekleidet mit einer abgetragenen Militäruniform und einem Strohhut, nicht die Spur wie ein wichtiger Funktionär aussehend. In seiner lässig-höflichen Art hatte er uns gefragt, welche Probleme uns zu schaffen machten; wir hatten den Eindruck gewonnen, dass er uns wirklich helfen wollte. Begleitet hatte ihn sein Vize Hsieh Chingyi, der ebenfalls zur VBA-Einheit 8341 gehörte und früher der persönliche Sekretär Chiang Ch'ings [Maos Gattin Jiang Qing, geb. 1913] gewesen war. Beeindruckt durch das sichere Auftreten der beiden, hatten wir uns gesagt, diese neuen Führer seien fähig, zugänglich und wirklich besorgt um das Wohlergehen der Peita-Gemeinde. Als Chi Ch'un dann im Sommer 1971 die Auflösung der Kaderschule in Kiangsi [Guangxi] verfügte, gewann er in der Fakultät noch mehr Anhänger.
Die Propagandatrupps bekleideten nach wie vor auf allen Ebenen Führungsämter, aber die ursprünglichen Leute waren nach Wiederherstellung des Friedens ausgetauscht worden. Die meisten der neuen Arbeiter waren entweder sehr jung und unerfahren oder dem Rentenalter nahe, gewöhnlich nette, liebenswürdige Leute, die jedoch nichts von Erziehung verstanden. Ihre Funktion beschränkte sich darauf, die Anweisungen der an den Schalthebeln der Macht sitzenden VBA-Kader auszuführen.
Hauptziel von Chi Ch'uns Verwaltung war die Durchsetzung einer neuen Erziehungspolitik, die auf der Weisung des Vorsitzenden Mao von 1958 basierte, dass Studenten der Geistes- und Sozialwissenschaften die Gesellschaft als Labor zur Erprobung ihrer Theorien benutzen müssten. In den vergangenen siebzehn Jahren, so sagte man uns, habe das Hauptproblem bei der Erziehung in den «Drei Trennungen» bestanden, der Getrenntheit der Universität von Praxis, Politik und körperlicher Arbeit. Die Wissenschaftler konnten mit Weizen ausgeklügelte Experimente in Reagenzgläsern ausführen, waren aber unfähig, Weizen im Freien am Halm zu erkennen; und die Intellektuellen verfolgten angeblich ihre Forschungsziele im allgemeinen, ohne die Bedürfnisse des Volkes zu berücksichtigen. Darum sollten die Studenten künftig daran gehindert werden, alte Wege zu beschreiten. Sie dürften nicht länger dem alten Pfad von der Bibliothek zum Speisesaal und zum Schlafsaal folgen, hieß es, diesen sogenannten «Drei Punkten in gerader Linie», oder sich in der Universität isolieren wie Schnecken in ihren Häusern. Und sie dürften auch nicht so mit nutzlosen Informationen vollgestopft werden, wie man Pekingenten vor dem Braten stopft, sondern müssten ermutigt werden, selbst zu denken. Darum werde man die Studienzeit verkürzen, das fünfjährige Lehrprogramm der Abteilung für chinesische Literatur auf drei Jahre und das sechsjährige Programm für Physik und Mathematik auf vier Jahre.
Diese neuen Verfahrensvorschriften waren in vieler Hinsicht vernünftig, warfen jedoch einige Probleme auf. Die Lehrer erholten sich erst allmählich von der Zeit heftiger Kritik, Bekämpfung und Erniedrigung und hatten darum keinen rechten Mut, Vorlesungen zu halten. Sie zogen es vor, Diskussionen zu leiten, denn sie wollten nicht riskieren, zu «bourgeoisen akademischen Autoritäten» erklärt zu werden. Außerdem wusste niemand, wie man die Gesellschaft als Labor benutzen sollte. Die Studenten andererseits, die ihre Zeit an der Universität als kostbare Gelegenheit zum Lernen betrachteten, wollten studieren und nicht ständig zu Kommunen oder in Fabriken fahren.
Wir machten uns also daran, die Erziehung nach bestem Vermögen zu reformieren. Mein Lehrauftrag für das Herbstsemester 1971 lautete, Vorlesungen zu halten über den Kampf zwischen der bourgeoisen und proletarischen Literaturtheorie ab der 4.-Mai-Bewegung von 1919 bis zur Befreiung von 1949. Die eine Richtung, exemplifiziert durch Dichter wie den von Mallarme [Stéphane Mallarmé, französischer Dichter, 1842 - 1898] und Baudelaire [Charles Baudelaire, französischer Dichter, Kunstkritiker und Essayist, 1821 - 1867] beeinflussten Hsü Chihmou [Xu Zhi Mou], führte nach neuem Verständnis in die Dekadenz; die andere Richtung dagegen, repräsentiert durch so gefeierte Schriftsteller wie Lu Hsün [Lu Xun, chinesischer Dichter, 1881 - 1936] und Kuo Mo-jo [Guo Moruo, chinesischer Dichter, 1892 - 1978], ermutigte die Menschen angeblich in ihrem revolutionären Kampf. Neben den Vorlesungen sollte ich die Studenten die Fehler in der literarischen Linie während der vergangenen siebzehn Jahre analysieren lassen; und ich sollte ihnen verständlich machen, dass die Literaturpolitik Chou Yangs [Zhou Yang, geb. 1907], des ehemaligen Chefsprechers der Partei für kulturelle Angelegenheiten, falsch gewesen sei, weil sie zu einer Trennung der Literatur von Arbeitern, Bauern und Soldaten geführt habe, dass andererseits Chiang Ch'ings [Maos Gattin Jiang Qing, geb. 1913] Politik, Modellopern zu fördern, gut sei. Gemäß der neuen Linie müssten Arbeiter, Bauern und Soldaten in jedem literarischen Werk als Helden dargestellt werden, als «groß, geachtet und vollkommen».
Die Aufgabe stellte mich vor beträchtliche Schwierigkeiten. Schon wegen meiner Kinder wollte ich die Führer gern zufrieden stellen und mir ihr Lob sichern, aber es war nicht leicht. In der Kaderschule hatte man mich gezwungen, eine Erklärung für meine angebliche Opposition gegen die Literaturtheorie des Vorsitzenden Mao abzugeben, und jetzt musste ich über die Vorzüge der Modellopern lehren, obwohl ich wusste, dass die Arbeiter, Bauern und Soldaten keineswegs vollkommen waren und dass das Misstrauen gegenüber der neuen Literatur um so stärker wurde, je nachdrücklicher wir erklärten, sie seien ohne Fehl und Tadel. Weil jedoch Chiang Ch'ing [Maos Gattin Jiang Qing, geb. 1913] gesagt hatte, die Eliminierung der «mittleren Charaktere» sei der Hauptunterschied zwischen der alten bourgeoisen Linie Chou Yangs [Zhou Yang, geb. 1907] und der neuen proletarischen Linie, hatte ich keine andere Wahl, als den Auftrag auszuführen. Ich sammelte Material aus Zeitungen und Zeitschriften und legte meinen Erläuterungen statt eigenen Gedanken immer diese Abhandlungen über die offizielle Politik zugrunde, damit niemand meinen Standpunkt kritisieren konnte.
Doch dann wurden unsere diversen Sorgen durch ein Ereignis von größter Tragweite in den Hintergrund gedrängt. Eines Abends Mitte September, kurz nach unserem Hochzeitstag und dem Todestag meiner Mutter, kam eine junge Studentin, die mir sehr ans Herz gewachsene Tochter eines hohen Marinefunktionärs, mit einer schockierenden Neuigkeit zu mir. Lin Piao, so erzählte sie mir atemlos, habe ein Attentat auf den Vorsitzenden Mao unternommen, das fehlgeschlagen sei, und das Flugzeug, mit dem er versucht habe, in die Sowjetunion zu fliehen, sei abgestürzt. Ihre Geschichte erschien mir völlig absurd. Schließlich war Lin Piao der «enge Vertraute» des Vorsitzenden Mao, schließlich schwenkte ich täglich mein Rotes Buch in der Luft und rief rhythmisch: «Vorsitzender Mao, möge er tausend Jahre leben; Lin Piao [Lin Biao, 1907 - 1971], möge er sich ewig bester Gesundheit erfreuen!»
In der Rückschau ist eine solche ritualisierte Verehrung schwer verständlich, aber wir skandierten diese Lobpreisung damals voll Aufrichtigkeit und Begeisterung. Der erregte Bericht meiner Studentin erschreckte und entsetzte mich. Ich sagte warnend zu ihr, die sensationelle Geschichte sei bestimmt nur ein Gerücht, und sie dürfe sie nicht weitererzählen, weil sie allein schon durch die Verbreitung einer unbestätigten Nachricht sich selbst in ernste Gefahr bringen könne. Das Gehörte schien mir zu schrecklich, um wahr, zu phantastisch, um auch nur teilweise glaubhaft zu sein. Ich vermutete, dass irgendein neuer Machtkampf entbrannt und dass es zu einem ernsten Riss in der höchsten Führung gekommen war. Am Abend dann meinte auch Lao Tang, die Geschichte könne unmöglich stimmen, denn Lin Piao [Lin Biao, 1907 - 1971] sei der engste Verbündete des Vorsitzenden Mao; gleich mir war Lao Tang überzeugt, dass es eine Verschwörung solchen Ausmaßes in der Kommunistischen Partei einfach nicht geben könne."
"Die Führung war sich des allgemeinen Unbehagens nach der Lin-Piao-Affäre bewusst und leitete eine massive Erziehungsbewegung ein, um das hehre Bild der Partei möglichst unversehrt zu bewahren. An der Peita beauftragte Chi Ch'un die kleinen Schriftsteller-Kritiker-Gruppen in den geisteswissenschaftlichen Abteilungen, ihre Aufmerksamkeit von ihren bisherigen Zielen wie der alten Erziehungspolitik oder der literarischen Linie Chou Yangs [Zhou Yang, geb. 1907] abzuwenden und eine gründliche Kritik Lin Piaos zu beginnen, um die Partei zu entlasten und zu reinigen. Etwa zwei Monate später setzte er die Große Peita-Kritikgruppe ein, in der er acht Personen aus den bestehenden Abteilungen zusammenzog; sie sollte kritisches Material gegen Lin Piao zusammenstellen, seine Verschwörung diskutieren und den richtigen Standpunkt zu dieser jüngsten Krise propagieren.
Auf Wink von höchster Ebene der Partei hin erklärte diese Universitätsgruppe,
der gescheiterte Coup sei eine unglückselige Sache, aber kein so schreckliches
Ereignis, dass man damit nicht fertig werden könne, wenn man es in der
richtigen Weise angehe. Lin Piao, so führte die Gruppe aus, sei kein
Linkspolitiker gewesen, auch wenn man diesen Eindruck gehabt habe, sondern im
Grunde ein Rechtsabweichler. Chi Ch'un und Hsieh Chingyi erzielten mit ihrem
Versuch, den Eindruck von Einheit und Vertrauen zu erzeugen, einen beachtlichen
Erfolg. Wer beobachtete, mit welcher Effizienz und Schnelligkeit sie die
zentrale Kritikgruppe organisierten und auf allen Ebenen erste Diskussionen
einleiteten, war zwar nicht von der Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen, aber
von ihrer Tüchtigkeit als Führer überzeugt. Vielleicht herrschte im
Zentralkomitee tatsächlich noch unerschütterliche Einheit, sagte man sich,
vielleicht war Lin Piaos Verrat ein vereinzeltes Vorkommnis, eine Verirrung.
Während wir in unseren Abteilungsversammlungen über Lin Piaos Verbrechen
diskutierten und über die verschiedenen Zeitungsartikel debattierten, die ihn
abwechselnd als ultralinks, als Rechtsabweichler, als Linkspolitiker am Anfang
und Rechtsabweichler am Schluss sowie als Linkspolitiker nach außen und
Rechtsabweichler im Inneren hinstellten, versuchten wir gleichzeitig, den
Universitätsbetrieb wieder in Gang zu setzen. Ich bekam in den ersten beiden
Jahren nach der Rückkehr aus der Kaderschule verschiedene Aufträge.
Im Winter 1971 und Frühling 1972 arbeitete ich eine Zeitlang an den Luftschutzräumen mit, die wir auf dem Universitätsgelände bauten, nachdem der Aufruf des Vorsitzenden Mao ergangen war: «Grabt tiefe Tunnel, legt Getreidevorräte an und trachtet niemals nach Hegemonie.» Um für einen Atomkrieg gerüstet zu sein, richteten wir unterirdische Klassenräume ein, einen Speisesaal und sogar eine Bibliothek, die alle mit dem unter der Stadt entstehenden weitläufigen Tunnelnetz verbunden waren. Als erstes schafften wir mit Schulterkörben und Schubkarren riesige Mengen Erde weg, dann brachten wir auf kleinen Handkarren hohe Eisenbetonbögen nach unten, und schließlich deckten wir unsere Schutzräume mit der Erde unsichtbar ab. Alle arbeiteten einen vollen Monat an diesem Gemeinschaftsprojekt. Später teilte ich meine Zeit zwischen politischen Versammlungen, der Durchsicht von Graduierungsarbeiten, der Ausarbeitung einer neuen Vorlesung über Lu Hsün und der Abfassung kurzer Artikel, in denen ich den studierenden Arbeitern, Bauern und Soldaten seine Essays erklärte.
Im Herbst widmeten sich die Studenten intensiv dem Studium des Marxismus-Leninismus und besuchten Vorlesungen über vier Werke von Marx [Karl Marx, 1818 - 1883]. Ich war für Ergänzungsvorlesungen über zwei dieser Werke zuständig, die Kritik des Gothaer Programms [1875, 1891 veröffentlicht] und das Kommunistische Manifest [1847]. Nach den Vorlesungen traf ich mich mit einer Gruppe Studenten in deren Schlafsaal, um ihnen bei der Beantwortung von Fragen zu helfen, die sie im Zusammenhang mit den Vorlesungen hatten.
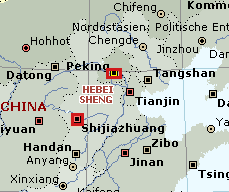
Abb.: Lage von Beijing und Shijiazhuang (©MS-Encarta)
Im Frühsommer 1973 waren wir weit genug fortgeschritten, um das Universitätsgelände verlassen und die Gesellschaft als Labor benutzen zu können. Aufgrund meiner früheren Erfahrung im Lehren/Schreiben teilte man mir die Journalistikgruppe meiner Abteilung zu und sandte mich mit zehn Studenten und zwei anderen Lehrern nach Shih-chiachuang [Shijiazhuang], der sechs Eisenbahnstunden entfernten Hauptstadt der Provinz Hopeh [Hebei]. Wir sollten in den Büros der dortigen Zeitung wohnen, und die Studenten sollten zu Reportern ausgebildet werden.
Ich verließ mein Heim diesmal sehr ungern und beneidete gleich vielen anderen Lehrern die Verwaltungsleute der Universität um ihr geregelteres, ruhigeres Leben. Lao Tangs Mutter war trotz ihres angespannten Verhältnisses zu ihrer anderen Schwiegertochter nicht zu uns gezogen, weil wir in unserem Haus sehr wenig Platz hatten und außerdem über keine ayi [Amme] verfügten, die für sie hätte sorgen können. Sie genoss es jedoch immer, bei uns zu sein, und es machte mich traurig, dass meine Abreise sie der glücklichen Stunden mit ihren Enkeln beraubte. [Mein Sohn] Tang Shuang, mittlerweile vierzehn, würde mich stärker vermissen als je zuvor, denn sein Vater kam von den vielen Versammlungen, mit denen er beschäftigt war, praktisch nur zum Schlafen heim. Ich schloss für meinen Sohn einen Essensvertrag mit einer Kantine ab, in der Studenten der nahe gelegenen Akademie der Wissenschaften verköstigt wurden. Es blieb mir nichts anderes übrig, als Tang Shuang einmal mehr sich selbst zu überlassen. Voll Kummer dachte ich daran, wie wenig ich mich immer um ihn hatte kümmern können; ich war nicht einmal fähig gewesen, ihn als Säugling mit meiner Milch zu ernähren.
In dem halben Jahr meiner Abwesenheit vom Universitätsgelände lebte ich mit
den Studentinnen in den Zeitungsbüros zusammen, schlief in meiner Bettrolle auf
dem Boden und aß in der Betriebskantine. Bald spielte sich ein Tagesablauf ein,
der recht angenehm war für mich. Tagsüber sammelte ich mit den Studenten
Informationen und half ihnen bei der Strukturierung des Materials, und abends,
wenn sie mit dem Abfassen ihrer Artikel beschäftigt waren, versenkte ich mich
in westliche Romane, vor allem von Balzac und Dostojewski, die ich mir in der
gutbestückten Zeitungsbücherei borgte. Gefesselt von der Lektüre, las ich
sogar unter meiner Steppdecke mit einer Taschenlampe weiter, wenn um elf Uhr die
Lichter ausgingen.
Meine Gruppe war für Reportagen über Erziehung und Agrikultur zuständig, und
wir hatten gerade begonnen, uns mit der Situation in Shih-chiachuang [Shijiazhuang]
vertraut zu
machen, als die Sache mit Chang Tiesheng [Zhang Tie Sheng] passierte. Anfang 1973 war vielerseits
eine Reform des Zulassungssystems zur Universität gefordert worden, mit der
Begründung, die Zulassung dürfe nicht nur auf Empfehlungen, sondern müsse
auch auf Prüfungsergebnissen basieren. Als Reaktion darauf hatte man im Sommer
die Aufnahmeprüfungen wiedereingeführt. Auf wenig Gegenliebe stieß die neue
Politik jedoch bei den hohen Kadern, deren Kinder nun nicht mehr automatisch
zugelassen wurden, sowie bei den jungen Leuten, die in der Kulturrevolution
bekannt geworden und politisch weit vorangekommen waren, aber nur begrenzte
Bildung besaßen. Ein Studienanwärter, der ehemalige Rotgardist Chang Tiesheng
aus der Provinz Liaoning, unterzog sich der geforderten Prüfung über
Agrikultur, doch weil er die Fragen nicht beantworten konnte, schrieb er, solche
Verfahren bedeuteten eine Rückkehr zur alten Erziehungsweise. Die Prüfungen
seien so angelegt, behauptete er, dass sie einerseits die Arbeiter, Bauern und
Soldaten ausschlössen und es ihnen verwehrten «die Höhen [über dem
Schlachtfeld) zu besetzen», andererseits den bourgeoisen Intellektuellen
gestatteten, diese strategisch wichtigen Positionen einzunehmen. Die Prüfungen
seien schlicht ein Mittel zur Unterdrückung der jüngeren Generation und zur
Fesselung ihres Denkens, schloss Chang Tiesheng, darum gehörten die für ihre
Einführung verantwortlichen Leute gestürzt.
Weil viele ranghohe Führer, darunter Chi Ch'un, den Ausführungen Changs Beifall spendeten, veröffentlichten die Zeitungen seine Kommentare und dazu zahlreiche Artikel, die ihn als einen gegen das alte Erziehungssystem kämpfenden Helden priesen. Meine Gruppe von der Hopeher [Hebeier] Tageszeitung wurde ausgeschickt, um Mittelschullehrer, Studenten und Arbeiter zu interviewen und ihre Ansichten über die Kontroverse zu ergründen. Einige der Interviewten sagten, Changs Reaktion sei richtig, denn man dürfe nicht durch Prüfungsergebnisse bestimmen, wer ein Anrecht auf Bildung habe; andere dagegen fragten, wie jemand, der nicht einmal fähig sei, Prüfungsfragen zu beantworten, als Held gefeiert werden könne.
Ich persönlich lehnte Changs Argumentation ab, aber der Zeitungschef hatte verlangt, dass wir die Affäre als wichtiges Beispiel behandelten, weil Chang Tiesheng das Recht der Arbeiter, Bauern und Soldaten auf Bildung schütze. Das Bildungsniveau in der Gegend von Shih-chiachuang [Shijiazhuang] war damals ziemlich niedrig, und wahrscheinlich wollte der Zeitungschef deshalb Chang Tiesheng als Helden dargestellt sehen, der eine Rückkehr auf den alten Weg und die Heranbildung einer «geistigen Aristokratie» verhinderte. Nicht alle Studenten waren mit dem Standpunkt des Zeitungschefs einverstanden, und so gab es lange Diskussionen über das Problem.
Eine Studentin, die früher Arbeiterin auf den Modell-Ölfeldern von Taching [Da Qing] gewesen war, drang auf die Darstellung beider Seiten und weigerte sich, nur über die zustimmenden Aussagen der Interviewten zu berichten, doch ihr Artikel wurde nicht veröffentlicht. Die Zeitungsfunktionäre hielten ein solches ausgewogenes Urteil im Augenblick für völlig fehl am Platze und empfahlen den Studenten, in ihren Artikeln die «neugeborenen Dinge» der Kulturrevolution zu unterstützen und sich um eine Verbesserung all dessen zu bemühen, was sie für mangelhaft hielten. Nachdem ich schon einmal kritisiert worden war, weil ich das Recht der Studenten verteidigt hatte, Fehler der offiziellen Politik zu analysieren, beugte ich mich dem Urteil des Zeitungschefs.
Als ich zum Frühlingsfest nach Hause kam, erfuhr ich, dass viele Mitglieder der Fakultät den Versuch kritisiert hatten, Chang Tiesheng zu einem «Helden des leeren Papiers» zu machen. Um ihre Haltung zu korrigieren, hatte Chi Ch'un insgeheim eine Prüfung organisiert, die diese arroganten Professoren demütigen sollte. Eines Nachmittags wurden alle Lehrer zu einer wichtigen Versammlung gerufen, und es hieß, niemand dürfe sich davon beurlauben lassen. Nachdem sich alle in den Versammlungsräumen ihrer Abteilungen eingefunden hatten, erhielten sie einen Prüfungsbogen mit Fragen aus ihrem Fachgebiet sowie Fragen zur politischen Theorie. Angeblich konnte man viele der politischen Fragen nur beantworten, wenn man sich an bestimmte, oft triviale Informationen erinnerte. Die meisten Professoren ärgerten sich schrecklich über diese erniedrigende Behandlung, und einer schrieb einfach: «Ich möchte gern die Note Null haben und von Chang Tiesheng lernen.» Chi Ch'un wollte, dass sich die Lehrer klein fühlten, er wollte demonstrieren, dass eine einzige Prüfung kein genaues Bild von den Fähigkeiten einer Person gebe und dass man darum das Schicksal der jungen Generation nicht von einer einzigen Prüfung abhängig machen dürfe. Doch statt das Überlegenheitsgefühl der Professoren zu dämpfen, minderte diese Episode nur die Wertschätzung der Fakultätsmitglieder für Chi Ch'un.
Während des Aufenthalts in Shih-chiachuang [Shijiazhuang] begleitete ich die Studenten auch bei mehreren Fahrten aufs Land. Nach Beobachtung der Bauern kehrten wir in die Zeitungsbüros zurück, diskutierten unsere Feststellungen und überlegten, wie unsere Daten zu analysieren seien. lm August fuhren wir mit einem Bus zu einer fünf Stunden entfernten Kommune westlich der Stadt, um über die fortschrittliche Art der Bauern beim Pflanzen von Baumwolle zu berichten."
[Yue, Daiyun <1931 - >: Als hundert Blumen blühen sollten : die Lebens-Odyssee einer modernen Chinesin im Strudel der revolutionären Umbrüche vom Langen Marsch bis heute ; Autobiographie u. Zeitdokument / Yue Daiyun. Aufgezeichnet von Carolyn Wakeman. -- Bern [u.a.], 1986. -- ISBN 3-502-18880-7. -- Originaltitel: To the storm (1985). -- S. 278 -285,289 -293]Weiterführende Ressource:
Spence, Jonathan D. ; Chin, Annping: Das Jahrhundert Chinas. -- München : Bertelsmann, ©1996. -- 263 S. : Ill. -- ISBN 3570122824. -- Originaltitel: The Chinese century (1996). -- [Sehr gute Darstellung mit herausragender Bilddokumentation. Sehr empfehlenswert]. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}

Abb.: Australische Aborigines (©Corbis)
Stephen Harris beschrieb 1978 folgende Unterschiede zwischen dem Lernverhalten der weißen Majorität in Australien und den Ureinwohnern (Aborigines):
| Weiße | Aborigines | |
|---|---|---|
| Lernsituation | hat formalen Charakter. | hat informellen Charakter. |
| Lernort ("Schule") | Lernen erfolgt in speziell dafür vorgesehenen Erziehungsinstitutionen und -gebäuden. | Lernen ist nicht an bestimmte Institutionen oder Gebäude gebunden. |
| Lehrer | Lerninhalte werden durch ausgebildete Lehrer vermittelt, die einen eigenen Raum für sich beanspruchen. | Lerninhalte werden durch verschiedene Mitglieder der Verwandtschaftsgruppe vermittelt. |
| Das Gelernte | hat nicht unbedingt einen Bezug zum alltäglichen Leben und ist nicht notwendig, um zu überleben. | ist unmittelbar mit dem alltäglichen Leben verknüpft und ist nötig, um zu überleben. |
| Lernen | erfolgt zumeist durch verbale Kommunikation. | erfolgt vorwiegend durch nonverbale Kommunikation. |
| erfolgt in Form von strukturierten Kompaktkursen, deren Vermittlung relativ wenig Zeit erfordert. | Lernen erfolgt über einen langen Zeitraum. | |
| ist eine äußerst bewusste Erfahrung. | Lernen wird häufig nicht nur als bewusste Erfahrung erlebt. |
[Vorlage der Tabelle: Schierle, Sonja: Alternative Perspektiven in der Schulerziehung von US-amerikanischen Indianern und australischen Aborigines. -- In: Ethnopädagogik : Sozialisation und Erziehung in traditionellen Gesellschaften ; eine Einführung / hrsg. von Klaus E. Müller ... -- 2., überarbeitete Aufl. -- Berlin : Reimer, ©1996. -- ISBN 3496025905. -- S. 215 (dort Quellennachweis). -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Zu Kapitel 7: Betriebskulturen und Entscheidungsfindung