Internationale Kommunikationskulturen
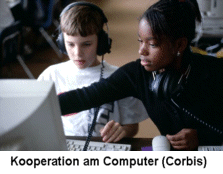
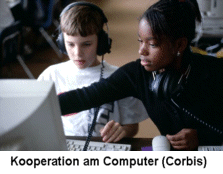
mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - >: Internationale Kommunikationskulturen. -- 9. Kulturelle Faktoren: Essen, Trinken, Geselligkeit. -- 1. Teil I: Tischsitten und Gastlichkeit. -- Fassung vom 2001-04-16. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur091.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2001-04-16
Überarbeitungen:
Anlass: Lehrveranstaltung, HBI Stuttgart, 2000/2001
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Länder und Kulturen von Tüpfli's Global Village Library
Anstatt einer Einleitung stehen kommentarlos folgende Zitate aus der Enzyklopädie Die Frau aus der DDR zur Etikette im ehemaligen real existierenden Sozialismus:
"Essen ist mehr als die dem Menschen aus biologischen Gründen gebotene Energiezufuhr, es stellt darüber hinaus eine gesellschaftliche Handlung dar und ist zugleich ein Gradmesser des zivilisierten Benehmens, das sich der einzelne angeeignet hat. Treffenderweise spricht man von Esskultur. ...
Mindestens eine Mahlzeit am Tage sollte alle Mitglieder der Familie vereinen. Selbst wenn es sich um ein zeitiges Frühstück handelt, ist dafür eine hinreichende Spanne einzuplanen, damit unter den Versammelten eine Atmosphäre von Ruhe und Behagen aufkommen kann. Sie fördert nicht nur ein gesundheitsgerechtes Aufnehmen der Nahrung, sondern auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Man entlässt einander mit einem freundschaftlich-aufmunternden Wort und freut sich schon auf das Wiederbegegnen.
Essen im kleineren oder größeren Kreis kann in sehr verschiedenem Rahmen erfolgen als Kaffeerunde, Grillparty oder Betriebsmahlzeit, selten sind die Gelegenheiten, einmal wirklich zu speisen, sich in der Hohen Schule des Essens zu erproben. Ein solches Ereignis -- privat oder offiziell -- findet meist in einer gastronomischen Einrichtung statt. Wer von Kindheitstagen an gewöhnt ist, ein Essbesteck mit Anstand zu handhaben, braucht als Neuling an feiner Tafel keine Ängste auszustehen. Alle Gerichte werden heutzutage so serviert, dass zu ihrer Bewältigung keine besonderen Geräte oder Kunstfertigkeiten nötig sind. Einige Vorsicht im Umgang mit Weinglas und Mundtuch, Soßenrest und Obstkern ist zu empfehlen, etwas absehen beim mehr erfahrenen Nachbarn nicht verboten.
Zusätzliche Aufmerksamkeit verlangt die (moralische) Pflicht zur Beteiligung am Tischgespräch. Ist die Runde nicht übermäßig groß, werden sich die Gastgeber bemühen, ein gemeinsames Gespräch aller Anwesenden in Gang zu halten. Dabei sind sie auf Unterstützung angewiesen. Der vorbildliche Gast bringt es fertig, mit seinen nächsten Nachbarn einige Bemerkungen auszutauschen, ohne dass daraus eine störende Separatdebatte entsteht; er ist ein aufmerksamer Zuhörer bei den Ausführungen älterer, würdiger Tischgefährten und gleichzeitig bereit, an passender Stelle einen eigenen Gedanken als knappen Einwurf beizusteuern (wobei er sich streng davor hütet, etwa unter der anfeuernden Wirkung eines Schluckes Alkohol das Gespräch an sich zu reißen).
Noch seltener -- eine Einladung zum Stehbankett. Hier ist die Beherrschung der Formen noch mehr gefragt, fallen Verstöße besonders auf. Tatsächlich scheint mancher die einfache Regel nicht zu kennen, dass während der einleitenden Ansprachen das Büfett noch nicht berührt wird, dass man auch später während einer Rede nicht isst und ohne Aufforderung nicht trinkt. Durch sein ganzes Verhalten bekundet der gewandte Teilnehmer an solchem Beisammensein, dass es ihm in erster Linie um die Geselligkeit, den Gedankenaustausch geht; die angebotenen Genüsse nimmt er gleichsam nebenher zu sich, was nicht ausschließt, dass er gegenüber den Gastgebern diese oder jene Spezialität mit einem Kompliment zu rühmen versteht. Vor den stets mehr als reichlich aufgebauten Speisen vermeidet man selbst den Anschein von Gedränge, lässt anderen den Vortritt, bedient aufmerksam auch eine unbekannte Dame. Die sparsam vorhandenen Sitzgelegenheiten -- das zur strikten Beachtung -- bleiben älteren, besonders ausgezeichneten Gästen vorbehalten. Platz zum Aufstellen eines Tellers ist im allgemeinen knapp; so tut man gut daran, sich vorzugsweise mit gabelgerechten Bissen zu versehen und kommt dann nicht in Verlegenheit, aus freier Hand etwas schneiden zu müssen. Vorsicht ist anzuraten vor den stärkeren Getränken! Schon mancher, der sich auf einem Empfang, etwa in angeregter Unterhaltung, vom eifrig umhergehenden Servierpersonal zu zügig bedienen ließ, erlebte eine unangenehme Überraschung."
"Auf einem gedeckten Tisch kommen Speisegeschirre, Gläser, Bestecke und sonstige Gefäße und Gegenstände gemeinsam zur Wirkung und zum Gebrauch. Trotz eingeschränkter Zeit für die Haushaltführung und weniger gemeinsamer Mahlzeiten der Familie sollte auf alle Falle die Tischkultur gepflegt werden. Nicht nur Manieren und Sitten bei Tisch, das Wissen um die richtige Handhabung der Geräte beim Essen sind besonders bei der Erziehung der Kinder wichtig, auch die Pflege einer kultivierten Tischatmosphäre ist erforderlich. Beim Decken des Tisches sollte auf das Zusammenpassen der Geschirre und Geräte und deren geschmackvolle Anordnung geachtet werden, auch wenn aus Zeitgründen nur ein einfaches Essen eingenommen wird."
[Die Frau. -- Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, ©1987. -- (Kleine Enzyklopädie). -- ISBN 3-323-00109-5. -- S. 275 f., 400]
Gastlichkeit in den verschiedenen Kulturen liegt zwischen verschiedenen Polen:

Abb.: Zeigen, was man hat (©ArtToday)
"Die Gesellschaft »Prunklosia«: In einer großen Hauptstadt unseres Deutschen Reiches lebt ein Freundeskreis von Gelehrten, Künstlern, Offizieren, Beamten und Privatleuten, welche sich durch eine ganz eigentümliche Art von Mut von den übrigen Gebildeten unterscheidet, um den Mut, der vielbeklagten und nie abgestellten Gesellschaftsüppigkeit kurzer Hand den Garaus zu machen. Wie schwer lastet der unsinnige Zwang der »standesgemäßen Bewirtung« auf vielen sorgenvollen Familienvätern, mit welch unwürdigen und traurigen Opfern müssen die feinen Braten und teuren Weine der jährlichen »großen Gesellschaft« hinterher aufgewogen werden! Aber »der einzelne kann sich nicht ausschließen!« heißt es regelmäßig, wenn diese Frage erwogen wird, »es liegt einmal so in den Zeitverhältnissen, die alte Einfachheit lässt sich nicht mehr wiederherstellen.« Die Herzhaften aber sagen: »Warum nicht? Es kommt auf die Probe an.« Und diese Probe ist dem besagten Kreise glänzend ausgefallen, er genießt heute als Gesellschaft »Prunklosia« eines wohlverdienten Ansehens, denn seine Zusammenkünfte zeichnen sich durch vortreffliche Unterhaltung aus, obschon oder weil die Bewirtung nicht die Hauptsache ist. Suppe, Braten und Gemüse, hinterher eine süße Speise, also was jede der Familien an ihrem eigenen Tische genießt, machen den durch Gesellschaftsbeschluss festgesetzten Küchenzettel aus, und alle vierzehn Tage sieht ein anderes Familienzimmer zu Mittag den fröhlichen Kreis, der es seinen Hausfrauen so leicht macht, Gäste zu bewirten. Möchten doch an recht vielen Orten im Deutschen Reich Zweigvereine dieser wohltätigen Gesellschaft entstehen und ein entsprechend einfaches Programm auch für Abendgesellschaften ausarbeiten. Wer nicht den Mut besitzt, aus eigenem Antrieb bei seinen Freunden dafür zu werben, der berufe sich auf die »Gartenlaube«! Sie hat schon manche gute Neuerung vertreten und empfiehlt diese hier aufs wärmste der deutschen Familie!"

Abb.: Gastlichkeit zuhause (©ArtToday)
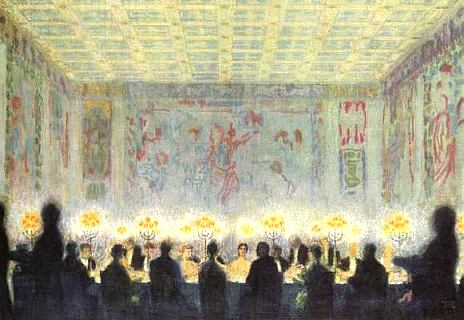
Abb.: Formelle Gastlichkeit: Stuck, Franz von <1863 - 1928>:
Das Diner, 1904
| A tavola si connosce l'uomo | Bei Tisch erkennt man den Menschen |
|
Toskanisches Sprichwort |
|
Tischkultur ist kulturabhängig:
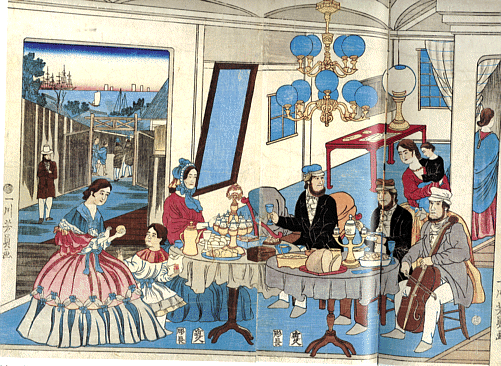
Abb.: Europäische Tischkultur mit japanischen Augen gesehen: Issen Yoshikazu:
Ausländer-Residenz in Yokohama. -- Holzschnitt. -- 1861
[Quelle der Abb.: Dambmann, Gerhard: Wie Japan den Westen entdeckte : eine Geschichte in Farbholzschnitten. -- Stuttgart [u.a.] : Belser, ©1988. -- ISBN 3-7630-1633-3. -- S. 38f.]
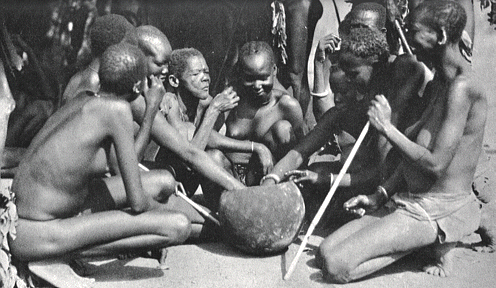
Abb.: Wie in vielen Kulturen werden bei den Rumbek-Djur am oberen Nil die
Mahlzeiten von Frauen und Männern getrennt eingenommen
[Quelle der Abb.: Bernatzik, Hugo Adolf <1897 - 1953>: Zwischen Weißem Nil und Kongo : ethnographische Bilddokumente einiger Völker am oberen Nil. -- Wien : Schroll, ©1943. -- Abb. 73]
Tischkultur hängt vom sozialen Status ab:
|
|
|
|
Die eigene Tischkultur wird oft mit "Zivilisation" verwechselt:
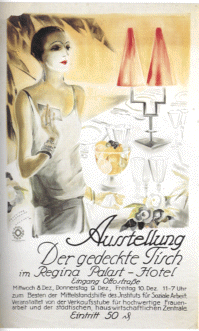
Abb.: Slopsnies, Franziska: Plakat zur Ausstellung "Der gedeckte
Tisch". -- München, 1926
[Quelle der Abb.: Die anständige Lust : von Esskultur und Tafelsitten / hrsg. von Ulrike Zischka ... -- München : Edition Spangenberg, ©1993. -- ISBN 389409-074-X. -- S. 301]
Unter Gedeck versteht man
"Die gesamte Hardware, die ein Gourmet zum Essen benötigt und die deshalb vom Besteck bis zu den Gläsern eingedeckt bereitliegt, ehe aufgetragen wird. In romanischen Ländern ist es üblich, sich diese Vorbereitung inklusive Brot und Butter vorab mit eigenem Rechnungsposten (französisch couvert, italienisch coperto, spanisch cubierto, portugiesisch refeião) gesondert bezahlen zu lassen. In Deutschland umfasst ein Gedeck nur die für einen einzelnen Gast benötigte Menge Geschirr und Besteck. In unfreundlichen und Nepp-Fällen ist ein Kneippengedeck vor allem im Rotlichtmilieu die Zwangsabnahme eines umsatzsichernden Getränkedoppels (Kombigetränke wie Bier und Schnaps, Kaffee und Cognac etc.)"
[Pini, Udo <1941 - >: Das Gourmethandbuch. - Köln : Könemann, ©2000. -- ISBN 3829014430. -- S. 362. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gedecke, USA 1922:
Emily Post <1873–1960> war die Autorität für Umgangsformen (Etikette) in den USA. Die verschiedenen Auflagen ihres Hauptwerks:
Post, Emily <1873–1960>: Etiquette in society, in business, in politics and at home : illustrated with private photographs and facsimiles of social forms. -- New York : Funk & Wagnalls, 1922. -- 627 S. : Ill.
wurden in insgesamt über 1 Million Exemplaren verkauft. 1997 erschien die 16. Auflage (ISBN 0062700782. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen})
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beim Gedeck wird oft auf Linkshänder keine Rücksicht genommen. Für Linkshänder ist es dann oft angebracht, sich wie Rechtshänder zu benehmen.
Besondere Probleme bei vornehmen Gedecken kann die Vielfalt des Bestecks bieten. Die folgende Übersicht zeigt, wie schwer man sich das Essen machen kann:
| "Besteck kann zu festlichen Anlässen oder bei einem
großen Dinner in verwirrender Vielfalt eingedeckt sein und wird denn
zweckbestimmt von außen noch innen zur Hand genommen.
Besteckstandard eines Gedecks:
Spezialbestecke bei Tisch:
[Pini, Udo <1941 - >: Das Gourmethandbuch. - Köln : Könemann, ©2000. -- ISBN 3829014430. -- S. 82. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}] |
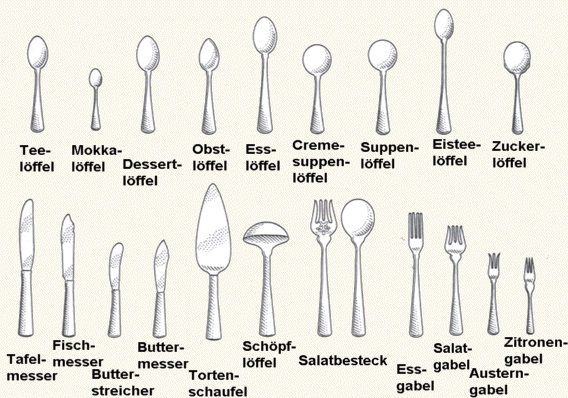
Abb.: Besteck, USA
[Quelle der Abb.: Mendelson, Cheryl: Home comforts : the art and science of keeping house. -- New York, NY : Scribner, ©1999. -- ISBN 068481465X. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
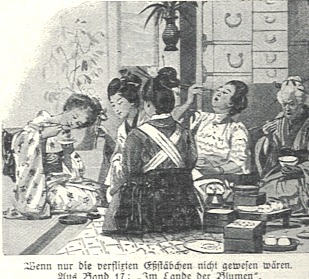
Abb.. "Wenn nur die verflixten Essstäbchen nicht gewesen wären!". --
Abb. in: Das Kränzchen : illustrierte Mädchen-Zeitung. -- 35. Jg. (1922). --
Nr. 48
In Ostasien sind Essstäbchen (chopsticks) das wichtigste Besteck.
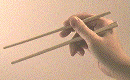
Abb.: Handhabung von Stäbchen (animated gif) [Bildquelle: ©http://www.japan-guide.com/e/e2039.html.
-- Zugriff am 2001-03-19]
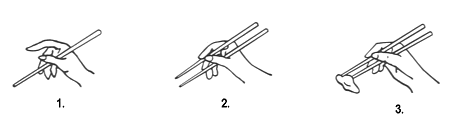
Abb.: Handhabung von Esstäbchen
In manchen Ländern, z.B. Südasiens, gilt beim Essen der Gebrauch der Hände als Besteck als die hygienischste Methode (man weiß schließlich, ob und wie man seine Hände gereinigt hat, bei aufgelegtem Besteck ist das nicht so klar). In solchen Fällen ist es das Beste, wenn man sich den anständigen Gebrauch der Finger von einer kundigen Tafelgenossin (oder Tafelgenossen) erklären lässt.
Unbedingt zu beachten ist, dass bei Muslimen die linke Hand bei Essen und Trinken nicht benutzt werden darf. (In Bengalen hat eine brahmanische Mutter immer herausbekommen, ob ihre Kinder sie angeschwindelt haben und muslimische Freunde/Freundinnen mit ins Haus gebracht haben: Hindus greifen nach dem Glas mit der linken Hand, Muslime niemals!).
Aus Trinkgläsern haben manche eine reine Wissenschaft gemacht, So entwickelt Professor Georg Riedel, Kufstein, Österreich [Webpräsenz: http://www.riedelcrystal.co.at/index.htm. -- Zugriff am 2001-03-20] , für fast jeden Wein ein besonderes Glas, das deutlich mehr charakteristische Noten aus einem individuellen Wein herausholen soll als ein Standard-Weinglas.
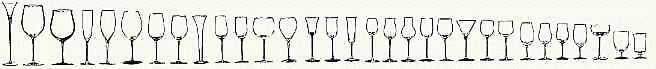
Abb.: Riedel Gourmetglasserie ™Sommeliers
"Wir müssen heute von zwei strikten
Grundforderungen ausgehen, denen alle anderen Etikettevorschriften
unterworfen sind:
|
[Wrede-Grischkat, Rosemarie: Manieren und Karriere : internationale Verhaltensregeln für Führungskräfte. - 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl.. -- Frankfurt am Main : Frankfurter Allgemeine Zeitung, © 1998. -- ISBN 3409391460. -- S. 196. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Die Etikettenvorschrift der Geräuschlosigkeit gilt z.B. in China und Japan, wo Rülpsen als Kompliment an Gastgeber oder Koch gilt.
| "Wenn du am Tisch eines reichen Mannes sitzt, so sperr deinen Mund nicht auf
und denke nicht: Hier gibt's viel zu fressen!, sondern bedenke, dass ein neidisches Auge schlimm ist; denn was ist neidischer als das Auge? Darum weint es schon beim geringsten Anlass. Greif nicht nach dem, wohin der andre sieht, damit du nicht mit ihm in der Schüssel zusammenstößt. Überlege dir, was dein Nächster gern oder ungern hat, und bedenke alles, was du tust. Iss, was dir vorgesetzt wird, wie ein Mensch, und greif nicht gierig zu, damit man dich nicht missachtet. um des Anstandes willen höre du zuerst auf, und sei kein unersättlicher Vielfrass, damit du keinen Anstoß erregst. Wenn du mit vielen zu Tisch sitzt, so greif nicht zuerst zu. Ein wohlerzogener Mensch ist mit wenig zufrieden; darum braucht er in seinem Bett nicht so zu stöhnen. Und wenn der Magen mäßig gehalten wird, so schläft man gut und kann früh am Morgen aufstehen und fühlt sich wohl. Aber ein unersättlicher Vielfrass schläft unruhig und hat Leibschmerzen und Bauchweh. Wenn du genötigt worden bist, viel zu essen, so steh auf, erbrich dich und geh weg, dann wirst du Ruhe haben. Mein Kind, gehorche mir und verachte mich nicht, so wirst du zuletzt meine Worte wahr finden. Bei allem, was du tust, sei eifrig, so wirst du auch nicht krank werden. Einen gastfreien Mann loben die Leute und sagen, er sei ein trefflicher Mann; und das stimmt; aber von einem Geizhals redet die ganze Stadt schlecht, und man spricht mit Recht so von ihm. Sei kein Held beim Weinsaufen; denn der Wein bringt viele Leute um. Das Feuer prüft den Stahl, wenn er in Wasser getaucht ist; so prüft der Wein die Mutwilligen, wenn sie in Streit geraten.
Der Wein erquickt die Menschen, wenn man ihn mäßig trinkt. Und was ist das Leben ohne Wein?
Denn er ist geschaffen, dass er die Menschen fröhlich machen soll. Der Wein, zu rechter Zeit und in rechtem Maß getrunken, erfreut Herz und Seele.
Aber wenn man zuviel davon trinkt, bringt er Herzeleid, weil man sich gegenseitig reizt und miteinander streitet.
Die Trunkenheit macht einen Narren noch toller, bis er strauchelt und kraftlos hinfällt und sich verletzt.
Schilt deinen Nächsten nicht beim Wein und verachte ihn nicht, wenn er lustig wird.
Gib ihm keine bösen Worte und dränge ihn nicht, wenn er dir etwas zurückzuzahlen hat. Du, der du zu den Älteren zählst, kannst reden, weil es dir zukommt und du Erfahrung hast; aber hindere die Spielleute nicht. Und wenn man lauscht, so schwatz nicht dazwischen und spare dir deine Weisheit für andere Zeiten. Wie ein Rubin auf einem Goldring leuchtet, so ziert Musik das Festmahl. Wie ein Smaragd auf schönem Golde, so wirken Lieder beim guten Wein. Auch du, Jüngling, darfst reden, wenn's nötig ist, aber höchstens zweimal, wenn man dich fragt. Mach es kurz, und sage mit wenigen Worten viel; und mach es wie einer, der zwar Bescheid weiß, aber doch schweigt. Stell dich nicht den Vornehmen gleich, und wo Alte sind, schwatz nicht viel. Vor dem Donner leuchtet der Blitz; und dem Bescheidenen geht große Gunst voraus. Steh beizeiten auf und sei nicht der Letzte; sondern geh eilends heim und sei nicht leichtsinnig. Dort freue dich nach Herzenslust, doch sündige nicht im Übermut; sondern danke für das alles dem, der dich geschaffen und mit seinen Gütern gesättigt hat." Jesus Sirach (um 175 v. Chr.), 31,12 - 32,17 |

Abb.: In der Renaissance war der Fußboden bei fürstlichen Festmahlen eine
Festtafel für Hunde und Katzen
Zahllos sind seit Ende des Mittelalters die pädagogischen Versuche, Kinder auf eine feinere Lebensart vorzubereiten. So fordert der Schulmeister Sebaldus Heyden in seinem Büchlein Formula puerilium colloquiorum (Die Formel kindlicher Unterhaltungen) 1529:
"Danach setz dich fein züchtig nieder.
Die Speis greif nicht mit den Fingern an!
Nicht fass sie in die Faust!
Nicht sei der erste mit essen!
Trink auch nicht als erster!
Nicht stütz dich auf die Ellenbogen!
Sitz aufrecht!
Und spreiz die Arme nicht aus!
Nicht trink begehrlich!
Auch kau nicht geizig!
Nimm das dir nächste!
Säum dich nicht auf dem Teller!
Guck andere Leut nicht an!
Wisch den Mund, wenn du trinken willst!
Nicht mit der Hand, sondern mit dem Tuch!
Das Gebissene tunk nicht wieder ein!
Nicht leck an den Fingern!
Nag auch kein Bein!
Ein jedes mit dem Messer schneid!
Beschmier den Mund nicht!
Die Finger trockne oft!
Nicht bohr in der Nasen!
Schweig, weil man dich nicht fragt!
Iss soviel du magst!
Wenn du genug hast, so steh auf!
Wasche die Händ wieder!
Heb das Tischgerät auf!
Sag Gott, dem Herrn. Dank!"
[Zitiert in: Die Freud des Essens : ein kulturgeschichtliches Lesebuch vom Genuss der Speisen aber auch vom Leid des Hungers / von Herbert Heckmann. -- Frankfurt am Main : Büchergilde Gutenberg, 1980. -- ISBN 3-7632-2404-1. -- S. 133]
Tischmanieren (Tischsitten) ändern sich ständig:
"Tischsitten: Amüsantes Kapitel der Feinschmeckerei, weil in den Jahrzehnten vom frühkindlichen Drill des rechten Benehmens bei Tisch bis zur souveränen Beherrschung der sog. Regeln immer wieder einige abgeschafft werden. Bei offiziellen Tafelgelegenheiten wiederum sind alte Bräuche wieder angesagt. In diesem Spannungsfeld verordnet heute ein deutscher »Arbeitskreis Umgangsformen International« meist jedoch nacheilend und eher konservativ, was oft schon eingerissen ist:
Die Empfehlungen des Arbeitskreises wollen allzu weitgehende Lockerungen aus eher voreiligen Etikettebüchern korrigieren, etwa, wenn Keulen und Koteletts ruhig aus der Hand zu essen und das Schlürfen und Schmatzen beim Krebsessen auch nicht peinlich seien.
Immerhin ist jetzt »gestattet«, Zahnstocher bei Tisch zu benutzen.
Während ältere Deutsche tendenziell in mehr Strenge, opportunerweise aber eher zu erlösenden Vorschriften neigen (im Extremfall sollen Servietten dann Kleiderschutz und beileibe kein Mundtuch sein), orientieren sich Jüngere an den liebenswerten Manieren der Nachbarländer: Dann wird Brot in Suppen gebrockt und eine lohnende Sauce mit Baguettestücken aufgewischt. Genuss ist angesagt. Tischsitten sind eben Milieufragen. Und Sittsamkeit halbiert den Genuss."
[Pini, Udo <1941 - >: Das Gourmethandbuch. - Köln : Könemann, ©2000. -- ISBN 3829014430. -- S. 942f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Im Folgenden einige Abbildungen zu Tischmanieren des wohlerzogenen Kindes aus dem amerikanischen klassichen Benimmbuch:
Post, Emily <1873–1960>: Etiquette in society, in business, in politics and at home : illustrated with private photographs and facsimiles of social forms. -- New York : Funk & Wagnalls, 1922. -- 627 S. : Ill.
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Abb.: (©Corel)

Abb.: Testessen bei Heiratsbewerbung um 1910: "Sie machte dem Offizier
einen regelrechten Knicks"
[Quelle der Abb.: Deutsches Mädchenbuch : ein Jahrbuch der Unterhaltung, Belehrung und Beschäftigung für junge Mädchen. -- Stuttgart : Hoffmann. -- Bd. 19 [1912]. -- S. 79]
"Diese Art [nämlich Brötchen zu brechen und nicht abzubeißen] sollten Sie vorsichtshalber überall dort praktizieren, wo Sie nicht genau wissen, ob Ihre Tischgenossen die einfachere Methode akzeptieren. Bis das Abbeißen vom Brötchen nicht mehr als Zeichen von schlechter Erziehung gilt, werden sicher noch einige Jahre vergehen. Wenn sich diese traditionelle Regel überhaupt lockert. Zur Zeit ist eher das Gegenteil der Fall.
Wenn Sie jemand vermeintlich locker mit »Lassen Sie uns doch ganz zwanglos zusammen essen gehen, dann können wir noch mal in aller Ruhe über den neuen Job sprechen« einlädt, sollten Sie sich auf alle Fälle blitzschnell an die alte Brotbrech-Sitte erinnern. Bei der Vergabe von Posten im mittleren und gehobenen Management werden nämlich verstärkt so genannte Testessen eingesetzt. Einladungen zu einem solchen, bewusst als »zwanglos« bezeichneten Essen stellen sich im Nachhinein oft heraus als der berüchtigte Wolf im Schafspelz, Sie verführen Nichtwissende durch den ungezwungenen Ton zu dem freudigen (Irr-!)Glauben: »Den Job habe ich in der Tasche, wenn der/die mich sogar schon zum Essen einlädt.« Pustekuchen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine zusätzliche Hürde, die genommen werden muss. Die neueste Masche von Interviewern bei großen Firmen und Institutionen: Die Partnerin oder der Partner der oder des Jobsuchenden wird gleich mit getestet. Werden beim »Anhang« dann Defizite festgestellt, ist die Bewerberin oder der Kandidat den Job in spe genauso los, als wenn sie oder er selbst nicht ganz top ist in Sachen Tischsitten. Manch einer empfiehlt für diese Situation: »Wenn Sie etwas nicht wissen, machen Sie es einfach dem Tester nach.« Doch Vorsicht! Dieser Rat ist äußerst gefährlich. Es gibt nämlich inzwischen Interviewer, die absichtlich Tischsittenfehler begehen und genau auf diese Fehlreaktion warten. Der bessere Weg: Bekommen Sie wirklich etwas total Exotisches vor die Nase gesetzt, geben Sie einfach zu, so etwas noch nie gegessen zu haben. Das signalisiert Selbstbewusstsein. Mit dem Begriff »exotisch« meine ich natürlich weder Hähnchenschenkel noch Artischocke oder Garnelen. Über die Verzehrtechnik solcher relativ bekannter Gerichte sollten Sie sich besser vorher informieren. Auch wenn die Super-Schlemmerei mit Austern, Kaviar oder Hummer bei einem Testessen mehr die Ausnahme als die Regel ist, lohnt es sich, Ahnung von solchen Gerichten zu haben, Rechnen Sie aber eher mit recht gebräuchlichen Speisen und einem kritischen Blick des Testers für Kleinigkeiten. Zusätzlich zur Brot-Brech-Technik sollten Sie am Beispiel auf den richtigen Umgang mit Gläsern und Besteck .. achten sowie auf all die übrigen Details traditioneller Tischmanieren."
[Wolff, Inge: Umgangsformen : ein moderner Knigge. -- Niedernhausen : Falken, ©2000. -- ISBN 3806873917. -- S. 185 - 187. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Service: Ursprünglich nur das Angebot der Küche, das in mindestens drei Abschnitten auf der Tafel für die Gäste abgestellt wurde. Die Abwandlung dieser auf Show zielenden Umständlichkeit verlagerte den Begriff Service mehr auf die alternativen Serviermethoden und das Personal dafür, das im Laufe der Zeit immer knapper und teurer wurde.
Deshalb ist der bequeme Service am Tisch noch heute Teil des doppelten Vergnügens, etwas zum Genießen sitzenbleibend vorgesetzt zu bekommen -- und das in Zeiten, in denen Gäste- und Schaubüffets dem Personal die Bedienarbeit (von lateinisch servire = (be-)dienen) inzwischen immer öfter abnehmen sollen.
Heutige Restaurants müssen sich ganz professionell für eine der Servicemethoden entscheiden, weil ihre Brigaden und ihre geschulten Kellner die feinen Unterschiede kennen."
|
|
"Beim Service à la française folgten drei Gänge aufeinander.
Das Tranchieren der Grosses pièces erfolgte durch Diener an Nebentischen, die auch beim Auflegen der Gerichte auf die Teller halfen." [a] "Der sog. Französische Service hat keinen Ersatz für seine alte Pracht (service en ambigue) bekommen, bei der in höfischer Dekadenz ein möglichst hochdekoratives Vielerlei nur viertelstundenweise auf die Tafeln gewuchtet und von den selbst zulangenden Gästen in Eile zerstört wurde, ehe das Erkaltete wieder vorzeitig abserviert wurde. Die Show diente Gastgebern und Köchen, aber nicht dem Genuss. Der modernere Service à la française bedient an vergleichsweise kahlen Tafeln mit wenig Aufsätzen oder Rechauds, holt Vor- wie Nachspeisen vom seitlich aufgebauten Büfett, portioniert die Speisen vor den Augen der Gäste und reicht sie wie die Beilagen »zur Selbstentnahme«, wenn sie nicht auf den Tisch gestellt werden. Erkennen lässt sich dieser Service schon am Eindecken der Bestecke, denn Gabelzinken und Löffellaffel krümmen sich dem Tischtuch zu." [b] |
|
|
"Beim festlichen Dinieren oder in besseren Restaurants hat sich bis heute der sog. Russische Service (service
à la russe) durchgesetzt, den Prinz Alexander Borisowitsch Kurakine in Paris als Botschafter am Hofe von Napoleon III. (2. Empire) zur Mode machte: An wohldekorierten Tischen wurde informeller gegessen und schneller sowie heißer aufgetragen, Platten wurden den Gästen präsentiert, die vorgeschnittene Portion von links vorgelegt, wobei acht, zehn oder höchstens zwölf Gäste von einem
maitre d'hötel bedient wurden. Wein wurde ihnen von rechts eingeschenkt,
Obst, Gebäck, sogar Getränke standen auf dem Tisch. In einer privaten Runde übernahm der Gastgeber das Herumreichen der Platten. Nach dieser russischen Art wurde seit Ende des 19.Jh. zunehmend und wird heute noch am häufigsten serviert."
[b]
"Beim Service à la russe stand die Tafeldekoration für den Dessertgang von Anfang an auf dem Tisch. Konfekt, Obst, Kompott und Blumen bildeten die kontinuierliche Tafelzier. Die linear aufeinander folgenden Gänge des Essens wurden auf Tellern bereits fertig geschnitten und angerichtet durch die Bedienung den Gästen vorgesetzt. Die Suppe wurde in Tellern gereicht. Das Menü war nach Art und Umfang nur auf der geschriebenen Menükarte zu überschauen." [a] |
|
|
"Der Service à l'anglaise zeigte verwandte Züge zum französischen Servieren. Auch hier stand der erste Gang fertig zu Beginn des Mahles auf dem Tisch, die Gäste halfen jedoch einander dabei, von den Platten und aus den Schüsseln zu nehmen. Diener arbeiteten an Anrichten und portionierten kompliziertere Speisen. Die Eigentümlichkeiten lagen darin,
dass das kunstgerechte Tranchieren der Bratenstücke durch den Hausherrn erfolgte und die Suppe von der Hausfrau ausgeteilt wurde. Solche patriarchalischen Sitten wurden im
19. Jahrhundert auch in Haushalten des Adels gepflegt, gemildert wurde dieses archaische System durch die Diener, welche von Buffets weitere
Speisen austeilten. An der damals englischen Universität Göttingen
gehörte das Tranchieren als akademisches Studienfach neben reiten und
Fechten zur Grundausbildung eines Studenten und wirklichen Herren. Es
wurden dort dementsprechend »Vorträge über die Kunst des Tranchierens«
gehalten." [a]
"Beim Englischen oder Rundservice werden die vorbereiteten Platten (meist dem Hausherren oder Gastgeber) präsentiert, ehe auf Beistelltischen Suppe aus Terrinen geschöpft oder Teller für die Gäste gefüllt und vor dem Gast eingesetzt werden. Im besseren À-la-carte-Geschäft ist diese vornehmste Art des Servierens heute die Regel; sie erinnert an personalstarke englische Haushalte und einen überwachenden oder zelebrierenden Butler, weil eine Bedienung vorlegt und die zweite die Teller einsetzt bzw. Beilagen nachreicht. Da sich so lange dinieren lässt, werden beim Englischen Service auch mehr als drei Besteckteile aufgelegt." [b] |
|
|
"Beim deutschen Service reichen sich die Gäste die Beilagen selbst herum. Teller und Platten werden direkt auf den Tisch gestellt, wo auch filiert wird. " [b] |
| "Last and least fürchten Serviceexperten den Amerikanischen Service, bei dem alle Gerichte auf einem Teller serviert werden, also Vor-, Zwischen- und Hauptgericht höchst rationell beisammen sind." [b] |
[Textquelle:
[a] = Die anständige Lust : von Esskultur
und Tafelsitten / hrsg. von Ulrike Zischka ... -- München : Edition Spangenberg, ©1993. -- ISBN 389409-074-X. -- S. 256f. [dort auch die Abb.]
[b] = Pini, Udo <1941 - >: Das Gourmethandbuch. - Köln : Könemann,
©2000. -- ISBN 3829014430. -- S. 881 - 883. -- {Wenn Sie HIER
klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de
bestellen}]
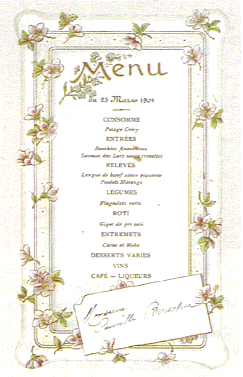
Abb.: Französische Menükarte
"Teil I
Teil II
Wie immer gilt, dass auch hierbei die variatio delectat (lat. = Abwechslung erfreut) und diese besonders vom fünften Gang an eher gewagt wird als davor, weshalb die Angebote dann auch gern vom Wagen ausgewählt werden können. Wenn überhaupt noch ein Gang geht."
[Pini, Udo <1941 - >: Das Gourmethandbuch. - Köln : Könemann, ©2000. -- ISBN 3829014430. -- S. 348. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]

Abb.: Offiziersmesse der britisch-indischen Kolonialarmee mit Gedeck à l'anglaise,
Peshawar, heutiges Pakistan
[Quelle der Abb.: Morris, Jan: the spectacle of Empire : style, effect and the Pax Britannica. -- London [u.a.] : Faber and Faber, ©1982. -- ISBN 0-571-11957-3. -- S. [165]]
"Der selten beschriebene Service à l'anglaise war eine im 19. Jahrhundert gebräuchliche Art, Speisen aufzutragen und vorzulegen. Besonders nordeuropäische Fürstenhöfe und das gutsituierte Bürgertum machten vom Service à l'anglaise Gebrauch. Bestandteile dieser Sitten sind nicht untergegangen und existieren bis heute fort. In England waren diese Konventionen so selbstverständlich, dass sie unbewusst blieben und nicht niedergeschrieben wurden:
»Diese Gewalt, welche die Engländer über die Fremden ausüben, sie zu ihren Sitten zu zwingen, ist wirklich merkwürdig. Sie reden gar nicht davon und tun eigentlich nichts dazu, aber man findet hier alles in so festen, konsequenten und durch alle Punkte durchgehenden Formen, auch bis auf gewisse Unterschiede so gleich durch alle Stände der Nation, dass einem auch gar nicht einmal der Gedanke kommt, sich davon ausnehmen zu wollen.«
(Wilhelm von Humboldt [1767 - 1835] an seine Frau Caroline, London 1818-01-09)."
"Einen tieferen Einblick in »typisch englische« Sitten, die sich von kontinentalen Bräuchen gravierend unterschieden, geben Schilderungen aus den Jahren 1805 und 1818 durch Besucher Großbritanniens. Den ausführlichsten Bericht verdankt man Johanna Schopenhauer [1766 - 1838], Mutter des berühmten Philosophen, die mit ihrer Familie von 1803 bis 1805 England und Schottland bereiste [Schopenhauer, Johanna <1766 - 1838>: Sämtliche Schriften. -- Leipzig, 1830. -- Bd. 15/16. -- Kapitel: Ein Tag in London]. Sie bemerkt erstaunt und auch bisweilen schockiert die ihr fremden Sitten.
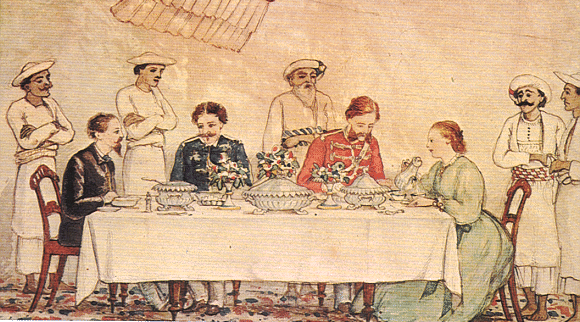
Abb.: Britischer Zivilist gibt Dinner für Kolonialoffiziere, Ceylon [?], 1860
[Quelle der Abb.: Morris, Jan: the spectacle of Empire : style, effect and the Pax Britannica. -- London [u.a.] : Faber and Faber, ©1982. -- ISBN 0-571-11957-3]
Das Dinner beginnt in der Regel um 18.30 Uhr am frühen Abend. Alles steht fertig zum ersten Gang auf dem Tisch bis auf die Gläser. Servietten sind damals eine absolute Neuigkeit. Zuvor bedienten sich die Gäste des lang herabhängenden Tischtuchs. Die Sitte gilt noch bei den Familienmahlzeiten. Im Gegensatz zum größeren Teil Europas nehmen der Hausherr und die Hausfrau an den beiden Enden der langen Tafel Platz. Während die Gäste nur Stühle angeboten bekommen, verfügen der Hausherr und die Hausfrau über Armlehnstühle als ihre Ehrenplätze. Dann beginnt eine zeitraubende und sehr umständliche Prozedur: die Hausfrau teilt die Suppe aus, und der Hausherr tranchiert; dabei fragen sie jeden der Gäste der Reihe nach, wieviel er haben möchte und welche Stücke oder Teile er bevorzugt. Dabei entwickelt sich eine fortgesetzte Diskussion über die verschiedenen Qualitäten und Quantitäten der Essensportionen.
»(Der Gast) muss Rede und Antwort von jeder Schüssel geben, ob er davon verlangt, ob viel oder wenig, mit Brühe oder ohne Brühe, welchen Teil vom Geflügel, vom Fisch, ob er es gern stärker oder weniger gebraten hat, eine Frage, die besonders oft die Fremden in Verlegenheit setzt; man sagt: Much done or little done, wörtlich übersetzt heißt das: viel getan oder wenig getan.«
Es gilt als unschicklich, über etwas anderes als das Essen zu sprechen und mit Konversation die Mahlzeit zu stören. Nach der Suppe werden alle aufgesetzten Speisen zugleich angegangen und nicht der Reihe nach wie man es sonst gewohnt war. Freunde des Hauses halfen bei der komplizierten Prozedur des Austeilens. Natürlich erwähnt Johanna Schopenhauer auch die klassischen Kritikpunkte englischen Essens, wie:
statt dessen schildert sie bereits 1805 den exzessiven Gebrauch von
Gewürze und Saucen werden in umfangreichen cruets während des ganzen Essens bereitgehalten und ohne jede Zurückhaltung gebraucht. Gelindes Erstaunen verursacht das Zutrinken mit Portwein, bei der jeder der anwesenden Herrn verpflichtet ist, auf jede der anwesenden Damen mit to your very good health einen Toast auszubringen. Entsetzen verursacht, dass am Ende des Essens Käse aufgetragen wird, ein Brauch, der in Deutschland oder Frankreich in Gegenwart von Damen undenkbar wäre. Ekel verursacht schließlich der Gebrauch von rincing-bowls aus Kristall, mit denen bei Tisch der Mund ausgespült wird.
»Die ganze so beschäftigte Gesellschaft erinnerte uns oft an einen Kreis Tritonen, wie man sie Wasser speiend um Fontänen sitzen sieht.«
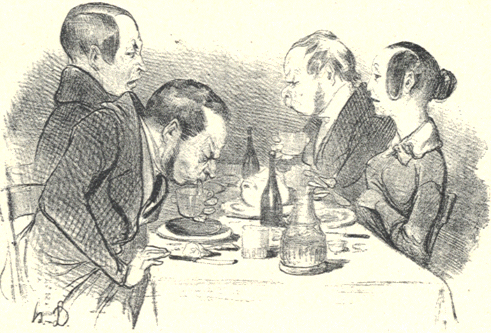
Abb.: Daumier, Honoré <1808 - 1879>: Mundspülen bei Tisch
Danach wird der Tisch mitsamt dem Tischtuch abgeräumt, Früchte und Süßigkeiten gereicht, kein Kaffee serviert und erst nachdem die Damen sich getrennt zurückgezogen haben, für alle gemeinsam durch die Hausfrau Tee gereicht.
Als Besteck wurden um 1800 auf dem Kontinent Löffel verschiedener Größe gebraucht, dann eine Gabel und ein Messer mit einer Stahlklinge. Dazu kamen verschiedene Vorlegebestecke. In England hingegen entsteht ein neuer Luxus an verschiedensten Bestecken und einer Vielzahl verschiedenster Vorlegebestecke.
Der Service à l'anglaise braucht stets mehr als drei verschiedene Besteckgarnituren, die nebeneinander aufgelegt werden. Wilhelm von Humboldt sieht sich 1818 außerstande, englische Gäste in die preußische Botschaft einzuladen, weil er weder über notwendige silberne Terrinen, Schüsseln und Platten, noch über die sechs silbernen Bestecksätze pro Gast verfügt, die anständigerweise erwartet werden.
»Mit meinem Silber bin ich sehr schlimm dran, und nach hiesiger Mode wird mein Tisch nie gut aussehen. Wir haben nicht genug und nicht groß genug, und nicht nach Art hiesigen Tafel-Arrangements. So hat man hier immer zwei Terrinen, größere Schüsseln zu den Fischen und großen Fleischspeisen. Der Unterschied kommt daher, dass man alles zugleich aufsetzt, und dies anders zu machen, daran ist schlechterdings nicht zu denken.«
Materialluxus verband sich dabei in England mit einer bewussten Schlichtheit der Gestaltung:
»Der Luxus ist in keinem Lande höher gestiegen, und das Verzweifeltste ist, dass er noch dabei immer ganz einfach aussieht. Diese Verbindung der Einfachheit mit dem ungeheuren Aufwande ist das wahre und echte Zeichen des Reichtums und der Wohlhabenheit« (Humboldt, a.a.0. 9.1.1818)."
[ Die anständige Lust : von Esskultur und Tafelsitten / hrsg. von Ulrike Zischka ... -- München : Edition Spangenberg, ©1993. -- ISBN 389409-074-X. -- S. 256ff.]
Gespräche (Thema, Form, Stil) bei Essen und Trinken sind in verschiedenen Kulturen unterschiedlichst geregelt, abhängig von
Allgemeine Regeln lassen sich kaum geben. Am Wichtigsten ist vorsichtige Sensibilität für die geltenden Normen, damit man sich nicht völlig denebenbenimmt.
[Das Gesprächsthema] sollte im allgemeinen ein Thema sein, das allen angenehm ist: Im Deutschen gehören zu den »sicheren« Themen unter Fremden für gewöhnlich
zu den »unsicheren« Themen zählen
Es gibt eine Reihe willkürlicher Grenzen: Man kann einen anderen zwar meist ohne weiteres fragen, womit er sein Geld verdient, nicht aber, wieviel er verdient. Kulturelle Unterschiede werfen unter Umständen Probleme auf: Kommentare über den Preis von Möbeln oder den Geschmack des Essens können in der einen Gesellschaft akzeptabel sein, in einer anderen nicht.
Verallgemeinerungen darüber, was bei Gesprächen als
gilt, sind kaum möglich; die kulturellen Unterschiede sind zu groß.
Das Schweigen zum Beispiel hat durchaus unterschiedlichen Stellenwert. Unter Deutschen wirkt es peinlich, außer wenn besondere Gründe vorliegen (etwa Trauer). In manchen Kulturen (z.B. bei Lappen, Dänen und westlichen Apachen) ist es jedoch völlig normal, dass die Anwesenden verstummen.
Wer spricht und wieviel gesprochen wird, hängt oft vom sozialen Status der Teilnehmer ab -- zum Beispiel wird in manchen Fällen erwartet, dass Personen von niedrigerem Rang schweigen, wenn die ihnen Übergeordneten zu sprechen wünschen.
Sogar die Grundregel, dass immer nur einer spricht, kann durchbrochen werden: Auf Antigua ist es durchaus nichts Ungewöhnliches, dass ein ganzes Gespräch hindurch mehrere Teilnehmer auf einmal reden."
[Crystal, David <1941 - >: Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache. -- Köln : Parkland, 1998 (©1993). -- ISBN 3880599548. -- Originaltitel: The Cambridge encyclopedia of language (1987). -- S. 116f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
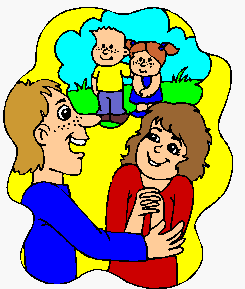
Abb.: Small-Talk-Thema "Die lieben Kleinen" (©ArtToday)
Richard D. Lewis schreibt zu diesem Thema stark schematisierend:
"Einige Nationalitäten blühen in der Atmosphäre von Cocktailpartys auf, andere nicht.
Für einige Nationalitäten stellt der Small Talk allerdings ein substanzielles Problem dar.
[Lewis, Richard D.: Handbuch internationale Kompetenz. -- Frankfurt [u.a.] : Campus, ©2000. -- ISBN 3593363933. -- Originaltitel: When cultures collide (1999). -- S. 174f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Im Lauf der Zeiten war das »Über Essen reden« wechselnd verboten, zulässig, snobistisch, kennerhaft, vulgär oder anstößig. Genauso verpönt blieb es, im Gespräch die Themen Sexualität, Krankheit, Verdauung oder Geld zu erörtern, eben alles was mit dem Körper oder seinen Lüsten zu tun hat. Zu einer wahren Essenskultur ist der Diskurs über das Essen, der über das Nennen von Namen hinausführt und das >Wie< über das >Was< stellt, notwendig. Ein gastrosophischer Journalismus hat hier, sit venia verbo, der stummen Zunge die Augen geöffnet und war sicherlich Beginn eines Umdenkens."
[Die anständige Lust : von Esskultur und Tafelsitten / hrsg. von Ulrike Zischka ... -- München : Edition Spangenberg, ©1993. -- ISBN 389409-074-X. -- S. 10]
Mit Tischsitten, Getränken und Speisen ist eine Menge Aberglauben verbunden. Hier nur einige Beispiele:
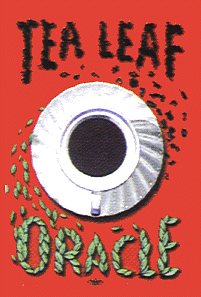
Abb.: Teeblätterorakel
Bestimmten Speisen und Getränken wird -- meist zu Unrecht -- potenzsteigernde oder libidofördernde Wirkung zugeschrieben
Auch die meisten religiös und anders begründeten Speisetabus (s. unten) gehören in diese Kategorie
Die beiden wichtigsten Fragen, wenn man auswärts essen und trinken geht, sind
Über die in der jeweiligen Kultur gültigen Regeln darüber, wer bezahlt, und über die Rituale (z.B. Scheinkampf um das Recht zu bezahlen) muss man sich rechtzeitig kundig machen, um nicht zu beleidigen.
In Ländern, in denen das Trinkgeld nicht im Preis enthalten ist -- besonders den USA -- , ist es wichtig, die entsprechende Trinkgeldsumme (meist 15 bis 20%) hinzuzufügen, da das Servierpersonal keine anderen Einnahmen hat.

Abb.: Tip the waiter (to tip = kippen; ein Trinkgeld geben) (©ArtToday)
"Trinkgeld: Seit dem 14. Jh. übliche »kleinere Geldsumme als Belohnung für außer der Regel geleistete Dienstverrichtungen«, vor allem aber für Freundlichkeit und Extras beim Service als Dank oder Ansporn. Routiniers zahlen das Trinkgeld (franz. pourboire, engl. tip, gratuity, ital. mancia, span. propina) gelegentlich vorab, um sich Sonderbehandlung zu erkaufen, üblich ist die Erhaltung der Spannung bis zum Schluss. Trinkgeld wurde so zur Belohnung und zahlte sich als sog. Bedienungsgeld für Personal vom Gepäckträger bis zum Taxifahrer vor allem in Hotels und Gastronomie am besten aus. Vor Einführung der allgemeinen Mehrwertsteuer [in Deutschland] als Rechnungszuschlag war das Trinkgeld fester Aufpreisposten von 10-15 %, was im Ausland häufig noch Sitte geblieben ist. Auch bei freiwilliger Zahlung haben sich diese 10-15 % als Durchschnittsbetrag etabliert. Aus Eifersuchts- und Fairnessgründen wandern Restauranttrinkgelder in einen gemeinsamen Topf (dem tronc) und werden am Ende eines Abends gerecht oder nach einem festgelegten Schlüssel geteilt. Da die Löhne und Gehälter in Hotel- und Gaststättenbereichen mit direktem Kundenkontakt wegen hoher Trinkgelder niedrig sind, rächt sich Trinkgeldgeiz von Kunden schnell. In den USA wird der tip körpersprachlich vom Personal durch Erstarren und Fixieren geradezu eingefordert.
Nur dort, wo service charge auf der Rechnung ausgewiesen ist, könnte ein Tip entfallen; das zu entscheiden ist eine Frage der Dankbarkeit. Andererseits bewirkt spontanes Zustecken schon bei der Ankunft bei Wagenmeister, Concierge, Portier und Zimmerservice (in Holland Geld unters Kopfkissen) Wunder. Bei längeren Aufenthalten oder auf Kreuzfahrtschiffen gilt es, am Ende der Reise viele kleine Umschläge mit Trinkgeldern für viele gute Geister vorzubereiten.
In Zeiten des real existierenden Sozialismus galt Bedienungsgeld als historisch überlebt und bei sozialistischem Bewusstsein als verwerflich (wie auf Kuba noch). In Island werden Trinkgelder aus stolz empfundener sozialer Gleichberechtigung gar nicht erst erwartet, auch in Japan eher nicht.
Umgekehrt provozieren geschickte, auf Prozentebasis arbeitende Kellner die Höhe des Trinkgeldes durch intensive Zuwendung und Aufmerksamkeiten, im Fachjargon wird damit der Gast trinkgeldgierig »befummelt«."
[Pini, Udo <1941 - >: Das Gourmethandbuch. - Köln : Könemann, ©2000. -- ISBN 3829014430. -- S. 953f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Zu Kapitel 9, Teil 2: Speisen und Fasten