Internationale Kommunikationskulturen
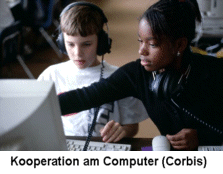
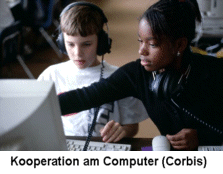
mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - >: Internationale Kommunikationskulturen. -- 10. Kulturelle Faktoren: Kleidung und Anstand. -- 3. Teil III: Accessoires und Schmuck. -- Fassung vom 2008-06-17. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur103.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2001-05-13
Überarbeitungen: 2008-06-17
Anlass: Lehrveranstaltung, HBI Stuttgart, 2000/2001
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Länder und Kulturen von Tüpfli's Global Village Library
| "Krawattennadel, Uhr, Manschettenknöpfe, Ring oder Schreibgerät sollten mit der gleichen Sorgfalt wie die Kleidung gewählt werden. Denn die Dinge, derer wir uns täglich bedienen, sagen nicht nur viel über uns aus -- sie vermögen auch über die Erfüllung ihrer Funktion hinaus Schönheit in den Alltag zu bringen. Dabei bieten Accessoires mehr noch als Anzug, Schuhe und Hemd die Möglichkeit des größten Understatements. Schließlich weiß außer Ihnen nur noch der Juwelier, dass die Krawattennadel vielleicht ein kleines Vermögen gekostet hat." |
[Roetzel, Bernhard <1966 - >: Der Gentleman : Handbuch der klassischen Herrenmode. -- Köln : Könemann, ©1999. -- ISBN 3895086371. -- S. 220.-- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Besonders dort, wo relativ ähnliche Kleidung getragen wird, insbesondere auf der hohen Managerebene die Anzüge mit den gedeckten Farben bei den Männern bzw. die meist schwarzen Hosenanzüge der Frauen, bieten Accessoires die Möglichkeit sich von anderen abzuheben und seinen Stand zu zeigen. Da gerade die gehobene Kleidung für Männer und Frauen heute international eher gleich ist, kann man durch zusätzliche Kleinigkeiten seine nationale Seite zeigen, z.B. eine Umhängetasche für Männer mit dem Schweizer Kreuz. Man kann davon ausgehen, dass auf dieser Ebene Accessoires bewusst ausgewählt werden, im Fall der Männer eventuell auch von ihren Ehefrauen.
Vor allem in Filmen werden solche Accessoires gern als Zeichen benutzt, um etwas über eine Person auszusagen: so ist in dem Disney-Film Mary Poppins von 1964 der Vater der Kinder durch seinen Hut und seinen schwarzen Regenschirm eindeutig als englischer Gentleman ausgewiesen. Bei seiner Kündigung durch die Bank wird symbolisch der Schirm zerstört.
Roetzel weist auf die Bedeutung der Zigarettenmarke hin: ..."der Gesamtzusammenhang, in dem ein Accessoire auftaucht, verrät in jedem Fall etwas darüber, ob es ein bewusst gesetzter Akzent oder eher eine Zufälligkeit ist. Wenn zum Beispiel ein Belgier, der in Brüssel lebt, die spanische Zigarettenmarke Ducados raucht, dann drückt er damit nicht nur die Vorliebe für den würzigen Geschmack dieser Sorte aus, sondern auch eine offenkundige und wahrscheinlich irgendwie biographisch begründete Sympathie für die Iberische Halbinsel. Wenn ein Spanier in Spanien Ducados raucht, dann raucht er einfach die starke Volkszigarette. Auch dies ist eine Aussage, allerdings eine völlig andere."
"Der international gültige Kleidungsstil lässt wenig Spielraum für nationale Variationen, deshalb setzen gerade hier die Accessoires oftmals entscheidende Akzente. Wer die Sprache der Accessoires kennt, vermag diesen Stil nicht nur individueller zu gestalten, sondern kann auch mehr aus der äußeren Erscheinung seines Gegenübers herauslesen. Die Aufmerksamkeit, die wir dem jeweiligen Detail widmen, verbessert auf diese Weise das Gespür für das Ganze."
[Roetzel, Bernhard <1966 - >: Der Gentleman : Handbuch der klassischen Herrenmode. -- Köln : Könemann, ©1999. -- ISBN 3895086371. -- S. 221.-- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
In diesem Teil können nicht einmal die wichtigsten Codes genannt werden, die zur Signalisierung mittels Accessoires in verschiedenen Kulturen und Moden dienen. Statt dessen soll der Blick etwas geschärft werden für solche Signale.
Die wichtigsten Accessoires (Zubehör) sind:
Webportal:
Vor allem in traditionellen Kulturen kann man an Kopfbedeckungen die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk, einer Religion oder Stand erkennen. So müssen Sikhs ab einem bestimmten Alter einen auf spezielle Art gebundenen Turban tragen, den sie in der Öffentlichkeit nicht mehr abnehmen dürfen, was z.B. zu Problemen mit der militärischen Uniform der indischen Streitkräfte geführt hatte.
Die Taliban verlangten zur Zeit ihrer Herrschaft in Afghanistan ebenfalls einen Turban, der zeigen sollte, dass der den Turban tragende Mann ein frommer afghanischer Muslim ist.
Mit einem Hut kann man seinen Stand ausdrücken z.B. tragen die Cholitas, die tüchtigen Händlerinnen von La Paz in Bolivien, zu ihrer traditionellen Tracht einen Bowler, an dem man u.a. auch erkennt, dass die Frau schon vergeben ist. Sie empfinden es im übrigen als Anmaßung, wenn eine Ausländerin einen solchen Hut trägt. Oder z.B. beim Pferderennen in Ascot werden noch heute von Damen der Gesellschaft aufwändige Hüte getragen.
Auch für Männer war es lange Zeit üblich Hut zu tragen, wobei man einerseits den Schutz dieses Kleidungsstückes gegen die Witterung nutzte und andrerseits durchaus auch die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand zeigen konnte. Roetzel weist darauf hin, dass man bis in die sechziger Jahre hinein, Protest ausdrückte, wenn ein Mann ohne Kopfbedeckung unterwegs war, dass aber später ein Hut nicht mehr unbedingt erforderlich war:
"Wer dennoch ohne Hut herumlief, signalisierte deutlich, dass er sich außerhalb der gesellschaftlichen Normen bewegte. In Thomas Manns »Zauberberg« ermahnt Hans Castorp seinen Vetter Joachim Ziemßen, dass »man einen Hut aufhaben soll [...], damit man ihn abnehmen kann, bei Gelegenheiten, wo es sich schickt«.
"Wenn das ursprüngliche Erfordernis nicht mehr besteht, wird das dafür gedachte Kleidungsstück irgendwann als überflüssig empfunden. Wer mit dem Auto zur Arbeit fährt, statt lange Wege zu Fuß zurückzulegen, kann gut auf den Hut verzichten. Und wer in der Lage ist, sich sein Haar zu waschen, sobald es nötig ist, braucht es nicht unbedingt vor Staub und Schmutz zu schützen. Die fünfziger Jahre mit ihrer wöchentlichen Haarwäsche sind lange vorbei. Die Frisurenmode der sechziger und siebziger Jahre hat dem klassischen Herrenhut die Existenz zusätzlich erschwert, denn wer wollte schon auf die kunstvoll gefönte Pracht einen Filzhut stülpen, der das Haar unweigerlich an den Kopf gedrückt und es seines mühsam aufgebauten Volumens beraubt hätte."
[Roetzel, Bernhard <1966 - >: Der Gentleman : Handbuch der klassischen Herrenmode. -- Köln : Könemann, ©1999. -- ISBN 3895086371. -- S. 208.-- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
|
|
Der Fez (Fes; persisch: Tarbusch) soll in der Stadt Fes in Marokko hergestellt worden sein. 1832 wurde der Fez für türkische Staatsbeamte und Soldaten anstelle des Turbans eingeführt, dies wurde 1926 in der Türkei, 1953 in Ägypten wieder abgeschafft. Heute wird der Fez noch in Marokko, Albanien und Griechenland getragen. |
|
Turbane werden vor allem von Hindus und Muslimen getragen. |
Eine besonders gebundene Art von Turban ist der Keski, ein Kennzeichen der Sikhs, einer nordwestindischen Religionsgruppe. |
|
|
|
Bei allen nicht praktischen Verwendungen oder Nichtverwendungen von Kopfbedeckungen, sollte man in sonnigen Gegenden die wichtige Schutzfunktion einer Kopfbedeckung nicht übersehen: an ozonreichen und sonnigen Tagen ist ein Hut ein wichtiger Schutz u.a. vor Hautkrebs!
Webportal:
|
[Quelle der Abb.: 1000 extra/ordinary objects. -- Köln [u.a.] : Taschen, ©2000. -- ISBN 3822860212. -- S. 149. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}] |
[Bildquelle: http://www.feminist.org/afghan/intro.asp. -- Zugriff am 2001-04-14] |
Nachdem im Westen Witwenschleier keine Rolle mehr spielen, sind heute vor allem die Schleier für muslimische Frauen von Bedeutung. Es gibt zwei Arten:
Das Kopftuch der Muslimin ist in neurer Zeit heftig umstritten: zeigt es nur die Zugehörigkeit zum Islam oder drückt es aus, dass die Frau sich als Islamistin bekennt? Zeigt das Kopftuch die Unterdrückung der Frau? Oder will die Kopftuch tragende Frau eine politische Aussage machen? Bei der heutigen Diskussion wird oft vergessen, dass das Bedecken der Haare ebenfalls in traditionellen christlichen Kreisen (vgl. die Nonnenhaube) und bei orthodoxen Juden verlangt wird (orthodoxe Jüdinnen lösen das Problem u.a. damit, dass sie Perücken tragen).
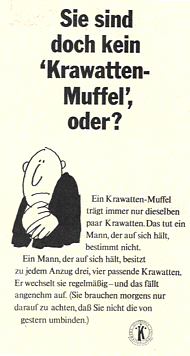
Abb.: Werbung der Deutschen Krawatten-Industrie, 1964
Trägt ein Mann bei einer festlichen oder offiziellen Veranstaltung keine Krawatte, sieht man das immer noch als eine gewissen Protesthaltung und bis zu einem gewissen Maß als Nichtachtung der Einladenden (es sei denn, man benutzt einen weißen Rollkragenpullover). Trägt man auch bei täglichen Auftritten ein Mascherl will man dem Gegenüber mitteilen, dass man etwas Besonderes ist und man mehr weiß, als die übrigen Leute (man schaue sich die Diskutanten um die Zweiklassenmedizin im Fernsehen an!)
"Die Business-Krawatte: Die klassischen Business-Muster sind alles andere als originell. Doch das sollen sie auch gar nicht sein. Nur an kleinsten Details darf unser Gegenüber ausmachen können, ob es sich um eine Durchschnittskrawatte oder um eine der Spitzenklasse handelt. Understatement funktioniert wirklich nur dann, wenn sich höchste Qualität hinter größter Unauffälligkeit verbirgt, wie zum Beispiel bei den Krawatten des Neapolitaners Marinella. Wer irgendwo gelesen hat, dass bei ihm mit die feinsten Krawatten der Welt zu bekommen sind, die zudem nach Maß angefertigt werden können, wird vielleicht enttäuscht sein, wie schlicht die Dessins des Hauses sind. Aber gerade in der Schlichtheit liegt ihre Größe. Less is more das gilt auch bei der Krawatte."
[Roetzel, Bernhard <1966 - >: Der Gentleman : Handbuch der klassischen Herrenmode. -- Köln : Könemann, ©1999. -- ISBN 3895086371. -- S. 80. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Auffällt, dass auch Business-Frauen häufiger Krawatte tragen. Die Aussage soll wohl sein, dass man gleichberechtigt ist und mindestens eben so viel kann, wie die umgebenden Business-Männer.
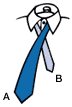
Abb.: Binden eines Windsor-Knotens (animated GIF)
| Name | Abbildung | Anleitung zum Binden |
|---|---|---|
| Four-in-Hand |
|
http://www.fashionmall.com/guide/tie/doc/fourhand.html. -- Zugriff am 2001-03-30 |
| Half Windsor |
|
http://www.fashionmall.com/guide/tie/doc/halfwindsor.html. -- Zugriff am 2001-03-30 |
| Full Windsor (a.k.a. Double Windsor) |
|
http://www.fashionmall.com/guide/tie/doc/windsor.html -- Zugriff am 2001-03-30 |
| Mascherl (Bow Tie) |
|
http://www.fashionmall.com/guide/tie/doc/bowtie.html. -- Zugriff am 2001-03-30 |
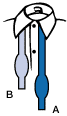
Abb.: Binden eines Mascherl (animated GIF)
In Großbritannien (und teilweise den USA) muss man bei der Wahl der Krawattenfarben vorsichtig sein:

Abb.: Krawattenmuster von (ehemaligen) Angehörigen der Royal Navy
"Wer eine Krawatte mit den Farben eines Regiments, eines Colleges, einer Schule oder eines Clubs trägt, will damit sagen, dass er dazugehört, zu der entsprechenden Institution -- und vor allem zur guten Gesellschaft. So ist es jedenfalls in England, der Wiege dieser Krawatte. Männer, die nicht dort beheimatet sind, kaufen solche Krawatten nach stilistischen oder ästhetischen Kriterien, und dagegen ist auch nichts zu sagen. Peinlich wird es nur, wenn ein Deutscher einen englischen Geschäftspartner trifft und aus Versehen die Farbe eines renommierten Ruderclubs trägt, in dem er natürlich nicht Mitglied ist - im Gegensatz zu seinem englischen Gegenüber. Die Wahrscheinlichkeit, auf diese Weise ins Fettnäpfchen zu treten, ist in England relativ groß, da es eine unübersehbare Zahl von »sprechenden« Farbkombinationen gibt."
[Roetzel, Bernhard <1966 - >: Der Gentleman : Handbuch der klassischen Herrenmode. -- Köln : Könemann, ©1999. -- ISBN 3895086371. -- S. 73. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Webportal:

Abb.: Behandschuhte Dame (©ArtToday)
Nicht in allen Epochen unserer Geschichte konnte man so freizügig unbekleidet sein wie heute. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts war es durchaus üblich, dass auch Eheleute sich nie vollständig nackt gegeneinander zeigten. Vor allem in bürgerlichen Kreisen war man eher prüde, was sich z.B. an der Wortwahl zeigte, so durfte noch in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts in traditionellen bürgerlichen Kreisen in Hamburg nicht von Unterhosen gesprochen werden, weil alles unterhalb des Bauchnabels tabu war. Musste man doch mal darüber sprechen, redete man von den "Unausprechlichen". Dass dann auch die Hände und Arme bekleidet waren, erwartet man. Sowohl Dame als auch Herr mussten für jeden Anlass spezielle Handschuhe besitzen - für Herren meistens feines Leder, für Damen Handschuhe aus guten Stoffen wie Seide u.ä. Entsprechend war das Benehmen: anders als heute zog man die Handschuhe zum Begrüßen nicht aus.
Heute kann mit Handschuhen zeigen, dass man modebewusst ist und es sich leisten kann z.B. Handschuhe von Armani zu etwa 100 Euro zu kaufen (Stand Juni 2008). Oder man will zeigen, dass man sportlich ist, indem man entsprechende Handschuhe trägt.
[vgl.: Roetzel, Bernhard <1966 - >: Der Gentleman : Handbuch der klassischen Herrenmode. -- Köln : Könemann, ©1999. -- ISBN 3895086371. -- S. 276. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Webportal: http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/Apparel/Accessories/Gloves_and_Mittens/. -- Zugriff am 2001-04-05 + 2008-06-16
|
|
|
Jeder von uns kennt Frauen, die im kalten Winter dünne Strümpfe anziehen, weil wir dünne Strümpfe als elegant ansehen,. Das weist daraufhin, dass solche Frauen ihre Eitelkeit über die Vernunft stellen oder dass sie nicht selbstbewusst genug sind, sich zu Gunsten der eigenen Gesundheit anzuziehen.
Wie sehr dünne Strümpfe an schlanken Beinen unserem heutigen Schönheitsideal entsprechen, zeigen z.B. die Frauen, die in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg so taten, als ob sie Nylonstrümpfe anhätten, indem sie sich eine Strumpfnaht auf ihre nackten Beine malten. Aber auch die Business-Frauen im tropischen Bangkok tragen dünne Strümpfe.
Roetzel empfiehlt für Herren das Tragen von Kniestrümpfen, damit man beim Sitzen kein Bein sehen kann. Die Farbe soll den Schuhen entsprechen, aber nicht im Gegensatz zur sonstigen Kleidung stehen.
[vgl.: Roetzel, Bernhard <1966 - >: Der Gentleman : Handbuch der klassischen Herrenmode. -- Köln : Könemann, ©1999. -- ISBN 3895086371. -- S. 186. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Webportal:
|
"Psychologen werden nicht müde, der verborgenen Symbolik des Schuss nachzuspüren, sprechen von der phallischen Form, deuten ihn als mystisches Gefäß. Manche sagen, Frauen sammelten Schuhe als Ersatzhandlung für die Reisen, von denen sie eigentlich träumen; andere sehen darin Symbole ihres Strebens nach Erleuchtung. Ein neues Paar Schuhe «heilt zwar vielleicht keinen Liebeskummer und vertreibt auch keinen Spannungskopfschmerz», schreibt die Modejournalistin Holly Brubach, «aber es lindert, die Symptome und die Laune.» Man muss nicht einmal besonders eitel sein, um einen ganzen Wochenverdienst für ein Paar auszugeben, dem man einfach nicht widerstehen kann. Wenn man der Statistik glauben darf, besitzen Frauen in der westlichen Welt im Schnitt mindestens 30 Paar Schuhe, und passionierte Sammlerinnen bringen es nicht selten auf mehrere hundert. Eine Frau, die von ihrer Lieblingsform ganz selbstverständlich jede neue Variante kauft, setzt nur die Maxime in die Tat um, die jeder Schuhfreund kennt -- wenn du einen Schuh findest, in den du dich verliebst, dann musst du ihn in jeder Farbe haben. Mag man mit seinem Körper noch so unzufrieden seid, die Füße lassen einen niemals im Stich. «Füße werden nicht dick und nehmen auch nicht ab», meint Sara Vass, eine Sammlerin, die über 500 Paar Schuhe im Schrank hat. «Wenn man ein paar Pfund zunimmt, dann passt einem vielleicht die Lieblingshose nicht mehr, aber auf die Lieblingsschuhe ist immer Verlass.» Einer passionierten Schuhsammlerin geht es eher darum, sie zu besitzen als sie zu tragen. Deshalb kaufen Frauen immer wieder neue Schuhe, auch wenn sie nur wenige davon wirklich anziehen. Und aus dem gleichen Grunde würden sie sich auch von einem Schuh, den sie wirklich mögen, niemals trennen, selbst wenn er völlig untragbar ist. Seit altersher sind Schuhe Ausdruck des Ansehens und Wohlsstands der Trägerin. Die Aristokratinnen des frühen 19. Jahrhunderts schmückten sich mit hauchdünnen Brokatslippern, während die Hausmädchen bei der Arbeit kräftige Lederstiefel anhatten. Die Goldsohlen-Sandalen römischer Kaiserinnen, die Pumps mit roten Absätzen, die man am Hofe Ludwigs XIV. trug, und die Gucci-Slipper unserer Tage sind allesamt Visitenkarten, die Wohlstand und sozialen Status verraten. Und nicht nur die Sozialgeschichte spiegelt sich in Schuhen, sie sind auch Dokumente unseres eigenen Lebens, Marksteine, die eine bestimmte Zeit, einen Ort, ein Gefühl ins Gedächtnis rufen. Als Erinnerungsstücke an den Tag, an dem sie getragen wurde, bewahren Schuhe Vergangenes, sie beschwören lebendige Erinnerungen herauf wie ein Fotoalbum -- der winzige erste Schuh eines Kindes, für alle Zeiten in Bronze festgehalten, oder ein Paar Brautschuhe in der Schachtel, in der sie geliefert wurden. .. Ob ein Schuh praktisch oder bequem ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das ist vielleicht auch die Erklärung dafür, dass 88 Prozent aller Frauen ihre Schuhe eine Nummer zu klein kaufen. Manch ein Schuh ist witzig oder schlicht und einfach überwältigend und dabei durch und durch unbequem. ... Und so wählen Frauen, da, wo Phantasie und Realität aufeinanderprallen, ohne Zögern das Unvernünftige. So schön der Gedanke an einen bequemen Schuh auch sein mag, will jede Frau im Innersten doch eine Pantolette mit Sex-Appeal. Bewundernde Blicke bekommt man schließlich nur mit hohen Absätzen. Eine Birkenstock-Sandale mag Erholung für die Füße sein, doch eine Kreation von Blahnik verspricht Abenteuer." |
[O'Keeffe, Linda: Schuhe : eine Hommage an Sandalen, Slipper, Stöckelschuhe. -- Köln : Könemann, ©1997. -- ISBN 3895084670. -- S. 12 -16. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
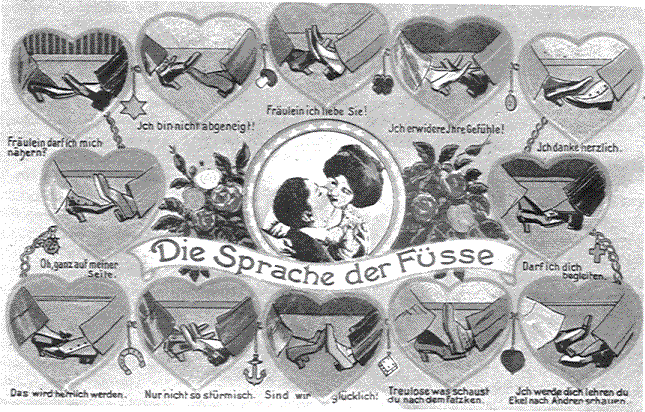
Abb.: Die Sprache der Füße, Postkarte, um 1910
Vernünftige Schuhe trugen und tragen oft das "Stigma" der arbeitenden Bevölkerung: Unpraktische Schuhe signalisieren, dass die Trägerin es nicht nötig hat, sich bei der Arbeit zu bewegen. Deshalb sind die meisten bequemen Frauenschuhe abgewandelte Männerschuhe.
wurden zuerst für Männer hergestellt und später für Frauenfüße abgewandelt.
Bei
gab es von Anfang an keinen Unterschied zwischen Männer und Frauenschuhen.
| "Messungen haben ergeben, dass die Wölbung des weiblichen Pos im Durchschnitt um 25 Prozent zunimmt, sobald eine Frau hochhackige Schuhe trägt." |

Abb.: Männer balzen um den Stöckelschuh (©ArtToday)
"Rein physiologisch ist es unmöglich, dass eine Frau mit hohen Absätzen eine geduckte Haltung einnimmt. Sie ist einfach gezwungen, Rückgrat zu zeigen, sich in Positur zu werfen, denn ihr anatomischer Schwerpunkt hat sich nach vorn verlagert. Sie streckt den Po heraus, Rückgrat und Beine erscheinen länger und die Brust ist stolz erhoben. Waden und Fesseln wirken schlanker, und der Rist des Fußes scheint sich aus dem Schuh herauszuwölben. Hohe Absätze zwingen den Fuß in die Vertikale, eine Haltung, die der Sexualforscher Alfred Kinsey als typisches Signal für die sexuelle Erregung der Frau deutet, bei der «der gesamte Fuß so weit gestreckt sein kann, dass er mit dem restlichen Bein eine Linie bildet»."
"Pfennigabsätze ... zwingen das Bein zum -- wie die Verhaltensforscher sagen würden -- »Balztanz«."
"Als Symbole der Aggression, gesteigerter Sexualität und einer spielerischen Herausforderung wurden Stöckelschuhe zum Markenzeichen für den Typus des ungezogenen Mädchens."
"In den fünfziger Jahren galt die Ferse als besonders erotischer Körperteil. Pantoletten waren der letzte Schrei".
[O'Keeffe, Linda: Schuhe : eine Hommage an Sandalen, Slipper, Stöckelschuhe. -- Köln : Könemann, ©1997. -- ISBN 3895084670. -- S. 127, 72 - 73, 442, 121, 110. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Stöckelschuhe (heute meist high heels genannt) unterstützen das heutige Schönheitsideal der langen schlanken Beine. In der Vereinfachung einer Tageszeitung wurde die Wahl des Topmodels des Jahres 2008 mit den 113 cm langen Beinen der Siebzehnjährigen begründet. Auch wenn die anatomisch erzwungene Betonung von Bein, Hintern und Busen Sexverlangen von Männern hervorruft und Frauen sich über solche Signale bewusst sind, ist es zu einseitig das Tragen von Stöckelschuhen nur dem Balztanz zuzuordnen. Seinen Ursprung hat das heutige Schönheitsideal mit den langen Beinen, knackigem Hintern, eingezogenem Bauch und hervorstehende Brust in unserem biologischen Erbe: es geht schließlich darum Nachkommen zu zeugen.
Das Schönheitsideal hat sich verselbständigt, wir empfinden Stöckelschuhe und die dadurch bedingte gerade Haltung als elegant, als Signal einer selbstbewussten Frau, die ihr Repräsentationsbedürfnis zeigt. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war das Tragen von Schuhen mit Absätzen das Zeichen des Erwachsenwerdens (zur Konfirmation gab es jeweils zum Mal solche Schuhe). In den späteren Jahren der Frauenbewegung wurden Stöckelschuhe abgelehnt, aber heute wehren sich Frauen gegen die Unterdrückung in der Frauenbewegung und betonen deshalb ihre Weiblichkeit durch das Tragen von Schuhen mit hohen Absätzen. Die Botschaft des Senders - insbesondere wenn es sich um ältere Frauen handelt - lautet heute in erster Linie: ich bin eine selbstbewusste Frau und der Empfänger in westlicher Kultur wird das Signal richtig interpretieren.
Die Botschaft des Senders mit Stöckelschuhen und Minirock in einem islamischen Land wird hingegen vom Empfänger interpretiert als: diese Frau ist als Sexobjekt zu haben.
Schuhfetischisten und Sadomasochisten scheinen eine besondere Vorliebe für hochhackige Schuhe zu haben.

Abb.: Plateauschuh (©ArtToday)
Von Plateauschuhen spricht man, wenn sowohl Absatz als auch Sohle erhöht sind, so dass der oder die Trägerin entsprechend größer erscheint. Im Internet werden heute (Juni 2008) solche Schuhe mit Höhen von 3 und 10 cm angeboten, wobei Absatz und Sohle die gleiche Höhe haben können. Angeboten werden aber häufiger unterschiedliche Höhen für Absatz und Sohle (z.B. Sohle 4,5 cm und Absatz 15 cm). Bei sogenannten Megaplateausandaletten kann der Absatz 21 cm und die Sohle 11 cm betragen, bei sogenannten Fetischschuhen (auch Balletheels oder Skyscrapers genannt) können die Absätze 40 cm und die Sohle 20cm hoch sein. Damit ist noch nicht die Höhe der historischen Vorbilder im Venedig des 16ten Jahrhunderts erreicht, denn die damaligen Plateauschuhe (Chopine oder Zoccoli genannt) hatten Sohlen bis zu 75 cm Höhe. Diese Schuhe waren ursprünglich hilfreich bei schmutzigen Straßen, waren aber bald das Zeichen des Reichtums und des Ansehens ihrer Trägerinnen. Schließlich brauchte eine Dame zwei Bedienstete, die ihr beim Gehen halfen. Sogar Touristen kamen extra nach Venedig, um dieses Kunststück zu bestaunen. Die Kirchenvertreter hatten nichts gegen diese Mode einzuwenden, denn man konnte sich mit diesen Schuhen nicht sehr bewegen und vor allem nicht tanzen. Später wurden die Schuhe verboten, weil Schwangere damit stürzten und Fehlgeburten erlitten. Auch in späteren Jahrhunderten trugen Männer und Frauen solche erhöhten Schuhe, obwohl vor allem von Seiten der Ärzte davor gewarnt wurde.
Im letzten Jahrhundert war die große Plateauschuhphase bei Männern und Frauen in den siebziger Jahren, ausgelöst wohl mindestens teilweise durch die Vorbilder der Sänger in der Rock- und Popkultur. Die moderne Welle (ab Mitte oder Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts) ist in erster Linie eine Mode bei Frauen.
Die Träger solcher Schuhe wollen größer erscheinen. Der Wunsch größer zu sein ist auf der einen Seite durch unser biologisches Erbe bedingt. Dem Größeren schreibt man mehr Stärke zu, man vergleiche die Kämpfe der männlichen Tiere um die weiblichen Tiere. Auf der anderen Seite verbindet sich Größe mit Macht durch Stärke und durch Hervorheben der Größe wird das Ansehen und die Bedeutung des Trägers betont. Zusätzliche Größe kann man entweder erreichen, indem man sich Kronen oder eine Tiara aufsetzt, oder aber indem man seine Schuhe erhöht. Z.B. hatte der japanische Kaiser Hirohito bei seiner Krönung 1926 30 cm hohe Holzsandalen (Geta) angezogen.
Bei den üblichen Plateauschuhen, deren Absatz deutlich höher ist als die Sohle kommen zusätzlich die Signale zur Geltung, die man mit Stöckelschuhen aussendet.
Plateauschuhe können auch einen praktischen Zweck haben:
[vgl.: O'Keeffe, Linda: Schuhe : eine Hommage an Sandalen, Slipper, Stöckelschuhe. -- Köln : Könemann, ©1997. -- ISBN 3895084670. -- S. 348f., 356, 383, 370. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Sneakers: ursprünglich zweifarbiger amerikanischer College-Schuh aus Leinen; zum Allgemeinbegriff für Sportschuhe geworden, die zur Alltagskleidung bis zu kleinen festlichen Veranstaltungen (Disco, Cocktailparty) getragen werden. Manchmal verziert und sogar bestickt."
[Hofer, Alfons: Textil- und Modelexikon. -- 7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. -- Frankfurt a. M. : Deutscher Fachverlag, ©1997. -- ISBN 3871505188. -- S. 833. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]

Abb.: ©Nike Air Jordan XVI Sneakers
| "Ein fünfzehnjähriger Junge aus Crown Heights hatte [1997] einen Vierzehnjährigen ermordet. Er hatte das Opfer zusammengeschlagen und ihn auf dem Gleis liegen lassen, als sich eine U-Bahn näherte. «Polizei sagt: Jugendlicher starb für seine Turnschuhe und seinen Beeper.», lautete die Überschrift [der Times]. Und was für Turnschuhe waren es? Air Jordans [Vgl: http://members.aol.com/JUMPMAN47/Bulls-23-shoes.html. -- Zugriff am 2001-04-15]. In dem Artikel wurde die Mutter des Täters zitiert. Sie sagte, ihr Sohn habe sich mit den Gangs eingelassen, weil er «schöne Dinge haben wollte». Ein Freund des Opfers erklärte, dass das Tragen von Designerklamotten und einem Beeper für arme Jugendliche ein Weg sei, «sich wichtig zu fühlen»." |
[Klein, Naomi <1971 - >: No Logo! : der Kampf der Global Players um Marktmacht ; ein Spiel mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern. -- [München] : Riemann, ©2001. -- (One earth Spirit). -- ISBN 3570500187. -- S. 383. -- Originaltitel: No logo (2000). -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]

Abb.: "Turnschuhminister": Joschka Fischer (geb. 1948) bei der
Vereidigung zum hessischen Umweltminister, 1985
Der erste populäre Turnschuh, Ked, kam in den USA 1917 auf den Markt. 1980 wurden Joggingschuhe als Straßenschuhe akzeptabel, als während des Streiks der New Yorker Verkehrsbetriebe Tausende von Frauen in Kostüm und Turnschuhen zur Arbeit gingen.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden Marken bei Turnschuhen, Joggingschuhen, Freizeitschuhen, Sneakers zu besonderen Zugehörigkeits- und Imagesymbolen. Marken wie
wurden erfolgreich als Bestandteil einer Weltanschauung und eines Lebensgefühls vermarktet.
Das Design von Sneakers (Sportschuhen) wurde seit Mitte der 1990er Jahre "zunehmend schriller, und selbst die Sohlen zeigten dynamische Muster und auffällige Farbflecke."
[O'Keeffe, Linda: Schuhe : eine Hommage an Sandalen, Slipper, Stöckelschuhe. -- Köln : Könemann, ©1997. -- ISBN 3895084670. -- S. 253. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
| "Es macht mich wirklich fertig, das Ganze. Ständig werde ich mit
der Tatsache konfrontiert, dass ich mein Geld mit armen Leuten verdiene. Viele sind Sozialhilfeempfänger. Manchmal kommt eine Mutter mit einem Jugendlichen herein, und der Junge ist dreckig und schlecht gekleidet. Aber er will Schuhe für hundertzwanzig Dollar, und die dumme Mutter kauft sie ihm. Ich kann das innere Bedürfnis des Jungen spüren - seine Sehnsucht nach diesen Dingen und nach den Gefühlen, die mit ihrem Besitz verbunden sind - aber es tut mir weh, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind."
Ein Schuhladenbesitzer aus Newark, New Jersey, USA |
[Zitat in: Klein, Naomi <1971 - >: No Logo! : der Kampf der Global Players um Marktmacht ; ein Spiel mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern. -- [München] : Riemann, ©2001. -- (One earth Spirit). -- ISBN 3570500187. -- S. 378. -- Originaltitel: No logo (2000). -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
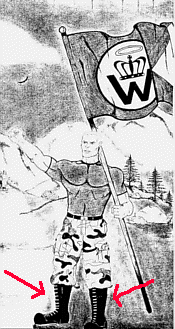
Abb.: Selbstbild weißer Rassisten (Skinheads), USA, 2001
[Aus Gründen des deutschen Strafrechts darf die Internetquelle dieses Bildes nicht angegeben werden]
Neben Arbeitsstiefeln wurden Stiefel zum Identitätszeichen: Springerstiefel als Kennzeichen von Rechtsradikalen haben eine traurige Berühmtheit erlangt. Doch dies stört Modenarren nicht, insbesondere die Schuhe von DocMartens sind zum Inbegriff von jugendlicher Subkultur geworden:
"»Schräge« Stiefel brauchten nun nicht mehr von Fetischisten im Schrank versteckt zu werden, sondern fanden den Weg auf den Laufsteg. Ähnlich wie die Arbeitsschuhe wurden auch Cowboystiefel vom einfachen Gebrauchsgegenstand zum Modeobjekt erhoben und galten -- nicht zuletzt dank des Films Urban Cowboy -- plötzlich als schick. Heute verbinden Doc Martens [Webpräsenz: http://www.drmartens.com. -- Zugriff am 2008-06-16] -- der Inbegriff des wuchtigen Stiefels für beiderlei Geschlecht -- sämtliche Moderichtungen, von Skinheads über Punks und Psychobilly bis zum Grunge. Und Springerstiefel trägt man ... einfach zu allem, von Jeans bis zu Dessous."
[O'Keeffe, Linda: Schuhe : eine Hommage an Sandalen, Slipper, Stöckelschuhe. -- Köln : Könemann, ©1997. -- ISBN 3895084670. -- S. 297. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]

Abb.: Badelatsche (Zehen-Badeslipper)
[Quelle der Abb.: 1000 extra/ordinary objects. -- Köln [u.a.] : Taschen, ©2000. -- ISBN 3822860212. -- S. 213. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
In vielen Ländern Asiens geht man im Haus barfuss. Der Fußboden ist sehr sauber und würde durch Straßenschuhe verdreckt. In Tempeln und Moscheen darf man grundsätzlich keine Schuhe tragen. Sich nicht an diese Regeln zu halten, ist absolut unhöflich und beleidigend. Um das ständige An- und Ausziehen von Schuhen zu erleichtern, ist es sehr bequem (und üblich), Badelatschen wie den oben abgebildeten zu tragen. Solche Badelatschen sind nicht sehr haltbar, dafür aber preiswert. Erfunden wurden sie von US U-Boot-Soldaten im Zweiten Weltkrieg. In Lateinamerika und Osteuropa werden solche Latschen oft aus alten Autoreifen hergestellt.
|
|
|
[Quelle der Abb.: O'Keeffe, Linda: Schuhe : eine Hommage an Sandalen, Slipper, Stöckelschuhe. -- Köln : Könemann, ©1997. -- ISBN 3895084670. -- S. 480 -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Da für Hindus das Rind heilig ist, kommt Schuhwerk aus Rindsleder nicht in Frage.
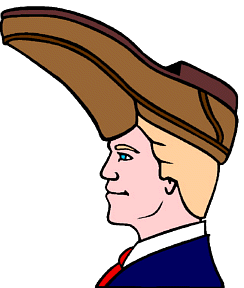
Abb.: Am liebsten würde der feine Herr seine teuren Schuhe so tragen (©ArtToday)
Roetzel nennt berühmte Hersteller für Rahmen genähte Schuhe. Beispiele:
"Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Firmen, die zum Teil ebenfalls sehr gute Schuhe machen, doch hier seien in erster Linie die Marken erwähnt, die in den meisten Großstädten dieser Welt ohne Probleme erhältlich sind. Die Reihenfolge der Nennung ist nicht willkürlich, sondern stellt eine Wertung dar. Mit Crockett & Jones beginnt die gehobene Mittelklasse."
[Roetzel, Bernhard <1966 - >: Der Gentleman : Handbuch der klassischen Herrenmode. -- Köln : Könemann, ©1999. -- ISBN 3895086371. -- S. 153. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
|
|
|
|
|
|
Zweckmäßig, wenn auch wenig genutzt, sind Schirme als Sonnenschirme. Die Zahl der Hautkrebsfälle ließe sich durch einen häufigeren solchen Gebrauch stark verringern.
Webportal: http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/Outdoors/Gear_and_Equipment/Umbrellas/. -- Zugriff am 2001-04-05 + 2008-06-16
Webportale:

Abb.: Brillenträgerin (©Corel)
Brillen ändern sich je nach Mode sehr häufig. Mit dem Brillengestell kann man unterschiedliche Signale aussenden. In den Jahren um 1968 herum haben z.B. manche Intellektuelle bewusst das Kassenmodell bevorzugt, um ihre politische Gesinnung zu zeigen. Manche Frauen wählen Farben wie lila und pink um zu betonen, dass sie sich aus der Menge abheben. Will man zeigen, dass man es sich leisten kann, nimmt man eventuell Titan und achtet darauf, dass das Zeichen einer einschlägigen teuren Marke zu erkennen ist.
In Filmen benutzt man gern die Möglichkeit der Signale durch Brillen:
"Die Sehbrille hat sich in den letzten Jahrzehnten von einer ungeliebten Notwendigkeit zu einem modischen Accessoire gemausert. Mitunter werden Brillenträger schon um die Kreationen beneidet, die sie auf der Nase tragen. Früher dagegen hatten sie mit dem Spott ihrer Mitmenschen zu leben. Besonders Frauen waren mit einem Sehfehler doppelt geschlagen. Zuzüglich zur Fehlsichtigkeit selbst mussten sie ihr Gesicht auch noch mit unschönen Brillengestellen verunzieren. Jeder erinnert sich an die bedauernswerte Figur, die Marilyn Monroe in dem Film »Blondinen bevorzugt« darstellt: eine Frau, die so sehr unter ihrer Brille leidet, dass sie lieber ohne sie herumläuft und dadurch in allerlei komische Situationen gerät. Männer hatten es da schon immer etwas leichter. Getreu dem Motto, dass ein Mann nicht schön sein muss, gereichte ihm die Brille nicht unbedingt zum Makel. Im Gegenteil, damals wie heute lässt sie ihn vermeintlich intelligent aussehen - und macht ihn rührend hilflos, wenn er sie abgesetzt hat. Es wurde immer wieder versucht, einen Zusammenhang zwischen Fehlsichtigkeit und Intelligenz herzustellen. Zeitweise galt die Meinung, dass Brillenträger nicht intelligenter aber immerhin gebildeter seien als andere Menschen, weil sie mehr gelesen und sich dadurch die Augen verdorben hätten. Diese Argumentation hält natürlich keiner Überprüfung stand, denn abgesehen von der Frage, ob schlechte Augen von zu vielem Lesen verursacht werden, muss das Lesen an sich nicht unbedingt der Bildung förderlich sein. Es kommt schließlich darauf an, was man liest. Trotzdem hält sich hartnäckig das Vorurteil vom Intellektuellen mit der Brille. Vielleicht schreckt es sogar manch einen davon ab, seine Brille gegen Kontaktlinsen auszutauschen."
[Roetzel, Bernhard <1966 - >: Der Gentleman : Handbuch der klassischen Herrenmode. -- Köln : Könemann, ©1999. -- ISBN 3895086371. -- S. 266. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]

Abb.: Sonnenbrille als Teil der Selbstinszenierung (©ArtToday)
Neben ihrer schützenden Funktion wurde die Sonnenbrille seit den 1980er Jahren auch bei Nicht-Mafiosi zum teuren Statussymbol.
Webportale:
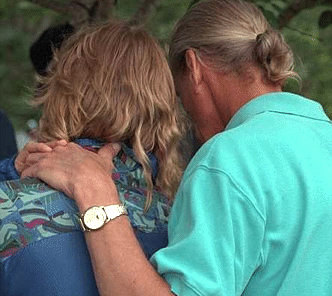
Abb.: Armbanduhr (©ArtToday)
Was für Uhren man trägt, hat oft nichts mit der Funktion der genauen Zeitmessung zu tun. Warum würden sonst mechanische Uhren für viele Tausend Mark gekauft, wenn man supergenaue funkgesteuerte Funkarmbanduhren schon für unter 100 DM erhält.
Webportale:
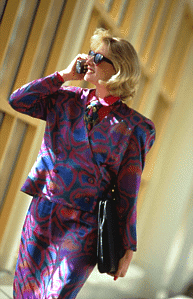
Abb.: "Ich bin wichtig!" (©ArtToday)
Ein "unentbehrliches" Zeichen dafür, wie wichtig man ist, ist ein Handy mit möglichst vielen Funktionen, das möglichst ständig in Betrieb ist. Für ein mäßiges Entgelt kann man sich anrufen lassen, Anrufe in Fremdsprachen sind etwas teurer. Auch über ein i-Pod sollte man verfügen.
| "Wir schmücken uns und stecken uns Blumen ins
Haar, damit unsere Seele sich freut und nicht zu den Ahnen
entflieht. Sonst müssten wir sterben."
Ein Sakkudei aus Siberut, Mentawei, Indonesien |

Abb.: Maskentänzer, Afrika (©Corel)

Abb.: Ostafrika (©Corel)

Abb.: Neuguinea (©Corel)
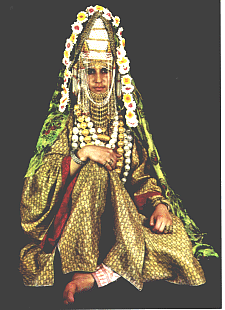
Abb.: Jüdische Braut, Jemen (Bildquelle: Gabus, a.a.O.)
[Bildquelle für "Jüdische Braut": Gabus, Jean: Schmuck und Geschmeide aus aller Welt. -- Neuenburg : Avanti, [1962]. -- S. 25]
Eine ausgezeichnete Darstellung zu Schmuck als Mittel der Kommunikation ist die Ausstellungsbroschüre:
Vogelsanger, Cornelia ; Issler, Katharina: Schmuck -- eine Sprache? -- Zürich : Völkerkundemuseum der Universität, 1977. -- 40 S. : Ill.
Seitenangaben im Folgenden beziehen sich auf diese Broschüre.
Schmuck hat vielerlei Funktionen:
Sehr wichtig sind die wirtschaftlichen Aspekte als Versicherung und Vorsorge für schlechte Zeiten:
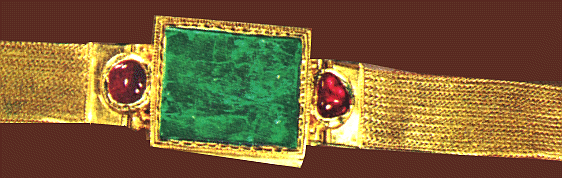
Abb.: Schmuck als Sparversicherung Goldarmband mit Smaragd, Indien (Nanubhal
Jewellers)
[Bildquelle: Gabus, Jean: Schmuck und Geschmeide aus aller Welt. -- Neuenburg : Avanti, [1962]. -- S. 85]
"Für die Frauen in Indien oder Nordafrika gehört Schmuck zur Mitgift und stellt oft ihre einzige Möglichkeit dar, über eigenes Vermögen zu verfügen (Frauen dürfen z.B. nach Hindurecht keinen Landbesitz erben). Oft legt auch die Familie erwirtschafteten Überschuss in neuen Schmuck für die Frauen an. Was die Frau am Leibe trägt, ist dann sozusagen die Sparversicherung der Familie. Damit fällt den Frauen auch die Rolle zu, an großen Festen den Familienreichtum mit ihrem Schmuck zur Schau zu stellen. In Notzeiten sieht sich dagegen manche Familie gezwungen, den Frauenschmuck an Händler zu verkaufen. (So kam es vor einigen Jahren dazu, dass nach einer Hungersnot in Afghanistan plötzlich afghanischer Nomadenschmuck in großen Mengen in Europa auftauchte...)" [S. 23]
In unserem Zusammenhang am wichtigsten sind die kommunikativen Funktionen von Schmuck. Dazu schreiben die Autorinnen zu Schmuck als Form der Kommunikation:
"Der Gedanke, Schmuck als Sprache zu verstehen, ist nicht neu. Im Jahre 1900 erschien in Berlin eine Abhandlung von Emil Selenka mit dem Titel »Der Schmuck des Menschen«. Der Autor bezeichnet darin Schmuck als »eine Art bildlicher Mitteilung, eine Bildersprache«, die, ähnlich wie die Mimik, »natürlich und international verständlich« sei. Dagegen beruhen laut dem Autor die »Lautsprache« und die »Gebärdensprache« auf Abmachung und Konvention. ...
Ist nun aber Schmuck tatsächlich eine Sprache, die man ohne weiteres und überall spontan versteht? Das würde ja unter anderem bedeuten, dass die Gattin des Schweizer Bundespräsidenten und ein Krieger aus Neuguinea nicht nur die gleiche Auffassung darüber hätten, was sie verschönert, sondern auch darüber, wie sie ihre Person darstellen wollen, mit andern Worten: über ihr Selbstverständnis und über die eigenen Vorzüge, die sie betonen wollen. Dies ist nun aber keineswegs der Fall. Schmuck setzt wohl immer ein Bewusstsein seiner selbst voraus, ist Imagepflege, Selbstdarstellung, aber das Selbst-Bewusstsein kann sehr verschieden gelagert sein und mit sehr verschiedenen Mitteln ausgedrückt werden. Dabei spielt unter anderem eine Rolle, welche Materialien in einer Gesellschaft als besonders wertvoll angesehen werden (z.B. bei uns: Gold; in Neuguinea: gebogene Eberhauer). Oder es kommen magisch-religiöse Vorstellungen zum Ausdruck, wenn beispielsweise ein Mann in Neuguinea alle Körperöffnungen mit Schmuckstücken bedeckt, um keine bösen Mächte eindringen zu lassen. (Diese Vorstellung hat sich bei uns in der Gewohnheit erhalten, beim Gähnen den Mund mit der Hand zu bedecken.) Die Sakuddei auf Mentawei (Indonesien) legen Schmuck an, damit ihre Seele sich bei ihnen wohl und heimisch fühlt.
Auch historische Entwicklungen spielen eine Rolle, deren sich der Träger von Schmuck oft kaum bewusst ist. Ahnt eine Bäuerin, die ihre Tracht anzieht, dass ihr Trachtenschmuck einst als Nachahmung höfischer Schmuckmoden entstanden ist?
Mit andern Worten: Schmuck teilt nicht nur über den Träger etwas mit, sondern auch über seine Gesellschaftsordnung, seine Wertvorstellungen und sein Weltbild. Schmuck ist von der Kultur geprägt und gestaltet, er ist ein Ausdrucksmittel der Kultur. Und daraus folgt, dass die »Schmucksprache«, ähnlich wie die »Gebärdensprache«, zu einem großen Teil überliefert und gelernt wird.
Abgrenzung und Zugehörigkeit
Indem er sich schmückt, befriedigt der Mensch zwei gegensätzliche Bedürfnisse, die nicht leicht auseinanderzuhalten sind. Er grenzt sich einerseits ab von seiner Umwelt, indem er seine Individualität, seine Einmaligkeit und Bedeutung, betont und pflegt. Dies tut sowohl ein schönes Mädchen, das sich eine Blume ins Haar steckt, als auch ein afrikanischer König, der sich mit den Abzeichen seiner Würde und Macht umgibt. Im Extremfall kann ein Schmuckstück auch ein ganz privates, geheimes Zeichen sein, dessen Bedeutung nur der Träger selbst kennt, weil für ihn vielleicht eine bestimmte Erinnerung oder Symbolik damit verknüpft ist, oder weil er sich magischen Schutz davon verspricht (persönlicher Talisman). Dann trägt er dieses bestimmte Schmuckstück, um sein Selbstgefühl und seine persönliche Sicherheit zu verstärken, und beabsichtigt keine Wirkung auf andere. Schmuck ist aber selten so strikt eine Privatangelegenheit, sondern richtet sich fast immer an ein Publikum."
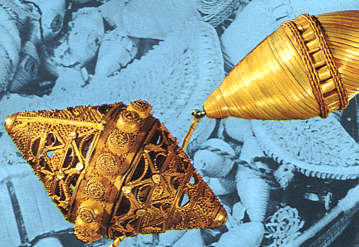
Abb.: Goldschmuck und Nachahmung als Strohschmuck, Songhai, Mali: der
Goldschmuck ist Kennzeichen von Reichtum und hohem sozialen Rang, in den 1960er
Jahren von den Minderbemittelten mit Getreidestroh, das in Henna oder Safran
getaucht wurde, imitiert (Völkerkundenmuseen Neuenburg und Genf)
[Bildquelle: Gabus, Jean: Schmuck und Geschmeide aus aller Welt. -- Neuenburg : Avanti, [1962]. -- S. 115]
"Neben dem Bedürfnis nach Abgrenzung und Betonung der eigenen Individualität erfüllt Schmuck auch das Bedürfnis, Zugehörigkeit zur Gesellschaft auszudrücken, und damit häufig Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Klasse, den verheirateten Frauen etwa oder der regierenden Oberschicht. Man grenzt sich einerseits ab -- als verheiratete Frau von den ledigen Mädchen, als Reicher von den Armen, als Freier von den Sklaven, als Häuptling von den Untergebenen, ordnet sich aber gleichzeitig zu: eben den verheirateten Frauen, den Freien, den Vermögenden, den Regierenden usw. (Zum Wesen des Schmucks als Selbstdarstellung gehört, dass er Vorzüge betont -- falls der Träger nicht von der Gesellschaft dazu gezwungen wird, Schmuck zu tragen, der ihn als Nicht-Privilegierten kennzeichnet.)
Ein Code für Insider
Die Zeichensprache Schmuck wendet sich häufig in erster Linie an einen bestimmten, eingeweihten Personenkreis, und erst in zweiter Linie, im Sinne der Abgrenzung und Absetzung, an die Allgemeinheit. So präsentieren sich oft die Mitglieder eines Geheimbundes nach innen und außen als Träger von Insider-Schmuck. In unserer Gesellschaft gibt es ebenfalls viele Beispiele von Schmuck, der nur innerhalb einer »Subkultur« verständlich ist, etwa die militärischen Gradabzeichen oder den Rockerschmuck (Totenköpfe, Hakenkreuze und ähnliches), der Außenstehende ausdrücklich abschrecken, verwirren und vom Verständnis ausschließen soll. Rotarier erkennen sich gegenseitig an einem diskreten Clubabzeichen am Rockaufschlag. Tatauierungen gehören in unserer Gesellschaft zum Image der Matrosen.
Bestimmte Arten von Schmuck können auch plötzlich für eine gewisse Zeit elitäre Bedeutung erlangen und dann wieder verlieren: Vor wenigen Jahren noch wurde außereuropäischer Schmuck, etwa aus Indien und Nepal, ausschließlich von Hippies und vielleicht noch von Ethnologen getragen, die sich damit als weitgereist und mit fremden Kulturen auf vertrautem Fuße stehend zu erkennen gaben, gleichzeitig aber auch milden Protest gegenüber den ästhetischen Konventionen unserer westlichen Mode zum Ausdruck brachten.
Ein indischer Armreif aus Silber oder Elfenbein mag im Laufe seiner Existenz einen mehrmaligen Funktionswechsel durchgemacht haben: zuerst am Arm einer Rajasthanifrau als Vermögensanlage getragen, dann, von der indischen Familie vielleicht wegen einer Hungersnot verkauft, am Arm eines Trampers als Erinnerungsstück und als Ausweis der Indienfahrt nach Europa gebracht, schließlich in einer hiesigen Schmuckgalerie für anspruchsvolle Kundinnen angeboten, die im Lauf der letzten Jahre außereuropäisches Kunsthandwerk als Modeartikel entdeckt haben.
Obligatorischer Schmuck -- sozialer und religiöser Druck
Die Zeichen, die mit dem Schmuck gesetzt werden, können in einer Gesellschaft allgemeinverbindlich sein und sogar obligatorisch. So brauchte bei den Senufo früher eine Frau, welche die mehrere Kilo schweren Fußringe aus Metall wegen einer körperlichen Schwäche nicht tragen konnte, einen formalen »Dispens« der Priesterin. Als Ersatz musste eine Miniaturkopie am Gürtel getragen werden. Den richtigen Schmuck zu tragen, wird hier zu einem Ausweis der gesellschaftlichen Integration.
Für viele polynesische Völker war die korrekte Tatauierung der Reisepass ins Land der Ahnen, ohne den die Seele des Verstorbenen ruhelos umherirren musste. Nach der Auffassung gewisser Stämme Neuguineas fanden Verstorbene keinen Einlass ins Jenseits, wenn das Nasenseptum nicht der Sitte entsprechend mit einem Stäbchen durchbohrt war. In andern Gegenden Neuguineas galt die Gesichtsbemalung, die ein Krieger im Ritual trug, viel eher als Ausdruck seiner Persönlichkeit als seine individuellen Gesichtszüge; folglich bemalte man den Schädel eines Verstorbenen mit seinem persönlichen Ritualmuster.
Solche Beispiele weisen eindeutig darauf hin, dass Schmuck nicht nur einen sozialen Bezugsrahmen hat, sondern im religiösen Sinne verbindlich sein kann; d.h. er stellt nicht nur die Kommunikation mit der Gesellschaft her, sondern auch mit übernatürlichen Mächten und dient als Erkennungszeichen eines integren Menschen im Jenseits. Besonders deutlich wird diese Vorstellung an der Berufstracht des sibirischen Schamanen, der durch die an seiner Kleidung angebrachten Symbole mit den Geistern kommuniziert, die ihm bei der Reise ins Seelenland helfen. Für den Angehörigen eines bestimmten nordamerikanischen Indianerstammes war es in alten Zeiten ein Grund zu tiefster Verzweiflung, ja zum Selbstmord, wenn das Ohrläppchen zerriss, weil dann der vorgeschriebene Ohrschmuck nicht mehr befestigt werden konnte.
Religiöse Vorstellungen müssen wir auch dann vermuten, wenn der Verlust eines Schmuckes Anlass zu tiefer Beschämung ist. Ein Hindumädchen galt als entehrt, wenn es seinen Nasenring verlor. Von australischen Jägergruppen wird berichtet, dass sie sich unter keinen Umständen dazu bewegen ließen, ihren Schmuck bei weißen Händlern gegen bunte, verlockende Glasperlen einzutauschen. Bei diesem Beispiel geht es wiederum sicher nicht um die spielerische, ästhetische Seite des Schmuckes, sondern der Schmuck stellt ein Ausdrucksmittel sozialer und religiöser Identifikation dar, das bestimmten Normen entsprechen muss."

Abb.: Amulettkästchen an Halskette aus Silber und Gewürznelken, Algerien
(Ethnographische Museum Neuenburg): im Kästchen trägt man Koransuren, magische
Buchstaben oder heilige Zahlen, Gewürznelken werden heilende und vorbeugende
magische Eigenschaften zugeschrieben
[Bildquelle: Gabus, Jean: Schmuck und Geschmeide aus aller Welt. -- Neuenburg : Avanti, [1962]. -- S. 111]
"Amulette und Talismane haben also, wie wir sehen, keine grundsätzlich andere Bedeutung als der übrige Schmuck. Sie stellen zwar im engen, spezialisierten Sinn einen Versuch dar, Geister zu bannen oder herbeizurufen, aber es geht beim Schmuck allgemein um ganz ähnliche Zusammenhänge. Das Verb »kosmein« hat im Griechischen die doppelte Bedeutung von »ordnen« und »schmücken«. »Schmücken« heißt also immer auch: »eine Ordnung herstellen«, »vervollständigen«. Die Art und Weise, wie ein Mensch sich selber »ordnet« und »vervollständigt«, spiegelt sein geistiges Weltbild; er setzt sich durch den Vorgang des »Schmückens« mit der Weltordnung in Verbindung, so wie er sie versteht.
Schmuck als Zwang
Aus diesen geistigen Motiven wird auch verständlich, dass Schmuck nicht immer freiwillige Selbstdarstellung ist, sondern häufig zum sozialen Zwang erhoben wird. Der Mensch hat das Bedürfnis, nicht nur an seiner eigenen Person, sondern auch an seiner Umgebung die Ordnung herzustellen, die er für gültig und richtig hält. Auf der einen Seite dehnt er den Drang nach Schmuck und Perfektionierung auf sein Besitztum aus, sein Heim, seine Waffen und Geräte, seine Lieblingstiere (Pferd, Leitkuh, Pudel usw.), seinen Garten; ferner, in einem vielleicht weniger besitzergreifenden Sinn, auf seine Gestaltung des Übernatürlichen, auf Tempel und Götterbilder. Auf der andern Seite neigt er dazu, seine Vorstellung von Schmuck und Ordnung auch unter seinen Mitmenschen durchzusetzen, wenn nötig mit Gewalt. Oft werden Körpertracht, Kleidung oder Schmuck einer bestimmten Menschengruppe von den Herrschenden aufgezwungen, und umgekehrt reserviert die Oberschicht gewisse Schmuckmaterialien, Farben oder Muster für sich selbst. Auf den Fidschiinseln war es nur den Häuptlingen erlaubt, Pottwalzähne zu besitzen und sich mit ihnen zu schmücken. Verbarg ein Mann einen Pottwalzahn vor dem Häuptling, so traf ihn die Todesstrafe. Bei den Akanvölkern in Westafrika durften nur die regierenden Familien und die Goldschmiede Goldschmuck tragen, und es herrschte der Glaube, dass Gold die weniger Privilegierten töten würde, wenn sie es behielten; deshalb schreckten sie sogar davor zurück, Gold zu berühren. In Java waren bestimmte Batikmuster den Angehörigen der Fürstenfamilien vorbehalten.
Sklaven und Verurteilten dagegen wurden in vielen Völkern nicht nur bestimmte Formen der Kleidung vorgeschrieben, sondern auch Verstümmelungen und Brandmarken aufgezwungen. Weit verbreitet ist die Sitte, an Kindern (z.T. schon im Säuglingsalter, am häufigsten aber in Form von Initiationsritualen im Pubertätsalter) kosmetische Prozeduren oder regelrechte Verstümmelungen vorzunehmen, die dem Menschenbild und Schönheitsideal der Erwachsenen entsprechen und mit denen sich die Kinder identifizieren, weil ihnen die auferlegten Leiden als notwendig, ihr geduldiges Ertragen als Beweis der Tapferkeit und Reife dargestellt werden." [S. 1 - 8]
"Ausdruck einer Beziehung
![]()
Abb.: Verlobungsring mit Aufschrift True love waits, d.h. kein Sex vor
der Ehe, USA
[Bildquelle: http://www.factory79.com/tlw. -- Zugriff am 2001-04-14]
Wieder eine Kategorie für sich bildet Schmuck, mit dem der Träger eine Beziehung zu einer andern Person zum Ausdruck bringt. Symbole der Treue und dauernden Bindung zwischen Mann und Frau sind oft Fingerringe (Verlobungs- und Trauring), aber auch andere Schmuckstücke. Bei den Bavili (Bakongo, Afrika) symbolisierte ein bestimmtes Kupferarmband, das von beiden Eheleuten getragen wurde, ein ganz bestimmtes Heiratsritual, bei dem die Frau geschworen hatte, mit ihrem Mann zu sterben. Eine Vendafrau (Afrika) trägt zeitlebens die von ihrem Geliebten geschenkten Kupferdrahtringe; bei ihrem Tod werden diese zerschnitten aufs Grab gelegt.
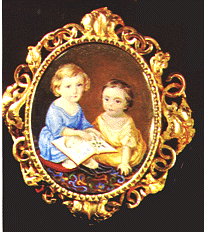
Abb.: Goldbrosche mit Bildnis der Kinder, Emaille, Schweiz, 19. Jhdt.
(Historische Museum, Neuenburg)
[Bildquelle: Gabus, Jean: Schmuck und Geschmeide aus aller Welt. -- Neuenburg : Avanti, [1962]. -- S. 59]
Bei uns waren früher Medaillons, welche ein Miniaturportrait oder Haarlocken einer geliebten Person bargen, sehr verbreitet. Schmuckstücke, die eine Beziehung zum Ausdruck bringen, werden in der Regel geschenkt. Schmuck schenken ist an sich schon Ausdruck einer Bindung, geschenkter Schmuck soll den Beschenkten binden.
Auch mit dem Tragen eines Erbstückes, etwa der Uhrkette des Großvaters, kann man eine enge Beziehung zu einer Person zum Ausdruck bringen. Das
»Hei tiki« der Maori (Neuseeland), ein Anhänger aus grünem Nephrit, den Männer wie Frauen an einer Schnur um den Hals trugen, wurde innerhalb der Familie über viele Generationen hinweg weitergegeben, und jeder Träger fügte - so glaubte man - dem Schmuckstück etwas von seiner Seelen- und Lebenskraft (Mana) hinzu. Für viele Völker ist es eine besonders sympathische Vorstellung, ein Schmuckstück oder
Amulett aus einem Knochen eines verstorbenen Vorfahren zu besitzen; hier geht es wieder um die
Übertragung der Seelenkraft der Ahnen, die den Lebenden stärkt und vor Gefahren schützt. In Washkuk (Neuguinea) photographierte Rene Gardi einen Mann im Tanzschmuck, der einen Behang aus Zöpfchen von Haaren seines verstorbenen Vaters trug.
Viel seltener sind Fälle, wo durch Schmuck eine sozusagen »negative« Beziehung ausgedrückt wird wie im folgenden Beispiel (Meidung): Bei den Navajo (Nordamerika) muss ein Ehemann der Sitte gemäss seiner Schwiegermutter aus dem Weg gehen. Deshalb trägt die Schwiegermutter ein silbernes Glöcklein am Gürtel, das mithilft, ein unschickliches Zusammentreffen zu vermeiden. Das
»Schwiegermutterglöcklein« ist aber natürlich zugleich auch ein Statussymbol
für eine ältere Frau, die erwachsene, verheiratete Töchter hat." [S. 25
- 26]
Webportale:
Weiterführende Ressource in Printform:
Fisher, Angela: Afrika im Schmuck. -- Köln : DuMont, ©2000. -- 304 S. : Ill. -- ISBN 3770148940. -- Originaltitel: Africa adorned (1984). -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}. -- [Preiswerter, hervorragend illustrierter Bildband über die Schmuckkulturen Afrikas]

Abb.: Frauen als Accessoires: Hugh Marston Hefner (geb.ÿ1926),
Gründer des Playboy (1953), Erfinder der Playmate, der
Playboy-Häschen und der Playboy-Clubs, hier mit einer seiner Freundinnen im
Playboy-Club, London (©Corbis)
An weiteren Accessoires sollen hier nur erwähnt werden:
Zu Kapitel 10, Teil IV: Körpergestaltung