Internationale Kommunikationskulturen


mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - >: Internationale Kommunikationskulturen. -- 11. Kulturelle Faktoren: Wohnung und Privatsphäre. -- 1. Teil I: Wohnen und Wohnräume. -- Fassung vom 2007-02-06. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur111.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2001-06-12
Überarbeitungen: 2007-02-26 [Ergänzung]
Anlass: Lehrveranstaltung, HBI Stuttgart, 2000/2001
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Länder und Kulturen von Tüpfli's Global Village Library
Statt eines Motto
| "Einmal, nach der Rückkehr von einer längeren Sommerreise, führte mich mein Vater mit besondrer Feierlichkeit in unsre Wohnung. Hatte ich bisher ein Zimmer neben der Schlafstube der Eltern bewohnt, in dem sich tagsüber meist auch die Jungfer aufzuhalten pflegte, so öffnete er mir jetzt die Tür zu einem bis dahin unbenutzten Raum. »Das ist dein Reich, mein Kind,« sagte er. Ich konnte das Glück kaum fassen: ein eignes Zimmer! Dieser Traum jedes zu selbständigem Leben reifenden Menschenkindes sollte mir so wundersam in Erfüllung gehen! Keine rasselnde Nähmaschine durfte mich hier mehr stören, niemand konnte mir den Platz am eignen Schreibtisch streitig machen! " |
[Braun, Lily <1865 - 1916>: Memoiren einer Sozialistin. -- München : Langen, 1909. -- In: Deutsche Literatur von Frauen / hrsg. von Mark Lehmstedt. -- Berlin : Directmedia, 2001. -- 1 CD-ROM. -- ISBN 3898531457. -- S. 9279. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie diese CD-ROM bei amazon.de bestellen}]
In der Einleitung zur lesenwerten Broschüre des Museums für Kulturen Basel
Bauen und Wohnen / Redaktion: Brigitta Hauser-Schäublin ... -- Basel [u.a.] : Birkhäuser, ©1987. -- 84 S. : Ill. -- Mensch, Kultur, Umwelt ; 2). -- ISBN 3-7643-1854-6
schreibt Brigitta Hauser-Schäublin zum Thema "Bauen und Wohnen bei uns [d.h. der Schweiz] und in anderen Gesellschaften":

Abb.: Altstadt, Basel, Schweiz (©ArtToday)
"Wenn man einen Städter fragen würde, warum er an einer bestimmten Strasse eines Quartiers, in einer bestimmten Wohnung eines Hauses wohnt, dann würde er vermutlich einen Augenblick lang überrascht schweigen und dann mehrere Gründe aufzählen. Maßgebend für die Wahl einer Wohnung sind wohl Lage, Größe und Komfort im Verhältnis zum Mietzins. Wichtig ist wohl auch die Distanz zum Arbeitsplatz, zu Läden und den öffentlichen Verkehrsmitteln, respektive die Frage, ob man in unmittelbarer Nähe sein eigenes Motorfahrzeug abstellen kann. Eltern werden wahrscheinlich auch bei der Wahl einer Wohnung darauf achten, ob die Kinder in der Nähe im Grünen spielen können und wie weit Kindergarten und Schulen entfernt sind.
Die Wahl einer Wohnung wird -- wenn man alle diese Gründe zusammennimmt -- bestimmt durch eine Vielzahl von Faktoren, wobei nicht zuletzt auch die Situation auf dem Wohnungsmarkt (Angebot und Nachfrage) eine Rolle spielt. Selbst wenn die meisten Mieter in eine neue Wohnung einziehen in der Meinung und Absicht, dort für unbestimmte Zeit zu leben, so ist sich gleichzeitig auch jeder bewusst, dass er wieder ausziehen kann, falls ihm das eine oder andere nicht passt, sich seine berufliche Situation ändert oder er gar den Arbeitsort wechseln muss.

Abb.: Gartenstadt, Arizona, USA (©ArtToday)
Wer sich ein Eigenheim leisten kann, legt auf ähnliche Punkte Wert, wobei aber gerade der Standort des Hauses oder die Lage der Wohnung nach längerfristigen Gesichtspunkten ausgewählt wird. In baulichem Eigentum, das der Nutzung als eigene Wohnung dient, bleiben die Menschen durchschnittlich wesentlich länger wohnen als bloße Mieter. -- Bei einem Eigenheim wird dem Wohnen im Grünen und in Quartieren ohne Verkehrslärm und andere Belästigungen besondere Bedeutung beigemessen. Die Distanz zu oft dezentral gelegenen Einkaufszentren sowie anderen Versorgungsstrukturen ist beim «Wohnen im Grünen» sekundär, da das Motorfahrzeug als individuelles Verkehrsmittel raschen Zugang ermöglicht. Die frühere Bedeutung und Funktion der Stadt als Zentrum mit umfassenden Angeboten auf engem Raum hat sich deshalb, aufgrund der größeren räumlichen Mobilität, verändert.

Abb.: Kondominium, Mexiko (©ArtToday)
Wohnen in bevorzugten Quartieren und Strassen hängt -- abgesehen von den finanziellen Rahmenbedingungen, die es voraussetzt -- mit individuellem Prestige- und Standesbewusstsein zusammen. In der Regel gilt: Je höher der Quadratmeterpreis, desto höher das Wohnprestige. -- Wohnen ist heute wohl selten mit einem Gefühl innerer Verbundenheit an den Ort gekoppelt. Kaum jemand lebt heute als Erwachsener in der Wohnung, in dem Haus und an der Strasse, wo er aufgewachsen ist. Unsere Gesellschaft, zu deren Kennzeichen räumliche und soziale Mobilität gehört, fördert nicht die Sesshaftigkeit, die Gebundenheit an Mikroräume, sondern verlangt von ihren Mitgliedern maximale Flexibilität, ein Sich-Anpassen an immer neue Anforderungen und Gegebenheiten. Wohnen hat deshalb kaum mehr etwas mit kultureller oder gesellschaftlicher Identität, Leben in einer bestimmten räumlichen und mit einer bestimmten sozialen Umgebung zu tun.

Abb.: San Francisco, USA, Viktorianische Häuser vor Hochhäusern (©ArtToday)
Leben in Blöcken und Hochhäusern -- das Haus als Wohnmaschine, wie Le Corbusier es genannt hat -- ist funktionell geworden, im Dienste übergeordneter Interessen. Die Bewohner solcher Gebäude, die nach festgelegten Umzugsterminen kommen und gehen, sind geprägt vom Leben in der Anonymität. Anonymität, die zwischen (vermeintlich totaler) Freiheit (jedoch eingeschränkt durch die Regeln der Hausordnung) und totaler Vereinsamung hin- und heroszilliert. Der Zufallsnachbar oben, unten, links oder rechts ist unwichtig, solange er sich nicht unangenehm bemerkbar macht. Nur getrennt durch wenige Zentimeter wird geliebt, gelebt, gestorben, ohne dass dies die räumlichen Nachbarn berührt, vielleicht nicht einmal wissen. Nachbarn sind in den meisten dieser großen Wohneinheiten beliebig austauschbar geworden, denn die fixe räumliche Anordnung bestimmt das Nebeneinander. Durch die Unverbindlichkeit des Wohnens, dessen Verbindlichkeit durch den Mietvertrag mit einem ebenfalls oft anonym bleibenden Eigentümer bestimmt ist, hört in Einzelfällen erst dann auf, wenn der Besitzer sein Haus einem anderen Bestimmungszweck zuführen oder verkaufen will und deshalb seine Mieter hinausbefördern möchte. Dann entwickelt sich gelegentlich unter den Mietern eine Solidarität, die sich in der gemeinsamen Aktion nach außen, auf ein bestimmtes Ziel hin, manifestiert. Dann, auf Initiative Einzelner, hört die Anonymität sowohl unter den Bewohnern selbst als auch gegenüber dem Vermieter auf und wird durch persönliche Beziehungen und Interaktionen abgelöst.
Wenn also Wohnen in unserer Gesellschaft Individualbereich geworden ist, wo jeder sich zurückziehen kann, ganz wie es ihm passt, so ist diese Individualität jedoch beschränkt. Zwar kann jeder Mieter bestimmen, etwa ob er sein Bett mit einem roten oder einem grünen Überwurf zudecken soll, ob er in der Küche stehend und mit bloßen Händen oder in einem eigens eingerichteten Esszimmer an einer Tafel und mit Silberbesteck Nahrung zu sich nehmen will. Die Grundrisse der Wohneinheiten aber sind weitgehend standardisiert; ihre Aufteilung schreibt Funktionen vor. Das Badezimmer und die Küche sind wohl diejenigen Räume, die aufgrund der Einteilung und Installationen gar keine andere dauerhafte Nutzung zulassen. Wenn man die Pläne von Wohnblöcken anschaut, fällt auf, dass ebenfalls Elternschlaf-, Kinder- und Wohnzimmer vorgegeben sind. Dies drückt sich nicht nur in der entsprechenden Benennung auf den Plänen aus, sondern auch in den Massen und den elektrischen Installationen. In einem Kinderzimmer haben in der Regel ein Bett (an einer vorbestimmten Wand) und ein kleiner Tisch Platz; im Elternschlafzimmer ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten, die nebeneinander stehen, je ein kleines Tischchen (<Nachttischchen>) und ein größerer Kleiderschrank. Im Wohnzimmer sind Raum für eine Polstergruppe und in einer Ecke ein Esstisch mit Stühlen vorgesehen. Ein beliebiger Austausch der verschiedenen Funktionen ist innerhalb der Wohnung kaum möglich, wenn man das dafür vorgesehene, ebenfalls standardisierte Mobiliar mitbringt, denn die Grundrisse und die Einheitshöhe der Zimmer bestimmen im wesentlichen Inhalt und Nutzung. So beschränkt sich der individuelle Aspekt des Wohnens im wesentlichen auf die Ausgestaltung des Innenraums mit Elementen, deren Form und Größe nicht den vorgegebenen baulichen Bedingungen widerspricht. -- Die Gründe für den immer noch steigenden Anspruch des Schweizers auf mehr Wohnfläche in Quadratmetern hängt vermutlich u.a. mit dem Wunsch nach größeren Variationsmöglichkeiten innerhalb der Wohnung und nach größerem individuellem Bewegungsraum zusammen.

Abb.: "Schweizer Käse" -- Spottnamen für dieses 30stöckige
Mietshaus, La Defense, Paris, 1960er-Jahre
Die Beziehung des Bewohners eines Mietshauses ist wohl vor allem die zu seiner Wohnung und weniger die zum Haus als baulicher Einheit. Trotzdem findet sich die Bindung an einen Ort und auch an ein Stück Land sogar in bestimmten städtischen Kreisen, die sich nur Mietwohnungen leisten können, in besonders deutlicher Form wieder: Bei jenen, die eine Parzelle mit eigenem Häuschen in einem Familiengarten besitzen. Für viele scheint dies die Erfüllung der Wünsche vom Leben auf eigenem Land, im eigenen Häuschen und in einer überschaubaren Gemeinschaft darzustellen. Die Flucht hinaus aus den Städten ins <unkomplizierte>, (einfache) Leben zeigt sich wohl auch in der Camping-Bewegung, wo jeder Stadtnomade noch das Gefühl hat, dort seine Behausung (Zelt oder Wohnwagen) aufschlagen zu können, wo es ihm gerade gefällt.
Gebäude einer Stadt werden von Architekten entworfen und stellen Kompromisse dar zwischen den Anforderungen der Bauzone und der Baulinie, der Größe des Platzes, des zur Verfügung stehenden Materials und den finanziellen Möglichkeiten des Auftraggebers sowie des künftigen Nutzungszweckes, kombiniert mit einem Hauch individueller künstlerischer Selbstdarstellung. Aufgebaut werden sie von Menschen, die Lohnarbeit ausführen und nicht zwingend die künftigen Bewohner des Hauses oder Nachbarn sind. Wohnblöcke besitzen heute kaum mehr stadtspezifische Gesichter. Sie sind im Zuge des internationalisierten Geschmacks nahezu austauschbar geworden. Über Ländergrenzen und Kontinente hinweg beginnen sich die Häuser der Großstädte immer mehr zu ähneln. Dank dem massiven Einsatz von Energie (zur Heizung respektive zur Kühlung) sind auch die verschiedenen Klimazonen kein Hindernis mehr: von der Südspitze bis zur Nordspitze eines Kontinentes verbreitet sich die bauliche Uniformität aus Beton, Metall und Glas in immer schneller werdendem Tempo.
Häuser und Städte -- sofern man geschützte historische Bausubstanz und noch vorhandene ländliche Traditionen weglässt -- haben je länger je weniger mit lokalspezifischer Identität ihrer Bewohner, die auf Zeit dort wohnen, zu tun. So verliert es heute dementsprechend immer mehr an Bedeutung, ob man Bürger der Stadt oder des Dorfes ist, wo man wohnt. Bei der hohen Mobilität der Menschen muten die in den Heimatscheinen und Pässen eingetragenen Bürgerorte fast anachronistisch an. [In der Schweiz ist man nicht Bürger des Wohnortes, sondern des Heimatortes.] Von einer generellen Bindung an einen von den Vorfahren oder vom Ehepartner übernommenen Heimatort kann keine Rede mehr sein; viele haben ihn wohl kaum je in der Absicht besucht, ihren eigenen Herkunftsort kennenzulernen und Beziehungen zu den Menschen dort anzuknüpfen. Nur noch in einzelnen ländlichen Gebieten mögen die Bewohner auch tatsächlich Bürger des Ortes sein, in dem sie geboren wurden und selber leben. Die Bindung an den Bürgerort besteht bei vielen Schweizern vermutlich nur noch aus Ausweispapieren. Die Diskrepanz von Wohn- und Bürgerort beunruhigt kaum jemanden. Das Heimatgefühl -- sofern es dieses in einem positiven Sinn noch gibt -- hat sich gelockert.
Durch die hohe räumliche (und soziale) Mobilität der Erwachsenen werden auch Kinder je länger je weniger an ein räumlich festgelegtes Heim gebunden. Die Familie (wohlverstanden: die Kernfamilie!) ist eine soziale Einheit, die zwar räumlich zusammenlebt, aber an wechselnden Orten. Hinzu kommt, dass Kinder die räumliche Einheit der Familie auch dann relativ früh verlassen, selbst wenn sie in der gleichen Stadt wie die Eltern weiterleben. Der Individualisierungsprozess, der sich im Schaffen und im Ausbau eines eigenen persönlichen räumlichen Rahmens äußert, wird von der jungen Generation übernommen. Dabei aber kann dies zum Teil zu neuen sozialen Formen des Wohnens, zu Wohngemeinschaften führen. Diese bauen jedoch nicht auf dem Prinzip der Verwandtschaft auf, wie dies die Familie tut, sondern es handelt sich dabei um temporär eingegangene Zweckverbindungen, die meist aufgrund der Kriterien ähnliches Alter, sozialer Status und Zivilstand sowie zur Verfügung stehendes Geld eingegangen werden. »Verwandtschaft«, ein Begriff der sich ohnehin vor allem auf die Kleinfamilie reduziert hat, wird durch Wahlverwandtschaften ersetzt. Während das erstere im Prinzip zeitlich unauflöslich ist, hat das zweite, ebenso wie das Wohnen heute, meist nur temporären Charakter und ist im wesentlichen ohne Konsequenzen auflösbar.
Aus allen den hier aufgezählten Elementen lässt sich ableiten, dass die Raumgebundenheit der Menschen sich im Zuge der Industrialisierung grundlegend verändert hat: Aus der begrenzten Lokalbeziehung wurde eine überregionale Austauschbarkeit. Die Gründe für die locker gewordene Bindung an einen bestimmten Raum hängt zweifellos auch mit den Mitteln zusammen, die der Überbrückung und dem mühelosen Überwinden von Distanzen dienen. So unter anderem, wie bereits erwähnt, die öffentlichen Verkehrsmittel wie Straßenbahn und Zug sowie Flugzeuge, aber auch die privaten Fahrzeuge, die sogar ein tägliches Pendeln zwischen Arbeits- und Erholungs-/Schlafort (selbst wenn diese Dutzende von Kilometern voneinander entfernt liegen) erlauben und somit eine räumliche Aufteilung von Funktionen -- Arbeiten und Wohnen -- ermöglichen. Aber auch Kommunikationsmittel haben dazu beigetragen, dass die Bindung an einen Ort vor allem die an die eigene Wohnung als temporärer Aufenthaltsort ist und weniger auch die an eine bestimmte soziale Umgebung. Das Telephon beispielsweise ermöglicht, unabhängig von der effektiven sozialen Umgebung, Kommunikation mit Menschen, die einem wichtig sind, jedoch in anderen Quartieren oder gar Städten leben. Es ersetzt (oder vermutlich verhindert es) bis zu einem gewissen Grad sogar direkte soziale Interaktionen mit räumlichen Nachbarn. In die gleiche Richtung, die -- je nach Betrachtungsweise -- Individualisierungs- respektive Isolierungsprozesse, den Rückzug in »die eigenen vier Wände«, verstärken, wirken Radio und Fernsehen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auf dem Hintergrund der hier skizzierten Art und Weise, wo und wie wir wohnen, heben sich die in diesem Band zusammengestellten Beiträge scharf ab. Die meisten schildern Bauen und Wohnen in traditionellen Gesellschaften. Dort bedeutet dies auch immer das Eingebettetsein des Einzelnen in Sozialverbände, die lokal, d.h. in einem Dorf, verankert sind. Die Häuser als Ganzes, aber auch ihre Einzelteile sind dort sichtbare Zeichen kultureller Identität und werden als solche von den Menschen, die sie selbst gebaut haben, auch empfunden.
Dies drückt sich im Beitrag von Urs Ramseyer über ein Dorf auf der indonesischen Insel Sumba besonders deutlich aus: Die Menschen, die nicht nur Aufenthaltsorte für die Lebenden (Häuser), sondern auch, mitten im Dorf, für die Toten (megalithische Grabmäler) geschaffen haben, setzen sich für ihre eigene Tradition, die sich am augenfälligsten in den imposanten Bauten manifestiert, zur Wehr gegen zweifelhafte Modernisierungsprozesse. Noch empfinden sie das Dorf als Gemeinschaft der Lebenden und der Toten, der jetzigen und der vergangenen Generationen. Es ist für sie der Mittelpunkt ihrer Welt.
Sozusagen ein Sonderfall der Idee vom Zentrum der Welt respektive des Kosmos haben die Azteken mit ihren Tempeln auf bis zu 40 oder 50 Meter hohen Pyramidensockeln geschaffen. Gerhard Baer beschreibt diese Bauten, die nicht nur in Mesoamerika, sondern auch in Südamerika verbreitet waren. Sie waren Kultstätten, auf denen Priester den Göttern Menschenopfer darbrachten. Diese eindrücklichen Zeugnisse der kolossalen Steinarchitektur der Azteken waren aber nicht typisch für dörfliche Gemeinschaften -- wie sie die meisten Autoren dieses Bandes beschreiben --, sondern für komplexere städtische und staatsähnlich organisierte, geschichtete Gesellschaften mit einflussreicher Priesterschaft. Innerhalb einer ethnischen Gruppe oder einer Region, die auf den ersten Blick einheitlich erscheinen mag, unterscheidet sich meist ein Dorf in der Anordnung und Ausführung der Gebäude vom andern. Oft handelt es sich dabei um Details, die verschieden sind, auf die aber die Bewohner besonderen Wert im Sinne auch eines dörflichen Kennzeichens legen und das ihr Wir-Bewusstsein manifestiert.
Der Ort innerhalb des Dorfes, wo die Mitglieder einer Familie ein Haus bauen, wird nicht bestimmt primär durch individuelle Vorlieben und Möglichkeiten, sondern vor allen Dingen durch den Bodenbesitz des Verwandtschaftsverbandes, des Clans oder der Sippe. Das Bauen eines Hauses ist deshalb hauptsächlich eine Angelegenheit des betreffenden Verwandtschaftsverbandes, wobei jedes Mitglied das zum Aufbau eines Gebäudes beiträgt, das ihm aufgrund seines Alters, seines Geschlechtes, seines Wissens und Könnens möglich ist. Dieser Aspekt, der zugleich auch das Prinzip der gegenseitigen Hilfe auf dörflicher Ebene anspricht, ist im Aufsatz von Brigitta Hauser-Schäublin über eine egalitäre Pflanzergesellschaft in Papua-Neuguinea enthalten.
In allen hier beschriebenen dörflichen Verhältnissen wohnen Menschen auf dem Land, das ihnen gehört und auf dem vor ihnen schon viele Generationen gelebt haben. Das Dorf, in dem in der Regel immer die gleichen Clane zusammenwohnen -- wo jeder jeden kennt und mit ihm auch verwandt ist (ähnlich wie dies früher auch bei uns auf dem Lande üblich war) --, ist meistens zugleich die größte wirtschaftliche und politische Einheit. Dabei aber gibt es eine Vielzahl von Unterschieden: In der Größe und der Anlage der Dörfer, in der Einfügung in die engere und weitere topographische Umwelt, in den Formen und der Größe der Häuser, im dazu verwendeten Material und der Bauweise von Fußböden, Wänden und Dächern, in der Ein- und Aufteilung in Wohn-, Wirtschafts- und Kultgebäude, in der sozio-religiösen Bedeutung der Häuser und ihrer Teile, in der Infrastruktur der Siedlungen (Wege, Plätze, Wasserzuleitungen und -ableitungen) und der Häuser (Aufteilung nach Funktionen), in der jahreszeitlichen Nutzung, in sozialen Kriterien wie etwa Geschlecht, Alter sowie Schicht- oder Kastenzugehörigkeit.
Viele der hier aufgezählten Aspekte (von denen es noch zahlreiche weitere gibt) sind in verschiedenen Beiträgen dieses Bandes vertreten:
Im Aufsatz von Iren von Moos und Edwin Huwyler über ein Hochtal in Afghanistan wird deutlich, wie sehr jahreszeitliche und klimatische Schwankungen das Dorfleben beeinflussen: Während die Familie den Winter über auf engstem Raum im Innern des Hauses zusammenwohnt, ziehen im Frühjahr die Frauen mit dem Vieh auf die Alpweiden hinauf. Auch wird gerade in diesem Bericht deutlich, wie die Aufteilung des Raumes (innerhalb und außerhalb des Hauses) nach Kriterien von Geschlecht und Alter vorgenommen werden. Zugleich beinhaltet diese räumliche Aufteilung nach Geschlecht eine feste soziale Aufgabenzuweisung.
Die Anpassung an primäre Gegebenheiten wie Jahreszeiten und Klima zeigt sich bis zu einem gewissen Grad auch in den für den Hausbau verwendeten Materialien, die aber nicht einfach etwa durch ökologischen Determinismus zu erklären sind, sondern oft auch das Resultat kultureller Bevorzugung darstellen. So werden in diesem Band Gesellschaften beschrieben, die z. B. nur Holzarchitektur kennen (die Abelam in Papua-Neuguinea); andere verwenden Steine nur für Sakralbauten (Sumba und teilweise auch die Azteken). Andere wiederum kombinieren Stein- und Holzelemente für ihre Wohnhäuser (Afghanistan und Nordindien).

Abb.: Adobe-Bau, USA (©ArtToday)
Vertreten ist auch die westafrikanische Lehmarchitektur, die Bernhard Gardi am Beispiel Moptis (Mali) darstellt. An diesem Beispiel einer Stadt wird dem Leser auch deutlich gemacht, um wieviel komplexer die Siedlungs- und Wohnstruktur und die damit zusammenhängenden Probleme einer Stadt sind im Vergleich zu einem Dorf.
Der Beitrag von Susanne Haas über ein indisches Dorf an den südlichen Ausläufern des Himalayas zeigt, wie sich die Sozialstruktur und Dorf- respektive Hausanlage gegenseitig durchdringen. Nicht nur scheinen die seltenen Eheformen der Polyandrie, z.T. kombiniert mit Polygynie, der Aufsplitterung von Land- und Hausbesitz entgegenzuwirken, auch spiegelt sich in der Größe und vor allem in der Lage der Häuser innerhalb der Siedlung die Kastenzugehörigkeit wieder." [S. 6 - 13]
"Wohnbau im weitesten Sinne umfasst alle Bauten, die Wohnzwecken dienen, eingeschlossen Bauten, die über das Wohnen hinaus soziale Aufgaben erfüllen, wie z.B. Krankenhäuser, Heime, Schulen, Kindergärten usw. Unter Wohnbau im engeren Sinne versteht man vor allem den Wohnungsbau.
In fast allen frühen Kulturen beginnt der Wohnbau mit dem Bauernhaus, abhängig von den Formen des Zusammenlebens wie des Wirtschaftens und den örtlichen Verhältnissen (Klima, Baumaterialen usw.); so wechselt in Deutschland die Form des bäuerlichen Hauses von Landschaft zu Landschaft. Das befestigte Haus (Burg) und der Palast entstanden mit der Differenzierung der Gesellschaft; auch diese Entwicklung ist in nahezu allen Kulturen festzustellen; die sehr unterschiedliche Ausprägung der Palastformen
erklärt sich weitgehend aus den verschiedenartigen Aufgaben, die der repräsentative Wohnbau in den einzelnen Kulturen zu übernehmen hatte.
Überall dort, wo die Urbanisierung viele Menschen auf engstem Raum zusammenbrachte, entstanden
Mietshäuser, oft mehrstöckig, in Straßenzeilen oder Blocks angeordnet, von den Stadtstaaten der Antike über die des
Mittelalters, wie
z.B. Venedig, bis hin zu den mod. Metropolen.
Zwischen dem mehrstöckigen Mietshaus (Hochhaus) auf der eine Seite und dem Bauernhaus oder Schloss auf der anderen Seite stehen das Bürgerhaus des Handwerkers oder Kaufherrn und das Stadtpalais des Adels. Auch sie sind landschaftlich und von der Funktion her geprägt, z.B.
Die industrielle Revolution führte, zuerst in England, überall zu einer verstärkten Urbanisierung; in den Ballungszentren schossen eintönige Arbeitersiedlungen wie Pilze aus der Erde, anfangs von geradezu abstoßender Hässlichkeit (Slums). Eine Änderung setzte erst etwa um 1850 ein, von England ausgehend, wo sich damals Architekten und Theoretiker dieses Problems bewusst annahmen. Die Suche nach menschenwürdigeren Wohnformen führte zu einer Reform des Mietshauses und um die Wende zum 20. Jh. u.a. zur Gartenstadt und Gartenvorstadt, wo zwischen Grünanlagen gesunde, helle, hygienische Wohnblocks errichtet wurden.
Gleichzeitig mit der Gartenvorstadt entwickelten sich neue Formen des Einzelhauses und Einfamilienhauses wie
Das engl. Domestic Revival (William Morris [1834 - 1896], Philip Webb [1831 - 11915], [Charles Francis Annesley] Voysey [1857-1941]) hat auf dem Kontinent, vor allem in Deutschland, zu einer Abkehr von der seit der Renaissance wiederbelebten Form der römischen Villa bzw. des neugotischen burgartigen, pittoresken Hauses geführt. [Hermann] Muthesius [1861 - 1927] war ein besonderer Befürworter des englischen Landhausstils, da das englische Haus traditionell dem Wohnen, nicht der Repräsentation dient, im Gegensatz zur französischen Maison oder zur Villa. Viele deutsche Architekten waren führend bei der Durchsetzung des Internationalen Stils der 20er Jahre im Wohnbau ([Peter] Behrens [1868 - 1940], Bruno Taut [1880 - 1938], [Ludwig] Mies van der Rohe [1886 - 1969]). Ihr Stil wurde auf der ganzen Welt, vor allem in Skandinavien und den angelsächsischen Ländern, aufgegriffen und weiterentwickelt."
[Lexikon der Weltarchitektur / Nikolaus Pevsner ... -- 3., aktualisierte und erweiterte Aufl. -- München : Prestel, © 1992. -- Digitale Ausgabe: Berlin : Directmedia, 2000. -- 1 CD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 37). -- ISBN 3898531376. -- S. 5855. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie diese CD-ROM bei amazon.de bestellen}]
|
Die Bassena ist der gemeinsame Wasserhahn für jeweils drei Wohnungen auf einem Stockwerk in Mietshäusern Wiens aus der 2. Hälfte 19. Jahrhundert bis 1. Viertel 20. Jahrhundert. Eine Bassena befindet sich auf dem Treppenabsatz jedes Stockswerks. Da alle Mieter bei der Bassena ihr Wasser holen müssen, ist die Bassena ein Kommunikationszentrum ersten Ranges: es gibt keine familiären und kaum persönliche Geheimnisse, die nicht auf dem Weg über die Bassena Gemeingut der Mieter würden. In Wien ist der Ausdruck Bassenawohnung ein fester Bestandteil der Sprache. Wasser auf der Etage, wenn auch an einer gemeinsamen Bassena, war übrigens ein immenser sozialer und hygienischer Fortschritt gegenüber der Zeit davor, als man das Wasser an Hofbrunnen oder anderen öffentlichen Brunnen holen musste. |
"Schon in der Antike gibt es, um der Wohnungsnot in den damaligen Weltstädten Herr zu werden, den Typus des Mietshauses mit geschlossenen Etagenwohnungen, das bereits damals bis zu 30 m Höhe erreichte. In späteren Zeiten formen die Mietshäuser die Plätze und Straßen entgegen der Tradition des bisherigen Städtebaus.
So werden in der Renaissance bedeutende Platzanlagen geschaffen. So gilt die Piazza Ducale in Vigevano (1493-95), ein geschlossener Platz mit durchlaufenden Arkaden und einheitlicher Fassade, als Prototyp für die später im Absolutismus folgenden verschiedenartigen Platzanlagen mit umschließenden repräsentativen Wohngebäuden. Schon bestehende individuelle Gebäude werden bei Reihung gleicher Elemente zu einem einheitlichen Gesamteindruck verbunden.
Auf Initiative Heinrichs IV. von Frankreich entsteht 1605-12 in Paris die Place des Vosges als Promenadeplatz mit einheitlicher Bebauung (ein Geviert von je 140 m Seitenlänge; dreigeschossige Wohnhäuser mit ausgebauten Dächern). Ursprünglich für die Arbeiter der königlichen Brokatmanufaktur vorgesehen, wird diese Wohnanlage zu einem bevorzugten Wohnsitz der Aristokraten und des gehobenen Bürgertums.
Die Zentralisierung von Wohnhäusern um Plätze, die Tendenz zur Verbindung von Bauwerken und Gartenlandschaften führen zu neuen Strukturen des Städtebaues (z.B. der Achse »Paris - Versailles« oder in Rom »Engelsburg - Peterskirche«).
In England bietet die großangelegte Erweiterung des mondänen Badeortes Bath zu einem Wohnort für die großbürgerliche Gesellschaft ein neues Beispiel. Der Architekt [John Wood d.Ä. [1707 - 1754] und sein Sohn waren zunächst in London die entscheidenden Planer am Anfang einer Reihe ähnlicher Projekte, die mit dem Bau von Mietshäusern Straßen und Plätze vereinheitlichten. 1728 entstand der Queen's Square mit schlossähnlichen Wohnblöcken, 1754 der Circus, ein kreisrunder Wohnkomplex mit Promenadeplatz. John Wood d.J. [1728 - 1781] gab mit dem Royal Cresent (1767-75) in Bath die Geschlossenheit des noch vom Vater gebauten Square preis und stellte die in einem Halbkreis zu einer Fassade zusammengezogenen Reihenhäuser einer parkähnlichen Rasenfläche gegenüber. Das Prinzip der zu einer einzigen palastartigen Fassade vereinheitlichten Mietshäuser verwendete auch Robert Adam [1728 - 1792] bei dem von ihm an der Themse mit Luxuswohnungen ausgestatteten Komplex Adelphi (1768-72, 1928 abgebrochen).
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand unter Napoleon in Paris der weitverbreitete Typ des Boulevardhauses, ein Mietshaustyp in gleichartiger Bauweise an breiten Straßen und Plätzen, der in regionalen Variationen das Straßenbild europäischer Großstädte bestimmt (z.B. Rue de Rivoli nach Plänen von [Pierre François Léonard Fontaine [1762 - 1853] und [Charles] Percier [1764 - 1838]). Das Erdgeschoss nimmt dabei, zuweilen unter Arkaden, Ladenlokale mit Schaufenstern auf, darüber zugehörige Büros und Lager, in den folgenden Etagen, meist drei oder vier, über eine zentrale Treppenanlage erreichbar die geschlossenen Etagenwohnungen.
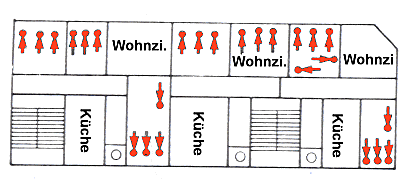
Abb.: Typische Belegung mit Schlafplätzen in Mietshaus, Zürich, 1896
[Quelle der Abb.: Handbuch der schweizerischen Volkskultur / hrsg. von Paul Hugger. -- Zürich : Offizin. -- Bd. 1. -- ©1992. -- ISBN 3907495365. -- S. 387. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Obiger Belegungsplan zeigt, dass noch 1896 in der Stadt Zürich ein Einzelzimmer ein absolutes Privileg der wohlhabenden Schichten war. Normalerweise war ein Schlafzimmer mit 3 bis 5 Personen belegt!
Im 20. Jh. schaffen gesetzliche Bestimmungen zur Besiedlungsdichte in Stadtgebieten (CIAM [Congrès Internationaux d'Architecture Moderne]., Charta von Athen [1933]) eine Trennung von Verkehr, Gewerbe- und Wohnviertel. Dem Höhendrang der Büro- und Verwaltungsgebäude folgen die Wohnhochhäuser und die in den USA entwickelten Apartmenthäuser und begründen eine neue Form des städtischen Wohnens.

Abb.: Mietshaus"festung" Karl-Marx-Hof (Architekt: Karl Ehn), Wien,
1927
[Adolf] Loos' [1870 - 1933] Überlegungen zum sozialen Wohnungsbau in Wien Anfang der 20er Jahre, [Walter] Gropius' [1883 - 1969] lineare, auf klare, wiederkehrende Baukuben beschränkte Wohnhochhäuser (ab 1928) führen zur Abkehr von Fassaden des Historismus und begründen den langgestreckten Zeilenbau (1929, Siedlung Dammerstock bei Karlsruhe von Gropius und Haesler, Römerstadt in Frankfurt von Ernst May), der schließlich in der Unité d'Habitation in Marseille von Le Corbusier [1887 - 1969] kulminiert 1946-52).
Der Leitgedanke, der zu solch großen Baukuben führte, besteht darin, ein ganzes Stadtviertel durch wenige Großbauten zu ersetzen, um den sich stark ausbreitenden Flächenstädten entgegenzuwirken. Hieraus folgt die Entwicklung der Trabantenstädte wie Beaumont Leys bei Leicester (England, 1966) von W.G. Smigielski für ca. 40000 Einwohner, bei der die Idee der Gartenstadt als Grundmaxime Berücksichtigung findet. Bes. japanische Architekten zeigten auf dem Gebiet der Großmietshäuser, nicht zuletzt durch den Einfluss der Metabolisten, beeindruckende Lösungen ([Sachio] Otani [geb. 1924], [Kenzo] Tange [geb. 1913], [Kiyonori] Kikutake [geb. 1928])."
[Lexikon der Weltarchitektur / Nikolaus Pevsner ... -- 3., aktualisierte und erweiterte Aufl. -- München : Prestel, © 1992. -- Digitale Ausgabe: Berlin : Directmedia, 2000. -- 1 CD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 37). -- ISBN 3898531376. -- S. 3546ff. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie diese CD-ROM bei amazon.de bestellen}]
|
|
Nach dem Wiener Kongress (1815) und auch nach den fehlgeschlagenen bürgerlichen Revolutionen 1848 zogen sich in Deutschland und Österreich große Teile des Bürgertums aus dem politisch-öffentlichen Raum in die Privatsphäre und Privatidylle der Häuslichkeit zurück. Die "gemütliche" Wohnung wurde zu einem wichtigen Bestandteil des Lebens in der Biedermeierzeit. |
|
|
Man beachte die Ausstattung dieses Schlafzimmers: Götterbild, Uhr, Kleidung, Bett, Teppich, aber kaum Anzeichen des Bemühens, den Raum "wohnlich" in unserem Sinn zu machen. Vernachlässigte Wandfarbe ist geradezu typisch für Indien, auch dort wo Farbe kein Problem der Finanzierung ist. |
|
[Bildquelle: Bettgeschichte(n) : zur Kulturgeschichte des Bettes und des Schlafens / hrsg. im Auftr. Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums - Volkskundliche Sammlungen von Nina Hennig und Heinrich Mehl. -- Heide i. Holstein : Boyens, ©1997. -- (Arbeit und Leben auf dem Lande ; Bd. 5). -- Ausstellungskatalog. -- ISBN 3-8042-0813-4. -- S. 24]. |
Dieses Zimmer zeigt mit Truhe, Sessel, Geschirr, Decken usw, dass der Inhaber auf "Wohnkultur" Wert legt. |
|
|
Dieses Bild einer südasiatischen Küche ist idyllisierend, weil in ihm nicht der im rauchfanglosen Raum beißende Rauch des Küchenfeuers zum Ausdruck kommt, der bei Küchenpersonal, Hausfrauen und Kindern zu chronischen Augenentzündungen führt. (Ähnlich war es übrigens z.B. in den Küchen der traditionellen Schwarzwaldhöfe). |
|
|
Die Wohnküche war außer an Feiertagen der einzige beheizte Raum in der Wohnung, deshalb spielte sich -- zumindest während der kalten Zeiten -- der Großteil des Lebens in ihr ab. |
|
"Die Befreiung der Frau wird erst vollständig durchgeführt sein, wenn sie von der Sklaverei der Küche erlöst ist" |
Die Frankfurter Küche trennte -- aus vermeintlich hygienischen Gründen -- die Küche radikal vom Wohn- und Essbereich der Wohnung. "Als erste moderne seriell hergestellte Einbauküche 1927-28 von der Architektin [Margarete] Schütte-Lihotzky [1897 - 2000] entworfen, die unter der Leitung des Stadtbaurats May am sozialreformerischen Bauprogramm 'Das Neue Frankfurt' mitwirkte. Nur sechseinhalb Quadratmeter groß, war die Frankfurter Küche durch Raumökonomie und streng funktionale Einrichtung ein Beitrag zur 'Rationalisierung der Hauswirtschaft'. Als zeit- und kräftesparende Arbeitsküche wurde sie bis 1930 in rund 10000 Wohnungen der Frankfurter Sozialsiedlungen eingebaut. Die Frankfurter Küche war das Vorbild der 'Schwedenküche', die seit den fünfziger Jahren weltweit Einzug in den Haushalt hielt." [Lexikon der Weltarchitektur / Nikolaus Pevsner ... -- 3., aktualisierte und erweiterte Aufl. -- München : Prestel, © 1992. -- Digitale Ausgabe: Berlin : Directmedia, 2000. -- 1 CD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 37). -- ISBN 3898531376. -- S. 1751. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie diese CD-ROM bei amazon.de bestellen}] |
|
[Bildquelle: Bettgeschichte(n) : zur Kulturgeschichte des Bettes und des Schlafens / hrsg. im Auftr. Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums - Volkskundliche Sammlungen von Nina Hennig und Heinrich Mehl. -- Heide i. Holstein : Boyens, ©1997. -- (Arbeit und Leben auf dem Lande ; Bd. 5). -- Ausstellungskatalog. -- ISBN 3-8042-0813-4. -- S. 270]. |
Diese Mägdekammer zeigt deutlich, unter welchen Umständen auch in Deutschland viele Menschen bis in die 1950er-Jahre hausen mussten. Immerhin mussten hier die Mägde nicht im gleichen Raum wie die Knechte schlafen, wie es in der Oststeiermark (Österreich) noch 1950 vorkam (man kann sich vorstellen zu wieviel sexueller Gewalt dies geführt hat). |
Zu Kapitel 11, Teil II: Wohngegenden und Siedlungsformen