Internationale Kommunikationskulturen


mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - >: Internationale Kommunikationskulturen. -- 11. Kulturelle Faktoren: Wohnung und Privatsphäre. -- 2. Teil II: Wohngegenden und Siedlungsformen. -- Fassung vom 2001-06-12. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur112.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2001-06-12
Überarbeitungen:
Anlass: Lehrveranstaltung, HBI Stuttgart, 2000/2001
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Länder und Kulturen von Tüpfli's Global Village Library
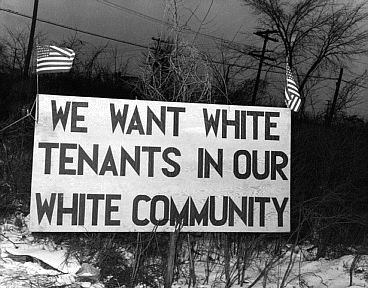
Abb.: Rassistische Abgrenzung von Wohngegenden: Detroit, Michigan, USA, Februar 1942
(©Corbis)
Die Bedeutung von Nachbarschaften (Wohngegenden) für Kommunikationskulturen wurde schon dargestellt in:
Payer, Margarete <1942 - >: Internationale Kommunikationskulturen. -- 5. Kulturelle Faktoren: Soziale Beziehungen. -- 4. Teil IV: Lebensstile. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur054.htm
In diesem Teil geht es um grobschlächtigere Kategorien wie
Jede dieser Siedlungsformen hat spezifische -- klimatisch, geschichtlich, kulturell bedingte -- Kommunikationskulturen.
Dabei spielen Stadtplaner und Architekten bzw. das Fehlen von Stadtplanung oft eine entscheidende Rolle:
"Erst heute beginnen wir die Zonenplanungen der Zwischenkriegszeit zu revidieren. Auch die Wohnungsgrundrisse müssen neu überdacht werden. Das noch immer häufig geplante System: Arbeitsküche, Essplatz, Wohnzimmer, ineinanderfließend mit dem Balkon davor, stammt aus den 20er Jahren. Andere Grundrisse zeigen «Nasseinheiten». Einer Installationswand sind beidseitig Küche, Bad, WC zugeordnet. Der Verzicht auf ein Vorzimmer oder einen Eingangsflur hat sich nicht bewährt. Die minimalsten Zimmerabmessungen, «Kabinengrundrisse», erwiesen sich als kinderfeindlich.
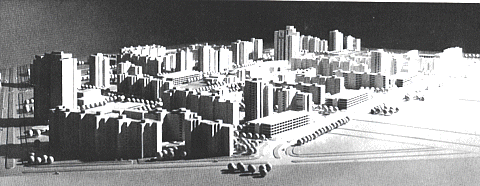
Abb.: Modell "Gropiusstadt", Berlin-Neukölln / Walter Gropius
TAC, USA und Wils Ebert, Berlin, 16800 Wohnungen, 1960er-Jahre
Die ab 1964 erbaute «Gropius-Stadt» vom Rodelberg in Berlin wurde zur sozialen Katastrophe. Christiane E schrieb im erschütternden Bericht Wir Kinder vom Bahnhof Zoo: «Bei schlechtem Wetter war es echt beschissen in der Gropiusstadt für uns Kinder. Freunde durfte eigentlich niemand von uns in die Wohnung nehmen. Dazu waren die Kinderzimmer auch viel zu klein»"
[Birkner, Othmar: Die Sanierung der industriellen Stadt und ihre Bedeutung für Wohnbauten. -- In: Handbuch der schweizerischen Volkskultur / hrsg. von Paul Hugger. -- Zürich : Offizin. -- Bd. 1. -- ©1992. -- ISBN 3907495365. -- S. 351. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
In diesem Teil gehen wir ziemlich summarisch vor allem auf Dorf und Stadt sowie städtische Wohnformen ein. Das weite Gebiet des ländlichen Wohnens sowie der nomadischen Wohnformen kommt dabei aus Platzgründen zu kurz.
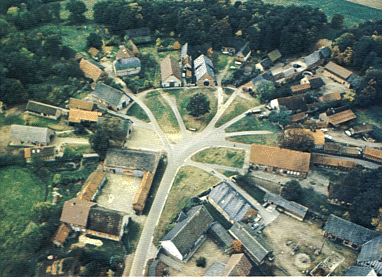
Abb.: Rundlingsdorf, Norddeutschland
"Der traditionelle Gegenstand der Volkskunde, das überschaubare Dorf mit seiner (methodisch unterstellten) kulturellen Homogenität, kennt unter anderem zwei kommunikativ relevante Maximen:
Um Missverständnissen vorzubeugen:
Die zwei Idealisierungen der gegenseitigen Zugänglichkeit und des gemeinsamen unterstellten kollektiven Wissens teilen die Welt in klar abgetrennte Bereiche der Zugehörigen und Fremden; sie legen zugleich eine Ressource an selbstverständlichen Kommunikationsmöglichkeiten und -inhalten fest, die für jeden Dorfbewohner gelten. Der «Fremde» dagegen ist nur eingeschränkt zugänglich; gemeinsames Wissen kann ihm ebenfalls nur in beschränktem Maß zugeschrieben werden. Ihm gegenüber bestehen beschränkte Kommunikationsmöglichkeiten und -inhalte.

Abb.: Hongkong (?), China (©Corbis)
Die (groß-)städtische Umwelt löst die beiden Idealisierungen in unterschiedlichem Maß auf; Zugänglichkeit gilt weiterhin im lokalen Kontext nur noch für Personen mit bestimmten Eigenschaften. Das unterstellte gemeinsame Wissen ist weniger spezifisch, daher leerer.
Bei den Eigenschaften, die eine Person für ein Individuum zugänglich machen, sind
zu unterscheiden.
Nicht jedes Durchbrechen der Zugänglichkeitsschranke macht aus einem Fremden einen Bekannten. Bekannte sind dadurch ausgezeichnet, dass sie unmittelbar zugänglich sind und mit dem Individuum eine minimale gemeinsame Geschichte haben (eine minimale WIR-Beziehung). Die Zahnarzt-Sprechstundenhilfe etwa, die man jedes halbe Jahr einmal sieht, gehört nicht zu den «Bekannten» in dem Sinn, dass man sie wiedererkennt, grüßt und anspricht, wenn man ihr in der Stadt begegnet. Ein vages Gefühl von «irgendwoher kenne ich die» mag einen zwar beschleichen, aber der auf die Rolle beschränkte Kontakt zwingt einen nicht dazu, sie zu erkennen. Immerhin würde die gemeinsame Geschichte sich unter geeigneten Umständen in eine WIR-Beziehung verwandeln lassen.
Das Dorf verfügt nicht nur über die Idealisierung der Zugänglichkeit, sondern auch über ihre Regelung. Die Formen gegenseitiger Zugänglichkeit sind sozial festgelegt; es gehört zum kollektiv unterstellten Wissen, diese Formen zu kennen. Die Individualisierung des Lebens im großstädtischen Kontext dagegen führt zur Koexistenz individueller oder gruppenbezogener Regelungen, die entsprechend in Konkurrenz zueinander oder Konflikt miteinander treten können. Die Stärke der sozialen Kontrolle des Dorfes interagiert mit den Kommunikationsmöglichkeiten: Das Individuum ist nicht frei, zu tun, was es will, aber es verfügt über einige gegebene und vorgeformte Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten, die es sich nicht erst erkämpfen, erarbeiten muss. Die schwache soziale Kontrolle des Individuums in der Stadt legt diesem zwar weniger Zwänge auf, bietet ihm dafür aber auch weniger vorgeformte Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Die Bildung der in der Kultur geltenden Normen wird nicht mehr primär durch den direkten Kontakt mit der Kultur und ihren Vertretern bewirkt (durch Sanktionen etc.), sondern verläuft über einen indirekten Prozess, in welchem heute insbesondere die Massenmedien eine wesentliche Rolle spielen (was die Norm der «Leute» ist, erkenne ich in meiner Isolation nur noch aus dem Verhalten, das man mir am Fernsehen vorspie[ge]lt; meine Normen sind aus dem schönen Schein abgeleitet; sie verleiten mich zu einem sozialen Verhalten, das seine Begründung nicht aus dem sozialen Kontakt erhält).
Für das Kommunikationsverhalten des Stadtbewohners bedeutet dieser Aspekt der Individualisierung und der schwächeren sozialen Kontrolle eine Erschwerung des kommunikativen Zuganges zu Fremden. Der Stadtbewohner muss sich Techniken der Kommunikationsaufnahme erarbeiten, sofern ihm die Technik nicht genau dies liefert in der Form des Telefons. ...
Die moderne Kernstadt mit ihrer Agglomeration ist [in der Schweiz; in anderen Ländern sieht es anders aus] seit einiger Zeit geprägt von zwei sich gegenseitig aufhebenden Tendenzen:
Die Stadtflucht beschert den Agglomerationen zersiedelte Einfamilienhausgebiete mit städtisch orientierten Einwohnern, deren Sprache sich nicht an der Ortssprache orientiert; die unterstellte Monolingualität des Dorfes in der Agglomeration wird abgelöst von einer Multi- oder Plurilingualität, die sich im kernstädtischen Kontext durch die fremdsprachigen Arbeitsimmigranten noch verstärkt."
[Werlen, Iwar: Kommunikation im Ort : Kommunikationsgemeinschaften und ihre Kulturen. -- In: Handbuch der schweizerischen Volkskultur / hrsg. von Paul Hugger. -- Zürich : Offizin. -- Bd. 1. -- ©1992. -- ISBN 3907495365. -- S. 418 -421. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
|
|
128000 Einwohner |
|
|
1,7 Mio. Einwohner |
Als Grundmerkmal städtischer öffentlicher Kommunikationskulturen gilt im Allgemeinen:
| "Typisch für die städtische Welt ist, dass der öffentliche Raum keine Verpflichtung auch nur zur rituellen Kundgebung der Wahrnehmung der andern enthält." |
Sonst sprechen folgende Bilder für sich:
| Ostasien | |
|---|---|
|
7,8 Mio. Einwohner (1997) |
10,6 Mio. Einwohner |
|
7 Mio. Einwohner |
3 Mio. Einwohner |
| Südostasien | |
|
6 Mio. Einwohner |
1,2 Mio. Einwohner |
|
3,6 Mio. Einwohner |
|
|
7,8 Mio. Einwohner |
1,6 Mio. Einwohner |
| Südasien | |
|
4,4 Mio. Einwohner (1991) |
3,4 Mio. Einwohner |
| Europa | |
|
7 Mio. Einwohner |
10,7 Mio. Einwohner (1995) |
| Afrika | |
|
1,4 Mio. Einwohner |
1,5 Mio. Einwohner |
|
|
Soweto: 0,6 Mio. Einwohner |
| Nordamerika | |
|
7,4 Mio. Einwohner |
0,7 Mio. Einwohner |
|
9,8 Mio. Einwohner |
|
| Südamerika | |
|
2 Mio. Einwohner |
6,5 Mio. Einwohner |
|
5,6 Mio. Einwohner |
|
| Ozeanien | |
|
2,9 Mio. Einwohner |
0,4 Mio. Einwohner |
Die Luxushotels, Luxusappartements und Luxushäuser, in denen Ausländer und ihre Geschäftspartner in Großstädten besonders der "Dritten Welt" meist leben, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass für viele der dortigen Stadtbewohner die Kommunikationsschauplätze ganz anders aussehen: es sind Straßenschlafplätze, Squatter, Slums und sehr bescheidene Wohnungen.
"Noch vor wenigen Jahrzehnten waren es hauptsächlich die vom Land [in die Stadt] zugezogenen Menschen, die unter schlechtesten Bedingungen leben mussten. Sie verließen ihr Dorf in der Hoffnung, bei Verwandten in der Stadt aufgenommen zu werden und vielleicht über sie auch an eine Arbeit zu gelangen. Lange Zeit funktionierte dieses System; nachdem das Problem der Übernachtung geregelt und eine Beschäftigung gefunden war, ging es langsam bergauf. Anfang der 70er Jahre kam es durch die weltweite Wirtschaftskrise zu einem Rückschlag, der zuerst diejenigen traf, die am untersten Ende des Arbeitsmarktes standen. Während sich die Industrienationen bald wieder erholten, wurde die Krise in der Dritten Welt durch die zunehmende Schuldenlast prolongiert.
Zusätzlich zur Wirtschaftskrise kam dann aber das Problem der Mittellosen in zweiter Generation. Sie wuchsen bei ihren Eltern unter schlechtesten Bedingungen auf, als sie aber darangingen, eine eigene Familie zu gründen, hatten es die Eltern noch zu keiner wesentlichen Verbesserung ihres früheren Standards gebracht. Eine Vergrößerung des Haushaltes war nicht möglich, der Nachwuchs musste sich einen eigenen Lebensraum beschaffen. Dadurch hat sich das Wohnproblem potenziert und in einigen Städten zum Zusammenbruch jedes Planungsansatzes geführt.
Straßenschläfer
Die vielen Menschen, die nachts auf den Straßen asiatischer Städte ihre Zeitung oder ihren Karton auslegen, um zu übernachten, sind nicht neu zugezogen, sondern konnten in der Regel ihre Unterkunft nicht behalten. Sie sind die Nomaden der Stadtzentren, tragen ihr Hab und Gut mit sich und kehren regelmäßig zu bestimmten Schlafplätzen zurück.

Abb.: Straßenschläfer, Katmandu, Nepal (©Corbis)
Die Plätze, an denen die Straßenbewohner schlafen, sind typisch für die verschiedenen Städte. In New Delhi werden die Mittelstreifen der Schnellstraßen bevorzugt. Dort brennt die ganze Nacht das Licht, Autos und Motorroller rasen oft nur einen halben Meter neben dem Schlafenden vorbei, aber man ist vor Vorbeigehenden geschützt. Bombay und Calcutta zeigen in der Nacht ein total anderes Bild als am Tage: Unter den Arkaden, wo tagsüber die Geschäftsleute durchhetzen, liegen in der Nacht in Tücher eingewickelte Körper, daneben brennt oft ein kleines Feuer. Viele Straßen Calcuttas werden so in der Nacht unpassierbar.
Manila bekam vor wenigen Jahren eine Hochbahn, die Fläche darunter wurde sofort von Straßenbewohnern okkupiert. Sicherlich werden mittlerweile bereits »Mieten« für die besten Stellen eingehoben. Die Unterführungen sind ebenfalls ein beliebter Platz für Unterstandslose. In Tondo, der Müllhalde dieser Megacity, leben tausende Menschen, die sich von den Abfällen ernähren und Gegenstände suchen, mit denen sie irgendeinen Tauschhandel treiben können. Aber auch abgebrochene Häuser und Baustellen werden in der Nacht zu Unterkünften Tausender, die tagsüber dort nicht zu sehen sind.
In Hong Kong konzentrieren sich Straßenbewohner um die Hauptpost direkt im Zentrum der Stadt. In den gedeckten Gängen zwischen Star Ferry, Hauptpost und Exchange Square haben sie ihre Kartons und Kisten aufgestellt. Tagsüber gehen sie irgendwelchen Tätigkeiten nach, abends, wenn der Geschäftsverkehr geringer wird, sieht man sie zwischen ihren Decken und Kisten sitzen. Eine Armut, wie sie in anderen Teilen Asiens anzutreffen ist, wo Menschen nicht einmal Materialien haben, um sich eine behelfsmäßige Kleidung zu beschaffen, ist in Hong Kong nicht mehr anzutreffen: Sie haben Decken, um sich zumindest vor Kälte schützen zu können, gekocht wird auf blauen Campingkochern und der Schlafplatz ist relativ sauber.
Vietnam hat ebenfalls mit der Verelendung seiner Städte zu kämpfen. Jahrelang wurden tausende Menschen aus den Städten in Kommunen aufs Land verfrachtet, ohne ihnen dort eine Überlebensmöglichkeit zu bieten. Im Laufe der Jahre sind rund 20% wieder in die Stadt zurückgekehrt. Als Illegale haben sie keine Möglichkeit, bei staatlichen Stellen eine Arbeit zu finden. Da es keine Privatwirtschaft gibt, ist ihre Lage ziemlich aussichtslos. Wenn man davon ausgeht, dass die Hälfte der illegalen Rückwanderer zumindest zeitweise ohne Unterstand auf der Straße lebt, würde es sich um mindestens 300000 Menschen handeln. Da die Regierung nach dem Krieg kaum städtischen Wiederaufbau leistete, die Stadtbevölkerung sollte ja drastisch reduziert werden, steht Vietnam heute vor einem der größten Wohnungsprobleme Südostasiens.
Squatter
Wenn irgendwie möglich, versucht jeder, einen Platz für sich zu beanspruchen und als seinen Besitz zu kennzeichnen. Als erstes wird immer ein Regenschutz errichtet, bei den tropischen Regengüssen sicher die wichtigste Einrichtung. Siedeln mehrere Familien in dieser Art nebeneinander, entstehen sogenannte Squatter. Es sind dies die ersten Formen einer ständigen Behausung. Sie werden auf öffentlichen oder privaten Grundstücken errichtet und sind nur durch weitreichende Maßnahmen der Stadtverwaltungen wieder abzusiedeln. Lange Zeit dachte man, mit Gewalt diesen Siedlungen beikommen zu können. In Manila, Dacca, Calcutta, fast in allen Großstädten gab es zu verschiedenen Zeiten großangelegte Aktionen, die viel Leid verursachten, das Problem aber nur verlagerten.
Squatter treten als Nebenerscheinung der Industrialisierung auf. Die Menschen werden von der Möglichkeit einer Verbesserung ihres Lebensstandards angezogen, ohne die Voraussetzungen zu haben, sich eine neue Existenz aufzubauen. Meist gelingt es erst nach Jahren, sich selbständig zu ernähren und eine eigene Unterkunft zu haben. Bis dahin ist man auf die Hilfe anderer angewiesen. In der ersten Phase werden Kontakte geknüpft und finanzielle Mittel angespart, um sich selbst die nötigsten Bedürfnisse erfüllen zu können. Danach wird die Unterkunft gewechselt. Man unterscheidet hier verschiedene Formen der Squattersiedlung:

Abb.: Landarbeitersiedlung bei Salamanca, Spanien (©Corbis)
Als Ort für Squattersiedlungen werden alle freien Gebiete in der Stadt herangezogen. Bevorzugt werden Flächen, von denen man annimmt, dass sie in den nächsten Jahren nicht verbaut werden. Gesiedelt wird zentrumsnah auf den Straßen, in Parks, auf Eisenbahn und Straßentrassen und unter Brücken. Das Hauptproblem der Squatter sind die sanitären Zustände. Trinkwasser ist fast nie vorhanden, Abwasser läuft offen an der Oberfläche, Toiletten gibt es nicht. Manchmal schließen sich einige Familien zusammen, heben eine Grube aus und verwenden sie als Senkgrube. Meist fehlen dazu jedoch die Voraussetzungen, im Bewusstsein der Bewohner erscheint es auch nicht als vordringliches Problem. Wird die Müllbeseitigung nicht intern organisiert, verbrennt jede Familie ihren Unrat selbst oder wirft ihn aufs Dach ihrer Hütte.
Der entscheidende Faktor für den Ort eines Squatters ist seine Nähe zu potentiellen Arbeitsplätzen. Bei Einkommen, die knapp die notwendigsten Ernährungskosten abdecken, können weder eigene Transportmittel erworben noch Transportkosten bezahlt werden. Jede Übernachtungsmöglichkeit, die nicht in Gehdistanz zum Arbeitsplatz liegt, ist daher wertlos.
Obwohl die Squattersiedlungen nach außen einen chaotischen Eindruck vermitteln, sind sie in sich hierarchisch organisiert. Jeder Meter der Siedlung ist verteilt, die unregelmäßigen Formen der Hütten unterliegen einer gewissen Planung, die von einem Führungsgremium oder auch einer Einzelperson aufgestellt wurde.
So gab es in Karachi einen »King of Squatters«, der 70 % der Siedlungen kontrollierte.
In Calcutta wieder hat sich das »thika« System entwickelt, das zu regelrechten Squatterunternehmern geführt hat. In der ruralen Gesellschaft stellte der thika den Mittler zwischen Grundherrn und Arbeitern dar. Er zahlte aus und erhob Steuern. Auf die städtische Siedlung umgelegt, wurde er zum Verwalter fremden Grundbesitzes und schlug auf alle Mieten einen Prozentsatz für seine Tätigkeit auf. In Calcutta war das der Beginn des organisierten Squatters. Der Vorteil der Siedler lag in der relativen Legalität ihres Wohnplatzes. Diese Squattersiedlungen Calcuttas, »bustees« genannt, entwickelten sich aus den Unterkünften fahrender Handwerker. Selbst heute noch sind bustees größtenteils nach Berufssparten organisiert.
Diese Organisation ist auch einer der Gründe, warum Squattersiedlungen so schwierig abgesiedelt werden können. Ginge es den Bewohnern nur um ihre Unterkunft, könnten sie sich unter Umständen woanders eine ähnliche Behausung sichern. Die Betreiber der Siedlungen verlieren aber ihre Einnahmequelle, die dank der niedrigen Investitionskosten eine enorme Rendite abwirft.
Es wird ein Widerstand unter den Bewohnern organisiert, mit Aufständen gedroht und die Solidarität mit den anderen Squattem herausgestrichen. Dadurch kommt die Stadtverwaltung in ernste Probleme, da sie diese Menschen ja irgendwie unterbringen muss. Eine Lösung wird hinausgeschoben, wodurch sich die Position der Vermieter festigt und die Probleme weiter zunehmen.
In Manila wurden in den frühen 70er Jahren die Squatterbewohner von Intramuros von der Polizei gezwungen, ihre Hütten 30 km vor der Stadt zu errichten. Die Siedlung im Zentrum wurde zerstört. Obwohl sie später mehr Platz zur Verfügung gehabt hätten, haben fast alle in kurzer Zeit wieder eine Hütte in der Stadt errichtet oder gemietet.
Daran ist deutlich zu sehen, dass dem Problem durch direkte Maßnahmen kaum beizukommen ist. Die Aktion in Manila, wie viele ähnliche in anderen asiatischen Städten auch, hat zu einem Verlust an Substanz geführt, da bewohnbare Hütten zerstört wurden. Neben dem finanziellen Verlust gab es aber auch einen Abzug an Arbeitskräften im Dienstleistungssektor. Die vielen Mechaniker, Schuhputzer, Handwerker und sonstigen Helfer, die überall in den Städten zur Verfügung stehen, waren über Nacht aus ihrem angestammten Umfeld herausgerissen. Die schlechte Organisation dieser Städte, die durch die vielen kleinen Dienstleistungen ausgeglichen wird, kam dadurch erst voll zum Durchbruch.
Slums
Der Unterschied zwischen Squatter und Slum ist sein Zustand bei der Errichtung. Eine Squattersiedlung wird zur Erfüllung der mindesten Anforderungen errichtet, während ein Slumgebiet dem Standard eines Wohngebietes entsprach, bevor es durch unterschiedlichste Faktoren, manchmal schon innerhalb eines Jahres, zu einem Slumgebiet wird. Hauptauslöser sind meist die Besitzverhältnisse. Wenn die Mieten die Erhaltungskosten des Hauses nicht mehr decken, ein Abbruch aber auch nicht möglich ist, dann stellt das Grundstück nur mehr einen Spekulationswert dar, das Gebäude selbst wird aufgegeben.

Abb.: Armleutewohnungen, o.O. (©Corbis)
Wenn ein Wohngebiet unter einen gewissen Standard fällt, kann es nur mehr für die unterste Bevölkerungsschicht interessant sein. Der Zuzug steigert sich und der Verfall der Bausubstanz schreitet voran. Da ein Slumgebiet aus wirtschaftlichen Gründen bis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit besiedelt wird, liegt das Hauptproblem in erster Linie in seiner Überfüllung. Gäbe es genügend Slumgebiete, wäre ihr allgemeiner Zustand nicht so schlecht, da sie nicht mehrfach überbelegt wären. Die Überfüllung liegt sowohl in der Baudichte als auch bei der Anzahl der Bewohner pro Objekt. In einem Zimmer leben durchschnittlich vier Menschen, jedem steht eine Grundfläche von 2,5 m2 zur Verfügung.
Die Nebenerscheinungen dieser Zustände haben ebenfalls großen Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen. Der Mangel an Abgeschlossenheit, die soziale Abkapselung vom Leben der Stadt und der Mangel an Bewegungsfreiheit führen, besonders bei Kindern, zu schweren psychischen Störungen. Normalerweise liegt auch die Kriminalitätsrate bei Slumbewohnern über dem Landesdurchschnitt. Es wäre aber falsch, diese proportional zur Verschlechterung der Wohnverhältnisse zu sehen. Sie ist eher die Folge der angespannten finanziellen Lage. Der Mangel an Privatheit und das Zusammenleben mehrerer Generationen auf engstem Raum führen zu einer sozialen Kontrolle, wie sie unter normalen Wohnverhältnissen nicht gegeben sein kann. Dadurch, dass jeder einzelne Teil der Gemeinschaft ist, können Missstände, die durch die Wohnform verursacht sind, teilweise kompensiert werden.
Lösungsversuche
Der Wohnungsnot durch staatlichen Wohnbau beizukommen, ist in den meisten Städten Asiens irreal. Die neuen Wohnungen müssten entweder zu verschenken sein oder sie dienen nicht denjenigen, für die sie errichtet wurden. Hassan Fathy' brachte dieses Problem durch den Satz: no cost housing instead of low cost housing auf den Punkt. Eine Besserung kann nur mit dem Fleiß und Willen der Menschen erreicht werden, die direkt betroffen sind. Die einzige Möglichkeit, billigen Wohnraum zu schaffen, liegt im Eigenbau. Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass Squatter und Slumbewohner die Fähigkeit haben, ihre Unterkunft selbst zu errichten und zu erhalten. Wichtig dabei ist, in wieweit das Wissen des Hausbaus und die Nachbarschaftshilfe in der Bevölkerung verankert sind.
Eine Verbesserung über die Mindestanforderungen hinaus wird meist durch die ungeklärten Eigentumsverhältnisse verhindert. Investitionen, die in die Bausubstanz gemacht werden könnten, werden in Konsumgüter gesteckt. Erst eine definitive Regelung des Grundeigentums kann einen Ausgleich schaffen und führt zwangsläufig zu einem Investitionsschub und zu beachtlicher Stärkung der Substanz. Als Beitrag der Stadt ist die Errichtung der Infrastruktur ausreichend. Die Kombination aus Grundstück im Eigentum der Benutzer und die Möglichkeit, an die städtische Infrastruktur angeschlossen zu sein, führen unweigerlich zu einer Hebung des Wohnstandards.
Mit »upgrading« Programmen konnten bei urbanen Slumgebieten, relativ zu den Kosten, große Erfolge erzielt werden. Dabei werden jedoch keine neuen Wohnungen geschaffen, es kann sogar zu Absiedelungen in Bereichen kommen, wo öffentliche Einrichtungen entstehen sollen. Diese Form ist darauf ausgerichtet, durch eine Aufbesserung des Gebiets das Gemeinschaftsgefühl seiner Bewohner zu stärken. Die öffentliche Subvention macht ihre Empfänger de facto zu Eigentümern, was ihnen eine zusätzliche Sicherheit und eine soziale Aufwertung bringt. Wichtig dabei ist, dass rasch ein Minimum an Einrichtungen hergestellt wird: Straßen und Fußwege, Oberflächenentwässerung, Kanal, Trinkwasser, Straßenbeleuchtung und Müllbeseitigung. Parallel dazu müssen Schulen errichtet und ein Gesundheitssystem aufgebaut werden. Der wichtigste Faktor ist, durch die kommunalen Hilfeleistungen eine Dynamik in Gang zu setzen, die in der Folge einen Rückzug der öffentlichen Hand aus dem Projekt ermöglicht, ohne seine Weiterführung zu gefährden.
Die billigste Art, auf geordnete Weise neue Wohnmöglichkeiten zu errichten, bietet ein »site + service« Programm. Dabei werden Parzellen mit Wasserversorgung und Kanal zu niedrigsten Kosten auf einer freien Fläche eingerichtet, die in guter Verbindung zu umliegenden Arbeitsplätzen liegen. Diese werden, um die Kosten möglichst niedrig zu halten, in Einheiten von ca. 100 m² aufgeteilt und zu den Errichtungskosten weitergegeben. Im Vergabepreis ist die Betreuung durch Berater inbegriffen. Diese haben organisatorische Fragen zu klären und Hilfe bei Baufragen zu leisten. Auf jeden Berater kommen ca. 50 bis 100 Einwohner. In den zentralen Einkaufsstätten kann auf Kredit Baumaterial bezogen werden, Bargeld wird nicht verliehen. Land- und Baukosten dürfen nicht höher als 20% der Einkommen sein, daher ziehen sich die Arbeiten überviele Jahre hin und müssen fortlaufend betreut werden.
Die Planung der einzelnen Parzellen ist relativ einfach, in manchen Fällen wird sogar ein Bebauungsvorschlag mitgeliefert. Wesentlich komplexer ist die Gesamtplanung: dabei muss vom absoluten Minimum ausgegangen werden, jede Möglichkeit einer späteren Erweiterung muss jedoch schon eingeplant werden. Im Gegensatz zu den spontan wachsenden Hütten und Häusern muss der Bebauungsplan weitsichtig für die nächsten Jahrzehnte verbindlich erstellt werden. Dieser Gegensatz führt natürlich immer wieder zu Schwierigkeiten bei der Verwirklichung der Planungen.
Viele Regierungen sind bei der Durchführung eines »site + service« Programms zurückhaltend. Man ist versucht, rasche und eindrucksvolle Projekte zu zeigen, wofür Parzellierungen von unbebautem Land aber nicht geeignet sind. Die staatliche Betreuung muss über 5 bis 15 Jahre gehen, in den ersten Jahren ist die neue Siedlung von einem Squatter noch kaum zu unterscheiden. Die Verantwortlichen sind daher von der langfristigen Wirksamkeit schwer zu überzeugen und befürchten, vor einer sichtbaren Verbesserung massiver Kritik ausgesetzt zu sein."
[Bier, Michael: Asien: Straße, Haus : eine typologische Sammlung asiatischer Wohnformen. -- Stuttgart [u.a.] : Krämer, ©1990. -- ISBN 3782840070. -- S. 24 - 27. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]

Abb.: Laguna Niguel, Orange County, Kalifornien, USA (©Corbis)
Konflikte zwischen dem Traum von der Privatheit des Eigenheims, der damit verbundenen Mobilität und dem Schutz der Umwelt zeigen folgende Ausführungen
"90% der Bevölkerung hätten am liebsten ein eigenes Häuschen mit Garten. Besonders beliebt sind freistehende Eigenheime im Grünen. Das ist in allen europäischen Ländern ähnlich.
Doch im Unterschied beispielsweise zu Irland oder Belgien, wo die meisten Familien im Einfamilienhaus wohnen, oder auch zu Spanien, wo man meist in den eigenen vier Wänden lebt, wohnen nur rund 40% der Bundesbürger im eigenen Heim -- und schon das bereitet massive Umweltprobleme.
| Irland | 81% |
| Spanien | 79% |
| Griechenland | 78% |
| Italien | 70% |
| Großbritannien | 67% |
| Belgien | 66% |
| Luxemburg | 66% |
| Portugal | 61% |
| Frankreich | 55% |
| Dänemark | 53% |
| Niederlande | 47% |
| Deutschland | 41% |
Das Einfamilienhaus auf der grünen Wiese, selbst wenn es ein Niedrigenergie-Öko-Haus mit Grasdach, Solaranlage und Regenwassernutzung ist, kann unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit nicht dem Ideal des ökologischen Bauens entsprechen. Zwischen 1950 und 1990 ist in Deutschland der individuelle Wohnflächenbedarf von etwa 15 auf 37 m² gestiegen. Diese Durchschnittszahl verschleiert sogar noch die Dramatik der Entwicklung, weil in den Kernstädten die Wohnflächen eher stagnierten, in den mittelständisch geprägten Neubaugebieten im Umland sich hingegen Wohnflächen um oder über 50 m² pro Person etablierten. Geht man nach der Zahl der Zimmer, die eine Person bewohnt, liegt Deutschland nicht einmal an der Spitze in Europa: Während in Belgien und Großbritannien pro Kopf zwei oder mehr Zimmer zur Verfügung stehen, liegen Portugal und Italien am Ende dieser Wohlstandsskala.
| Zahl der Zimmer pro Person | |
|---|---|
| Belgien | 2,0 |
| Großbritannien | 2,0 |
| Luxemburg | 1,9 |
| Deutschland | 1,8 |
| Niederlande | 1,8 |
| Frankreich | 1,4 |
| Italien | 1,4 |
| Portugal | 1,3 |
Zugleich ist der Trend zum Singlehaushalt unübersehbar. So ist die Zahl der Haushalte bei etwa stagnierender Gesamtbevölkerung zwischen 1965 und 1995 beispielsweise in Westdeutschland von 21,2 auf 30,1 Mio. angestiegen. Schließlich drängen in den 90er Jahren die geburtenstarken Jahrgänge auf den Wohnungs- und Wohneigentumsmarkt, oftmals zudem ausgestattet mit erheblichem Erbschaftsvermögen. Die Nachfrage nach Wohnraum ist aus diesen Gründen stark gestiegen.
| Haushalte mit | 1900 | 1995 |
|---|---|---|
| 1 Person | 7% | 35% |
| 2 Personen | 15% | 32% |
| 3 Personen | 17% | 6% |
| 4 Personen | 17% | 12% |
| 5 Personen und mehr mehr | 44% | 5% |
Zugleich drängt es diese Nachfrage vor allem in den Bereich der Einfamilienhäuser. Der Mietwohnungsbau, vor allem auch der öffentlich geförderte, ist seit den 80er Jahren aufgrund der Baupreisentwicklung fast völlig zum Erliegen gekommen, zumal auch staatliche Förderungen in diesem Bereich drastisch gekürzt wurden.
Ein- bis Zweifamilienhäuser sind jedoch die größten Landfresser: Für jeden Quadratmeter Wohnfläche werden hier 1,7 m² Boden versiegelt, rechnet man die Erschließungsstraßen, Autozufahrt, Garagen, Wege und Terrassen mit. Für die Flucht aus der Stadt ins grüne Umland zahlt die Natur: Insgesamt 2 Mio. ha Land sind in der Bundesrepublik mit Straßen und Gebäuden zugebaut, das ist die 37fache Fläche des Bodensees. Etwa 22 000 ha kommen jährlich dazu -- das entspricht etwa der Größe der Stadt Frankfurt am Main.

Abb.: USA (©Corbis)
Die großen Baugebiete der 90er Jahre werden dennoch fast ausschließlich als reine Wohngebiete mit einem sehr hohen Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern geplant. Dabei entstehen Siedlungen, in denen zumindest die meisten Hauseigentümer etwa gleichaltrig und in der gleichen Lebensphase sind. Diese Siedlungen werden regelrechte Zyklen durchlaufen: Nachdem zahlreiche Kinder und Jugendliche sie zunächst lebendig gemacht haben, wird nach deren Auszug eine sehr niedrige Belegungsdichte und fortschreitende Überalterung der Bewohner eintreten, bis sich der Prozess wiederholt. Dem Ziel einer kompakten, durchmischten Stadt mit unterstützenden Nachbarschaften entspricht diese Entwicklung nicht. Die Alternative ist aber auch nicht der Großsiedlungsbau der 60er Jahre; eher schon eine gute Mischung aus Reihen- und Mehrfamilienhäusern.
Verhängnisvolle Entmischung
Auch die beanspruchten Flächen für Handel und Gewerbe sind in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. So verdoppelte sich die Verkaufsfläche im westdeutschen Einzelhandel zwischen 1968 und 1985 von 0,52 m² pro Einwohner auf 1,07 m² -- eine Folge der zunehmenden Selbstbedienung. Die Büroflächen explodierten ebenfalls: Reichten 1975 noch durchschnittlich 20 m² Bürofläche pro Arbeitsplatz, wurden 1986 bei Neubauten bereits 34,5 m² veranschlagt. Auch sonstige Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Freizeitgestaltung oder Restaurants beanspruchen stark gewachsene Flächen pro Einwohner.
Dadurch verstärkt sich der jahrzehntelange Trend zur Entmischung der verschiedenen Arbeits- und Lebensbereiche immer noch weiter. Würde man versuchen, alle von den Bewohnern einer Nachbarschaft in Anspruch genommenen Einzelhandels- und Dienstleistungsflächen sowie nur einen Teil der Freizeit- und Erholungsflächen in die Wohngebiete zu integrieren, würden diese großflächigen Nutzungen alle Maßstäbe sprengen.
Eine funktionierende Mischung von Wohnen, Arbeiten, Konsumieren und sich Erholen setzt nun einmal voraus, dass die unterschiedlichen Nutzungen mit ähnlich großen Parzellen und in etwa vergleichbaren Bauformen zurechtkommen."
"Der Verkehrsinfarkt der Städte
Diese Entmischung wurde ermöglicht und vorangetrieben durch die Entwicklung der Verkehrsmittel. Aus der Stadt der Fußgänger und Pferdefuhrwerke wurde erst die Stadt der Straßen- und Eisenbahnen und schließlich die Stadt des Autos. Nicht nur die Städte selbst wurden durch den zunehmenden Autoverkehr geprägt, vor allem die Suburbanisierung des Umfelds mit dem Verlust an Identität in früher dörflich geprägten Regionen war die Folge.

Abb.: Der tägliche Dauerverkehrsinfarkt in Bangkok, Thailand: es ist nicht
ungewöhnlich, täglich drei bis sechs Stunden im Stau zu verbringen (©ArtToday)
Während sich, wie Untersuchungen zeigten, in den vergangenen hundert Jahren die absolute Zeit, die die Menschen täglich auf die Fortbewegung verwendeten, nicht sehr verändert hat, wuchsen die dabei zurückgelegten Entfernungen beständig. Mit dem Auto wurden tägliche Arbeitswege von 50 und mehr Kilometern von der Ausnahme zur Regel.
Ebenso stiegen die zurückgelegten Entfernungen fürs Shopping oder den Besuch von Freizeiteinrichtungen: Zwischen 1960 und 1990 verdreifachte sich die pro Jahr zurückgelegte Verkehrsstrecke pro Person, dabei verdoppelte sich der Weg zur Arbeit und zum Einkaufen, während für Freizeit und Urlaub mittlerweile gar die vierfache Entfernung zurückgelegt wird. Diese für Westdeutschland erhobenen Zahlen können als repräsentativ für ganz Europa gelten.
Zwischen 1976 und 1994, also schon zu Zeiten der Massenmobilisierung in Deutschland, stieg nach einer Untersuchung des Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin
der Anteil der Wege, die mit dem Auto zurückgelegt wurden, von 44 auf 52%. Bei gleichbleibender Wegezahl bedeutete das eine Verlängerung der zurückgelegten Wegstrecke um fast ein Drittel. Waren in Stuttgart 1970 noch rund die Hälfte der Pendler mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, waren es 1987 trotz gestiegenem Fahrgastaufkommen nur noch 36%, weil zugleich die Zahl der Berufspendler von 163000 auf 243000 in die Höhe schnellte.
Das Auto ist mittlerweile der größte Umweltverschmutzer. Es verbraucht in Deutschland etwa halb so viel Energie wie alle Haushalte und Kleinverbraucher zusammen und damit fast ebenso viel wie die gesamte Industrie.
Es ist trotz Katalysator wesentlich für die Entstehung von Luftschadstoffen verantwortlich, nach offiziellen deutschen Angaben beispielsweise für 59% der Stickoxide, 47% der flüchtigen organischen Verbindungen oder 70% des Kohlenmonoxids. Nach einer 1997 veröffentlichten Studie aus dem Großraum Karlsruhe sorgt hier der Verkehr sogar für zwei Drittel aller Luftschadstoffe.
Die Automobilisierung verursacht enormen Landschaftsverbrauch durch die Verkehrswege und kostet nicht zuletzt jährlich an die zehntausend Verkehrsopfer. Dennoch ist die Zunahme des PKW-Bestandes ungebremst. Allein in den sieben Jahren von 1985 bis 1992 stieg die Zahl der PKW in Westdeutschland um nahezu ein Viertel auf 32 Mio. und wächst seither weiter, es gilt mittlerweile als normal, dass in etwa auf zwei Einwohner, Kinder und Greise mitgerechnet, ein Auto kommt. Wenn diese Zahlen in Europa vorläufig noch die Spitze markieren, sagt das allenfalls etwas über die Wohlstandsverteilung aus, denn der Trend weist in allen Ländern in die gleiche Richtung.
Weil Stadtentwicklung und Mobilitätsentwicklung sich wechselseitig bedingen, wird deutlich, dass ohne eine wieder mehr auf Durchmischung der Funktionsbereiche orientierte Baupolitik auch dem Krebsübel des Autoverkehrs nicht wirksam beizukommen ist. Dies ist zwar vor allem eine Aufgabe für Politiker und Regionalplaner. Doch auch jeder einzelne Bauherr beeinflusst mit seiner individuellen Bauentscheidung die allgemeine Entwicklung: Geht es weiter mit Landschaftsverbrauch und wachsendem Autoverkehr oder verstärkt sich der Trend zu verantwortungsbewusstem Umgang mit Bauland und zu einer organischeren Entwicklung unserer Städte. Wer sich bewusst gegen das neue Häuschen im Grünen und beispielsweise für die zentral gelegene Altbauwohnung entscheidet, weil er so auf ein Auto verzichten kann, der zeigt Weitsicht."
[Schmitz-Günther, Thomas <1953 - >: Lebensräume : der große Ratgeber für ökologisches Bauen und Wohnen. -- 3., aktualisierte Aufl. -- Köln : Könemann, 2000. -- ISBN 389508042X. -- S: 12 - 17. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Zu Kapitel 11, Teil III: Wohnen und "Metaphysik"