Internationale Kommunikationskulturen


mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - >: Internationale Kommunikationskulturen. -- 11. Kulturelle Faktoren: Wohnung und Privatsphäre. -- 4. Teil IV: Beispiele. -- Fassung vom 2001-06-12. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur114.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2001-06-12
Überarbeitungen:
Anlass: Lehrveranstaltung, HBI Stuttgart, 2000/2001
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Länder und Kulturen von Tüpfli's Global Village Library
"In der Regel sind häusliche Welt, Familie und Haushalt hinter der Schanze des privaten Lebens geborgen. Diese Schanze scheint in der französischen Gesellschaft dichter zu sein als etwa in der angelsächsischen Gesellschaft. So ist die englische Praxis des »bed and breakfast«, in der sich die bereitwillige Öffnung der häuslichen Szene für Fremde bekundet, in Frankreich unbekannt. Im vorigen Jahrhundert brachte man in Frankreich Schüler, deren Eltern weit entfernt von der Schule wohnten, lieber in Internaten unter, als sie, wie in Deutschland, bei Lehrern oder Familien am Ort einzuquartieren. Was in der häuslichen Welt geschah, war reine Privatsache.
Der Transformation der Privatsphäre im 20. Jahrhundert kommt man auch auf die Spur, wenn man nach der materiellen Gestaltung des häuslichen Rahmens fragt: Die Geschichte des privaten Lebens ist zunächst einmal die Geschichte des Raumes, in dem es sich abspielt.
Die Eroberung des Raums
Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Eroberung des häuslichen Raums, der für die Herausbildung privaten Lebens unabdingbar ist. Bis zu Beginn der fünfziger Jahre unterschied sich der bürgerliche Haushalt deutlich von dem der unteren Volksschichten. Die bürgerliche Wohnung hatte reichlich Platz: Es gab Empfangsräume, eine Küche mit Nebengelass für die Bedienstete(n), ein eigenes Schlafzimmer für jedes Familienmitglied und oft noch weitere Zimmer; ein Foyer und mehrere Korridore verbanden diese separaten Räume miteinander. In krassem Gegensatz zu diesen geräumigen Appartements, diesen »bürgerlichen« Häusern, standen die Wohnverhältnisse der unteren Schichten: Arbeiter und Bauern hausten in Unterkünften, die knapp bemessen waren und ein oder zwei Räume aufwiesen. Viele »Häuser« auf dem Lande bestanden aus einem einzigen Raum, in dem gekocht und gegessen wurde und wo man auch schlief.
|
|
|
Um 1900 ermittelten medizinische Untersuchungen der hygienischen Verhältnisse auf dem Lande, etwa im Morbihan oder in der Yonne, dass in solchen Räumen bis zu vier Betten aufgestellt waren, in denen jeweils mindestens zwei Personen nächtigten. Der verbesserte Lebensstandard der Bauern bewies sich um die Jahrhundertwende und erst recht in der Zwischenkriegszeit in Anbau von ein oder zwei Schlafkammern. Neben der Anzahl der Zimmer war deren Größe ein Indikator für Armut oder Reichtum ihrer Bewohner -- es gab Tagelöhner, die zwei Kammern besaßen, und bäuerliche Familien, die in einem riesigen Gemeinschaftssaal lebten. In der Regel indes waren die Gebäude für die vielerlei Tätigkeiten, die sich in ihnen konzentrierten, zu klein, im Durchschnitt 25 Quadratmeter Nutzfläche wie in der Yonne."
"Es ist nicht übertrieben, die in den Wohnverhältnissen der meisten Franzosen [seit 1954] eingetretene Veränderung als Revolution zu bezeichnen. In der modernen Wohnung, bestehend aus mehreren, in der Regel getrennten Zimmern und ausgestattet mit dem modernen Fließwasser- und Heizungskomfort, kann jedes Familienmitglied seinen eigenen Raum behaupten. Die vermehrte Freizeit -- seit der Volksfront sind 40Stunden-Woche und bezahlter Urlaub die Regel -- erlaubt jedem, diesen Raum nach Belieben zu nutzen und zu genießen. Das Familienleben konzentriert sich auf bestimmte Zeiten -- die Mahlzeiten, den Sonntag -- und auf bestimmte Orte -- die Küche oder das, was man seit dem Zweiten Weltkrieg »living room« nennt. Das Dasein zerfällt in drei ungleiche Teile:
Die Diversifizierung und Erweiterung der Privatsphäre in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts machte nicht an den häuslichen Grenzen halt. Sie eroberte sich nicht nur den Raum der Familie, sondern auch die Mittel, ihm zu entfliehen. Das Auto trat seinen Siegeszug an: 1981 verfügten 88 Prozent aller Haushalte (84 Prozent bei den angelernten Arbeitern) über ein Auto, 27 Prozent (17 Prozent) über einen Zweitwagen. Der Gebrauch des Autos, aber auch die Entwicklung anderer Verkehrsmittel diversifizieren die der Arbeitszeit abgerungene freie Zeit auf unterschiedlichste Orte. So kommt die gesamte Bevölkerung in den Genuss von Orten und Zeiten des privaten Lebens, über die einst nur das Bürgertum gebot. Die in den Bergen geschlossene Ferienfreundschaft, die Romanze am Strand gehören zu den aufschlussreichen Neuerungen des 20. Jahrhunderts: In einer paradoxen Volte, die uns noch beschäftigen wird, entzieht sich das private Leben dem häuslichen Bereich und taucht in die Anonymität der Öffentlichkeit ein."

Abb.: Wohnen auf kleinstem Raum, Sowjetische Besatzungszone, 1946
[Bildquelle: Parteiauftrag: ein neues Deutschland : Bilder, Rituale und Symbole der frühen DDR / hrsg. von Dieter Vorsteher. -- München [u.a.] : Koehler & Amelang, ©1997. -- ISBN 3733802128. -- S. 109. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Der Einzelne und sein Raum
Vor dieser Revolution teilte man seine Privatsphäre notgedrungen mit allen Menschen, die denselben häuslichen Raum bewohnten. Die Mauer der Privatheit schirmte zwar den häuslichen Bereich gegen den öffentlichen ab, das heißt gegen Menschen, die für die Familiengruppe Fremde waren. Hinter dieser Mauer jedoch fehlte es -- außer im Bürgertum -- an Platz, jedem Mitglied der Gruppe seinen eigenen privaten Raum zuzugestehen: Privatheit war nichts anderes als gruppeninterne Öffentlichkeit.
Verhinderte Intimität
Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, welchen Druck die Familiengruppe
damals auf den Einzelnen ausübte. Es gab keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen.
Eltern und Kinder agierten in engster Gemeinschaft. Toilette machte man vor den
Augen der anderen, die sich abwenden mussten, wenn sie ihr Schamgefühl verletzt
sahen. Bevor die Bergwerksgesellschaften in den Bergarbeiterwohnungen Duschen
installierten, fand der heimkehrende Kumpel im Gemeinschaftsraum einen
Holzbottich und auf dem Herd heißes Wasser vor; hier wusch er sich mit Hilfe
seiner Frau. Auf dem Bauernhof verhielt es sich genauso: Man wusch sich im
Gemeinschaftsraum oder im Freien; man wusch sich übrigens selten und niemals
den ganzen Körper.
Man schlief auch nicht allein: Es schliefen stets mehrere Personen in demselben
Raum, manchmal sogar in demselben Bett. Michel Quoist notiert noch aus der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg das Staunen von armen Kindern, die in Ferienlager
verschickt worden waren und die Betten entdeckten: »Und dann noch für jeden
eins!« Quoist wunderte sich darüber nicht: »Bei ihnen zu Hause gab es oft
genug nur ein Bett pro Haushalt: Darin schlief man zu zweit, zu dritt, zu viert,
zu fünft und manchmal noch zu mehreren.« Auf dem Lande war die Situation nicht
anders: P. J. Hélias teilte das Bett mit seinem Großvater. 1947 untersuchten
zwei Ethnologen ein Dorf in Seine-Inférieure und machten dieselbe Feststellung;
mit der Entrüstung von Menschen aus einer anderen Kultur beschrieben sie ein
vierjähriges Kind, das mit seinen Eltern in einem Bett schlief.

Abb.: Schlaf-, Wohn und Arbeitsraum einer Korbbinderfamilie, Bayerischer Wald,
Deutschland, um 1920
[Bildquelle: Bettgeschichte(n) : zur Kulturgeschichte des Bettes und des Schlafens / hrsg. im Auftr. Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums - Volkskundliche Sammlungen von Nina Hennig und Heinrich Mehl. -- Heide i. Holstein : Boyens, ©1997. -- (Arbeit und Leben auf dem Lande ; Bd. 5). -- Ausstellungskatalog. -- ISBN 3-8042-0813-4. -- S. 92].
Unter solchen Umständen war es nicht einfach, persönliche Gegenstände zu besitzen; man musste sie in der Hosentasche oder einer Börse bei sich tragen. Es war schwierig, eine Ecke für sich zu reservieren. Es war unmöglich, vor den anderen irgend etwas zu verbergen -- die geringste Unpässlichkeit wurde sofort bemerkt, jeder Versuch, sich zurückzuziehen, erregte sogleich Aufmerksamkeit.
Für Intimität gab es keine Chance. Die Sexualität, ein Tabu in bürgerlichen Familien, wo sie auf das eheliche Schlafzimmer, das Boudoir oder auf den Alkoven als abgetrennten Teil eines gemeinsamen Raumes verwiesen war, konnte hier nicht geheimgehalten werden. Über die Menstruation der jungen Mädchen wussten alle Bescheid, ja, in Bergarbeiterfamilien wurde darüber auf demselben Wandkalender in der Küche Buch geführt, in den der Kumpel seine Schichtzeiten eintrug. Die sexuellen Handlungen fanden entweder in der Grenzzone des Alltags statt, im Halbschatten hinter dem Tanzsaal, am Ackerrand, oder sie mussten die Beobachtung durch die Familiengruppe in Kauf nehmen. »Es ist der Sittlichkeit kaum abträglich«, schreibt 1894 ein Fachmann für ländliche Behausungen, »dass alle oder fast alle Hausbewohner im selben Raume schlafen. Im Gegenteil resultiert hieraus eine Art gegenseitiger Kontrolle. [. . .] Nur die Schamhaftigkeit leidet, aber diese Peinlichkeit ist nicht so groß, wie Menschen, die seit jeher das Alleinschlafen gewohnt sind, vermuten sollten.« Und Léon Frapié berichtet von einem Ehepaar, das mit seinen Kindern in einem kleinen Zimmer wohnte; vor der Liebesumarmung wurden die Kinder ins Treppenhaus geschickt, wo sie, auf den Stufen sitzend, geduldig warteten, bis man sie wieder hereinrief. Dass Frapié dieses Paar als Muster der Zartheit und Schamhaftigkeit preist, lässt darauf schließen, dass die meisten Eltern in derartigen Augenblicken sich nicht vor den Kindern verbargen; der Historiker aber merkt an, dass die sexuelle Aufklärung von Kindern und Jugendlichen erst in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts zum Problem geworden ist . . .
So vermischte sich zu Beginn des Jahrhunderts aufgrund der Wohnverhältnisse das private Leben der allermeisten Franzosen mit dem privaten Leben ihrer Familie. In den unteren Volksschichten besaß der Einzelne nur wenig persönliches Eigentum, zumeist handelte es sich dabei um Geschenke: ein Messer, eine Pfeife, einen Rosenkranz, eine Taschenuhr, ein Schmuckstück, ein Toilettennecessaire oder Nähzeug. Diese schlichten Dinge hatten für den Einzelnen einen sehr hohen symbolischen Wert; sie waren die einzigen Gegenstände, die er für sich beanspruchen konnte. Dieselbe Bindung fand sich auf dem Land in der Beziehung der Bauern zu ihren Tieren: Jede Kuh, jeder Hund, jedes Pferd hatte einen Namen und einen Herrn."
[Prost, Antoine. -- In: Geschichte des privaten Lebens / Philippe Ariès (Hrsg.) ... -- Frankfurt a. M. : Fischer. -- . -- Originaltitel: Histoire de la vie privée (1987) . -- Bd. 5: Vom Ersten Weltkrieg zur Gegenwart. -- ©1993. -- ISBN 3100336356. -- S. 63 - 64, 76, 73 - 74. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Lebendiger ist die Sozialität der Reihenhaussiedlung, wobei es allerdings kräftige regionale und soziale Unterschiede zu beachten gilt. Gewöhnlich sieht man einen Gegensatz zwischen den Franzosen, die ihr Grundstück sorgfältig einfrieden, und den Amerikanern, welche die Gärten der Reihenhäuser ineinander übergehen lassen. Als Frankreich 1966 aus der NATO austrat und die von der amerikanischen Armee zurückgelassenen Reihenhäuser an Franzosen verkauft wurden, war die erste Handlung der neuen Besitzer, beispielsweise in Orléans, die Errichtung von Zäunen: An die Stelle der offenen Grünflächen, auf denen die amerikanischen Häuser gestanden hatten, trat ein urbaner Wildwuchs von Büschen und Sträuchern. Doch die individualistische Deutung dieses Sachverhalts greift zu kurz. Bei genauerer Prüfung bewies die Einzäunung eine sehr subtile Aneignung des Raumes. Der Bewohner des Einfamilienhauses markierte physisch die Grenze seines Eigentums. Der Zaun war die Affirmation des Privatbesitzes; aber er sah dort, wo er dem Nachbargehege zugewandt war, anders aus als dort, wo er auf einen öffentlichen Weg ging. Hinter dem Haus und an den Seiten des Grundstücks war der Zaun in der Regel höher als vorne, zur Straße hin. Das lag daran, dass die verschiedenen Bereiche des Einfamilienhauses unterschiedlichen Zwecken dienten.
Das Grundstück eines Einfamilienhauses gliedert sich in zwei Teile, sozusagen eine Südlage und eine Nordlage.
So wird eine Transitstation geschaffen, in der erneut zu Ehren gekommene Konventionen die gutnachbarschaftlichen Beziehungen regeln. Um die Stätten des privaten Lebens legen sich wieder Zonen des Austauschs. Ganz allgemein gehen die neueren architektonischen Tendenzen in diese Richtung. Der zeitgenössische Städtebau folgt nicht mehr den funktionalistischen Theorien, die noch vor zwanzig Jahren im Schwange waren, er hat eine ganz andere, kulturalistische Perspektive. Heutzutage bemüht man sich, einladende Wohnviertel zu errichten, in denen man auf kurzen, platzähnlichen Straßen flanieren kann. Der Unterschied zwischen heutigen Bauten oder Neubauten und kaum zehn Jahre alten Vierteln ist mitunter frappierend."
[Prost, Antoine. -- In: Geschichte des privaten Lebens / Philippe Ariès (Hrsg.) ... -- Frankfurt a. M. : Fischer. -- . -- Originaltitel: Histoire de la vie privée (1987) . -- Bd. 5: Vom Ersten Weltkrieg zur Gegenwart. -- ©1993. -- ISBN 3100336356. -- S. 123 - 125. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
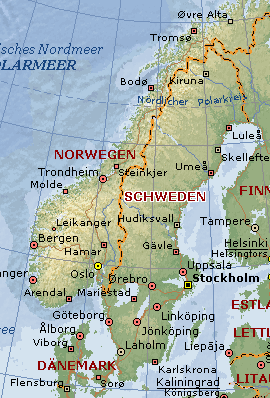
Abb.: Karte von Schweden (©MS Encarta)
"Sehr bezeichnend ist die Unterscheidung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen in Schweden. Das Lüften des Geheimnisses, die Ent-Privatisierung, die öffentliche Verwaltung des Privaten -- diese Grenzverschiebung, so spezifisch schwedisch sie erscheinen mag, bleibt gleichwohl beispielhaft. In der Tat haben die Franzosen gerade in diesem Land -- das sich selber paradoxerweise lange Zeit das »Frankreich des Nordens« genannt hat -- den Grundriss der idealen Gesellschaft gesucht. Doch die für die schwedische Gesellschaft kennzeichnende Ethik der absoluten Transparenz der sozialen Beziehungen und ihr Ideal der vollkommenen Kommunikation werden heute in Frankreich als Verletzung der Privatsphäre empfunden. Das Modell der Geheimnislosigkeit ist zu einer Maschinerie des Imperialismus geworden.
Das Modell der Geheimnislosigkeit
Dieses »Modell der Geheimnislosigkeit« tangiert in der Tat alle Bezirke des sozialen Lebens bis hin zu den »privatesten«. Stärker als vielleicht irgendwo sonst ist in Schweden Privates der Öffentlichkeit zugänglich Die sozialdemokratische Gemeinschaftsethik ist von der Zielvorstellung vollständiger Offenheit und Öffnung des gesellschaftlichen Verhaltens und des menschlichen Austauschs besessen.
Die Geheimnisse des Geldes entschleiert
In Schweden unterliegen, anders als in Frankreich, Gelddinge nicht der Vertraulichkeit. Materieller Erfolg genießt die Wertschätzung der Gesellschaft und wird, wie in den USA, rückhaltlos zur Schau gestellt. Steuererklärungen sind öffentlich; jedermann kann Einblick in den vorn Finanzministerium herausgegebenen taxing kalender nehmen, eine Art Jahrbuch, das Name, Adresse und Personenstand aller Steuerpflichtigen sowie ihr erklärtes Jahreseinkommen verzeichnet. Die Ermittlung von Steuerbetrügern ist geradezu institutionalisiert. Die Finanzverwaltung bekennt in der Presse, dass Denunziation zwar moralisch verwerflich sei, dem Finanzamt aber unschätzbare Dienste leiste: Selbst in der Ethik herrscht der Imperativ der Transparenz.
Öffentlichkeit amtlicher Dokumente
Ein weiterer Ausfluss dieses Imperativs ist das »Öffentlichkeitsprinzip«, der freie Zugang zu amtlichen Dokumenten. Es resultierte im wesentlichen aus dem Gesetz über die Freiheit der Presse (1766) und garantiert jedermann das Recht, in amtliche Dokumente, das heißt in alle Schriftstücke, die eine staatliche oder lokale Behörde empfängt, anfertigt oder weitergibt, Einsicht zu nehmen. Die einschlägigen Bestimmungen sehen die Möglichkeit vor, die Schriftstücke an Ort und Stelle zu konsultieren, zu kopieren oder von ihnen gegen Entrichtung einer Gebühr eine Abschrift herstellen zu lassen; mehr noch, jeder, dem eine Information verweigert wird, kann sogleich die Gerichte anrufen. In der Praxis wird dieses Recht von Bestimmungen des Gesetzes über die Geheimhaltung eingeschränkt; gewisse »sensible Bereiche« (nationale Sicherheit, Verteidigung, vertrauliche Wirtschaftsinformationen usw.) bleiben geschützt. Die Grundregel jedoch lautet: »im Zweifelsfall für das Öffentlichkeitsprinzip und gegen die Geheimhaltung«.
»Gläserne Akten«
Aufgrund der außergewöhnlichen Durchsichtigkeit seiner Bürokratie ist Schweden seit langem eine »Informationsgesellschaft«. Die Computerisierung hat diese Struktur verstärkt, indem sie enorme Informationsflüsse namentlich zwischen dem privaten Sektor und der Verwaltung ausgelöst hat. Es gibt wohl kaum ein anderes Land, in dem die Rechner mehrerer Versicherungsgesellschaften direkt mit denen zentraler Personenstandsbehörden vernetzt sind. Es kommt sogar vor, dass ein privater Autohändler über ein Terminal mit der Kfz-Zulassungsstelle verbunden ist oder dass eine staatliche Behörde die Dateien einer privaten Firma zu Erkundigungen über die Kreditfähigkeit eines Bürgers benutzt. Seit 1974 sind computergespeicherte Informationen den traditionellen Schriftstücken der öffentlichen Verwaltung gleichgestellt und unterliegen damit ebenfalls dem Öffentlichkeitsprinzip.
Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Namensverzeichnissen wird durch das 1946 geschaffene System der Personenkennzahl erleichtert. Jeder Bürger hat seine eigene Kennzahl, die von den Personenstandsbehörden schon vor der Einführung des Computers gebraucht worden ist. Sie geht in die meisten schwedischen Namensregister ein, gleichgültig, ob sie privater oder öffentlicher Art sind. Schweden war das erste europäische Land, das ein zentrales Amt für Statistik einrichtete (1756); es ist auch das erste Land, in dem es möglich ist, sämtliche auf einen bestimmten Menschen bezogenen Informationen mit Hilfe einer einzigen Zahl zentral zu bündeln und abzufragen."
"Facetten des Privaten
In dieser anscheinend gläsernen Gesellschaft gibt es indes ein paar blinde Stellen. Die schwedische Gesellschaft hat ihre Verbote -- es sind nicht viele, aber sie werden um so energischer durchgesetzt. Das betrifft zum Beispiel die Anwendung von Gewalt; sie wird einhellig verurteilt und ist dennoch allgegenwärtig. Ein weiteres Beispiel ist der Alkoholmissbrauch, ein Suchtfeld, auf dem der soziale Konsens am zerbrechlichsten und die soziale Kontrolle am umstrittensten ist."
"Das Imaginäre
Wo findet der Einzelne in dieser Gesellschaft, die die Gemeinschaft so nachdrücklich betont und die so sehr von der »Öffentlichkeit« kontrolliert wird, noch ein Refugium des Privaten? In seinem eigenen Haus, dem rustikalen Sommerhaus (»sommarstuga«) aus Holz, am Wasser gelegen oder im Wald versteckt. Das eigene Haus bleibt wie die eigene Insel der private Raum par excellence, abgeschlossen und persönlich. Wie schon Emmanuel Mounier in seinen »Notes scandinaves« bemerkt hat: »Die kollektivistischsten Völker -- Russen, Deutsche, Schweden -- sind zugleich die Völker, die einsam wohnen.« Der Traum jedes Schweden bleibt im Grunde ein individualistischer Traum, der sich in der Sehnsucht nach ursprünglicher Einsamkeit, der Sehnsucht nach der unermesslichen Weite der schwedischen Natur artikuliert. In seiner »stuga«, vielfach ohne fließendes Wasser und mit geringem Komfort ausgestattet, findet er seine ländlichen Wurzeln noch intakt und pflegt vertrauliche Zwiesprache mit den Dingen. Kein Schwede (oder fast keiner) wird in den schönen Sommermonaten -- Mai und Juni -- ins Ausland reisen, wenn mit einem Schlag, nach ihrem schier unendlichen Winterschlaf, die Natur in ihrem hellsten Licht erstrahlt und Schweden wieder das Land der 14000 Inseln und 96000 Seen wird. Das kleine, eigene Haus, auf dem Land oder im Wald verborgen, aber auch die Insel, der Archipel, das Segelboot (allein im Raum Stockholm liegen 70000 vertäut) bleiben so die letzten Zufluchtsorte des Individualismus in einer Gesellschaft, welche ganz und gar auf die Karte der Gemeinschaft setzt."

Abb.: Sommarstuga, Schweden (©ArtToday)
"Das »schwedische Modell« lässt sich auch als »totale« oder »totalisierende« Gesellschaft beschreiben. Es kreist um eine ganz auf den Konsens gestellte Gemeinschaftsethik, die wiederum auf der unbedingten Forderung nach Transparenz aller sozialen Beziehungen beruht (von dem Partner des jungen Mädchens bei den »nattfrieri« bis zum heutigen Recht des Kindes, seinen Vater zu kennen). Und das private Leben kann sich der herrschenden Ethik nicht entziehen. Der einzige Zwang, den die Gesellschaft zulässt, ist der Zwang zur Transparenz. Das Geheime und Verborgene erscheint als Bedrohung der Ordnung, als Gefährdung des Konsenses -- daher die unerbittliche Entschlossenheit, das Geheimnis zu lüften."
[Orfali, Kristina. -- In: Geschichte des privaten Lebens / Philippe Ariès (Hrsg.) ... -- Frankfurt a. M. : Fischer. -- . -- Originaltitel: Histoire de la vie privée (1987) . -- Bd. 5: Vom Ersten Weltkrieg zur Gegenwart. -- ©1993. -- ISBN 3100336356. -- S. 484f., 504, 507, 509f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
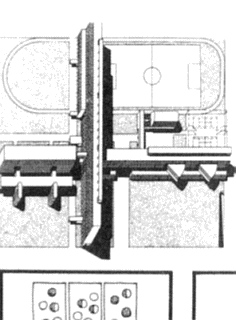
Abb.: Entwurf für ein Kommunehaus, von Michail Barstsch und Wjatscheslaw
Wladimirow, 1929. [Quelle: Vogt: Russische u. Französische
Revolutionsarchitektur, Köln (DuMont)]
"Kommunehaus. Bautyp der sowjetischen Architektur für die kollektive, sozialistische Lebensweise. Die ersten Kommunen entstanden nach der Enteignung des privaten Hausbesitzes in den großbürgerlichen Wohnhäusern der Städte durch die Wohnraumnutzung durch mehrere Familien. Auf dem 8. Parteitag der KP Russlands 1919 wurde zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frauen die Einrichtung von Kommunehäusern, Speisehäusern, Zentralwäschereien und Kinderkrippen propagiert, um die Lasten der Hauswirtschaft zu verringern. Gleichzeitig wurde damit die Forderung nach der Umgestaltung der Familie verbunden, die man als Keimzelle von Ausbeutung und Unterdrückung kritisierte (F. Engels, Der Ursprung der Familie, 1884). Seit 1920 bemühte man sich in Wettbewerben um die Klärung der Organisation und architektonischen Gestaltung der neuen Bauaufgabe. Um 1925 entstanden erste Neubauten von Wohnungs- und Baugenossenschaften mit gemeinschaftlichen Einrichtungen. 1926-30 entwickelten die konstruktivistischen Architekten verschiedene Experimentaltypen, die neben hotelähnlichen Kollektiveinrichtungen mit Kleinwohnungen auch Wohnformen für die Vergesellschaftung der gesamten Lebensweise vorsahen (zum Teil verwirklicht in Moskau, Swerdlowsk, Saratow, Kiew, Charkow). Die Anlagen bestanden meist aus Wohnhaus, Versorgungstrakt, Speisesaal und Kleinkindertrakt. Dazu traten Schule, Altersheim, Sport- und Grünanlagen sowie kulturelle Einrichtungen (Arbeiterklub, Bibliothek). Während in den sog. Übergangstypen noch Kleinwohnungen für Familien und Paare vorgesehen waren, sollten in den Kommunehäusern nach Geschlecht und Alter getrennte Schlaftrakte die Auflösung der traditionellen Familie und Ehebeziehung manifestieren. Finanzielle und technische Probleme sowie psychologische Widerstände führten nach 1930 zur Abkehr vom K. In den Mittelpunkt traten nun Fragen des typisierten Massenwohnungsbaus und der Wohnviertel mit Dienstleistungsbetrieben, um die intensive Einbindung der Frauen in den Produktionsprozess zu ermöglichen. Vorbilder für das K. sind die Projekte der Utopischen Sozialisten (Charles Fourier, Phalanstère, um 1825; Robert Owen, New Harmony, 1824), aber auch die amerikanischen Apartement-Häuser und die Einküchenhäuser. Die Diskussion um die Kommunehäuser wirkte auf die Wohnprojekte der funktionalistischen Moderne (Gropius, Stadt im Grünen, 1929/30; Le Corbusier, Unité d'habitation, 1945-52), auch die israelischen Kibbuzim sind von ihnen beeinflusst."
[Lexikon der Weltarchitektur / Nikolaus Pevsner ... -- 3., aktualisierte und erweiterte Aufl. -- München : Prestel, © 1992. -- Digitale Ausgabe: Berlin : Directmedia, 2000. -- 1 CD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 37). -- ISBN 3898531376. -- S. 2933. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie diese CD-ROM bei amazon.de bestellen}]
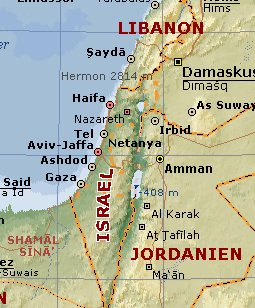
Abb.: Karte von Israel (©Corbis)
"»Der Kibbuz [Plural: Kibbuzim] ist ein Dorf, das auf sozialistischen Idealen basiert. Die Ideale sind inzwischen in der heißen Sonne des Südens zerflossen und den Realitäten
angepasst. Dennoch ist davon etwas übriggeblieben, das sich auch heute noch zu besichtigen lohnt.«
(M. Wagner »Gebrauchsanweisung für Israel«)
Der Staat [Israel], seine Ideologie, seine innerliche wie äußerliche Anziehungskraft, der Stolz seiner Begründer und deren Nachwuchses, all dies ist eng verbunden mit der Idee des Kollektivs. Der Kibbuz, die Verwirklichung des jüdischen Daseins im Land der Väter, ist längst zum untrennbaren Symbol des Staates geworden. Es ist die Erfolgsgeschichte einer auf dem sozialistischen Gedankengut fußenden Idee, die sich in der damaligen Atmosphäre des Aufbruchs und des notwendigen Aufbaues lückenlos einfügen ließ. Präsentiert wurde das Bild eines kreativen, selbständigen jüdischen Lebens, das sich nun als deutliches Gegenstück zu den gängigen, grassierenden Vorurteilen jüdischen Lebens in der Diaspora zeigte. Jüdische Arbeit, jüdisches Schaffen für den entstehenden jüdischen Staat wurden aufopferungsvoll geleistet.
Im Mittelpunkt stand die Gemeinsamkeit, die Solidaritätsgemeinschaft. Die Bereitschaft, zu geben, bezog sich nicht nur auf seine eigene Lebenssphäre, sondern auch auf den allgemeinen staatlichen Rahmen. Die Kibbuzbewegung war nicht nur ein integraler Bestandteil des Staates, sie war gleichzeitig auch eine Quelle seiner Selbstverwirklichung. Der Aufbau von Siedlungen, die Urbarmachung der Wüste, die Bekämpfung von Sumpfgebieten, der Aufbau einer effizienten Landwirtschaft, die Absorption von Neueinwanderern, die enge Einbindung in die Verteidigungsarmee, all dies und noch mehr wurde zur Säule des Kibbuz-Selbstverständnisses im jungen Israel. Es ging sogar soweit, dass man gelegentlich davon sprach, dass eine Streichung des Kibbuz aus der israelischen Landschaft mit der Eliminierung des Staates gleichzusetzen wäre.
Heute stehen wir vor einer völlig veränderten Situation. Quantitätsmäßig zählt die Kibbuzbewegung immer noch ca. 280 Siedlungen mit ca. 120.000 Mitgliedern. Über den wahren Zustand der Bewegung liefern diese Zahlen jedoch keine Auskunft. Eine der führenden Personen der Kibbuz-Bewegung und eine der Säulen der Arbeiterbewegung Israels, Itzchak Ben-Aharon, spricht heute unverblümt vom Tod des klassischen Kibbuz. In der Tat, die Pioniere des Landes, die ihre neuen Siedlungen mit viel Selbstaufopferung errichteten, hätten heute ihre Grundidee nicht mehr wiedererkannt. Private Institutionen, bezahlte Arbeitskräfte und der Verkauf von Gemeinschaftseigentum sind keine Seltenheit mehr. Die Wirtschaftlichkeit der Siedlungen ist zum Primat der Gemeinschaftsentscheidungen geworden. Die Auflösung von kollektivem Gemeinschaftsgut zugunsten einer verstärkten Selbstverwirklichung ist unübersehbar. Was bereits in ganz Israel voll im Gange ist, greift allmählich auch auf die letzten Bastionen des gemeinschaftlichen Denkens und Handelns über. Die Gesellschaft des »Wir« entwickelt sich immer mehr zu einer des »Ich«. Eine harte Bewährungsprobe für eine Gesellschaftsform, in der der Kollektivgedanke zur Basis eigenen Daseins zählte.
Natürlich, der Prozess der Kibbuzumwandlung ist nicht völlig neu. Der Kibbuz war schon immer ein fester Bestandteil der israelischen Gesellschaft. Ein Inseldasein konnte man nie bestreiten. Die Entwicklung des Staates Israel zu einem modernen Industriestaat mit einer westlich orientierten Lebensform ist an den Kibbuzim nicht spurlos vorbeigegangen. Eine gewisse Anpassung des Kibbuzes an die Entwicklung, die von einem verstärkt auftauchenden Individualismusdrang begleitet wurde, war auch vonnöten.
Hat der Kibbuz noch eine Zukunft? Zweifelsohne, der Kibbuz braucht neue, gesellschaftsadäquate Inhalte. Er braucht eine neue Vision. Er muss eine neue Gemeinsamkeit kreieren, die nicht erdrückend ist, sondern genügend Raum für die persönliche Erfahrung lässt. Eine gewisse Privatisierung lässt sich nicht mehr vermeiden und sollte auch nicht mehr mit allen zur Verfügung stehenden Energien bekämpft werden. Vonnöten ist die Akzeptanz der Privatisierungstendenz als unvermeidbares Phänomen, das nun eine größere Verantwortung des Einzelnen erfordert. Grundvoraussetzung für das weitere Bestehen ist der Wille und das Interesse für den Fortbestand des Kollektivs. Dies verlangt Standfestigkeit., den Glauben an die eigene gesellschaftliche Bestimmung und eine Standhaftigkeit in einer sich verändernden Gesellschaft, in der der Kollektivgedanke grundsätzlich an Attraktivität und Relevanz verloren hat.
Dr. Amnon Neu, Botschaftsrat an der Botschaft des Staates Israel, Bonn
»Der Kibbuz«, so schrieb Amos Oz [geb. 1939], israelischer Dichter und Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1992, »ist ohne Buch und Propheten entstanden.«
Wie alles begann
Jene Pioniere, die 1909 den Boden bei Um Dschundi am See Genezareth bearbeiteten, hatten anderes im Sinn als religiöse Ideologien und theoretische Kleinkrämerei. Ihr Ziel war die praktische Umsetzung einer Idee, orientiert an den Notwendigkeiten der täglichen Landarbeit und des Erhalts ihrer Gruppe.
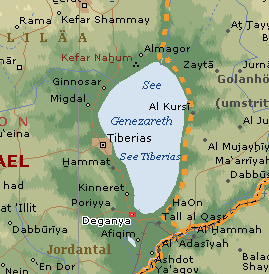
Abb.: Lage von Degania (©MS Encarta)
Sie nannten ihre Siedlung 1910 »Degania«, Kornblume. Erst später wurde aus der Kvutza (Hebräisch: »Gruppe«) der Kibbuz Degania und mit ihm das Wort Kibbuz zum weltweit bekannten Begriff für die israelischen Kollektivsiedlungen. Die Idee hinter ihrem Vorhaben war ein Traum: der Aufbau einer Gemeinschaft von freien, gleichberechtigten Menschen, in der das marxistische Ideal »Jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen« eingelöst wäre; deren Mitglieder ihren Lebensunterhalt durch praktische Arbeit verdienten und ihren Erlös in die Gruppe einbrachten; wo jedes Stück Inventar, bis hin zur Kleidung, Allgemeinbesitz wäre und die Kinder vom Kollektiv erzogen würden. Und dies alles sollte in Palästina stattfinden, denn dahin, so hatte Theodor Herzl 1896 in seinem Buch »Der Judenstaat« gefordert, sollten die in alle Welt verstreuten Juden zurückkehren und die »Wüste zum Blühen bringen«. Aber die Realität machte es den Kibbuzpionieren nicht leicht.
Wegen zunehmender Diskriminierung in ihrer Heimat waren schon vor Beginn des Jahrhunderts Juden im Rahmen der ersten großen Einwanderungswelle (Alijah) aus Osteuropa nach Palästina eingewandert. Ein Teil von ihnen hatte Arbeit auf jüdischen Farmen gefunden, die mit finanzieller Hilfe des Barons von Rothschild eingerichtet worden waren. Hier allerdings entwickelte sich eine Arbeitsstruktur, die dem Siedlungsideal der späteren Kibbuzgründer zutiefst widersprach: auf den Höfen wurden jüdische und arabische Lohnarbeiter beschäftigt, die in jeder Hinsicht abhängig von ihren Arbeitgebern waren. Den Kibbuzpionieren schwebte dagegen eine jüdische Gemeinschaft vor, deren Lebensgrund darin bestand, den Boden durch ihrer eigenen Hände Arbeit zu bewirtschaften -- ohne Ausbeutung anderer, ohne die Anstellung Lohnabhängiger. So hatte es der zionistische Philosoph Aharon David Gordon [1856 - 1922], [Leo] Tolstoi [1828 - 1910] im Hintergrund, proklamiert, indem er von der »Heiligkeit der Arbeit« und der untrennbaren Dreiheit von Mensch, Arbeit und Natur sprach.
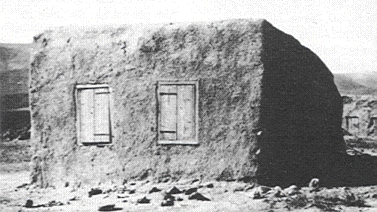
Abb.: Erste Hütte des späteren Kibbuz Degania, 1910
[Bildquelle: Naor, Mordecai <1934 - >: Eretz Israel : das 20. Jahrhundert. -- Köln : Könemann, ©1998. -- ISBN 3895085944. -- S. 52. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Der Weg zur Verwirklichung der Kibbuzidee war hart und forderte Opfer: Malaria und Hungersnöte, große Hitze und bewaffnete Auseinandersetzungen mit ihren arabischen Nachbarn trieben nicht nur einige Siedler in die Resignation; viele bezahlten das Experiment mit dem Leben. Aber auch der Alltag war alles andere als genussreich: die Kibbuzniks besaßen nicht viel, oft wohnten sie jahrelang in schäbigen Hütten und Zelten, bis sie genügend erwirtschaftet hatten und die ersten festen Häuser errichten konnten. Die wenigen lebensnotwendigen Dinge waren Allgemeinbesitz. lm Kleiderschrank gehörte die Kleidung allen, sogar die Unterwäsche war kollektives Eigentum. Das Leben verlief immer in der Gemeinschaft, so dass der Kibbuznik keine Zeit für sich selbst fand. Es war kein Platz im Kibbuz für den Ausdruck persönlichen Stils oder Geschmacks. Gleichzeitig lösten die Gründer aber ihre Vorstellungen vom Gruppenleben ein: die freie Liebe galt als angemessene Form der Beziehung, die Gemeinschaft wurde zum Ersatz für die Familie.
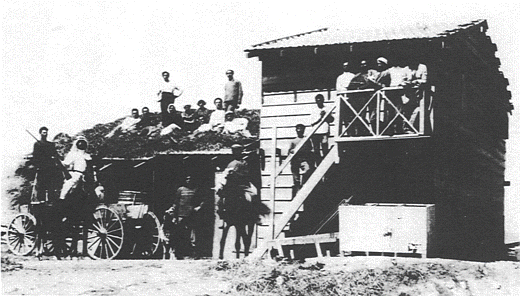
Abb.: Kibbuz Degania, 1912
[Bildquelle: Naor, Mordecai <1934 - >: Eretz Israel : das 20. Jahrhundert. -- Köln : Könemann, ©1998. -- ISBN 3895085944. -- S. 60. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Kibbuz-Degania, Modell und Vorläufer für die heute etwa 280 Kibbuzim, wuchs mit diesem Konzept so schnell, dass schon elf Jahre nach seiner Übernahme vom Jüdischen Nationalfonds (1909) Degania »B« entstand -- sein direkter Ableger. Diese »Zellteilung« erfolgte, weil die Mitglieder fürchteten, ein weiteres Wachstum könne die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen gefährden. Bis 1916 bildeten sich neben Degania vier weitere Kibbuzim."
"Heute leben nur noch ca. 2,7 % der israelischen Gesamtbevölkerung in rund 280 Kibbuzim, das sind etwa 129.000 Menschen. Die meisten zählen 300 bis 400 Mitglieder, zusammen mit Angehörigen, Kindern und Alten also fünfhundert bis sechshundert Bewohner (kleinster Kibbuz: 40 Mitglieder, größter: 1000 Mitglieder). Über die Hälfte der heute existierenden Kibbuzim entstand bereits
vor der Gründung des Staates Israel. Überraschend viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren selbst Kibbuzmitglieder oder sind es noch. Aus rein landwirtschaftlichen Siedlungen sind inzwischen längst nach marktwirtschaftlichen Kriterien arbeitende Erwerbsbetriebe mit Industrie und Hotelbetrieben (Kibbuz-Gästehäuser) geworden, um des Überlebens
willen bestrebt, mit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Israels Schritt zu halten. Die Kibbuzideologie hat sich im Laufe der Jahre also an die Mechanisierung der Landwirtschaft und das Aufkommen industrieller Fertigungsbetrieben anpassen müssen, die von den Mitgliedern mehr Sachkenntnis erfordert als die »körperliche Arbeit auf dem Feld«. Werten wie Wohlstand, Prestige, wirtschaftlicher Erfolg und Lebensstandard wird von den Kibbuzmitgliedern heute mehr Bedeutung beigemessen als noch während der Pionierzeit. Das blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Familiengemeinschaften innerhalb der Kibbuzim: die Kindererziehung rückte immer mehr in den Vordergrund, die Wohnung wurde aufwendiger und individueller eingerichtet, die Erziehung der Kinder war wieder Sache der Eltern (Mutter).
Auch äußerlich hat sich manches geändert, wie an Kleidung, Haartracht, Musikgeschmack
und Sexualverhalten -- vor allem der jungen Kibbuzmitglieder -- abzulesen ist. Mit dieser Liberalisierung einher ging die verstärkte Bereitschaft, offen Kritik an den Zuständen im Kibbuz zu äußern. Es ließe sich darüber streiten, ob sich die Kibbuzim selbst aktiv geändert haben, um unter gewandelten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen noch attraktiv zu sein, oder ob der »frische Wind« von außen an die herangetragen wurde: via Kabelfernsehen und Video, ausländische Freiwillige, das regional organisierte Oberschulsystem oder die Jugendbewegungen in den Städten. Die Bereitschaft, dem Kibbuz -- besonders nach Ableisten des Militärdienstes -- für immer den Rücken zu kehren, hat jedenfalls sprunghaft zugenommen. All das legt den
Schluss nahe, dass sich die Kibbuzim heute in einer -- je nach gesellschaftspolitischer Optik heilsamen oder schädlichen -- Umbruchphase befinden."
[Becker, Claus Stefan: Kibbuz, Moschaw und Freiwilligendienste - Israel. -- 2., überarbeitete Aufl. -- Freiburg : Iinterconnections, 1997. -- ISBN 386040010X. -- S. 13 - 17, 23f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Webportale:

Abb.: "Die Mieter des Hauses Plonstraße 2 reagieren auf den Aufruf des ZK
der SED zum Neuaufbau Berlins mit einer kollektiven Verpflichtung", Berlin
(Ost), Dezember 1951
[Bildquelle: Parteiauftrag: ein neues Deutschland : Bilder, Rituale und Symbole der frühen DDR / hrsg. von Dieter Vorsteher. -- München [u.a.] : Koehler & Amelang, ©1997. -- ISBN 3733802128. -- S. 212. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Hausgemeinschaften: Gelten als wichtige Form des Gemeinschaftslebens der Bürger im Wohngebiet. Mit ihrer Hilfe soll auch im Freizeitbereich jener Prozess der Herausbildung sozialistischer Denk- und Verhaltensweisen gefördert werden, den die Partei sonst vor allem im Arbeitsleben ständig zu initiieren sucht. Seit Mai 1953 erfolgte die Bildung von Hausgemeinschaften als Stützpunkte der Nationalen Front der DDR für die politisch-ideologische Arbeit mit den Bürgern. Sie sind ... die untersten Gremien der Nationalen Front, in denen staatliche und gesellschaftliche Aktivitäten unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) zusammenfließen. Ihre Bildung erfolgt auf dem Wege einer Entscheidung der Hausversammlung mit Unterstützung des Wohngebietsausschusses der Nationalen Front. Sie wählen eine Hausgemeinschafts-Leitung und beschließen in der Regel ein Arbeitsprogramm.
Ihre allgemeine Funktion besteht in der Gestaltung »sozialistischer« Beziehungen zwischen den Hausbewohnern, im gemeinsamen Lösen von Aufgaben im Hause, in der Vertretung der Interessen der Hausgemeinschaft gegenüber staatlichen Organen und Institutionen.
Zu den Aufgaben einer Hausgemeinschaft gehören im einzelnen: das regelmäßige persönliche politische Gespräch mit allen Hausbewohnern; die Anregung von Initiativen
der Bürger zur Erhaltung der Bausubstanz, zur Verbesserung der Wohnverhältnisse und zur Verschönerung der Grundstücke im Rahmen des Wettbewerbs »Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!«; die Beteiligung an Aufbaueinsätzen (Nationales Aufbauwerk [NAW]) im Wohngebiet und in der Gemeinde; die Entwicklung der staatsbürgerlichen Aktivität aller Hausbewohner, insbesondere bei der Plandiskussion, der freiwilligen ehrenamtlichen Arbeit, der gesellschaftlichen Kontrolle z.B. durch die Überwachung der ordnungsgemäßen Führung des
Hausbuches; die Durchführung von Solidaritätsaktionen; die gemeinschaftliche Gestaltung des geistig-kulturellen und sportlichen Lebens; die Organisierung der Nachbarschaftshilfe bis hin zur Einzelfallhilfe in persönlichen Schwierigkeiten, z.B. bei wirtschaftlichen Problemen oder im Zusammenhang mit der Resozialisierung Straffälliger; die Betreuung älterer Bürger; die gegenseitige Unterstützung bei Qualifizierung und Bildung; die Überwindung kleinerer Differenzen im Zusammenleben der Hausbewohner und die Durchsetzung der Hausordnung; die »Erschließung materieller Reserven« (Altstoffe, Abfälle); die rationelle Verwendung der Energie; enge Zusammenarbeit über die Ausschüsse der Nationalen Front mit der kommunalen Wohnungsverwaltung, dem VEB
Gebäudewirtschaft bzw. den Leitungen der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften (AWG) oder der Genossenschaftlichen Wohnungsbaugesellschaften.
Da in vielen Fällen die Hausgemeinschafts-Leitung nicht genügend aktiv ist, lastet die meiste Arbeit auf ihrem Vorsitzenden, dem Hausvertrauensmann (pl.: Hausvertrauensleute). Der Hausvertrauensmann ist als der politische Funktionär der Nationalen Front im jeweiligen Wohnhaus zu betrachten.

Abb.: Eine Potsdamer Hausgemeinschaft geht zur Wahl, DDR, 1961
[Bildquelle: Parteiauftrag: ein neues Deutschland : Bilder, Rituale und Symbole der frühen DDR / hrsg. von Dieter Vorsteher. -- München [u.a.] : Koehler & Amelang, ©1997. -- ISBN 3733802128. -- S. 69. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Da es keine andere Form gibt, über die die Bürger derart umfassend zum gemeinsamen Handeln mobilisiert werden können, wird der Bildung von Hausgemeinschaften wachsende Bedeutung beigemessen. Sie existieren jedoch noch keineswegs überall, und besonders in kleineren Gemeinden sowie in privaten Häusern begegnet ihre Einrichtung immer wieder Schwierigkeiten.
Um die Arbeit von Hausgemeinschaften zu stimulieren, organisieren Ausschüsse der Nationalen Front Wettbewerbe um den Titel »Vorbildliche Hausgemeinschaft«. Seit einigen Jahren empfiehlt man den Hausgemeinschaften, Chroniken anzufertigen (Hauschroniken), die als Nachweis über die Entwicklung einer Hausgemeinschaft dienen und zugleich eine gemeinschaftsbildende Funktion ausüben sollen."
[DDR-Handbuch / Bundesministerium des Innern. -- 1985. -- In: Enzyklopädie der DDR -- Berlin : Directmedia, 2000. -- 1 CD-ROM. -- (Digitale Bibliothek Band 32). -- ISBN 3932544447. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}. -- S. 3123ff.]
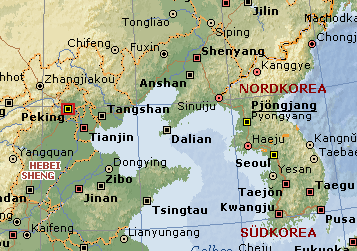
Abb.: Lage von Beijing (©MS Encarta)
"Student
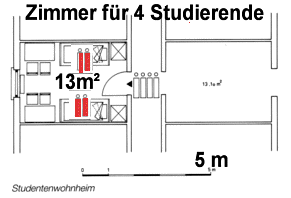
Xiong, 24, studiert an der Filmhochschule Beijing Schauspiel. Seine Unterkunft entspricht dem Standard, der für Studenten vorgesehen ist. Auf 13 m² leben vier Studenten unterschiedlicher Fachrichtung und Alters. Jeder Student hat ein Bett, einen halben Schreibtisch und die Hälfte eines 30 cm breiten Kastens zugeteilt. Waschschüssel, Nahrungsmittel und Lernmaterial werden in Koffern und unter dem Bett aufbewahrt. Gelernt wird abwechselnd an den kleinen Tischen, oft jedoch auch auf der Straße unter Laternen. An stärker besuchten Hochschulen werden Kasten und Tisch durch zwei zusätzliche Stockbetten ersetzt und ein Zimmer mit acht Studenten belegt. Dann können alle Tätigkeiten nur mehr sitzend auf dem Bett verrichtet werden.
Dreiköpfige Familie
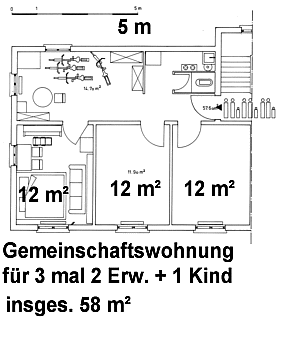
Zhang, 30, ist Dozent, seine Frau Bibliothekarin an der Universität. Sie haben ein einjähriges Kind. Ihre Wohnung (Zimmer) wurde ihnen von der Schule zugewiesen. Dadurch, dass sie als Familie ein eigenes Zimmer haben, fühlen sie sich privilegiert und sind mit ihrer Situation sehr zufrieden. Sie haben ein 12 m²-Zimmer zu ihrer alleinigen Verfügung. Dieses ist mit allen Einrichtungsgegenständen, die in einer westlichen Wohnung zu finden sind, eingerichtet: Tisch, Klavier, Doppelbett, Couch, Tisch. Gearbeitet wird am Schreibtisch, tagsüber liegt das Kind im Kinderwagen, nachts schläft es auf dem Sofa. Kommt Besuch, bleibt es auch in der Nacht im Wagen. Beheizt wird die Wohnung zentral, es gibt noch einen gemeinsamen Vorraum und eine Küche. Der Vorraum wird als Lager und Abstellplatz verwendet, jede der drei Familien hat dort einen Kasten stehen. Die Fahrräder werden ebenfalls hier eingestellt. Die Küche, obwohl an einer Außenwand, ist fensterlos und dient gleichzeitig als Badezimmer.
Kaderfamilie
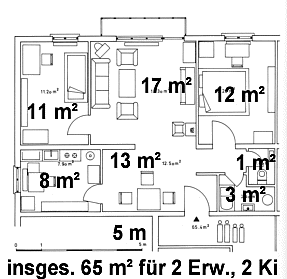
Huang ist Firmendirektor und hat eine vierköpfige Familie. Durch seinen Beruf ist er häufig auf Reisen, seine Frau befindet sich auf einem Postgraduate Studium in den USA. Die Tochter ist verheiratet und lebt in der Wohnung ihres Mannes. Einziger ständiger Bewohner dieser Wohnung ist der Sohn, der noch studiert. Es ist eine 3 1/2-Zimmer-Wohnung in einem Vorort Beijings. Für chinesische Verhältnisse ist sie bereits so riesig, dass tagsüber eine Haushälterin angestellt werden muss. Allerdings vermittelt eine Haushälterin auch den Eindruck der Wohlhabenheit, ist also mehr aus Repräsentationsgründen denn als Hilfe beschäftigt. Der Aufbau der Wohnung folgt westlichen Vorbildern: Bad und WC sind räumlich getrennt, obwohl kaum zu begehen. In der Küche gibt es einen Propangasanschluss und einen Kohleofen, ein Waschbecken und einen Eiskasten. Das Wohnzimmer hat einen Balkon vorgelagert und ist nach den gängigen Vorstellungsbildern mit Sitzgarnitur, Klavier und Video ausgerüstet. Außerdem hat die Wohnung einen der 3000 privaten Telefonanschlüsse Beijings."
[Bier, Michael: Asien: Straße, Haus : eine typologische Sammlung asiatischer Wohnformen. -- Stuttgart [u.a.] : Krämer, ©1990. -- ISBN 3782840070. -- S. 34. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Die Wohnung -- ihr Besitz, ihre innere Gliederung, die Rollen und Rechte, die sie abgrenzt -- ist das Symbol schlechthin für privates Leben im 20. Jahrhundert; sie ist der Schauplatz oft zorniger Interaktionen und Reibereien zwischen den beteiligten Akteuren. Konflikte entstanden, als in den dreißiger Jahren städtische Zentren modernisiert wurden, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und noch einmal in den siebziger Jahren. Es gab Auseinandersetzungen zwischen Familien, öffentlichen Einrichtungen und lokalen und staatlichen Behörden darüber, wie wertvoller Wohnraum geschützt und zugänglich gemacht werden sollte. außerdem sorgten sich die einzelnen Familienmitglieder um die familiären Ersparnisse und Investitionsstrategien sowie um die Aufteilung des Raums (wer würde ein Zimmer für sich bekommen?).
Technischer Fortschritt und häusliches Leben
Bis gegen Ende der fünfziger Jahre bestanden in der Art des Wohnens deutliche Unterschiede nicht nur zwischen Stadt und Land, sondern auch zwischen den sozialen Schichten. Wohnungen und Häuser des städtischen Bürgertums enthielten außer den Zimmern für die Eltern und die Kinder eine Küche, ein Nähzimmer, ein Wohnzimmer, das Arbeitszimmer des Ehemannes und Vaters und manchmal ein Dienstbotenzimmer. Bei derart geräumigen Verhältnissen gab es genügend Platz für das Familienleben, und jedes einzelne Familienmitglied hatte noch zusätzlich Raum für seine privaten Neigungen. In den meisten Arbeiter- und Bauernwohnungen gab es viel weniger Platz, und der Raum, der vorhanden war, musste verschiedenen Zwecken dienen.
Nach dem Zensus von 1931 zu schließen, lag der Median der Zimmer pro Wohnung bei 3,25 (unter »Zimmer« wurde jeder von Wänden umschlossene Raum mit Fenster verstanden); der Median der Personen pro Wohnung betrug 4,4. Die Belegungsdichte war umgekehrt proportional zur Anzahl der Zimmer pro Wohnung. Derselbe Zensus ermittelte, dass es in 66,9 Prozent der Wohngebäude (nicht unbedingt in jeder einzelnen Wohnung) Trinkwasser und in 78,2 Prozent eine Toilette gab. Nur bei 12,2 Prozent der Familien hatte die Wohnung ein Badezimmer. Die Befragung einer repräsentativen Stichprobe von Arbeitern und Angestellten durch das Statistische Büro der Firma Fiat ergab 1941, dass nicht eine einzige Familie ein Badezimmer besaß.
Die Daten aus dem Zensus von 1951 sahen nicht viel anders aus, was zum Teil von den kriegsbedingten Zerstörungen zumal in den Großstädten herrührte. In den ländlichen Gebieten fehlten fließendes Wasser und Toiletten, was insbesondere für die Frauen sehr beschwerlich war, die mehrmals täglich Wassereimer schleppen mussten. In Süditalien taten viele Frauen das noch in den fünfziger und sechziger Jahren.
Für Familien, die in den »Geländer«-Häusern der Großstädte lebten, erschwerte das Fehlen derartiger Einrichtungen die elementarsten häuslichen Arbeiten. Wasser musste ins Haus getragen, erwärmt, in Zuber gegossen werden usw. (aus diesem Grund gaben Familien mit bescheidenem Einkommen ihre Wäsche außer Haus, sobald sie es sich irgend leisten konnten.) Ein gewisses Maß an erzwungener Intimität mit den Nachbarn war unvermeidlich; da man wichtige Einrichtungen mit ihnen teilen musste, waren sie ständig Zeuge und Kolporteur der privaten, ja intimen Handlungen einer Familie oder eines Einzelnen. Das ständige Kommen und Gehen von einem Zimmer ins andere über den gemeinsamen Balkon (in Wohnhäusern mit inneren Umlaufbalkonen waren die Zimmer selten durch Türen miteinander verbunden, sondern gingen alle auf den Balkon hinaus), der Gang zur Toilette, das Wasserholen, das Aufhängen der Wäsche zum Trocknen usw. bildeten Anlässe zu Zwistigkeiten oder zu gegenseitiger Kontrolle. Mitunter wurde so aber auch die Solidarität gefestigt. Einige der von Guidetti Serra befragten Frauen erinnern sich, wie ein ganzes Mietshaus Menschen schützte, die von der faschistischen Miliz gejagt wurden. Doch war es schwierig, unter solchen Bedingungen eine Privatsphäre zu schaffen -- nicht nur physisch, sondern auch in der Beziehung zueinander. jeder Familienstreit wurde sofort öffentlich und konnte wohl nicht einmal auf jene Distanziertheit rechnen, die heute weithin das gegenseitige Verhalten von Hausnachbarn prägt, deren Familienangelegenheiten der Hellhörigkeit der Wohnungen wegen prompt neugierigen Ohren zugänglich werden.
Beengung herrschte nicht zuletzt innerhalb der Familie. Mehrere Kinder desselben Geschlechts oder auch Kinder und Erwachsene teilten sich ein Zimmer oder sogar ein Bett. Waschen und Ankleiden fanden in gemeinschaftlichen Räumen statt, minimale Privatheit zu
bewahren erforderte sorgfältige Planung und Verhandlungen über Zeiteinteilungen. In Familien der Unterschicht schliefen die Kleinkinder im Zimmer der Eltern oder gar in ihrem Bett. Viele der von Barbagli befragten Frauen hatten bis zu ihrer Heirat im elterlichen Schlafzimmer geschlafen; lediglich ein Wandschirm markierte eine unscharfe Grenze.
In großen bäuerlichen Familien, in denen die Familie eines Sohnes oder mehrerer Söhne mit der der Eltern zusammenlebte, berührte das Problem der Raumzuteilung unmittelbar das Maß an Privatheit oder Individualisierung, das dem Ehepaar zugestanden wurde. Das Ehepaar bekam in dem gemeinsamen Haus zwar ein Zimmer für sich, notfalls auf Kosten des Platzes für unverheiratete Brüder oder Schwestern; aber dieses Zimmer bezeichnete die ganze Privatsphäre, die dem Paar erlaubt war und die nur auf eine genau festgelegte Weise und zu ganz
bestimmten Zeiten genutzt werden durfte. In solchen Gemeinschaftswohnungen hatten das Paar und seine Kinder keinen Raum, um ein eigenes häusliches Leben führen zu können; alle Tätigkeiten
mussten der Ordnung und Arbeitsteilung der Familienhierarchie nicht nur angepasst, sondern untergeordnet
werden.
Von den Essenszeiten über den Speiseplan bis zu der Frage, welcher Stoff für ein Kleid oder gar welches Geschenk gekauft werden sollte,
mussten die täglichen Belange in der Familiengemeinschaft entschieden und deren Autorität unterworfen werden. Da die bäuerliche Familie eine Arbeitseinheit
war, lebte man sein Leben nicht vor allem in der Paarbeziehung, sondern in Geschlechts- und Altersgruppen. Das galt selbst für Tätigkeiten wie Essen,
Vergnügungen usw., die in anderen Familien bereits jene Intimität symbolisierten, die in den fünfziger und sechziger Jahren die Regel wurde (so
dass sogar Protest gegen neue Errungenschaften wie Schulcafeterias,
Mittagspause, Fünftagewoche usw. laut wurde, die man als Bedrohung häuslicher Rituale empfand). All dies bestimmte nachhaltig die Konzeption oder jedenfalls die Erfahrung von Privatheit.
War privates Leben auf eine paradoxe Weise eher außerhalb der Familie möglich, in den Räumen der Gesellschaft draußen? Hatten nicht die Männer ihre Osteria und das Bocciaspiel, die jungen Leute den Tanz oder Spaziergang am Samstagabend, die Frauen die Kirche, die Wallfahrt und das
Waschhaus. Diese Plätze waren zweifellos öffentlich, der Kontrolle der Familie und der Nachbarn entzogen.
Man darf vermuten, dass das Maß an Privatheit, das Männer und Frauen, Erwachsene und Jugendliche genossen, umgekehrt proportional zu der Zeit
war, die sie in der häuslichen Sphäre verbrachten.
Der soziale Wohnungsbau, der in Italien in den dreißiger Jahren begonnen hatte, spiegelte die Aufteilung von Räumen und Einrichtungen auf das Private und das Gemeinschaftliche. In Sozialwohnungen gab es meist weder Toiletten noch Badezimmer, oft nicht einmal fließendes Wasser. Im bürgerlichen Heim sah es anders aus. Raum stand in der Regel ausreichend zur Verfügung, obwohl es bei einer großen Zahl von Kindern manchmal schwierig sein mochte, jedem das »eigene Zimmer« zu gewähren, das traditionsgemäß zumindest dem ältesten Kind zustand. Jede Tätigkeit hatte ihren eigenen Ort in der bürgerlichen Wohnung, die räumlich die vielfältige Gliederung des privaten Lebens abbildete, nach außen (geschlossene Türen, private Badezimmer) ebenso wie nach innen. Das elterliche Schlafzimmer war für die Kinder tabu, wenn die Tür geschlossen war; die männlichen Familienmitglieder waren von den weiblichen getrennt, die Erwachsenen von den Kleinen, die Küche vom Esszimmer, das Esszimmer vom Wohnzimmer. Die Dienstboten und bisweilen auch die kleinen Kinder aßen getrennt von der Familie; Gäste durften weder die Küche noch das Schlafzimmer betreten, sondern nur das Wohnzimmer oder das Esszimmer, also »neutrale« Zonen.
Familien der unteren Mittelschicht näherten sich diesem Muster an; sie richteten ein kleines Arbeitszimmer für den Ehemann her, auch wenn er es nur gelegentlich benutzte, und leisteten sich ein Wohnzimmer, das freilich oft verschlossen blieb und dessen Möbel man durch Tücher vor dem Verstauben schützte. Die Familie lebte und aß im »tinello«, einem für Wohnungen der unteren Mittelschicht typischen, kurzen Raum, der den Ort der Nahrungszubereitung von dem Ort der Nahrungsaufnahme schied. Hier war das eigentliche »Familienzimmer«, wo man Radio hörte (und später fernsah) und Zeitung las. Hier machten die Kinder ihre Schularbeiten, und die Mutter nähte. Mitunter stand hier auch ein zum Bett aufklappbares Sofa für einen Sohn, der zu alt war, um bei seinen Brüdern zu nächtigen.
Das alles begann sich Ende der fünfziger Jahre rasch zu ändern. Mit der Verbreitung der Elektrifizierung sowie den verbesserten Technologien der häuslichen Infrastruktur (Kanalisation, Heizung) und der Haushaltsgeräte wandelten sich die Wohnstandards, und zwar just zu dem Zeitpunkt, da die Familien kleiner wurden. Seit 1961 zeigen Zensus und Erhebungen, dass fließendes Wasser, Toilette und Bad zur normalen Ausstattung der italienischen Wohnung gehören. Ende der sechziger Jahre -- also viel später als in den USA oder in nordeuropäischen Ländern, aber etwa zur gleichen Zeit wie in Frankreich -- waren Waschmaschine, Kühlschrank, Radioapparat, Fernsehgerät und Auto »Massenbesitztümer« und prägten die Gewohnheiten der Menschen und die Formen der Hausarbeit. Typologische Unterschiede zwischen dem städtischen und dem ländlichen Haus schwanden allmählich, häufig zum Vorteil des letzteren, da auf dem Lande mehr Platz zum Bauen verfügbar war.
Dieser Prozess ging einher mit einer gründlichen Transformation des Konsumniveaus und der Konsumformen. Während in den dreißiger Jahren der Lebensstandard der Familien im Vergleich zu den vorangegangenen Jahrzehnten gesunken war und noch in den fünfziger Jahren die Ausgaben für Lebensmittel bei 50 Prozent des Medians des Familieneinkommens lagen, fiel dieser Prozentsatz in den sechziger Jahren auf 39 und hatte sich Anfang der achtziger Jahre bei etwa 30 Prozent eingependelt. Das bedeutet, dass die Familie bei besserer Ernährung einen größeren Teil ihres Einkommens für andere Konsumgüter auszugeben und eine Vielfalt von Bedürfnissen zu befriedigen in der Lage ist. Gewiss bestehen zwischen den sozialen Schichten und den geographischen Regionen weiterhin enorme Unterschiede, was die Mittel und Möglichkeiten betrifft, Wohneigentum zu bilden und den häuslichen Lebensstandard, der heute als angemessen gilt, zu pflegen. Eine jüngere Studie über die Armut in Italien verweist auf das Ungleichgewicht zwischen den mittleren und nördlichen Gebieten Italiens einerseits und dem Süden andererseits; hinzu kommt noch die beträchtliche Verarmungsgefahr bei kinderreichen Familien (Familien mit drei oder mehr Kindern) und bei Alten. Technische Fortschritte auf dem Wohnungsmarkt scheinen nicht überall stattgefunden oder sich gleichmäßig ausgebreitet zu haben. Das hat zu sozialen und auch politischen Verzerrungen geführt, die um so eklatanter sind, als sie sich von dem Standard des Angemessenen weit entfernen. Bis zum heutigen Tag gibt es in weiten Teilen Süditaliens in den Häusern kein Trinkwasser, man gewinnt es aus Brunnen (die in regelmäßigen Abständen aufgefüllt werden müssen). Selbst in einigen süditalienischen Großstädten wie Neapel, Messina oder Palermo wird Wasser gelegentlich knapp, was Folgen für die Organisation der Hausarbeit und die körperliche Hygiene hat. Man kann ein Bad nicht dann nehmen, wenn der Reinlichkeitswunsch danach verlangt; man muss es dann nehmen, wenn Wasser verfügbar ist. In manchen apulischen Kleinstädten haben die Frauen es sich angewöhnt, nachts um zwei Uhr, wenn das Wasser kommt, aufzustehen, die Wasserbehälter im Haus zu füllen und die Waschmaschine einzuschalten."
"Aus diesen Veränderungen tritt uns ein Bild des Familienlebens entgegen, das heute »kanonische« Rhythmen und Räume hat. Geschlafen wird in eigens dafür eingerichteten separierten Zimmern; die persönliche Hygiene erlangt einen besonderen Ort, an dem man nicht nur funktionalen und Reinlichkeits-Bedürfnissen, sondern auch Ansprüchen der Ästhetik und des Komforts genügen kann (sobald man es sich leisten kann, dringt man auf zwei Badezimmer); das Kochen ist eine komplexe Tätigkeit, die vielerlei Gerätschaften und viel Platz erheischt (man denke an die Diskussion um die »funktionale Küche«, die in den dreißiger Jahren in Deutschland und den USA geführt wurde); immer mehr Platz okkupieren auch die Konsumgüter (Haushaltsgeräte, Kleidung, Spielzeuge der Kinder) sowie die Einrichtungsgegenstände zur Ordnung der häuslichen Sphäre (Schränke, Vitrinen usw.). Es kommt zu einer kontinuierlichen Neubestimmung des häuslichen Raums und der Familienrollen. Charakteristisch dafür ist die Küche. Sie variiert zwischen einem Maximum an Kompression (Kitchenette), das ihr Merkmal als Arbeitsplatz verleugnet, und einem Maximum an Sozialisation, das in eigentümlicher Weise an die alte bäuerliche Küche gemahnt und hier den Mittelpunkt des Familienlebens setzt. In der Mini-Wohnküche sind die Arbeit des Kochens und die Person, die kocht, nicht vom Familienleben separiert. Die Kücheneinrichtung selbst und die einschlägigen Reklamebotschaften oszillieren zwischen dieser doppelten Bedeutung der Küche: Funktionalität/Effizienz einerseits, Geselligkeit/Geborgenheit andererseits."
[Saraceno, Chiara. -- In: Geschichte des privaten Lebens / Philippe Ariès (Hrsg.) ... -- Frankfurt a. M. : Fischer. -- . -- Originaltitel: Histoire de la vie privée (1987) . -- Bd. 5: Vom Ersten Weltkrieg zur Gegenwart. -- ©1993. -- ISBN 3100336356. -- S. 532 - 537.. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
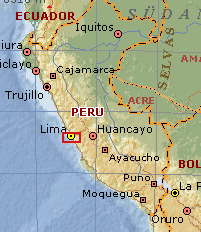
Abb.: Lage von Lima (©MS Encarta)
"Die Migranten, die zum größten Teil aus dem Hochland stammen, bringen ihren Lebensstil mit nach Lima. Als serranos fällt es ihnen nicht leicht, sich gegen die Städter zu behaupten, die mit ihrer Verachtung nicht zurückhalten. Das Aufeinandertreffen der zwei Kulturen erfordert vom serrano einen hohen Grad von Anpassung an die neue Umgebung. Er wird jedoch versuchen, sich so schnell wie möglich in seinem Verhalten an den Vorbildern der Stadtbevölkerung zu orientieren, was mit cholificación bezeichnet wird. Dies äußert sich am ehesten in der Kleidung und der Tatsache, dass er kein Quechua mehr spricht. Seit den 60er Jahren macht sich eine rückläufige Bewegung, ein neues Bewusstsein bemerkbar, das sich darin äußert, dass der indio seine Herkunft mit einem gewissen Stolz vertritt und verteidigt.
Die meisten Migranten trifft der Kulturschock nicht ganz unvorbereitet, sind sie doch durch vielfältige Kontakte über die Lebensweise in der Stadt orientiert. Viele fassen ihren Entschluss auch erst nach einem Besuch in der Hauptstadt oder wagen den Schritt nur, wenn sie dort Verwandte oder Bekannte haben. Die ersten Wochen oder Monate wohnen sie sehr oft bei einem Verwandten oder «Landsmann» (paisano) aus der Heimatgemeinde, denn Lima hat nicht genug billigen Wohnraum für die zuströmenden Zuwanderer. Die Rolle, die Verwandte sowohl bei der Auswahl des Zielortes wie auch bei der Überwindung der ersten Schwierigkeiten spielen, kann nicht genug betont werden.

Abb.: Markt in Lima (©Corbis)
Um sich wirtschaftlich halten zu können, müssen sie mit den primitiven Unterkünften in der Innenstadt (tugurios) vorlieb nehmen. In Sackgassen (callejones), die von einer Hauptstrasse abzweigen, reihen sich eingeschossige Häuser aneinander, die über einen gemeinsamen Mittelgang verfügen. In den fensterlosen Zimmern, die einzeln vermietet werden, wohnen ganze Familien, was die außerordentliche Dichte (1100 Einwohner/ha) erklärt. 1970 bestand die Altstadt von Lima zu 30% aus tugurios mit schätzungsweise 102 500 Einwohnern.
Für Neuankömmlinge bietet diese zentrale Wohnlage die beste Ausgangsmöglichkeit für die Suche nach einem Arbeitsplatz. Der Großmarkt von Lima, «La Parada», liegt im tugurio-Bereich. Dort findet sich Gelegenheitsarbeit, und auf der anderen Seite erweist er sich als soziales Zentrum, wo die Kontakte zur Heimatgemeinde durch die Lastwagenchauffeure gewährleistet sind.

Abb.: Barriada am Stadtrand von Lima, Peru (©Corbis)
Der Umzug in periphere Elendsviertel (barriadas) wird von den Bewohnern als Aufstieg betrachtet. Als barriadas werden Siedlungen bezeichnet, die durch Landbesetzung von öffentlichem oder privatem Grund auf illegale Weise entstanden sind. Die Umgebung von Lima erleichtert die Entstehung von barriadas, da die Stadt von Wüstenland umgeben ist, auf das selten Privatansprüche bestehen.
Die Besetzungen vollziehen sich vorwiegend in Gruppen, die sich oft schon in den tugurios zu Interessengemeinschaften zusammengeschlossen haben. Der Standort wird ausgesucht, besichtigt; man verteilt die Parzellen, und in den neueren barriadas wird auch das Land für zukünftige Schulen, Kirchen und Sanitätsposten reserviert.
Die Reaktion der Behörden reicht von hartem Einschreiten bis zum wohlwollenden Gewähren. Das Einschreiten der Behörden kann Landbesetzer in den wenigsten Fällen von ihrem Vorhaben abhalten.
Die barriada-Bewohner schließen sich in Vereinigungen zusammen, um ihre Interessen bei den Behörden zu vertreten. Ihr Hauptanliegen ist es, den de-facto Besitz durch rechtsgültige Titel abzusichern. Obwohl dies in den seltensten Fällen geschieht, betrachten sie sich mit der Zeit als rechtmäßige Besitzer und verkaufen oder vermieten ihre Behausungen. Die barriadas verlieren mit der Zeit ihren provisorischen Charakter, denn alles Geld wird in den Ausbau des Hauses gesteckt. Comas z.B. ist das größte aus einer barriada hervorgegangene Stadtviertel und hat nun den Status eines Verwaltungsdistriktes.
Die Militärregierung hat 1969 die Bezeichnung barriadas durch die weniger abwertende Bezeichnung pueblos jovenes ersetzt und damit auch einen Wandel in bezug auf die illegalen Siedlungen bezeugt. Sie wurden nun von den Behörden zur Kenntnis genommen und waren mit dem Ausbau der Infrastruktur nicht mehr ganz auf sich selbst gestellt. 1972 schätzte man die Anzahl der barriada-Bewohner auf 800 000, d.h. 25% der Gesamteinwohner von Lima leben in Elendsvierteln; 1956 waren es 8,7%. Andere Städte weisen noch höhere Prozentsätze an barriada-Bewohnern auf, z.B. Chimbote mit 81%."
[Gähwiler, Theres: Verstädterung und Landflucht in Peru. -- In: Menschen in Bewegung : Reise, Migration, Flucht / Redaktion: Gerhard Baer ... -- Basel [u.a.] : Birkhäuser, ©1990. -- (Mensch, Kultur, Umwelt ; 4). -- ISBN 3-7643-2405-8. -- S. 25 -- 27]
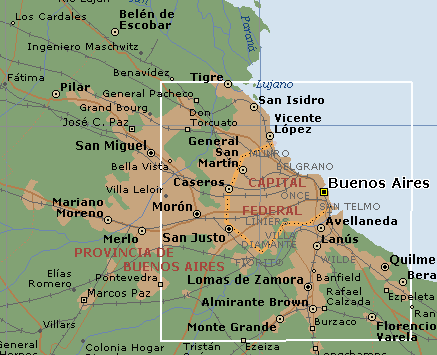
Abb.: Karte von Buenos Aires (©MS Encarta)
"Totz Regierungswechsel, Finanzkrisen, Schuldendebakel und anhaltender allgemeiner Verwirrung bleiben doch die meisten porteños [Einheimische von Buenos Aires] bei ihrem Lebensstil. Auch hier gilt: »My home is my castle«. Die Wohngebiete der Stadt erstrecken sich etwa 100 Blocks entlang der Avenida del Libertador, die im Zentrum beim Bahnhof Retiro an der Ecke der Plaza San Martin beginnt und etwa 30 Kilometer weiter nördlich bei Tigre endet, wo einige Dutzend Inseln das Delta des Rio Paraná bilden.
Was sich ein porteño unter einem idealen Heim vorstellt, hat sich seit Beginn des Jahrhunderts radikal geändert; jeder wird inzwischen auch andere Viertel nennen, in dem er oder sie gerne leben würde. Die bevorzugten Wohngebiete haben sich allmählich nach Norden verlagert, und hielt man sich früher an französische Stilvorstellungen, so neigt man heute zu den Ausdrucksformen der internationalen zeitgenössischen Architektur. In den palastartigen Gebäuden aus der Glanzzeit der Stadt sitzen inzwischen Institutionen und Unternehmen. Niemand würde heute den Bau einer Stadtresidenz im französischen Stil erwägen, und niemand käme mehr auf die Idee, sich ein luxuriöses Haus in der City zu bauen.
Manche der heutigen Magnaten lassen sich einen Hubschrauberlandeplatz auf das Garagendach in der City setzen, aber die meisten der neuen Mogule suchen doch ein größeres Grundstück, um dort etwas zu bauen, was sich eher kalifornisch als pariserisch ausnimmt. Aber bis heute sind es die feudalen Stadtvillen, die der City ihr Gepräge geben.
Porteños, die es sich leisten können, wohnen entlang einer Achse parallel zum Fluss -- nie direkt am schlammigen Wasser des Plata selbst. An dessen Ufern findet man heute eine Mischung aus Lagerplätzen für Container oder Sand, Tankstellen, Restaurants, auch ein Flugplatz liegt hier und gelegentlich stößt man auf einen Klub. Eine Straße und eine Bahnlinie trennen die Stadt vom Ufer. Die Parks von Palermo bilden einen breiten grünen Puffer, zugleich eine wunderbare Aussicht für die Hochhausappartements, die sich entlang der Avenida del Libertador von Retiro bis weit in die nahen nördlichen Vorstädte erstrecken.

Abb.: Buenos Aires mit Rio La Plata (©Corbis)
Wolkenkratzer mit Blick auf den Fluss, auf einen Park oder einen Platz stehen ebenso hoch im Kurs wie Häuser an einem der breiten baumgesäumten Boulevards in einem der ruhigeren Viertel, so etwa rund um den Bahnhof Belgrado. Es gibt inzwischen bessere Autos und bessere Straßen, das Bedürfnis nach Sicherheit hat zur Abwanderung in bewachte abgeschlossene Gartenstädte geführt, die bis zu anderthalb Fahrstunden vom Stadtzentrum entfernt sind. Zum Glück hat diese Flucht aus der Stadt und den nahen Vororten Qualität und Lebensstil in der City selbst noch nicht beeinträchtigt."
"Die Zeit des sorglosen Lebens in den Vororten scheint vorüber, heute lebt man eingegrenzter in abgeschlossenen »Countrys«. An vielen Vorortstraßen stehen, an strategischen Ecken postiert, private Wachmänner. Die Kontrollen mögen lästig sein, aber die Vororte von Buenos Aires sind viel sicherer als vergleichbare Viertel in São Paulo [Brasilien], wo Posten mit automatischen Waffen die Häuser von Türmen aus bewachen, oder als in Mexico City, wo in den Autos neben dem Chauffeur ein bewaffneter Wächter sitzt."
[Shaw, Edward (Text) ; Guntli, Reto (Fotografien): Leben in Buenos Aires. -- Kempen : te Neues, ©1999. -- ISBN 3823805541. -- S.105ff., 178. -- Originaltitel: At home in Buenos Aires (1999).. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Zu Kapitel 12: Zeit, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit