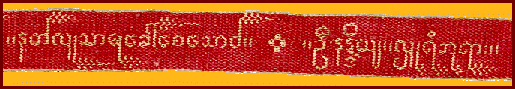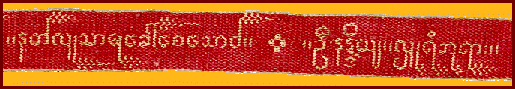Regeln zur Erfassung von Metadaten (Descriptive Cataloguing)
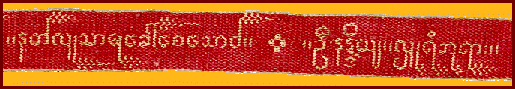
Erfassung von Metadaten einer buddhistischen Schrift
(Brettchenweberei, Birma 19. Jhdt.)
2. Beschreibende Elemente (Descriptive Elements)
von Margarete Payer
mailto: payer@hbi-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942-->: Regeln zur Erfassung von
Metadaten = Descriptive cataloguing. -- 2. Beschreibende Elemente (Descriptive Elements). --
Fassung vom 2004-03-17. -- URL: http://www.payer.de/metadaten/metadaten02.htm
Entwurf, erstmals veröffentlicht: 02.11.98
Überarbeitungen: 2004-03-17 [Korrekturen]; 2000-11-16;
1999-11-02
Anlass: Lehrveranstaltung Formalerschließung für den Studiengang
Informationsmanagement an der HdM, Stuttgart
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung.
Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der
ausdrücklichen Genehmigung der Verfasserin.
Grundregeln
- Das Objekt muss so beschrieben werden, dass man es durch die Beschreibung
wiedererkennen kann.
- Zur Beschreibung ist nach Möglichkeit das Objekt selbst (die Vorlage) zu
benutzen. (Wichtige von außerhalb der Vorlage eingefügte Angaben sind mit eckigen
Klammern zu kennzeichnen.)
- Das Objekt kann aus einem oder mehreren Teilen bestehen, es
kann selbständig oder unselbständig (d.h. innerhalb eines anderen Objekts) und in jeder
physischen Form erschienen sein.
- Wenn das Objekt zu verschiedenen Ebenen gehört, ist im allgemeinen für jede Ebene jeweils eine eigene
Aufnahme (eigener Datensatz) zu machen. Z.B. eine "Sammlung von Textbearbeitungsprogrammen" auf
einer CD-ROM, bei der es sich um Band 1 der Reihe "Die besten Programme auf
CD-ROM" handelt: es ist eine Aufnahme für die Reihe unter dem Titel "Die besten
Programme auf CD-ROM" und eine Aufnahme für die CD-ROM unter dem Titel
"Sammlung von Textbearbeitungsprogrammen" zu erstellen. Zusätzlich empfiehlt es
sich für jedes enthaltene Programm (die unselbständigen Objekte) eine eigene Aufnahme zu
machen.
- Die Schreibweise der Vorlage wird -- soweit möglich -- beibehalten (das gilt auch für
Groß- und Kleinschreibung am Anfang eines Wortes), aber nicht, wenn alles
mit Großbuchstaben oder Kapitälchen geschrieben ist.
- In für die Suche wichtigen Elementen dürfen Wörter nicht abgekürzt werden, und es
darf nichts ausgelassen werden.
Sachtitel und Zusatz zum Sachtitel, weitere Sachtitel
Als Sachtitel (title proper) wird die sachliche Benennung eines vorliegenden
Objekts bezeichnet.
- z.B.: "Forschung für den Frieden" (Sachtitel einer Monographie)
- z.B.: "Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und
Konfliktforschung" (Sachtitel einer Schriftenreihe -- fortlaufendes Sammelwerk,
serial)
- z.B.: "Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens in zehn Bänden" (Sachtitel
eines mehrteiligen Werkes -- series)
- z.B.: "Alte Jungfer, Junggeselle" (Sachtitel eines Artikels aus oben genanntem
Handwörterbuch)
- z.B.: "International & domestic communications standards" (Sachtitel einer
CD-ROM -- zusammenfassender Sachtitel, übergeordneter Titel, collective title)
- z.B.: "Network resource guide" (Sachtitel des einzelnen Objekts auf der oben
genannten CD-ROM -- enthaltenes Werk, title of the individual work)
Als Zusatz zum Sachtitel (other title information) werden zum
Sachtitel gehörige
Erläuterungen, Erweiterungen oder Einschränkungen bezeichnet.
Weitere sachliche Benennungen eines Objekts werden als weitere
Sachtitel erfasst; solche Titel in anderen Sprachen werden Paralleltitel genannt.
Aus der Vorlage übernommen wird:
- der Sachtitel
- der Zusatz bzw. die Zusätze zum Sachtitel
- weitere Sachtitel, wenn sie zusätzliche Informationen bringen, oder wenn es nicht
eindeutig ist, was der eigentliche Sachtitel (die eigentliche Benennung) des Objekts ist
- unter den weiteren Sachtiteln mindestens der erste Paralleltitel
Die Unterscheidung zwischen Sachtitel und seinem Zusatz ist wichtig, da unter dem
Sachtitel zitiert wird.
- Vorlage: Eine zu einer Million. Die Tricks und Lügen der Kartographen
- Aufnahme: Eine zu einer Million : Die Tricks und Lügen der Kartographen
Ist die Abgrenzung nicht deutlich ersichtlich, verwende man folgende Kriterien:
- grammatisch Zusammengehörendes soll möglichst nicht getrennt werden. Das gilt im
allgemeinen auch, wenn Verfassername oder Körperschaftsname grammatisch unauflösbar mit
dem Sachtitel verbunden sind.
- Vorlage: TELES ISDN. All-in-one-Multimedia-ISDN-Anwendungen (TELES ist die Firma)
- Aufnahme: TELES ISDN : All-in-one-Multimedia-ISDN-Anwendungen
- man ziehe die Typographie heran
Problemfälle:
- Fehlt bei einem Objekt ein Sachtitel, nehme man den Namen der verfassenden Person oder
Körperschaft als Titel oder bilde notfalls einen fingierten Titel
- Hat eine Vorlage, die mehrere Objekte enthält, keinen gemeinsamen (zusammenfassenden)
Titel sondern zwei oder mehr Titel, die zu den unterschiedlichen Objekten gehören, nehme
man den ersten Titel als Sachtitel für die Vorlage (Sammelwerk ohne übergeordneten
Titel, item lacking a collective title). Die Titel der weiteren Objekte (beigefügte
Werke), die getrennte Aufnahmen erhalten, erwähne man (weiteres s. unten)
- z.B. CD-Vorlage: Symphony no.1 "Jeremiah" --- "On the waterfront"
- Aufnahme des Sachtitels der CD: Symphony no. 1 "Jeremiah"
- In der Aufnahme (s. unter Angabe von untergeordneten und/oder beigefügten Teilen) wird
erwähnt: Mit: "On the waterfront"
Angabe des Sachtitels bei mehrteiligen Objekten:
- Haben die einzelnen Teile eines mehrteiligen Objekts jeweils eigene Titel (Stücktitel),
die auf einer eigenen Titelstelle (Titelseite) stehen, macht man mit diesen Titeln eine
eigene Aufnahme und zusätzlich eine mit dem übergeordneten Titel (Gesamttitel).
- Können die Bezeichnungen der einzelnen Teile nicht für sich allein stehen bzw. ist auf
der Titelstelle immer der übergeordnete Titel zusammen mit dem spezifischen Titel
angegeben, mache man für jeden Teil eine eigene Aufnahme: man gebe diesen spezifischen
Teil im Anschluss an den übergeordneten Sachtitel bzw. Zusatz zum übergeordneten
Sachtitel an. (Diese Methode empfiehlt sich vor allem bei Internetressourcen.)
- z.B. Internetressource: Materialien zur Forstwissenschaft. Kapitel 3: Mensch und Wald
- z.B. mehrteiliges Buch: The Oxford History of Australia. Volume 3: 1860-1900
- Unterscheiden sich die einzelnen Teile nur durch eine Zählung oder ist die getrennte
Aufnahme jedes einzelnen Teils zu aufwendig, mache man nur eine Aufnahme unter dem
gemeinsamen Sachtitel (zur zusammenfassenden Angabe der Teile und der Erscheinungsjahre s.
unten)
Angabe verantwortlicher Personen und Körperschaften
Bei den verantwortlichen Personen und Körperschaften ist zu unterscheiden:
- Verfasser: das sind Personen oder Körperschaften, die allein oder gemeinschaftlich ein
Werk erarbeitet bzw. geschaffen haben (Schriftsteller, Komponisten, Künstler u.ä.;
Vereine, Gesellschaften, Stiftungen, Gebietskörperschaften u.ä.)
- Sonstige beteiligte Personen und Körperschaften: das sind Personen und Körperschaften,
die am Zustandekommen der jeweiligen Ausgabe verantwortlich beteiligt waren (Hrsg.,
Übers., Redakteure, Illustratoren, Kommentatoren u.ä.; Kongressveranstalter,
Auftraggeber u.ä.)
Mindestens die ersten beiden Verfassernamen sind abzuschreiben. Es empfiehlt sich
weitere Verfasser, beteiligte Personen und Körperschaften zu übernehmen, wenn dies etwas
über das Objekt aussagt. Einleitende Wendungen in bekannten Sprachen sind zu übernehmen,
ebenso eine eventuell vorhandene Affiliation bei Personennamen. Adelstitel u.ä. bei
Personennamen können übernommen werden.
Angabe der Ausgabe
Bei der Ausgabebezeichnung handelt es sich um die Angabe der Auflage, des Reprints, der
Version, des Standes u.ä. Solche Angaben sind aufzunehmen.
Der Wortlaut der Vorlage kann gekürzt übernommen werden. Verantwortliche Personen
oder Körperschaften, die sich nur auf die vorliegende Auflage beziehen, können in dieses
Element übernommen werden.
Angabe des Erscheinungsvermerks
Der Erscheinungsvermerk besteht aus: Ort : Verlag bzw. Hersteller, Jahr bzw.
Datum.
Wenn statt des Verlages eine Körperschaft angegeben ist, wird diese genommen.
Bei mehreren Orten und auch mehreren Verlagen reicht es den ersten Ort und den ersten
Verlag zu übernehmen, bei speziellem Bedarf kann eine bestimmte Auswahl getroffen werden
z.B. zusätzlich den Ort im eigenen Land.
Ort und Verlag schreibt man in der Form der Vorlage ab.
Bei mehreren Erscheinungsjahren nehme man das jüngste aus der Vorlage.
Erscheinungsjahre in anderer Zeitrechnung sind umzurechnen.
Ist kein Erscheinungsjahr in der Vorlage genannt, muss man versuchen, das Jahr zu
ermitteln oder zu schätzen [circa 1960]. (Solche Angaben setze man in eckigen Klammern.)
Das genaue Datum muss angegeben werden, wenn das Jahr allein zur
Unterscheidung verschiedener Auflagen, Versionen usw. nicht ausreicht, z.B. bei
Internetressourcen, Protokollnotizen.
Bei mehrteiligen Objekten, die nur eine Aufnahme unter dem zusammenfassenden Titel
erhalten, wird eine zusammenfassende Angabe der Erscheinungsjahre gemacht, z.B. 1960 -
1970.
Physische Beschreibung und spezifische Materialbenennung
Es geht um die Angabe des Umfangs des Objekts, der spezifischen Materialbenennung und
des technischen Systems.
Bei mehrteiligen Objekten, die nur eine Aufnahme unter dem zusammenfassenden Titel
erhalten, wird eine zusammenfassende Umfangsangabe gemacht, z.B. 10 Bände, 3 CD-ROM, 100
Mikrofiche.
Wird für jedes Teil des mehrteiligen Objekts eine eigene Aufnahme
geschrieben, wird bei der Gesamtaufnahme dieses mehrteiligen Objekts die
Umfangsangabe dann gemacht, wenn das Werk abgeschlossen vorliegt.
Die physische Beschreibung richtet sich nach dem Material. Es folgt
eine Auswahl:
Bei Büchern :
bis zu drei Zählungen werden angegeben. Es wird jeweils die Seitenzahl auf der letzten
gezählten Seite, die noch zum Text des Buches gehört, angegeben.
An dieser Stelle kann weiterhin ein Hinweis auf Illustrationen, Karten, Begleitmaterial
erfolgen z.B. XII, 330 S. : zahlr. Ill., Kt. + 2 Microfiche
Bei Videokassetten:
das technische System, die Aufzeichnungsnorm, die Spieldauer, das Format u.ä., z.B. 1
Videokassette (VHS, 97 Minuten, schwarz-weiß)
Bei CD´s:
Durchmesser (wenn von vorgegebenem Wert abweichend), Aufnahme- und/oder Wiedergabeverfahren, Spieldauer u.ä., z.B. 1 CD (DDD,
60 Minuten)
Bei Disketten:
Format, Dateiumfang u.ä., z.B. 1 Diskette (23.456 Bytes, HD)
Bei CD-ROM´s:
Durchmesser (wenn von vorgegebenem Wert abweichend), Angabe von Farbe, Ton, Videosequenzen u.ä., z.B. 1 CD-ROM (farbig, mit
Ton und Videosequenzen)
Bei Internetressourcen:
datentechnisches Format, Dateiumfang, Angabe von Bild, Ton, Videosequenzen u.ä., z.B.
1 Datei (130 KB, mit Bild und Ton); z.B. Text / HTML (vgl. die entsprechende Angabe im Dublin
Core Set und vorgegebene Normierungen u.a. im SWB)
Angabe des übergeordneten Titels
Ausgehend vom vorliegenden Objekt sollte man nur die jeweils übergeordnete Vorlage
angeben nicht die gesamte Hierarchie. (Also z.B. Monographie in einer Reihe, Artikel in
einer Zeitschrift, Stück in einem mehrteiligen Werk, unselbständiger Teil enthalten in
einem Objekt mit übergeordnetem Titel).
- Beispiel: Angabe der Zeitschrift in der Aufnahme eines Artikels: (Nachrichten für
Dokumentation ; 48)
Mehrere übergeordnete Titel auf gleicher Ebene werden je für sich angegeben. Also bei
einer Monographie, die zu zwei Schriftenreihen gehört, z.B. (Herderbücherei ; Band 34)
(Reihe Initiative ; Band 2)
Eine vorliegende Zählung wird übernommen.
Die Angabe des übergeordneten Titels erfolgt in runden Klammern.
Angabe von untergeordneten und/oder beigefügten Teilen
Es handelt sich um Angaben bei der Aufnahme von Objekten, die einen übergeordneten
(zusammenfassenden) Titel bzw. keinen zusammenfassenden Titel für mehrere Objekte haben:
- Das Objekt (selbständiges Werk z.B. Musik-CD, CD-ROM) besteht aus mehreren Einzelwerken und hat einen
zusammenfassenden Titel: Die Titel der einzelnen Objekte
(enthaltene Werke) werden angegeben (und mit der Aufnahme des Teils verknüpft),
eingeleitet mit "Enthält:" (Z.B.: Enthält: Network Resource
Guide). Bei der Aufnahme des enthaltenen Werkes wird der
übergeordnete Titel in runden Klammern angegeben (s. oben).
Handelt es sich aber um
die Aufnahme eines mehrteiligen Werkes mit zusammenfassendem
Titel, für das Stücktitel gemacht werden, gebe man die Bandzählung und
den Band (Teil) möglichst mit Teiltitel an. Das gilt auch für die Aufnahme
einer Schriftenreihe
- z.B. "Teil" Band 3. Mittelalter
- Das Objekt hat keinen zusammenfassenden Titel: Die Titel der einzelnen Objekte
(beigefügte Werke) werden angegeben (und mit der Aufnahme des Teils verknüpft),
eingeleitet mit "Mit:". Bei der Aufnahme des beigefügten Werkes
sollte --
ebenfalls eingeleitet durch "Mit:" -- mit dem Titel des ersten Objekts
verknüpft werden.
- z.B. Mit: On the waterfront
Angabe von zugewiesenen Nummern
Es werden alle genormten Nummern der Vorlage übernommen u.a.:
- ISBN (alle in der Vorlage angegebenen ISBN werden übernommen)
- ISSN
- Report- und Normnummern
- URN (Uniform Resource Name)
- DOI
Zusätzliche Angaben (Fußnoten, Notes)
In diesem Bereich kann man zusätzlich Erläuterungen - auch von außerhalb der Vorlage
- angeben, die zur Information wichtig sind:
- Angaben zum Inhalt
- z.B.: in der Manifestation enthaltene Abstracts, Inhaltsverzeichnis, Deskriptoren usw.
- Angaben zur technischen Benutzbarkeit
- z.B.: Systemvoraussetzungen
- z.B.: Zugangsmöglichkeit
- Angaben zur Entstehung
- z.B.: Musikaufnahme am ... in ...
- Angaben zum Erwerb
- z.B. Lizenzangaben (10 Lizenzen vorhanden); public domain
- Angaben zum Benutzerkreis
- Sonstige relevante Angaben
- z.B.: Hinweis auf Bezugswerke (Fortsetzung von ...; Entstanden aus ...; Rezension;
zugleich in ... )
- Sprache der Vorlage
- Gattung
- Angaben zur bibliographischen Beschreibung
- z.B.: Titel vom Behälter
- z.B.: Beschreibung auf Grund der Internetfassung vom 1997-11-06
- Angaben zum Standort
- z.B.: URL: http://www.payer.de/cifor/cif000.htm
Zum nächsten Kapitel: 3. Zugangspunkte