

Herausgegeben von Alois Payer (payer@payer.de)
Zitierweise / cite as:
Strauß, David Friedrich <1808 - 1874>: Vorrede zu Gespräche von Ulrich Hutten. -- 1860. -- Fassung vom 2005-01-31. -- URL: http://www.payer.de/religionskritik/strauss02.htm
Erstmals publiziert: 2005-01-31
Überarbeitungen:
©opyright: Public Domain
Dieser Text ist Teil der Abteilung Religionskritik von Tüpfli's Global Village Library
Veröffentlicht in:
Strauß, David Friedrich <1808 - 1874>: Ulrich von Hutten. -- Leipzig : Brockhaus. -- Teil 3: Ulrich von Hutten <1488-1523>: Gespräche von Ulrich von Hutten / übers. und erl. von David Friedrich Strauß. -- 1860. -- LVIII, 417 S.
Abgedruckt in:
Strauß, David Friedrich <1808 - 1874>: Ulrich von Hutten. -- 4. bis 6. Stereotyp-Auflage. -- Bonn : Emil Strauß, 1895. -- 567 S. -- S. 537 - 562. [Wiedergabe hier nach dieser Ausgabe]
Über David Friedrich Strauß siehe:
Strauß, David Friedrich <1808 - 1874>: Über Leichenpredigten. -- 1863. -- URL: http://www.payer.de/religionskritik/strauss01.htm. -- Zugriff am 2005-01-21
|
Dankbar gewidmet meinen Lehrern 1965 - 1970 an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen, insbesondere Prof. Dr. Wilfrid Werbeck (geb. 1929),
Kirchengeschichte
Nach der mittelalterlichen Finsternis an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck 1962 - 1965 fühlte ich mich aus dem Mittelalter ins Zeitalter der Aufklärung versetzt. |
Vorrede zu Gespräche von Ulrich Hutten1
Noch nie bin ich bei einer Arbeit so sicher gewesen, dem Publikum einen Gefallen, der deutschen Nation einen Dienst zu tun, als bei der vorliegenden. Natürlich: bisher brachte ich Eigenes, so gut oder übel ich es vermochte; diesmal bringe ich eine Übersetzung von Ulrich Hutten.

Abb.: Hans Holbein d. J. (1497/98 - 1543): Porträt des (sogenannten)
Aussätzigen (Ulrich von Hutten?). -- 1523
Dem lesenden Publikum wird die frische, gesunde, reife Frucht schmecken; ja sie mag ihm nach so manchem schlechten Roman oder nicht bessern Erbauungsbuch Mund und Magen wiederherstellen helfen. Es ist nicht ohne Rücksicht auf dieses Publikum, dass ich von Hutten gerade die Gespräche2, in denen er den Ernst seiner reformatorischen Gedanken in geschmackvolle, phantasiereiche Formen kleidet, zur Übersetzung ausgewählt habe. Ja, dass ich es nur gestehe, ich gehöre in diesem Stück selbst ein wenig zum Publikum.
Dem deutschen Volke aber mache ich einen seiner Klassiker zugänglich. Es besitzt deren bekanntlich auch solche, die lateinisch geschrieben haben. Man kann über den Begriff des Klassikers streiten: ich verstehe hier einen Schriftsteller darunter, in dessen Werken die tiefste Eigentümlichkeit seines Volkes zum vollen Ausdruck kommt, und zwar in einer Form, die, wenn nicht für alle Zeiten mustergültig, doch für alle bedeutend und Anziehend ist. Dergleichen Schriftsteller können dem deutschen Volke am wenigsten in dem Jahrhundert gefehlt haben, da es seine größte nationale Tat vollbrachte, die Reformation3, und sie müssten die ersten unsrer Klassiker heißen, selbst wenn sie kein deutsches Wort geschrieben hätten.
Allen andern voran steht hier bekanntlich Luther selbst. Auch er hat sich noch vielfach der lateinischen Sprache bedient; aber seine Bibelübersetzung, seine Lieder, seine Katechismen, seine Predigten mit so vielem Andern noch sind deutsch, und so deutsch, dass sie zu unserem ganzen neueren Sprach- und Schriftwesen den Grund gelegt haben. Diese deutschen Schriften Luthers uns mehr als andere aus der gleichen Zeit frisch und genießbar zu erhalten, hat ein Umstand beigetragen, über den Sprachforscher, oder vielmehr Altertümler, schmälern mögen, der aber vom bildungsgeschichtlichen Standpunkt aus als höchst segensreich erscheint. Indem nämlich jedes folgende Menschenalter nicht bloß die Rechtschreibung, sondern auch manche veraltende Spracheigenheiten der Bibelübersetzung, der Lieder und der andern gelesenern Schriften Luthers in seiner Art sich zurecht machte, blieben sie in einem fortdauernden sprachlichen Erneuerungsprozess begriffen, der sie einer Masse von jetzigen Lesern zugänglich machte, denen sie in ihrer ursprünglichen Gestalt nur schwer und teilweise verständlich sein würden.
Hutten1, dem unter den klassischen Schriftstellern Deutschlands im Reformationsjahrhundert schwerlich jemand die zweite Stelle nach Luther streitig machen wird, ist, was die Sprache betrifft, heut zu Tage gegen diesen zunächst im Nachteil. Um so viel seine Latein besser ist als Luthers, um so viel ist sein Deutsch geringer. Als Humanist4 war nur jenes die Sprache, in der er sich geläufig schriftlich ausdrückte, und wenn er auch in spätern Jahren, um weitern Kreisen verständlich zu werden, Mehreres deutsch schrieb und einige seiner lateinischen Schriften, wie namentlich einen Teil seiner Gespräche2, ins Deutsche übertrug, oder unter seiner Mitwirkung übertragen ließ, so kehrte er doch, wenn er sich frei bewegen, und vor Allem, wenn er künstlerisch schaffen wollte, immer wieder zu seiner alten Humanistensprache zurück. Und seinen deutschen Schriften wurde dann fürs Andere, weil sie weniger gelesen und wieder aufgelegt wurden, jener fortgehende Verjüngungsprozess, jenes zeitenweise wiederkehrende Sichhäuten nicht zu Teil, das die Lutherischen lebendig und wirksam erhielt. Dies jetzt auf Einmal nachholen, d. h. Huttens deutsche Schriften sprachlich modernisieren zu wollen, würde teils unerträglich affektiert herauskommen, teils nicht einmal hinreichen, sie anziehend zu machen. Man muss seine besten lateinischen Schriften übersetzen, und zwar so, dass man auch bei den von ihm selbst schon übertragenen diese Übersetzung wohl für das Verständnis, nicht aber als sprachliches Vorbild benutzt, sondern sein Latein unmittelbar in das heutige Deutsch überträgt. Und hier tritt nun hinwiederum Hutten gegen Luther in Vorteil. Sein klassisches Latein steht unsrem heutigen Deutsch näher als Luthers Kirchenlatein und Bibeldeutsch. Aber auch seine Denkweise, seine mehr weltliche, politische Art, die menschlichen und insbesondere die religiösen Verhältnisse, anzusehen, spricht uns verwandter an.
Der Versuch, Huttens Schriften, namentlich auch die Gespräche, durch Übersetzung wieder unter den Deutschen einzubürgern, ist schon einigemale gemacht worden, doch ohne sonderlichen Erfolg. Man hatte es nicht recht angegriffen. So gab Alois Schreiber5 die beiden Fieber2, Ernst Münch6 außerdem noch den Vadiscus und die Anschauenden, mit allerhand Modernisierungen nach der alten Huttenschen Übersetzung; während der Letztere dann die von Hutten selbst nicht übersetzten Gespräche, so viel er deren gab, auf eigene Hand in seiner bekannten flüchtigen Manier übertrug. So fehlte auf jeden Fall die Gleichförmigkeit. Außerdem fehlten Einleitungen, den Leser auf den richtigen Standpunkt zu stellen, Anmerkungen, um Geschichtliches und was sonst zum Verständnis nötig, aber nicht Jedem gegenwärtig ist, herbeizubringen; denn Übersetzungen macht man ja nicht für Gelehrte, sondern um einen Schriftsteller jedem Gebildeten im eigenen Volke zugänglich zu machen. Wenn ich jetzt den Versuch in andrer Art wiederhole, so wird mich wenigstens der Vorwurf nicht treffen, ohne Vorbereitung an die Sache gegangen zu sein. Auch war ich äußerlich begünstigter als irgend einer meiner Vorgänger. Keinem von ihnen lag ja noch die Böckingsche7 Ausgabe von Huttens Werken vor, die, während sie eine Menge von Fehlern und Schwierigkeiten der alten Drucke aus dem Wege räumt, zugleich durch ebenso reiche wie gründliche historische und literarische Nachweisungen dem Übersetzer eine von mir dankbar benützte Hülfe leistet. Ihr Text (da mir vom vierten Bande die Aushängebogen zu Gebote standen) liegt meiner Übertragung durchaus zum Grunde, wo nicht in etlichen wenigen Fällen ausdrücklich ein Anderes angemerkt ist.
Doch nicht überhaupt nur um den Klassiker, den grunddeutschen und geistvollen Schriftsteller, ist es mir zu tun, indem ich Hutten durch diese Übersetzung eines Teils seiner Werke in die Hände des deutschen Volks zu bringen suche. Der Mitarbeiter des großen Reformators ist es vor Allem, der mutige Kämpfer gegen Rom, den ich, nachdem sein von mir biographisch gezeichnetes Bild8 so günstig aufgenommen worden, nunmehr selbst, in seinen eigenen Schriften auferwecken möchte. Dies war auch ein Hauptgesichtspunkt, der mich bei der Auswahl der zu übersetzenden Stücke leitete. Wenn ich einerseits nach solchen mich umsah, die vermöge ihrer Form auch heutige Leser noch anziehen könnten, so wählte ich unter diesen andrerseits diejenigen aus, die ihrem Inhalt und Zwecke nach mit Luthers Bestrebungen, mit der großen Nationalangelegenheit des sechszehnten Jahrhunderts, im Zusammenhang stehen. So wird man denn in den folgenden Gesprächen erst noch den Morgenstern des Humanismus4 am Himmel funkeln sehen, bis allmählich der Horizont sich rötet und die ersten Strahlen der selbst noch nicht sichtbaren Sonne der Reformation3 durch den Himmel schießen. Jetzt tritt sie hervor und wirft die Nebel nieder; sie steigt höher, aber die Nebel steigen auch, und je wärmer ihre Strahlen werden, desto dichter treten die Dünste zu Wolken zusammen, die bald mit verderblichen Gewittern drohen.
Man macht die Reformation3 für diese Wetter verantwortlich, man hört nicht auf, ihr vorzuwerfen, dass sie unser Volk gespalten, das deutsche Reich zerrissen habe. Man bedenkt nicht, wie zerklüftet und brüchig dieses schon vorher aus andern Ursachen war. Man bedenkt ferner nicht, dass die Reformatoren außer Schuld sind, wenn ihre Saaten nicht überall in deutschen Landen Wurzel schlagen durften, und mancher Orten, wo sie schon Wurzel gefasst hatten, gewaltsam wieder ausgereutet wurden. Hauptsächlich aber bedenkt man nicht, dass es immerhin besser war, Deutschland wurde, wenn es einmal mit dem ganzen nicht ging, wenigstens zur Hälfte deutsch, als dass es ganz romanisch geblieben wäre. Denn vor der Reformation war Deutschland so wenig schon es selbst, als die Larve schon die Biene oder der Schmetterling selbst ist. Das Grundwesen des germanischen Geiste ist individuelle Selbsttätigkeit, Leben aus dem eigenen Innern eines Jeden heraus. Dem entwickelten Deutschen kann kein mechanisches Abtun des Religiösen, kein unverständliches Schaugepräng und Plappern, kein gedankenloses Abkugeln von Rosenkränzen genügen: er will selbst mit seinem Bewusstsein, seinem innersten geistigen Wesen, dabei sein. Er kann sich in die Länge seinen Glauben nicht von außen vorschreiben, sich nicht von einer Priesterkaste in geistlichen Dingen bevormunden lassen: er muss selbst forschen, sei es vorläufig in der Schrift, oder weiterhin in der Vernunft. Dass wir das dürfen und können, das verdanken wir protestantische Deutsche der Reformation; dass wir es auch wirklich tun, uns in der Tat und Wahrheit als Deutsche beweisen, das ist unsre Sache.
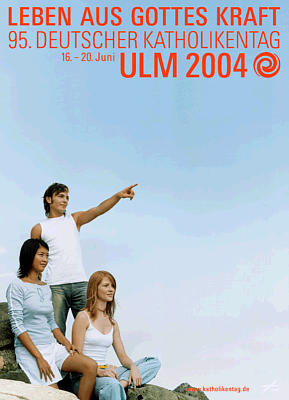
Abb.: "dass ... noch halb Deutschland in religiösen
Dingen sein Heil von jenen Bergen her erwarten würde, über die ihm seit
Jahrhunderten so viel Unheil und Verderben gekommen war!": Plakat zum
Katholikentag 2004
Wenn man Hutten gesagt hätte, dass die römische Hierarchie9, zu deren Umsturz er seine mächtige Lanze einsetzte, Luther seinen noch gewaltigern Arm nicht ruhen ließ, und alle Bessern in der Nation sich in einhelligem Unwillen erhoben hatten, — wenn man ihm gesagt hätte, dass sie nach mehr als dreihundert Jahren noch fortbestehen, dass auch dann noch halb Deutschland in religiösen Dingen sein Heil von jenen Bergen10 her erwarten würde, über die ihm seit Jahrhunderten so viel Unheil und Verderben gekommen war! So langsam geht es mit der Entwicklung der Völker und der Menschheit, so gründlich treibt der Geist in der Geschichte sein Geschäft. Das dürfen wir uns nicht verdrießen, noch weniger die Hoffnung sinken lassen. Aber ebensowenig uns verblenden über die Macht, die dem immer noch innewohnt, was wir für längst Überlebte halten möchten.
Manches freilich würde Hutten, wenn er heute wiederkäme, um sich den Stand der Dinge bei uns anzusehen, an der römischen Kirche, seiner alten Feindin, verändert finden. Über den Geldabfluss nach Rom, die finanzielle Ausbeutung Deutschlands durch den päpstlichen Hof, worüber er und alle Patrioten seiner Zeit so laute Klage erhoben, würde er sich jetzt ziemlich beruhigen können. Was ein lustiger Freund11 von ihm damals den Deutschen zurief: Augen auf und Beutel zu! davon haben sich seitdem Rom gegenüber das Letztere auch Diejenigen gesagt sein lassen, die sich zum Ersteren noch nicht entschließen mochten. Auch seine schmutzigen Bettelmönche12, seine prassenden Domherren13, die üppigen Hofhaltungen der Bischöfe seiner Zeit würde er im jetzigen Deutschland vergeblich suchen. Selbst in Rom würde er sich wundern, wie doch Alles jetzt so viel ehrbarer und anständiger zugehe. Aber täuschen würde er sich durch diese verschönerte Außenseite gewiss nicht lassen. Bald würde er finden, es sei zwar Vieles anders, nichts aber besser geworden. Ja vielleicht würde er in der Sprache der Bibel sagen, der Teufel sei wohl ausgetrieben, aber durch der Teufel Obersten. Und wir könnten ihm mit einem einzigen Wort das Rätsel lösen, indem wir ihn darauf aufmerksam machten, wie Ignatius Loyola14 zwar sein Zeitgenosse gewesen, aber nach seinem Tode erst Ordensstifter geworden sei.
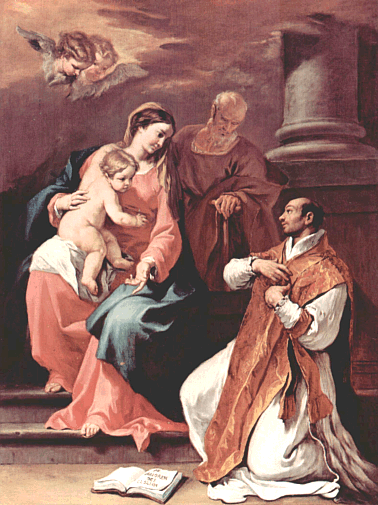
Abb.: "der Teufel sei wohl
ausgetrieben, aber durch der Teufel Obersten": Sebastiano Ricci: Heilige Familie und der Hl. Ignatius von
Loyola. -- 1704
Wenn in der Folge davon, statt dass Dominikaner und Franziskaner die Wissenschaft gehasst und verfolgt hatten, die Jesuiten15 fortan sich mit derselben einließen, aber nur um sie desto wirksamer mit ihren eigenen Waffen bekämpfen zu können; wenn, wo jene mit Prügeln auf die Geistesfreiheit losschlugen, diese ihr tückische Dolchstiche versetzten und schleichende Gifttränke eingaben: was war damit besser geworden? Wenn Hutten statt der dickwanstigen rotbackigen Schlemmer, die er unter der Geistlichkeit seiner Zeit in so großer Anzahl sah und in den Dunkelmännerbriefen16 verewigen half, die bleichen, hagern, von Herrschsucht verzehrten, von Fanatismus ausgebrannten Gestalten zu sehen bekäme, die jetzt unter uns umgehen, ob er nicht statt dieser Zöglinge Loyolas14 und Macchiavellis17 jene verhältnismäßig harmlose Herde Epikurs18 zurückwünschen möchte? Immer hat er neben der materiellen Ausbeutung als das noch viel Unerträglichere die politische Bevormundung, die geistige Knechtung angesehen, die Deutschland von Rom erleide und sich gefallen lasse. Und damit ist es so wenig besser geworden, dass diese geistliche Herrschsucht, dieser Hass gegen die Geistesfreiheit und Bildung der Völker, gegen die Selbständigkeit und politische Entwicklung der Staaten, mit dem unaufhaltsamen Fortschritt auf diesen Gebieten nur grimmiger und giftiger geworden ist.
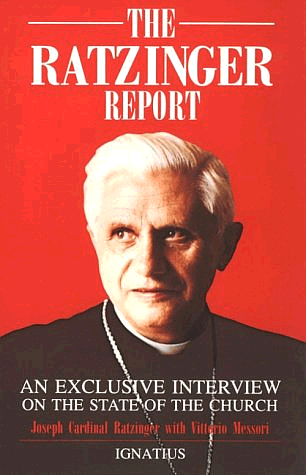
Abb.: "Er bekäme ja vielmehr zu sehen, wie das von hell denkenden und männlich
wollenden Vorfahren gelockerte Band jetzt die Nachkommen sich mit freiem Willen
enger um die Hälse schnüren": Joseph Kardinal Ratzinger19, Deutscher und Oberster
Glaubenswächter der katholischen Kirche (Umschlagtitel)
Auch das Verhältnis, worein sich Deutschland zu Rom gesetzt hat, würde Hutten tief unter dem finden, was man zu seiner Zeit erwarten durfte. Nicht das allein, dass mehr als die Hälfte der Deutschen bei der römischen Kirche geblieben, würde ihn in Verwunderung setzen, sondern dass auch dieser Teil, der das alte Band nicht zerreißen mochte, es nicht längst wenigstens lockerer gemacht hat. Was sagte ich, lockerer? Er bekäme ja vielmehr zu sehen, wie das von hell denkenden und männlich wollenden Vorfahren gelockerte Band jetzt die Nachkommen sich mit freiem Willen enger um die Hälse schnüren. Ein Ding wie das Österreichische Konkordat20 würde ihn sogar von einem Abkömmlinge jenes Ferdinand, der einst seine Erwartungen so bitter getäuscht hatte, in Erstaunen setzen. Das hat sich nun freilich bereits selbst gerichtet. Es sollte ein Kitt werden für die aus ihren Fugen weichende Einheit des Kaiserstaates: und seine erste Wirkung war, dass von ihren Pfaffen gehetzt die Österreichischen Katholiken ihre protestantischen Mitbürger nicht einmal im Grabe mehr neben sich dulden wollten. Italien hat es für Österreich nicht erhalten können, Ungarns Unzufriedenheit gesteigert, in ganz Deutschland das Vertrauen auf den Ernst von Österreichs Reformen zerstört, im Lande selbst die Hoffnungen der Patrioten niedergeschlagen. Wie freilich nach solchem Vorgang die protestantischen Fürsten südwestdeutscher Staaten Lust bekommen konnten, ihre katholischen Untertanen mit Konkordaten nach dem Muster des Österreichischen zu beglücken, ist ein noch ungelöstes Rätsel. Dass es der Wunsch der Bevölkerung, selbst der katholischen, nicht war, hat sich seitdem in Baden21 glänzend gezeigt, unter Landesfürst dieser Volksstimme in verfassungsmäßiger Weise Gehör gegeben: hoffen wir, dass sich der begangene Fehler vollständig wieder gut machen lasse, und das Beispiel in den Nachbarstaaten Nachahmung finde. Denn das ginge doch über alles Maß und wäre der schärfsten Huttenschen Satire wert, wenn in einem Zeitpunkt, da Petri Stuhl seinem vorgeblichen Nachfolger unter dem Leibe wankt, während die Italiener und voraus die Bewohner des Kirchenstaats seiner herzlich satt sind und ohne die fremden Bajonette ihn längst fortgejagt hätten, wenn jetzt noch Deutsche ihm Konkordate entgegenbrächten, deren sich die Päpste des sechszehnten Jahrhunderts gefreut haben würden.
Fände danach Hutten auf katholischer Seite noch heute nicht weniger zu schelten und anzuklagen als zu seiner Zeit, so dürfen wir Protestanten3 darum nicht meinen, er würde mit uns um so zufriedener sein. So gewiss er auf eine protestantische Kirche hingearbeitet hat, so zweifelhaft ist, ob er in der unsern, wie sie jetzt ist, die erkennen würde, die ihm im Sinne lag. Ja. ich weiß nicht, ob sein Unwille, den er der römischen Kirche gegenüber empfinden würde, weil sie nicht anders geworden, nicht noch viel heftiger gegen die unsrige entbrennen müsste, da sie so ganz anders geworden ist, als er von ihr hoffen zu dürfen glaubte. Dass sie vom Sinne Christi abgewichen sei, hat er der ersteren genug vorgehalten; dass sie sich als römischer treu geblieben, hat er ihr nicht absprechen können: an der protestantischen Kirche würde er zu rügen haben, was allemal das Schlimmste ist, dass sie sich selbst untreu geworden sei, ihr eigenes Prinzip verleugnet habe. dass es dahin mit ihr kam, hätte der Ritter möglicherweise selbst noch erleben können, denn es kam leider sehr früh: aber auch heute würde er noch nicht finden, dass sie im Großen und Ganzen ihr Prinzip wiedergefunden hätte. Das Prinzip, aus dem der Protestantismus hervorwuchs, ist freie Überzeugung des Einzelnen. nichts sich vorglauben zu lassen, sondern nur zu glauben, was man selbst persönlich im eignen Innern erlebt. Luther glaubte an die Schrift, wo es darauf ankam bis auf das einzelne Wort hinaus: aber nicht weil die Kirche es ihn hieß, sondern weil sein innerer Wahrheitssinn, den er als das Zeugnis des heiligen Geistes empfand, ihn der Wahrheit und Göttlichkeit des Schriftinhalts versicherte. Nur soweit dieser (jetzt durch ganz andere Mittel, als Luthern zu Gebote standen, unterstützte) Wahrheitssinn ihn von der Glaubwürdigkeit ihrer Erzählungen, der Vernunftmäßigkeit ihrer Lehren überführt, ist folglich der Protestant der Bibel zu glauben schuldig. Sobald an die Stelle dieses lebendigen und freien Glaubens ein toter und knechtischer Symbol22- oder Bibelglaube trat, war der Protestantismus von sich selber abgefallen: und wo hätte er denn seitdem bis auf den heutigen Tag dieses Afterprinzip von sich getan?

Abb.: "es ist unmöglich, sich einen katholischen Kant, Lessing, Goethe und
Schiller auch nur einen Augenblick vorzustellen": Lessing-Denkmal in
Wolfenbüttel / von Friedrich Doell (1750 - 1816). -- 1795
[Bildquelle: http://nibis.ni.schule.de/~lessing/www11a/les_denk/lwf.htm. -- Zugriff am 2005-01-27]
Gleichwohl lebte auch in der entarteten Kirche das echt protestantische Prinzip im Einzelnen und in engeren Kreisen beständig fort: das war der Segen der großen reformatorischen Tat, die den äußeren Zwang, die weltliche Macht der Hierarchie für den Kreis des Protestantismus gebrochen hatte. Der Zweifel, die Forschung, das philosophische Denken, in Deutschland zuletzt eine nationale Literatur, erwuchs auf diesem Boden, und es ist Freude und Stolz für ein protestantisches Herz, dass diese neuere klassische Literatur unsres Volkes ausschließlich dem Protestantismus angehört. Auf katholischem Boden ist sie schlechterdings undenkbar; es ist unmöglich, sich einen katholischen Kant, Lessing, Goethe und Schiller auch nur einen Augenblick vorzustellen. Freilich selbst in der protestantischen Kirche konnte diese Literatur erst in einer Zeit erwachsen, wo der in ihr aufgekommene Rationalismus23 ihre konfessionellen Schranken niedergeworfen, ihren Horizont erweitert, dem Licht und der freien Luft zugänglich gemacht hatte. Aber eben auch dieser Rationalismus konnte nur auf protestantischem Boden sich entwickeln. Der Katholizismus schwankt ewig zwischen Aberglauben und Unglauben; der Franzose, der Italiener, wo er sich dem Dogma seiner Kirche entfremdet, wird allemal frivol: ein Denken, das mit dem Kirchenglauben keineswegs auch den sittlichen, den Glauben an eine höhere Weltordnung und die Begeisterung für das Ideale aufgibt, Kants kategorischer Imperativ24, ist nur innerhalb oder unter dem Einfluss des Protestantismus möglich.
Man macht es den heutigen Frommen zum Vorwurf, dass sie die Träger unsrer großen Literaturepoche als Heiden verdammen, vor ihren Schriften warnen, auch in dieser Hinsicht dass deutsche Volk zur gänzlichen Umkehr von seinem bisherigen Wege mahnen. Ich gestehe, ich kann dieses Treiben unsrer Rechtgläubigen nur in der Ordnung finden. In ihrem Sinne, überhaupt in dem bisher üblichen (und ob das Wort noch einen weitern Sinn haben kann, wäre ja erst auszumachen), ist seit Klopstock25 keiner unsrer Klassiker mehr ein Christ gewesen. Lessing hat in seinem Nathan26 das symbolische Buch für diese Richtung geschrieben, und Goethe und Schiller, Wieland und Herder, stehen bei aller Freiheit der individuellen Auffassung doch wesentlich auf demselben Boden. Alle diese Männer (auch Herder nicht ausgeschlossen, dessen geistlicher Stand und qualmende Phantasie mehr nur auf die Form und Farbe, als auf den Gehalt seiner Ansichten von Einfluss waren) sind allem Positiven entwachsen; sie kennen keine Offenbarung als die im Gemüt, in Natur und Geschichte, kein Wunder als die Naturgesetze selbst, kein Heil und keine Versöhnung als die sich der menschliche Geist in sich durch Läuterung, durch Entsagung und Liebe schafft. Die biblischen Erzählungen galten ihnen nur so weit für geschichtlich, als sie sich natürlich fassen ließen; was darüber hinausging, war ihnen Sage oder Selbsttäuschung, und nicht immer erwehrten sie sich noch schlimmeren Verdachts. Die kirchlichen Glaubensartikel waren ihnen im besten Fall Symbole, an die sich sittliche Wahrheiten, religiöse Ideen anknüpfen ließen. Halten die Rechtgläubigen solcherlei Ansichten für unchristlich, wie sie auf ihrem Standpunkte müssen, so haben sie ein Recht, vor dem Lesen der Schriften, in denen dieselben mit so viel Geist vorgetragen, oder, was noch gefährlicher ist, so unmerklich vorausgesetzt werden, zu warnen, und die Schriftsteller, die wir Übrigen als Klassiker verehren, als Ketzer und Irrlehrer zu brandmarken. Es kommt ja nur auf uns an, ob wir ihnen Gehör geben, oder es darauf wagen wollen, mit Lessing, Goethe und Schiller in die Hölle, statt mit Hengstenberg27, Stahl28 und Vilmar29 in den Himmel zu kommen.

Abb.: "statt mit Hengstenberg, Stahl und Vilmar in den Himmel zu kommen": E. W.
Hengstenberg
[Bildquelle:
http://www.livenet.ch/www/index.php/D/article/346/19125/. -- Zugriff am
2005-01-27]
Zu der hundertjährigen Schillerfeier30 neulich haben jene Frommen natürlich äußerst sauer gesehen, und es ist nur Politik, um es mit dem Publikum nicht gar zu sehr zu verderben, von ihnen gewesen, wenn sie sich nicht noch weit stärker dagegen ausgesprochen haben. Naiv ist es freilich in hohem Grade, dass eben sie so unbefangen gegen Abgötterei eifern, als könnte es auf der Welt niemand einfallen, ihnen das Quis tulerit gracchos de seditione quaerentes [Wer ertrüge es, wenn sich die Gracchen (d. h. Revolutionäre) über Aufruhr beklagten]31? entgegenzuhalten. Auch einer der Gebildeten und Süßredenden unter ihnen, der die Schillerfeier in Schutz nahm, glaubte sich doch zum Ausruf bemüßigt: Hinweg mit aller Menschenvergötterung in wie außerhalb der Kirche! Nun, wir außerhalb können ihn versichern, dass nie einer von uns daran gedacht hat oder denken wird, weder dem alten Hauptmann Schiller32 zu Gunsten eines höhern Wesens die Vaterschaft an seinem Sohne abzusprechen33, noch den Rezepten, die dieser als Regimentsmedikus verschrieb, eine totenerweckende Kraft beizulegen, noch den Umstand, dass über dem Begräbnis des Dichters bis heute ein Geheimnis ruht, zu der Vermutung zu benützen, er sei wohl bei lebendigem Leib in himmlische Regionen erhoben worden34.

Abb.: "dass nie einer von uns daran gedacht hat oder denken wird, weder dem
alten Hauptmann Schiller zu Gunsten eines höhern Wesens die Vaterschaft an
seinem Sohne abzusprechen, noch den Rezepten, die dieser als Regimentsmedikus
verschrieb, eine totenerweckende Kraft beizulegen": Johann Caspar Schiller32 (1723
- 1796), der Vater des Dichters Friedrich Schiller
Insofern indes war das gemäßigte Auftreten der Hochgläubigen gegen die Schillerfeier vielleicht wohlberechnet, als die Wenigsten im Volke sich der ganzen Tragweite dieser Feier bewusst gewesen sein mögen. Man weiß wohl ungefähr, dass es mit des Mannes35 Christentum nicht ganz richtig (in der Tat vielmehr seit Lessing bei keinem so schlimm) gestanden, aber man hält ihm dies als Zeitgebrechen zu Gute, wie man ihm sein Weltbürgertum, seine geringschätzigen Reden über partikuläre Vaterlandsliebe zu Gute hält. In der Tat jedoch verhält es sich mit beiden Defekten ganz verschieden. Der deutsche Patriotismus fehlte Schiller keineswegs, wenn er auch dem Kosmopolitismus in ihm untergeordnet war, und würde, wenn der Dichter die Zeit der Freiheitskriege erlebt hätte, gewiss in hellen Flammen emporgelodert sein, ohne dass sich darum in seinem übrigen Denksystem das Mindeste hätte ändern müssen. Von dem Kirchenglauben hingegen war in Schiller schlechterdings keine Spur, und nicht das kleinste Zugeständnis hätte er demselben machen dürfen, ohne seine ganze Weltanschauung über den Haufen zu werfen; sobald er sich zum Glauben an ein einziges Dogma, an eine einzige biblische Wundergeschichte bequemte, war er mit dem Geist aller seiner Werke in Widerspruch getreten. Und dass nun gerade die Gestalt dieses Mannes, dessen geistige und sittliche Hoheit von jeder kirchlichen Beimischung frei, rein human und rationell erworben war, dass sie gerade auf das deutsche Gemüt diese Anziehungskraft übt, in Schiller gerade wie in keinem Andern der deutsche Volksgeist sich selbst wiedererkennt, das ist ein Zeichen, das jenen Kirchenmännern ebenso bedenklich, als uns erfreulich und hoffnungsreich erscheinen muss.
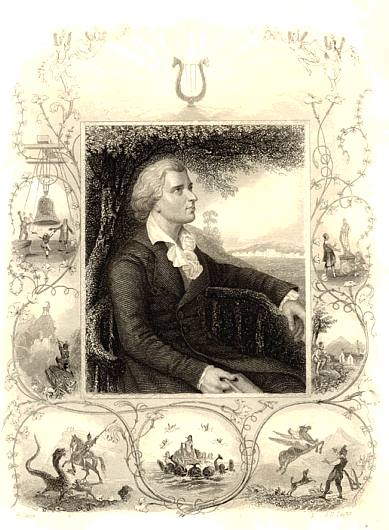
Abb.: "Von dem Kirchenglauben hingegen war in Schiller schlechterdings keine
Spur": Friedrich Schiller. -- Um 1840
Unsere klassische Literatur hatte sich in der Periode des Rationalismus entfaltet, und war zur Zeit der französischen Revolution und der Fremdherrschaft vollendet worden: als die Befreiungskriege anhuben, war ihre Zeit wie die des Rationalismus schon vorher um. Die französischen Dränger waren der Mehrzahl nach ungläubig gewesen, die Vornehmeren meist Voltairianer36, die Gemeinen nach Verhältnis, Alle Götzendiener der materiellen Gewalt: die deutschen Männer und Jünglinge, die gegen diese Gewalt aufstanden, taten das im begeisternden Glauben an eine höhere sittliche Macht, der sich ihnen im Gegensatz gegen den französischen Unglauben, mit den alten Anschauungen des Christentums verschmolz. So wurden die Dichter und übrigen Schriftsteller jener Jahre wieder christlich fromm, und mit den Thronen restaurierte sich hernach auch die Kirche, die Theologie und selbst die Philosophie. Friedrich Wilhelm III. trübte seine hoch- und freisinnige Tat, die Union der beiden protestantischen Kirchen37, durch eine katholisierende Agende38, die er ihr zur Mitgift gab; Claus Harms39 schrieb seine altlutherischen Thesen; die Evangelische Kirchenzeitung27 wurde gegründet, die Halleschen Rationalisten denunziert. Aber auch Hegel bildete sein ursprünglich auf den freiesten Grundlagen aufgebautes System zur scholastischen Beschönigung der gegebenen Zustände, insbesondere auch des kirchlichen Dogma um.
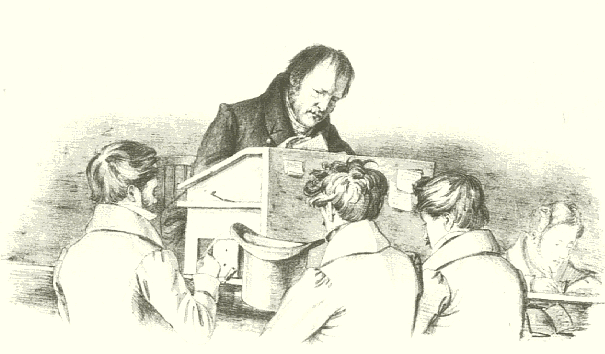
Abb.: "Aber auch Hegel bildete sein ursprünglich auf den freiesten Grundlagen
aufgebautes System zur scholastischen Beschönigung der gegebenen Zustände,
insbesondere auch des kirchlichen Dogma um.": G. W. Hegel
Ein Mann40 lebte in jenen Jahren, der ebenso klug wie fromm, vielleicht auch noch etwas klüger als fromm war: wer misst das so genau? Er war der Erste, der das Befreiende, was in der Union lag, erkannte und ausbeutete. Wenn in jeder der beiden evangelischen Konfessionen das aufhörte verbindlich zu sein, was sie gegen die andere festgesetzt hatte, so gab das schon eine hübsche Weite, in der sich menschlicher wohnen ließ, als in dem bisherigen konfessionellen Notstall beiderseits. Gleichwohl fand auch so noch Schleiermacher40 das Schiff der Kirchenlehre für sein mürbes Alter und die hochgehenden Wogen der Zeit viel zu schwer befrachtet; er riet, außer dem Notwendigsten Alles über Bord zu werfen, und setzte sich seinerseits ohne allen Ballast in den leichten Kahn des frommen Selbstbewusstseins. Nicht als Ausbeute aus der heiligen Schrift, nicht als Festsetzungen eines Symbols, als einfache Aussagen des christlichen Bewusstseins entwickelte er die Sätze der evangelischen Glaubenslehre, die er nur nachträglich mit jenen beiden Instanzen zusammenhielt. Dass dieses Bewusstsein ganz anders sprechen würde, wenn es nicht in einer an Schrift und Symbol erzogenen christlichen Gemeinde sich gebildet und erfüllt hätte, dass mithin seine Ableitung sich eigentlich im Kreise bewegte, machte ihn nicht irre. Wusste er nur für seine Sätze eine Fassung zu finden, in der sie weder einander gegenseitig, noch einer anerkannten Vernunfteinsicht widersprachen, so glaubte er seiner Aufgabe genügt zu haben. So brachte er ein überaus feines, aber ebenso künstliches System zusammen, ein Räderwerk, das nur eine so gewandte Hand, wie die seinige, im Gang zu erhalten wusste. Kein einziger seiner Glaubenssätze war weder nach Ableitung noch Inhalt irgend einem kirchlichen Dogma wirklich kongruent, aber es waren trefflich gefertigte, täuschen ähnliche Surrogate, die dem modernen Gaumen überdies besser als die nachgerade altbacken gewordenen kirchlichen Schaubrote41 schmeckten. Das Grunddogma, dem alle übrigen nur dienten, war das von Christus, mit dem in innigem persönlichen Verkehr sich zu fühlen, Schleiermachern von seiner Erziehung in der Brüdergemeinde her gemütliches Bedürfnis war. Aber dieser sein Christus war nicht die zweite Person in der Gottheit, nicht der aus einem frühern göttlichen Dasein in einen Menschenleib wunderlich herabgekommene und dann wieder zu jener höhern Existenz zurückgekehrte Gottessohn, sondern lediglich ein zwar sittlich normaler, sonst aber durch nationale wie persönliche Bedingungen beschränkter Mensch. So wenig mit dieser Vorstellung einerseits das kirchliche Dogma von Christo gedeckt war, so leicht war andrerseits einzusehen, dass auf Schleiermachers Standpunkt folgerichtig immer nur das Ideal, nicht aber die Wirklichkeit eines solchen Menschen abzuleiten, ja auch nur zu begreifen war.

Abb.: "Ein Mann lebte in jenen Jahren, der ebenso klug wie fromm, vielleicht
auch noch etwas klüger als fromm war": F. D. E. Schleiermacher
Noch weit übler als dem Dogma unter seiner Hand erging es, kaum dass Schleiermacher40 die Augen geschlossen, der Quelle des Dogma nach protestantischer Vorstellung, der heiligen Schrift, und man musste nachträglich noch den Mann bewundern, der sich zum Voraus so klüglich darauf eingerichtet, und sein Credo von derselben unabhängig zu machen gesucht hatte. Hier werden manche Leser meinen, ich wolle von meinem Buch über das Leben Jesu42 reden, und werden mir entgegen halten, dass dieses ja längst widerlegt sei. In der Tat wollte ich das nicht; weil aber von Widerlegung gesprochen wird, so will ich nicht ausweichen. Um über Worte nicht zu streiten, so sei ich also meinetwegen widerlegt; es fragt sich nur, wie? Das will ich dem verständigen Leser sagen. Gesetzt, ich hätte berechnet, meinem Gläubiger 2000 schuldig zu sein, und es käme ein Anderer, rechnete mir nach, und sagte dann: deine Rechnung ist falsch, du bist ihm nicht mehr als 500 schuldig: so würde ich über eine solche Widerlegung meiner Rechnung, wofern sie Grund hätte, gewiss ebenso wenig Ursache haben verdrießlich, als mein Gläubiger, vergnügt zu sein. Nicht anders ist mein Leben Jesu widerlegt worden.
Als ich an die Ausarbeitung des Buches ging, lagen mir über die evangelische Geschichte, insbesondere ihre wunderbaren Bestandteile, die von jeher der Glaubenslehre die wichtigsten waren, zwei oder vielmehr dreierlei Ansichten vor43.
Die eine fasste dieselben, wie sie sich gaben, als Berichte von übernatürlichen Vorgängen, die sie als wirklich so geschehen annahm: solchen Glauben wusste ich nicht von mir zu erhalten.
Die andre sagte gleichfalls: die Geschichten sind wahr, aber es ist Alles natürlich zugegangen, die Erzähler verschweigen nur gewisse Mittelglieder, gewisse Nebenumstände, vielleicht weil sie meinten, sie verstünden sich von selbst, und daher der wunderbare Schein: zu einer so gewaltsamen Deutung der biblischen Erzählungen konnte ich mich nicht entschließen.
Eine dritte Ansicht lag im Hintergrund, welche bald die Tatsachen bald die Erzählungen für Blend- und Machwerke von Betrügern ausgab: ein solcher Verdacht war mir widerlich.
Was also tun, um einen Ausweg zu finden? Ich blickte mich in den heiligen Erzählungen der alten Religionen um, die heute Niemand mehr weder mit Herodot44 übernatürlich fasst, noch mit Euhemerus45 natürlich erklärt, ebensowenig mit den eifernden Kirchenvätern46 Teufelsspuk oder Betrug darin sieht; sondern man fasst sie als Sagen47, die sich aus der frommen Phantasie der Völker und ihrer Dichter heraus ohne Arg und Absicht so gebildet haben. So demnach, als Erzeugnisse der absichtslos dichtenden urchristlichen Sage, betrachtete ich die evangelischen Wundergeschichten wenigstens ihrer Mehrheit nach.
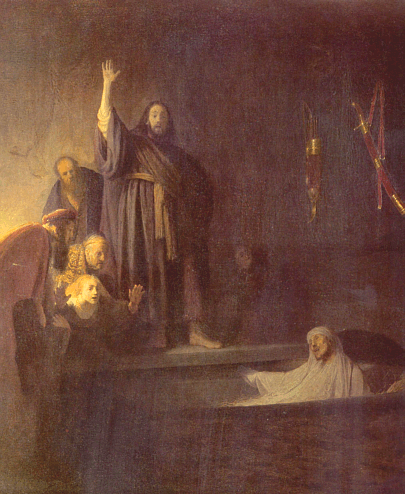
Abb.: "solchen Glauben wusste ich nicht von mir zu erhalten": Jesus weckt
Lazarus vom Tode auf (Johannesevangelium 11, 17-44) / von Rembrandt Harmensz.
van Rijn (1606 - 1669). -- Um 1630
Nun bin ich ja aber widerlegt. Es ist nachgewiesen, dass ein großer Teil dieser Erzählungen gar sehr absichtlich zu bestimmten und bewussten Parteizwecken erdichtet ist. Gut; wer kann dagegen etwas haben? Ich gewiss nicht. Wer kann sich dieser Widerlegung des "Leben Jesu"42 freuen? Gewiss nicht meine orthodoxen Gegner. Noch Eins. Das vierte Evangelium48 ging in meiner Rechnung nicht auf; es war nicht wohl denkbar, wie der Erzählungsstoff der drei ersten Evangelien ohne bewusste Absichtlichkeit eine so bedeutende Umwandlung erlitten haben sollte, wie sie im johanneischen Evangelium vor Augen liegt. Ich hatte das Wort dieses Rätsels noch nicht gefunden: seitdem ist bewiesen worden, dass das vierte Evangelium eine Komposition ist, deren Verfasser sich seines freien Schaltens mit dem geschichtlichen und Sagenstoff zu philosophisch-dogmatischen Zwecken so bewusst war, wie Plato dessen, dass er in seinen Dialogen den Sokrates gar manches reden und tun ließ, was diesem in Wirklichkeit nicht eingefallen war. Gut; wer verliert dabei? Ich wieder nicht; ich würde es nur, wenn es mir in der ganzen Sache um meine Meinung und meinen Namen zu tun gewesen wäre; es war mir aber vielmehr darum zu tun, Luft zu schaffen für die freie Bewegung des Geistes durch Wegräumung des alten Gemäuers, das ihn hier beengte: je gründlicher dieses mithin weggeschafft, je unwiederherstellbarer in die Luft gesprengt wird, desto lieber muss es mir sein. Ich also habe auch hier nichts verloren, und meine frommen Gegner nichts gewonnen; die man zudem jetzt, wenn sie (übrigens mit Recht) gegen das Zurechtmachen der Geschichte nach philosophischen Ideen eifern, auf ihr Lieblingsevangelium als ein wahres Musterbild solchen Verfahrens verweisen kann.
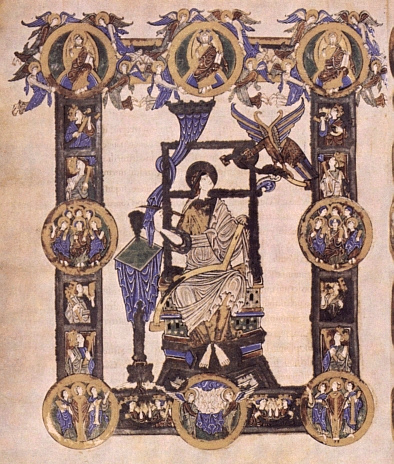
Abb.: "die man zudem jetzt, wenn sie (übrigens mit Recht) gegen das
Zurechtmachen der Geschichte nach philosophischen Ideen eifern, auf ihr
Lieblingsevangelium als ein wahres Musterbild solchen Verfahrens verweisen
kann": Evangelist Johannes. -- In: Evangelium des Grimbald. -- 11. Jhdt.
Solcher Zerstörung der Grundlagen der bisherigen Theologie arbeiteten gleichzeitig die übrigen Wissenschaften in die Hände. Das eifriger als je gepflegte Geschichtsstudium gab einen Maßstab für die Glaubwürdigkeit historischer Urkunden, an welchem gerade diejenigen biblischen Bücher, die der Theologie die wichtigsten waren, am wenigsten bestanden. Die zu staunenswerter Blüte sich entfaltenden Naturwissenschaften bauten immer vollständiger eine Weltanschauung aus, innerhalb deren sich der Kirchenglaube wie der stehen geblieben Rest eines alten Hauses in einem darüber gebauten Palaste störend und entstellend ausnahm. An das Missverhältnis der christlichen Vorstellungen von Himmel und Hölle zur Astronomie, der Schöpfungsgeschichte zu ebenderselben und zur Geologie, der biblischen Wunder zu den rechten und großen Wundern, in die uns Physik und Chemie den Einblick öffnen, ist kaum nötig zu erinnern. Und diese Ergebnisse der Geschichts- und Naturforschung blieben nicht, wie dies in früheren Jahrhunderten möglich gewesen war, ein Sonderbesitz der Gelehrten, sondern wurden, dem Geiste der Gegenwart gemäß, alsbald im Wetteifer für das Volk verarbeitet, in zahlreichen Büchern und Zeitschriften zum Gemeingut gemacht. Nur allein Humboldts Kosmos49 mit seinen populären Bearbeitungen hat dem Kirchenglauben unberechenbaren Abbruch getan, und ich kann es Humboldts Leichenredner in Berlin, meinem alten Freunde, nicht verdenken, wenn er dem heimgegangenen Naturforscher nur sehr bedingte Aussicht auf den Zutritt in den christlichen Himmel zu eröffnen wusste. a Vergessen wir auch unsre großen Dichter nicht. Erst in den letzten dreißig Jahren wurden sie gründlicher studiert, allgemeiner angeeignet: jede neue Auflage von Schillers oder Goethes Werken war eine neue Niederlage für die Orthodoxie.
a Wie richtig auch diesmal die geistliche Witterung war, haben die seitdem erschienen Briefe Humboldts an Varnhagen50 sattsam gezeigt.
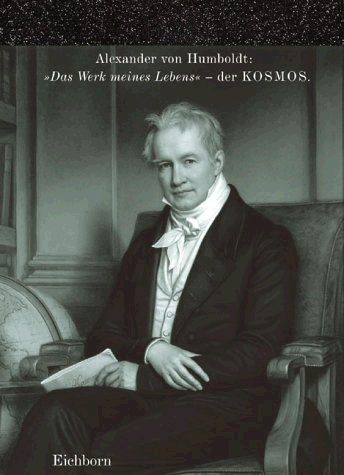
Abb.: "Nur allein Humboldts Kosmos49 mit seinen populären Bearbeitungen hat dem
Kirchenglauben unberechenbaren Abbruch getan"
Es standen also nun die Sachen so. Von Seiten der wissenschaftlichen Theologie war die Auflösung der bisherigen Glaubenslehre, samt deren vermeintlich historischer Grundlage in der biblischen, insbesondere evangelischen Geschichte, (jene großenteils schon durch Schleiermacher40, diese weniger durch mich, als durch Andere nach mir, die es besser gemacht haben) mit einer Schärfe und Bündigkeit vollzogen, deren sich kein Urteilsfähiger erwehren konnte. Von der andern Seite kamen Natur- und Geschichtsforschung diesen Ergebnissen bestätigend, ja fordernd entgegen. Und endlich war das alles längst über die abgeschlossenen Kreise hinaus ruchbar und im Zusammenwirken mit den Schriften unsrer neueren Klassiker zur allgemeinen Bildungsatmosphäre der Zeit geworden, die auf Jeden, der sich nicht gewaltsam abschloss, unwiderstehlich eindrang. Was sollte nun die Theologie tun? Das Rätsel der Sphinx51 war gelöst, aber in den Abgrund springen mochte sie nicht. Wir sind weit entfernt, ihr dies zu verargen; nur über die guten Thebaner müssen wir uns wundern, dass sie sich all den Spuk gefallen ließen und noch immer gefallen lassen, den die Alte seitdem angestellt hat.
Denn all ihr Bemühen ging von jetzt an dahin, die Welt, und am Ende gar auch sich selbst, glauben zu machen, es sei mit Nichten aus mit ihr, sie vielmehr immer noch ein gutes Haus, und die Gerüchte von ihrem Bankrott nur von leichtfertigen Buben ausgesprengt. Kurz sie gebärdete sich wie ein Kaufmann, der sich vom unvermeidlichen Ruin in der letzten Stunde noch zu retten sucht: sie schwindelte, nahm Anleihen auf, wo man ihr noch borgte, und verwirrte dadurch ihre Angelegenheiten nur um so mehr. Ein Blick auf die theologische Literatur der Gegenwart zeigt ein seltsames, widerwärtiges Schauspiel. Einem verschwindend kleinen Häuflein von solchen, die wissen und wissen wollen, wie es um die Theologie steht, die sich zum Geschäfte machen, die Wahrheit zu erforschen, und zur Pflicht, was sich ihnen als solche ergeben hat (vorbehaltlich manches menschlichen Fehlgriffs im Einzelnen) ungescheut auszusprechen, steht die unermessliche und äußerlich herrschende Mehrheit derer gegenüber, denen im Gegenteil Alles daran liegt, die sich aufdringende Wahrheit, von der sie sich in ihrem kirchlichen Besitzstande gefährdet sehen, vor sich selbst und Andern zu verstecken, das Unleugbare in Abrede zu stellen, das Offenbare zu vertuschen, zwingenden Gründen sich durch Seitensprünge zu entziehen, gegen jeden Beweis eine Ausrede, sei sie noch so schlecht, in Bereitschaft zu haben: und dieses Gebaren geht von der stumpfen oder feinen Selbsttäuschung bis zum frechen Umsichwerfen mit wissentlich unwahren Behauptungen fort. Dass man sich dabei notgedrungen einzelne Ergebnisse der Kritik angeeignet, dies aber durch Schmähen auf die Kritiker verdeckt, und jedenfalls die Konsequenzen ablehnt, trägt nur dazu bei, die Verworrenheit und Unlauterkeit des ganzen Treibens desto offenbarer zu machen. Wer hat seit zwanzig Jahren gegen die Tübinger Schule52, die Trägerin der theologischen Kritik, vom vermeintlich wissenschaftlichen, religiösen und sittlichen Standpunkt aus unermüdlicher gepoltert als Ewald53? Und nun hat er eine Geschichte Christi54 ans Licht treten lassen, die nur als ein sich selbst widersprechendes Gemisch von gläubiger, natürlicher und mythischer Auffassung, gehüllt in den Nebel einer überschwänglichen und doch zugleich hinterhältigen Sprache, bezeichnet werden kann. Da an diesem Beispiel alle dergleichen Rettungs- und Vermittlungsversuche sich beurteilen lassen, will ich einen Augenblick bei demselben verweilen.

Abb.: "ein sich selbst widersprechendes Gemisch von gläubiger, natürlicher und
mythischer Auffassung, gehüllt in den Nebel einer überschwänglichen und doch
zugleich hinterhältigen Sprache": Heinrich Ewald53 [Bildquelle:
http://www.uni-tuebingen.de/orientsem/ewald.htm. -- Zugriff am 2005-01-28]
Jesus ist in dieser Darstellung der Sohn Josephs, dabei aber sündlos und
menschlich vollkommen: Eigenschaften, die sich zwar für den Sohn Gottes von
selbst ergeben, für den Sohn Josephs aber schlechterdings nicht erweisen lassen.
Von den Wundern Jesu werden die Heilungswunder geschichtlich gefasst, aber nicht
als übernatürliche Taten eines ihm inwohnenden göttlichen Prinzips, sondern als
natürliche, wohl auch durch gewisse Handgriffe vermittelte und durch das
Vertrauen der Kranken in ihre Wirksamkeit bedingte Ausflüsse seiner Geistesmacht
und religiösen Vollkommenheit, als etwas, das jedem Menschen, der sich zu
derselben Stufe wie er erhöbe, möglich sein müsste. Nun lässt sich zwar der
altkirchliche Schluss von den Wundern Jesu auf seine Göttlichkeit gar wohl
hören, und wo diese im Sinne der Kirche anerkannt ist, machen hinwiederum die
Wunder keine Schwierigkeit; auch dass es vorzugsweise Heilungswunder waren
stimmt ganz gut, wo die Krankheit als Werk des Teufels betrachtet wird, dessen
Reich der Gottessohn zu zerstören hat: mit der menschlich religiösen
Vollkommenheit hingegen, wozu hier die Gottheit Christi abgeklärt ist, haben
Heilungswunder nichts zu schaffen; sonst müsste, wo wir höhere Religiosität
finden, wenigstens ein Anfang solcher höhern Heilkraft zu bemerken sein, was
doch außerhalb des Gebiets der Legende und des Aberglaubens nicht der Fall ist.
Wunder wie Sündlosigkeit stammen aus dem altkirchlichen Boden, und können in dem
modernen, in den sie sich hier ohne Wurzeln gesteckt finden, unmöglich
fortkommen.
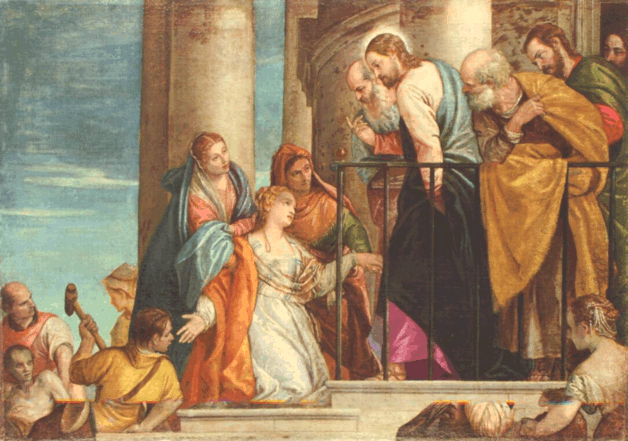
Abb.: "Wunder wie Sündlosigkeit stammen aus dem altkirchlichen Boden, und können
in dem modernen, in den sie sich hier ohne Wurzeln gesteckt finden, unmöglich
fortkommen": Die Heilung der Blutflüssigen (Mt 9, 20-22; Mk 5, 25-29; Lk 8,
43-44) / von Paolo Veronese (1528 - 1588). -- Um 1570
Was über die Heilung gegenwärtiger Personen hinausgeht, wie die Heilungen in die Ferne, die Totenerweckungen, die Speisungs- und Wasserverwandlungswunder samt den Raren auf dem See, alle dergleichen Erzählungen der Evangelien betrachtet Ewald als Ergebnisse davon, dass, wie er sich ausdrückt,
"dem Arbeiten der innersten Kräfte des reinsten und höchsten Geistes in Christus die hochgespannte Erwartung und der willige Glaube der seinigen entgegenkam", der nun in einzelnen Licht- und Höhepunkten "alles das Unendliche verwirklicht sah, das er von Jesu ahnete und hoffte."
Das heißt
entweder: Jesus machte auf seine Anhänger einen so mächtigen Eindruck, dass diese wohl auch Wunder von ihm zu sehen glaubten, wo doch Alles natürlich zuging.
Oder: der Trieb, ihren Stifter zu verherrlichen, war in der ältesten Christengemeinde so stark, dass sich dergleichen Erzählungen mythisch bildeten.
Wenn Ewald über das Speisungswunder55 bemerkt, was die erste Veranlassung zu der Erzählung gegeben, sei nicht mehr auszumitteln, jedenfalls lehre sie nur, wie da, wo sich der höhere Glaube mit der wahren Liebe verbinde, das Brot nie ausgehe, wie auf den geistigen Segen leicht auch der leibliche folge; wenn er die Verklärungsgeschichte einen Versuch nennt, das Erhabenste fasslich zu gestalten, wobei alles Niedere, was etwa als Anlass zum Grunde liege, sich in die reinste lichte Höhe verliere; wenn er über den Vorgang auf der Hochzeit zu Kana56 sagt: "das Wasser selbst wird unter dem Geiste Jesu zum besten Weine", und fast frivol hinzusetzt:
"wir würden uns diesen Wein, der seit jener Zeit auch uns noch immer fließen kann, selbst übel verwässern, wenn wir hier im groben Sinne fragen wollten, wie denn aus bloßem Wasser im Augenblick Wein werden könne; soll denn das Wasser im besten Sinne des Wortes nicht überall noch zu Wein werden, wo sein Geist in voller Kraft tätig ist?" —
so haben wir an allen diesen Stellen nichts Anderes als die mythische Auffassung, mag sich auch Ewald dieses Ausdrucks, angeblich weil er zu innig mit dem heidnischen Religionswesen verwachsen sei, sorgfältig enthalten. Aber enthielte er sich nur nicht eben so sorgfältig, an irgend einer Stelle bestimmt und mit dürren Worten zu sagen, dass er dergleichen Erzählungen für unhistorisch ansieht! Allein da wird mit niederer und höherer Geschichte, mit echter Erinnerung und höherer Darstellung, gespielt und gemunkelt, dass doch ja noch ein heiliger Dunst, noch ein Trost mit vermeintlich geschichtlicher Grundlage, die aber ein reiner Spuk ist, übrig bleibe.
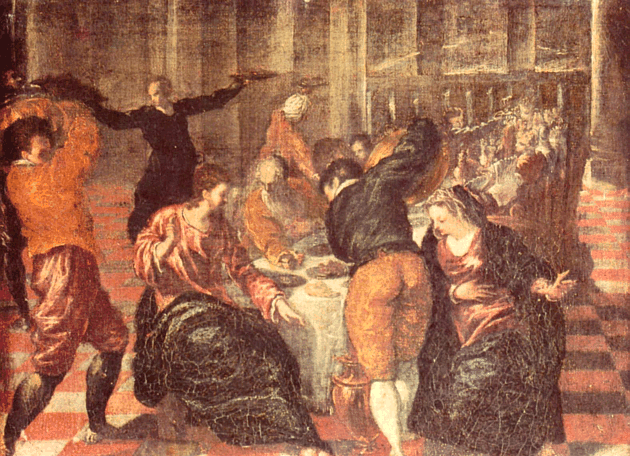
Abb.: "wir würden uns diesen Wein, der seit jener Zeit auch uns noch
immer fließen kann, selbst übel verwässern, wenn wir hier im groben Sinne fragen
wollten, wie denn aus bloßem Wasser im Augenblick Wein werden könne; soll denn
das Wasser im besten Sinne des Wortes nicht überall noch zu Wein werden, wo sein
Geist in voller Kraft tätig ist?" (Ewald): Hochzeit zu Kana (Joh 2,
1-11) / von El Greco (1541 - 1614). -- Um 1600
Diese zweideutige Haltung behauptet die Darstellung Ewalds bis zum Schlusse der evangelischen Geschichte, bis zur Auferstehung, wenn er diese als die ewige Verherrlichung bezeichnet, wenn er sagt, Alles, was Jesus als Christus leiten musste, sei mit seinem Tode vollendet gewesen, was von ihm über das Grab hinausreichte, sei schon als Frucht und Wirkung seines irdischen Tuns zu betrachten, und gehöre daher eigentlich zur Geschichte der Apostel: so hatte Weiße57 gewiss Recht, dies zustimmend so zu deuten, dass nach Ewalds Ansicht jene Ereignisse nur dem inneren Seelenleben des Apostelkreises, nicht mehr der äußeren Lebensgeschichte des Meisters angehören; und wir hinwiederum nehmen uns das Recht, auch diese, immer noch nicht ganz unumwundenen Worte dahin zu erklären, dass Beide, Weiße wie Ewald, in den Erscheinungen des Auferstandenen nur subjektive, psychologisch zu erklärende Visionen sehen.
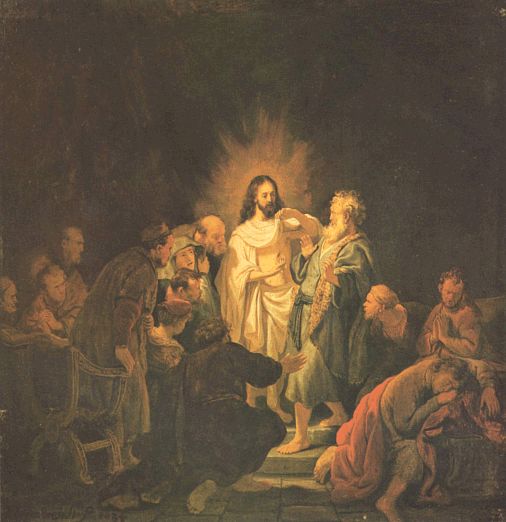
Abb.: "dass Beide, Weiß wie Ewald, in den
Erscheinungen des Auferstandenen nur subjektive, psychologisch zu erklärende
Visionen sehen": Der auferstandene Jesus offenbart sich dem ungläubigen Thomas
(Joh 20, 24-29) / von Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 - 1669). -- 1634
Das alles, wie gesagt, wäre schon gut, würde es nur offener ausgesprochen. Aber freilich, wie kann man deutlich heraussagen, dass man Erzählungen, wie die von dem Wunder zu Kana56, und vollends eine so bestimmte und umständliche wie die von der Auferweckung des Lazarus58, nicht für historisch hält, wenn man dabei wie Ewald53 gegen die verhasste Tübinger Schule52 darauf beharren will, der Verfasser des Evangeliums, in dem sie stehen, sei ein Augenzeuge, ja der vertrauteste Jünger des Herrn gewesen? Schon Weiße57 hat ihm vorgehalten, wie wenig das angeht, und sich daher, weil er doch die johanneischen Reden nicht ganz missen mag, seinerseits zur Teilung des vierten Evangeliums in einen apostolischen und einen nichtapostolischen Bestandteil entschlossen. Wäre nur nicht gerade dieses Evangelium selbst jener ungenähte Leibrock59, von dem es uns erzählt, um den man wohl losen, ihn aber nicht zertrennen kann. Davon sind nun leider alle die Ansichten und Darstellungen, die heutigen Tages zwischen dem streng kirchlichen und dem freiesten Standpunkte vermitteln möchten, das gerade Gegenteil: sie sind aus allerlei Fetzen der verschiedensten Stoffe zusammengeflickt, die unmöglich in die Länge zusammenhalten können. a
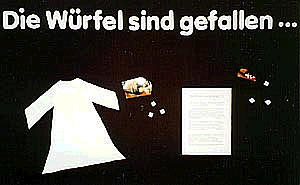
Abb.: "Wäre nur nicht gerade dieses Evangelium selbst jener ungenähte Leibrock,
von dem es uns erzählt, um den man wohl losen, ihn aber nicht zertrennen kann":
als um Jesu "Rock" gewuerfelt59 wurde, fielen die Wuerfel zu
unserer Rettung / von Bernd Marzinkewitsch
[Bildquelle:
http://www.net-art.de/tjs/sk/marzin.htm. -- Zugriff am 2005-01-28]
a Da ich hier zufällig auf Ewald53 zu sprechen gekommen bin, wird man vielleicht ein Wort über die Ungezogenheiten von mir erwarten, mit denen dieser Mann seit einer Reihe von Jahren mich zu überschütten nicht müde wird. Ich kann aber nur sagen, dass und warum ich mich um dieselben weder bisher gekümmert habe, noch fortan kümmern werde. Was will man mit einem Manne machen, der offenbar nicht zurechnungsfähig ist? In Folge von Gelehrtendünkel längst am Überschnappen, hatte ihm seit seinem Weggang von Göttingen die Einbildung, nun gar auch eine politische Größe zu sein, das Gehirn vollends zerrüttet. Wie er sich dann herbeiließ, den Ruf nach Tübingen anzunehmen, glaubte der Göttinger Professor, an der Schwabenuniversität eine Aufnahme ansprechen zu dürfen, ähnlich der des Orpheus unter den Bestien, oder des Kolumbus unter den Bewohnern der neuen Welt. Es kam aber anders. Die Schwaben fanden seine Gelehrsamkeit nicht unerhört, wohl aber seinen Hochmut. Dabei vermissten sie philosophische Durchbildung des Denkens wie humane des Charakters. Neben Einem Manne52 besonders, dem sein Fach ihn nahe stellte, konnte er in allen diesen Beziehungen nicht aufkommen, und in einer wohlbekannten Anstalt war eine Bildung herkömmlich, der er nicht Genüge tat. Daher sind bald die wütenden Ausbrüche seines Hasses gegen jenen Mann und dessen Schüler, diese Anstalt und ihre Einrichtungen. Und unerachtet seine verunglückte Schwabenmission jetzt längst beendigt ist, kehren dennoch, zwischen theologischem Orakeln, politischem Irrereden, Sendschreiben an Papst und Kardinäle, jene Wutanfälle und Ausfälle regelmäßig wieder. Je nun, wem Leute einer gewissen Art auf der Straße nachschreien, der tut am klügsten, seines Weges ruhig weiter zu gehen.
Abb: "Neben Einem Manne besonders, dem sein Fach ihn nahe stellte, konnte er in allen diesen Beziehungen nicht aufkommen": F. C. Baur52
Und um solche, nicht im edlen Kampf zerfetzte, sondern von Hause aus lumpige und gestückelte Fahnen sollte sich eine Gemeinde, sollte sich insbesondere die theologische Jugend sammeln? Um wenigstens das Letztere zu erreichen, werden ganz besondere Mittel nötig sein. Auf diese Jugend dringt ja in der Atmosphäre der Hochschulen der Geist der Neuerung am gewaltigsten ein. Wie gefährlich sind gleich die Vorbereitungswissenschaften! Die Philologie mit ihren alten Heiden; die Philosophie nun gar mit ihrem noch immer nicht überwundenen pantheistischen Hang60. Hier weiß man sich zwar dadurch zu helfen, dass man nicht leicht mehr einen Philosophen anstellt, es habe ihm denn zuvor Herr Fichte61 der Sohn oder Herr Weiße57 der Enkel (wie einem Schönheitswasser oder Wanzenpulver) die Unschädlichkeit attestiert; woraus sich, beiläufig gesagt, die staunenswerte Blüte der Philosophie auf unsern Hochschulen hinlänglich erklärt. Aber die schlimmen gedruckten Bücher. Wer weiß, ob der Kandidat nicht insgeheim den Hegel, den Feuerbach62 studiert? Man muss ihm keine Zeit dazu lassen. Man muss das vorbereitende Studium möglichst abkürzen, und was die Hauptsache ist, gleich von Anfang zwischen die philologischen und philosophischen Vorlesungen theologische einschieben. So stört man den Ausbau einer modernen Weltanschauung in dem Kopfe des Studierenden, so gewinnt unvermerkt sein Horizont die kirchlichen Schranken, über die er bald nicht mehr hinaussieht. Um Alles darf er sich nie die reine Frage stellen: was ist wahr? sondern nur: wie viel darf ich einräumen, ohne meiner geistlichen Bestimmung etwas zu vergeben? An diesem Faden ist dann der Kandidat auch während seines eigentlichen theologischen Studiums zu halten. Nicht frühe genug kann man den kirchlichen Eifer in ihm wecken. Das geistliche Herrschen hat auch in der protestantischen Kirche, der es eigentlich fremd sein sollte, und in der es wenigstens in Vergleichung mit der katholischen merklich eingeschränkt ist, einen unwiderstehlichen Reiz. Seelen lenken, ganze Bevölkerungen und einzelne einflussreiche, oft auch übrigens sehr verständige Menschen an geheimem Bande führen, vielleicht gar einmal hohe, ja allerhöchste Seelen63 zu regieren bekommen, welch lockendes Ziel für den jungen Ehrgeiz. Und durch welcherlei Ansichten man sich in der Prüfung und sonst vorwärts bringe, durch welche dagegen sich jede Aussicht verschließe, darüber lassen die Herren vom Kirchenregiment kein Dunkel bestehen. Also — fort mit Kritik und Zweifel! ich glaube, Herr Kirchenrat! so gewiss als Sie selber glauben.
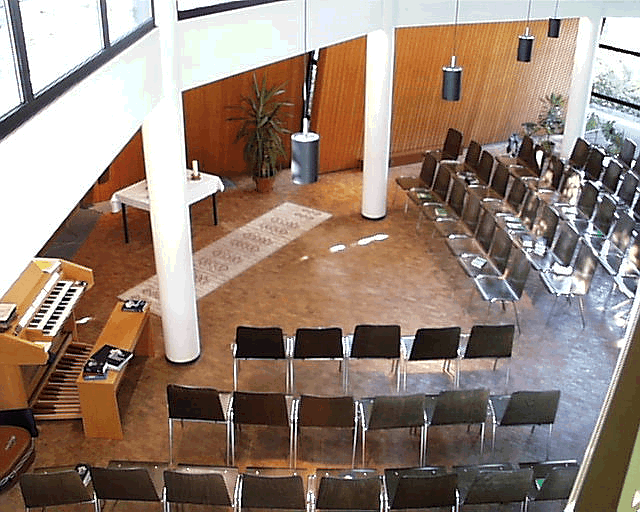
Abb.: "So stört man den Ausbau einer modernen Weltanschauung in dem Kopfe des
Studierenden, so gewinnt unvermerkt sein Horizont die kirchlichen Schranken,
über die er bald nicht mehr hinaussieht": evangelikales Theologenheim
Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen [Bildquelle:
http://www.bengelhaus.de/geschichte.htm. -- Zugriff am 2005-01-28]
Die Gewaltsamkeit, mit der ein solcher Kandidat seine Vernunft zum Schweigen gebracht hat, wirkt nun aber durch das ganze Leben in ihm nach. Er ist unduldsam gegen Alle, in denen er eine minder fügsame Vernunft als die seinige antrifft oder auch nur vermutet. Sein ganzes Wesen behält etwas Ungesundes, Leidenschaftliches; er ist, bei aller Bildung vielleicht, bei aller Selbstbeherrschung, doch im Innern ein Fanatiker. Und nun frage ich, ob das nicht der Durchschnittscharakter unsres theologischen Nachwuchses ist? Die jungen Leute kann man bedauern; der Vorwurf trifft die Lehrer und die Kirchenbehörden. Am meisten jedoch ist das Volk zu beklagen, dessen künftige Religions- und Sittenlehrer zu nichts früher und eifriger angehalten werden, als den unbefangenen Wahrheitssinn in sich zu ertöten, sich selbst zu belügen.
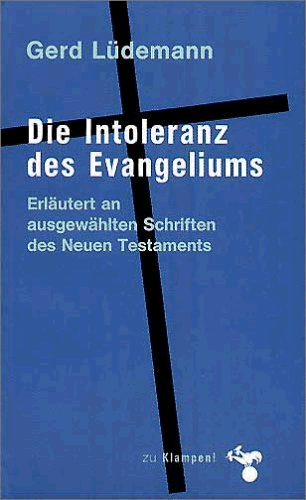
Abb.: "er ist, bei aller Bildung vielleicht, bei aller Selbstbeherrschung, doch
im Innern ein Fanatiker": Titel eines Buches, das die Wurzeln dieses Fanatismus
belegt
Diesem neukirchlichen Unwesen gegenüber hat sich hauptsächlich aus Anhängern Schleiermachers40 (nachdem übrigens mehrere seiner betrautesten Schüler höchst verderbliche Pfaffen geworden sind) ein Kreis von solchen gebildet, die nach des Meisters Vorgang das fromme Gefühl betonen, die christliche Religion von der Theologie wohl unterschieden, und der letzteren die Forschung so weit freigegeben wissen wollen, als es unbeschadet der ersteren geschehen kann. Gewiss, die Religion beruht nicht auf der Theologie, sondern umgekehrt; allein die Religion bildet sich naturgemäß eine Theologie an, und wenn diese anbrüchig wird, so kann auch jene einer Veränderung auf die Länge nicht entgehen. Des Baumes Leben ist nicht im Holz, sondern in der Rinde, dem Bast, dem Splint; woraus sich aber alljährlich neue Holzringe absetzen und dem Baum Gestalt und Haltung geben. Nun bekommt irgendwo die Rinde einen Riss, Feuchtigkeit dringt ein, das Holz fängt an zu faulen, wir haben einen hohlen Baum vor uns. Dieser hohle Baum ist die heutige Kirche und Theologie. Das Holz ist das Dogma, das ist teils schon geschwunden, teils faul und mit dem Finger zu zerdrücken wohin man rührt. Die Religion lebt noch, es steigt noch Saft durch Bast und Rinde in die Zweige und Blätter auf; aber Schönheit und Kraft des Baumes sind dahin, der nächste Sturm droht ihn zu spalten oder gar umzureißen. Da legen sie Klammern um die Äste: das sind die Beichtstühle und Kniebänke, die neuen Agenden und die neue Kirchenzucht, mit der man der protestantischen Kirche aufhelfen möchte; allein diese plumpen Klammern würden, wenn der Sturm kommt, den Fall des Baumes nur beschleunigen. Ich bin sonst kein Freund von langgesponnenen Allegorien; aber diese ist die Sache selbst.

Abb.: "Das Holz ist das Dogma, das ist teils schon geschwunden, teils faul und
mit dem Finger zu zerdrücken wohin man rührt": Die Bekenntnisschriften, die
dogmatische Grundlage der lutherischen Kirchen
Für die kirchliche Praxis, für die Tätigkeit des Geistlichen als Prediger und Seelsorger, ist der Standpunkt jener Schleiermacherschen Freunde gewiss der beste der sich vorerst einnehmen ließ, und es kann sich auf demselben, wie die Erfahrung zeigt, eine höchst segensreiche geistliche Wirksamkeit entwickeln: aber wissenschaftlich ist er schwach, weil er von der Theologie möglichst absieht und absehen muss.
Von keiner Seite, finde ich, sagt man gerne das letzte aufrichtige Wort. Und warum denn nicht? Ist es doch unter allen nur einigermaßen Gebildeten und Denkenden längst ein offenes Geheimnis, dass Keiner mehr an das kirchliche Dogma glaubt. Zu glauben glaubt, das räume ich ein; aber wirklich glaubt, das leugne ich. Für Keinen mehr ist das apostolische Symbolum64 oder die Augsburgische Konfession65 ein angemessener Ausdruck seines religiösen Bewusstseins. Keiner glaubt mehr an irgend eines der neutestamentlichen Wunder (von den alttestamentlichen gar nicht zu reden), von der übernatürlichen Empfängnis an bis zur Himmelfahrt. Entweder er erklärt sie sich natürlich, oder er fasst sie als Legenden. Und steht es bei denkenden Laien so, so steht es bei den Geistlichen, wie wir gesehen haben, nicht besser. Wozu also die Winkelzüge? Wozu die Heuchelei vor Andern und vor sich selbst? Ist es des Menschen in seinem Verhältnis zur Religion würdig, sich ihr gegenüber wie ein feiger und tückischer Sklave mit halben Worten und leeren Ausflüchten zu behelfen? Warum nicht offen mit der Sprache herausgehen? Warum nicht gegenseitig bekennen, dass man in den biblischen Geschichten nur noch Dichtung und Wahrheit, in den kirchlichen Dogmen nur noch bedeutsame Symbole anerkennen kann, dass man aber dem sittlichen Gehalt des Christentums, dem Charakter seines Stifters (soweit unter dem Wundergehäuse, in das seine ersten Lebensbeschreiber ihn gesteckt haben, die menschliche Gestalt noch zu erkennen ist) mit unveränderter Verehrung zugetan bleibt? Doch ob wir uns dann wohl noch Christen heißen dürfen? Ich weiß es nicht; aber kommt es denn auf den Namen an? Das weiß ich, dass wir dann erst wieder wahr, redlich und unverschroben, also bessere Menschen sein werden, als bisher. Auch Protestanten werden wir bleiben, ja dann erst rechte Protestanten sein.
Im Grunde haben es einsichtsvolle Geistliche mit Dogma und biblischer Geschichte längst nicht anders gehalten. Wenn Schleiermacher40 über eine Wundererzählung zu predigen hatte, pflegte er sie regelmäßig zu allegorisieren. Bei andern Texten hob er nicht die dogmatische, sondern die psychologische und moralische Seite hervor. Nur über die Person Christi liebte er zu dogmatisieren; doch, wie sich nach dem früher Gesagten von selbst versteht, in ganz anderem als dem kirchlich rechtgläubigen Sinne. Es war gleichsam eine Konversation mit dem Menschheitsideale, dessen Bild Schleiermacher dadurch für sich und Andere lebendiger und andringlicher machte, dass er es als wirklich einmal in bestimmten menschlichen Verhältnissen dagewesenes und in der Kirche fortwirkendes sich vorstellte. Übrigens waren diese christologisierenden Predigten keineswegs seine besten, vielmehr zum großen Teile von einer gewissen Eintönigkeit so wenig als das vorzugsweise christologische Evangelium freizusprechen; weit reicher an realem Gehalt waren die psychologisch-moralischen, wie jene seitdem auch im Druck erschienenen Vorträge über das Markusevangelium66, die der Schreiber dieser Vorrede einen Winter lang in unvergesslichen Sonntags-Frühstunden selbst mit angehört hat. Ähnlich wie Schleiermacher verfahren verständige und gebildete Geistliche, so weit sie nicht neukirchlich pikiert sind, heute noch, und tun den Verständigsten und gewiss auch den Besten ihrer Zuhörer damit Genüge.

Abb.: Schleiermachers letzte Erbauungspredigt. -- 1834
Wenn ein der leiblichen Notdurft dienendes Erzeugnis der Fremde so allgemeines Bedürfnis geworden ist, dass es trotz aller Einfuhrverbote doch fortwährend in Masse eingeschwärzt wird, was tut eine kluge und wohlmeinende Regierung? Sie lässt es gegen mäßigen Eingangszoll zu. Dieser Eingangszoll sei hier die Verpflichtung zum Festhalten an den sittlichen Wahrheiten des Christentums, zur Achtung für die Hüllen, unter denen sie der Menschheit zuerst zum Bewusstsein gekommen, zur Schonung derer die diese Hüllen noch nicht missen mögen. Sperrt man nur den Geist nicht gewaltsam ab, zwingt man nur Niemand zum Lügen und heucheln, so wird schon Alles von selbst werden. Immer mehr sehen wir ja die phantastische Strahlenbrechung schwinden, die der Menschheit, was sie stets nur aus sich selber schöpfte, als von außen kommende Offenbarung vorspiegelte. Wem es gelingen wird, aus dem begriffenen Wesen des Menschen in seinen natürlichen und geselligen Verhältnissen Alles was ihm obliegt, was ihn erhebt und beruhigt, vollständig und sicher abzuleiten, und dies fasslich und ergreifend für Alle darzustellen, der wird die Geschichte der Religion beschließen.
Das Thema, in das ich da hineingeraten bin, macht mir alte Zeiten wieder neu. Eben in diesen Tagen ist es ein Vierteljahrhundert, dass mein Leben Jesu42 zum erstenmal67 in die Welt ausgegangen ist. Die Theologen werden das fünfundzwanzigjährige Jubiläum dieses Buches schwerlich feiern wollen, unerachtet es mehr als Einem von ihnen erst zu allerlei hübschen Gedanken, dann zu Amt und Würden verholfen hat. Aber gar mancher bessere Mensch in allen Landen, der von dem Studium dieses Buchs seine geistige Befreiung datiert, ist mir, das weiß ich, lebenslänglich dankbar dafür, und macht so, ohne daran zu denken, im Stillen die Feier mit. Ich selbst sogar könnte meinem Buche grollen, denn es hat mir (von Rechtswegen! rufen die Frommen) viel Böses getan. Es hat mich von der öffentlichen Lehrtätigkeit ausgeschlossen, zu der ich Lust, vielleicht auch Talent besaß; es hat mich aus natürlichen Verhältnissen herausgerissen und in unnatürliche hineingetrieben; es hat meinen Lebensgang einsam gemacht. Und doch bedenke ich, was aus mir geworden wäre, wenn ich das Wort, das mir auf die Seele gelegt war, verschwiegen, wenn ich die Zweifel, die in mir arbeiteten unterdrückt hätte: dann segne ich das Buch, das mich zwar äußerlich schwer beschädigt, aber die innere Gesundheit des Geistes und Gemüts mir, und ich darf mich dessen getrösten, auch manchem Andern noch, erhalten hat. Und so bezeuge ich denn zu seinem Ehrentag, dass es geschrieben ist aus reinem Drang, in ehrlicher Absicht, ohne Leidenschaft und ohne Nebenzwecke, und dass ich allen seinen Gegnern wünschen möchte, sie wären, als sie dagegen schrieben, ebenso frei von Nebenabsichten und Fanatismus gewesen. Ich bezeuge ihm ferner, dass es nicht widerlegt, sondern nur fortgebildet worden ist, und dass, wenn es jetzt wenig mehr gelesen wird, dies daher kommt, dass es von der Zeitbildung aufgesogen, in alle Adern der heutigen Wissenschaft eingedrungen ist. Ich bezeuge ihm endlich, dass die ganzen fünfundzwanzig Jahre her über die Gegenstände, von denen es handelt, keine Zeile von Bedeutung geschrieben worden ist, in der sein Einfluss nicht zu erkennen wäre.
Doch was rede ich von mir und meinem Buch? Ich wollte ja diesmal einen Andern, Größern einführen; einen solchen allerdings, der über diese Vorrede, könnte er sie lesen, gewiss am wenigsten zürnen würde.
Heidelberg, im Mai 1860.
David Friedrich Strauß
Erläuterungen
1 Hutten
"Hutten, Ulrich, Ritter von, ritterlicher Vorkämpfer des Humanismus und der geistigen Freiheit, geb. 21. April 1488 auf dem Stammsitz seiner Familie, der Burg Steckelberg bei Fulda, gest. 1523, war der Sohn des Ritters Ulrich v. Hutten und der Ottilia v. Eberstein. Hutten kam 1499 in das Stift zu Fulda, um geistliche Erziehung zu genießen, verließ 1505 heimlich das Kloster und studierte in Köln bei Johann Rhagius, dann in Erfurt bei Eoban Hesse und Maternus Pistoris Latein und Griechisch. Nachhaltig wirkte dort auf ihn Mutianus Rusus von dem benachbarten Gotha aus. Seinem Lehrer Rhagius folgte Hutten 1506 nach Frankfurt a. O., wo er Bakkalaureus wurde, und 1507 nach Leipzig. In diese Zeit fallen seine ersten, wenn auch noch unfertigen poetischen Versuche: eine Elegie an Eoban, ein Lobgedicht auf die Mark, eine Ermahnung zur Tugend. Seit 1509 trieb er, von Reiselust und Wissbegierde gelockt, ein unstetes Wanderleben, verlor bei der Eroberung von Pavia 1512 sein Letztes und trat aus Not t 513 in die Reihen der kaiserlichen Landsknechte. Auf die Kunde von der Ermordung Hans v. Huttens schrieb er fünf Reden gegen Herzog Ulrich (s. d.) von Württemberg, die vornehmlich dessen Achtung herbeiführten, und ein »Tyrannengespräch« (»Phalarismus«), worin er zuerst seinen Wahlspruch: »Jacta est alea« (»Ich hab's gewagt«) gebrauchte. Diese Teilnahme an dem Schicksal seines Verwandten versöhnte seinen Vater wieder mit ihm, der mit seiner Flucht aus dem Kloster und seinen wissenschaftlichen Studien sehr unzufrieden gewesen war. Die Angriffe der Kölner Dominikaner auf Reuchlin (s. d.) erregten Huttens lebendigste Teilnahme und veranlassten sein wohl 1514 gefertigtes Gedicht »Triumphus Capnionis«, worin er die Gegner des Humanismus als Feinde der Wissenschaften und der beginnenden Aufklärung angriff. Gegen den Anfang des Jahres 1516 erschienen die »Epistolae obscurorum virorum« (s. d.). Hutten schrieb in Bologna eine Anzahl ähnlicher Briefe, die 1517 als 2. Teil gedruckt wurden. Aus Italien 1517 nach Deutschland zurückgekehrt, erhielt Hutten in Augsburg von Kaiser Maximilian den Lorbeerkranz und den Goldenen Ring. Zum Dichter und Universitätsredner ernannt, machte er sich den Kampf gegen Rom und für das von der Kurie ausgebeutete deutsche Vaterland zur Lebensaufgabe. Er nahm die Dienste des humanistenfreundlichen Erzbischofs Albrecht von Mainz, der bekanntlich den Anlass zu Luthers Angriff auf den Ablass gab und, innerlich über Roms Geldgier empört, mit Huttens kecker Kampfweise wohl zufrieden war. Dieser hatte soeben die Schrift des Laurentius Valla: »De donatione Constantini quid veri habeat«, herausgegeben und damit die weltliche Herrschaft des Papstes in ihrer Grundlage angegriffen. Während des Augsburger Reichstags, den er 1518 mit dem Erzbischof besuchte, ermahnte er in seiner Schrift »Ad principes germanos ut bellum Turcis inferant exhortatoria«, der deutschen Nation ihre Zerrissenheit vor Augen stellend, zur Einigkeit und zum gemeinsamen Kampf gegen den Glaubensfeind, dann verließ er, des Hoflebens müde (er geißelte es damals in einem Dialog), den Dienst des Mainzer Erzbischofs und beteiligte sich in Schwaben an dem Feldzug gegen Herzog Ulrich (1519). Hutten trat jetzt Franz v. Sickingen (s. d.), der die politische Wiedergeburt Deutschlands anstrebte, näher, und ebenso Luther. In mehreren Gesprächen, unter denen der »Vadiscus, oder die römische Dreifaltigkeit« das bedeutendste ist, deckte er das materielle und moralische Unheil auf, das von Rom aus seit langem schon über Deutschland hereingebrochen sei. Von fast gleicher Bedeutung wie der »Vadiscus«, aber noch vollendeter in der Form waren »Die Anschauenden«; auch hier fehlt es nicht an Spottreden über den hochmütigen Klerus (sein Repräsentant ist Cajetan), aber die Hauptsache ist eine Schilderung der deutschen Zustände, wie sie dem Sonnengott von seinem erhöhten Standpunkt aus erscheinen. In der Vorrede zu einer Sammlung von kirchenpolitischen Streitschriften aus dem 14. Jahrh. warnte Hutten die Nation vor den schriftstellernden Schmeichlern und munterte sie zum Kampfe für die Geistesfreiheit auf (»De schismate extinguendo etc.«, 1520).
Im Sommer 1520 war Hutten an den Hof des Erzherzogs Ferdinand nach den Niederlanden gegangen, wo man damals die Ankunft des neuen Kaisers, Karls V., erwartete, kehrte aber bald zurück, denn von Rom aus war an Erzbischof Albrecht der Befehl ergangen, die Frechheit der Lästerer, unter denen sein Diener Hutten der schlimmste sei, zu züchtigen. Hutten fand einstweilen eine Zuflucht auf der Ebernburg bei Franz v. Sickingen, verteidigte sich von hier aus in einem Sendschreiben an die Deutschen aller Stände, begann noch vor Ende 1520 um der größern Wirkung willen deutsch zu schreiben mit der Schrift »Klag und vormanung gegen den übermässigen gewalt des Bapsts«. Der Wormser Reichstag, die Besorgnis für Luthers Leben und den Ausgang der guten Sache veranlassten Hutten zu einer wahren Flut von Schmähschriften gegen die Römlinge, vor allen gegen den Legaten Aleander; er leitete sie durch ein Sendschreiben an Kaiser Karl ein, worin er den jugendlichen Monarchen vor seinen geistlichen Ratgebern warnte. Doch Karl nahm das Schreiben ungnädig auf und änderte seine Haltung gegen Luther auch nicht, als ihn Hutten in einem zweiten milder zu stimmen versuchte. Luthers Verurteilung versetzte ihn in die größte Entrüstung. Doch vergebens bemühte er sich, einen Bund der Ritter und Städte herbeizuführen; Sickingen brachte zwar 1522 einen Bund der rheinischen Ritterschaft zustande, doch misslang sein Zug gegen den Erzbischof von Trier; Hutten hatte, wenn er Sickingens Feinden in die Hände geriet, das Schlimmste zu befürchten und floh nach Basel, wo ihm sein langjähriger Mitstreiter Erasmus, zu weichmütig für jene eiserne Zeit, die Aufnahme versagte; Zwingli dagegen gewährte ihm eine Zuflucht, fand aber einen gebrochenen Mann. Jahrelang hatte Huttens Feuergeist gegen die verheerende Krankheit (Franzosenkrankheit, Syphilis), die auch ihn befallen hatte, angekämpft; trotz des Besuchs der warmen Quellen in Pfäfers schritt die Krankheit fort. Zwingli erwirkte ihm zwar bei einem heilkundigen und wohlgesinnten Geistlichen Aufnahme auf der Insel Ufnau im Züricher See, aber wenige Monate nach Sickingens traurigem Untergang machte ein schneller Tod den Leiden des Freundes ein Ende (in den letzten Tagen des August oder Anfang September 1523). Die Idee, für die Hutten zuletzt, aus dem literarischen Humanismus kommend, gelebt hatte, Deutschland zugleich kirchlich und politisch neu zu gestalten, ging mit ihm zu Grabe.
Seine Werke hat zuletzt Böcking herausgegeben (Leipz. 1859-62, 5 Bde., mit 2 Supplementbänden); ein Verzeichnis der Schriften Huttens enthält Böckings »Index bibliographicus Huttenianus« (das. 1858). Die Gespräche sind übersetzt und erläutert von D. Strauß (Leipz. 1860). 1889 wurde Hutten und Sickingen ein großes Denkmal (von Cauer) auf der Ebernburg errichtet; vgl. auch Tafel »Berliner Denkmäler II«, Fig. 3. Vgl. D. Strauß, Ulrich von Hutten (6. Aufl., Bonn 1895); Szamatólski, U. v. Huttens deutsche Schriften (Straßb. 1891); Volksschriften von Lange (Gütersl. 1888), Reichenbach (2. Aufl., Leipz. 1888), Schott (Halle 1890), Pappritz (Marb. 1893) u. a. - Die heldenhafte Persönlichkeit Huttens übte übrigens auch auf die neuere Dichtung eine mächtige Anziehungskraft. In epischer Form wurde sein Leben behandelt von Ernst v. Brunnow in dem Roman »Ulrich v. Hutten« (Leipz. 1843), von A. E. Fröhlich in den Gesängen »Ulrich v. Hutten« (Zürich 1845), von A. Schlönbach in einem gleichnamigen Epos (Berl. 1862), am vortrefflichsten von K. F. Meyer in der lyrischepischen Dichtung »Huttens letzte Tage« (Leipz. 1871). Zum Helden eines Dramas machten ihn R. Gottschall, Hutten Köster, G. Logau, K. Nissel und K. Berger."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
2 Gespräche
"GESPRAECH BUECHLIN HERR ULRICHS VON HUTTEN. Feber das Erst. Feber das Ander. Wadiscus. oder die Roemische dreyfaltigkeit. Die Anschawenden. Vier Dialoge von Ulrich von Hutten, erschienen 1521. – Das ursprünglich lateinisch verfasste und vom Autor selbst ins Deutsche übersetzte Werk umfasst vier fiktive Gespräche über zeitpolitische Themen der Reformationszeit, vor allem über die Missstände innerhalb der Geistlichkeit und die Unterdrückung der deutschen Nation durch die römische Kirche. In paarweise gereimten Versen stellt der Autor zu Beginn der Dialoge – mit Ausnahme des ersten – das jeweilige Gesprächsthema vor und wendet sich überdies am Ende des zweiten und dritten Gesprächs mit einer belehrenden Schlussfolgerung an den Leser. – Die Gesprächspartner in den beiden ersten Dialogen Das erste Feber und Das ander Feber sind das »Fieber«, eine Personifikation der Zeitkrankheit, und der Autor. Auf der Suche nach einem neuen »Wirt« wendet sich das Fieber an Hutten, der den unerwünschten Gast jedoch abweist und versucht, ihm eine andere »herberg« zu verschaffen. Da das Fieber nur mit einem wohlhabenden Mann abzufinden ist, empfiehlt Hutten den Kardinal Kajetan, der anlässlich des Augsburger Reichstags (1518) gerade in Deutschland weilt. Das Fieber lehnt jedoch ab, weil ihm der päpstliche Legat, der deutsche Speisen und Getränke verschmäht, zu mager ist. Auch Huttens Vorschlag, die reichen Fugger heimzusuchen, sagt dem Fieber nicht zu, da diese zu viele gute Ärzte haben. Die in Saus und Braus lebenden Mönche vermögen gleichfalls nicht, es von seinem Vorsatz, bei Hutten zu bleiben, abzubringen. Am Ende gelingt es diesem jedoch, das Fieber zu einem genusssüchtigen Domherrn weiterzuschicken. Der Dialog schließt mit einer gereimten Begrüßungsrede des Fiebers an den Domherrn.
Im zweiten »buechlin« bittet das Fieber erneut bei Hutten um Unterkunft. Da dieser es jedoch barsch abweist, gelingt es dem listigen Gast, Hutten in ein Gespräch über die wüsten Ausschweifungen und den üppigen Lebenswandel des Domherrn und allgemein über das »verkerte leben der geystlichen« zu ziehen. Hutten bleibt zwar unnachgiebig, ist aber von den Ausführungen des Fiebers so sehr beeindruckt und erschüttert, dass er aus Sorge um die deutsche Nation beschließt, sich an »kienig Carolus« zu wenden, damit dieser die Pfaffen von ihrem »boesen lebenn« abbringe und sie »allein geystlicher ding pflegen, und sich der weltlichen gar entschlagen«.
Im Dialog Wadiscus oder die Roemische dreyfaltigkeit wird ebenfalls über die Unsittlichkeit des Klerus, besonders der römischen Geistlichkeit, berichtet. Hutten erzählt seinem Freund Ernholt, was ihm der eben aus Rom zurückgekehrte Wadiscus mitgeteilt hat. Die in Rom beobachteten Missstände werden durch travestierende Anspielung auf die Dreifaltigkeit angeprangert: »Drey ding helt man zu Rom in großem werde, huepsche frawen, schoene pferd, und Baepstliche bullen.« Huttens Kritik richtet sich vornehmlich gegen die schamlosen Finanzmanipulationen der Kurie. Er ruft daher Deutschland zum Widerstand gegen Rom auf.
Derselbe militante Ton herrscht auch im letzten Dialog. Die »Anschawenden« sind der Sonnengott Sol und der himmlische Wagenlenker Phaeton, die aus der Vogelperspektive die Vorgänge auf dem Augsburger Reichstag betrachten. Sie geißeln die Abhängigkeit Deutschlands von Rom und beschuldigen Kajetan, der die Bewilligung einer Steuer für den Krieg Roms gegen die Türken zur Ausbreitung des Christentums durchsetzen möchte, dass er in Wirklichkeit nur der Geldgier des Papstes das Wort rede. Gegen Ende des Gesprächs greift der Kardinal selbst ein; er verflucht die beiden Heidengötter und fordert sie auf, Buße zu tun und um Absolution zu bitten. Über die Anmaßung des Legaten empört, beschimpfen sie ihn, worauf dieser seinem Abscheu gegenüber den Ketzern Luft macht: »Du vermaledeyeter, du uebeltaetter, du verdampter, ein sun Sathanas, wie darfstu mir widerbellen?«
Huttens literarisches Vorbild für diese Gespräche waren die zeitkritischen Dialoge des Lukian aus Samosata (um 120–185). Die derbe, volkstümliche Sprache an Stelle der lateinischen ist bezeichnend für die Bestrebungen der Reformation, sich dem Volk in seiner eigenen Sprache verständlich zu machen. Der Autor übernahm die Rolle des nationalen Erweckers und wurde durch seine heftigen politischen und religiösen Polemiken in diesem Werk einer der bedeutendsten Mitstreiter Luthers."
[Quelle: Anneliese Gerecke. -- In: Kindlers Neues Literaturlexikon. -- München : Kindler, ©1996. -- s.v.]
"Mit den Novi Dialogi ist das Gespräch büchlin zugleich Huttens wichtigster Beitrag zur Literatur. Mit dem Prosadialog erweckte er eine Gattung zu neuem Leben, die in der Flugschriftenliteratur der Reformation zentrale Bedeutung erhielt, u. führte exemplarisch vor, welche Möglichkeiten in ihr angelegt waren, auf den Parteienstreit Einfluss zu nehmen. In Huttens Dialogen reichen sie von der Abrechnung mit dem persönlichen Gegner (in Febris I u. II, in denen er mit deutlicher Spitze gegen Cajetan die Unmoral des hohen Klerus verspottet) bis zur gezielten Manipulation der öffentlichen Meinung zugunsten der Ritterschaftsbewegung (in den Praedones, in denen Kaufleute, Fürstendiener u. Klerus als die wahren »Raubritter« entlarvt werden). Darin spiegelt sich auch Huttens Entwicklung vom engagierten Humanistenpoeten zum politischen Autor wider. Denn steht das Gespräch büchlin in Aufmachung und Technik des aggressiven Sprechens noch spürbar unter dem Einfluss Lukians und der Humanistensatire und ist die Bulla als pathetisch dramatische Szene gestaltet, so beziehen die letzten der Dialogi novi unter Verzicht auf poetische Einkleidung direkt zu den Zeitereignissen Stellung. Als wichtigster Dialog gilt der Vadiscus, in dem Hutten das Herrschaftssystem der Kirche einer schonungslosen Kritik unterwirft und das Wesen der »unheiligen« römischen Dreifaltigkeit — Papst, Kurie u. Klerus — in dreigliedrigen Merksprüchen auf eine einprägsame, sentenziös zugespitzte Formel bringt. Seit seiner Neuentdeckung durch Herder (Hutten. In: Teutscher Merkur, 1776) hat Hutten wie kein anderer Autor des 16. Jh. die Phantasie der Deutschen beschäftigt, sei es, dass man ihn (wie Conrad Ferdinand Meyer: Huttens letzte Tage. 1873) zum tragischen Helden hochstilisierte oder ihn als Wegbereiter einer starken Nation und Verkünder deutscher Volkstugenden feierte. In den Freiheitskriegen, im Kulturkampf und nach der Reichsgründung wurde Hutten als Vorkämpfer für die jeweiligen politischen Ziele beansprucht und schließlich im Dritten Reich zum frühen Verfechter chauvinistischer Macht- und Gewaltpolitik verfälscht. Daneben hatte es freilich nie an kritischen Stimmen gefehlt, die eine Rückbesinnung auf den historischen Hutten forderten. Die Einsicht, dass sich seine Bedeutung nur unter den Voraussetzungen seines Zeitalters bestimmen lässt, dürfte sich inzwischen allgemein durchgesetzt haben, auch wenn die Kriterien, nach denen geurteilt wird, nach wie vor unterschiedlich sind. Unbestritten ist jedoch Huttens Rang als einer der wenigen Schriftsteller des 16. Jh., der die deutsche und lateinische Sprache gleich virtuos beherrschte u. handhabte."
[Quelle: Barbara Könneker. -- In: Literaturlexikon : Autoren und Werke deutscher Sprache / [hrsg. von] Walter Killy. -- Berlin : Directmedia Publ., 2000. -- 1 CD-ROM -- (Digitale Bibliothek ; 9). -- Lizenz des Bertelsmann-Lexikon-Verl., Gütersloh. -- ISBN 3-89853-109-0. -- s.v. "Hutten"]
3 Reformation
"Reformation (lat., »Umgestaltung, Verbesserung«; hierzu die Porträttafel »Reformatoren«), die Bewegung des 16. Jahrh., welche die Entstehung des Protestantismus (s. d.) und damit der lutherischen und reformierten Kirchen zur Folge hatte. Die Reformation hat in alle Gebiete des Kulturlebens der sich daran beteiligenden Völker mächtig eingegriffen, eine lange Reihe neuer Gestaltungen im politischen und kirchlichen Leben angebahnt und so die ganze moderne Entwickelung Europas bedingt. Viele Anzeichen kündigten schon seit langem das Herannahen einer neuen Kulturepoche an: die Erfindung der Buchdruckerkunst, die Erweiterung der Weltanschauung durch die überseeischen Entdeckungen, vornehmlich aber das Wiederaufleben der Künste und Wissenschaften im 15. Jahrh., alles, was man in der Regel unter dem Ausdruck Renaissance (s. d.) zusammenfasst. Speziell die Notwendigkeit einer »Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern« aber war durch die großen Kirchenversammlungen des 15. Jahrh. wiederholt anerkannt worden, und die reformatorischen Ideen, vor allen eines Wiclif und Hus, hatten dazu beigetragen, einen Umschwung der religiösen Grundideen anzubahnen. Als den Geburtstag der Reformation muss man den 31. Okt. 1517 bezeichnen, an welchem Tage Martin Luther (s. d.) seine Thesen über den Ablass an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. In kürzester Frist durchflogen diese Thesen ganz Deutschland. Aber erst auf der Disputation, die vom 27. Juni bis 16. Juli 1519 in Leipzig statthatte (vgl. Seitz, Der authentische Text der Leipziger Disputation, Berl. 1903), vollzog Luther innerlich den Bruch mit der katholischen Religiosität, indem er sich zu der Behauptung drängen ließ, der Papst sei nicht nach göttlichem, sondern nur nach menschlichem Recht Oberhaupt der Kirche. Von Melanchthon (s. d.) mit seiner Beredsamkeit und dialektischen Gewandtheit unterstützt, von Kurfürst Friedrich dem Weisen (s. Friedrich 68) beschützt und vom Enthusiasmus fast des ganzen deutschen Volkes getragen, gewann Luther immer neue und einflussreiche Anhänger, namentlich einen großen Teil des deutschen Adels, voran die Ritter von Schaumburg, von Sickingen und von Hutten (s. d.), für seine Sache. An diesen deutschen Adel, als an echte Repräsentanten seines Volkes, richtete er seine Schrift »Von des christlichen Standes Besserung« (im Juni 1520), worin er die Fürsten und Reichsstände aufforderte, Hand anzulegen, um das römische Unwesen in Deutschland abzuschaffen. In der Schrift »Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche« (im Oktober 1520) gab er eine einschneidende Kritik der kirchlichen Lehre von den Sakramenten, die auf Taufe, Buße und Abendmahl beschränkt und ihres dinglichen Charakters als Gnadenmittel entkleidet werden. Zu der kirchlich-politischen und der kirchlich-dogmatischen Urkunde gesellte sich noch im selben Jahre die religiöse Urkunde der Reformation, die Schrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen«, worin Luther auf Grund von 1. Kor. 9,19 mit sieghafter Klarheit die Doppelthese verfocht, dass der Christenmensch ein freier Herr sei über alle Dinge, niemandem untertan, und dennoch ein dienstbarer Knecht aller Dinge, jedermann untertan. Seine Lossagung vom Papsttum besiegelte er, indem er 10. Dez. 1520 vor dem Elstertor in Wittenberg die päpstliche Bulle, in der Leo X. ihm mit dem Banne drohte, samt dem kanonischen Rechtsbuch ins Feuer warf. Am 17. und 18. April 1521 bekannte er sich vor dem Reichstag zu Worms zu seinen die Vergangenheit stürzenden, die Gegenwart belebenden, die Zukunft verheißenden Gedanken. In Bann und Acht ward er der Heros des deutschen Volkes.
Allenthalben schlug die Reformation ihre Wurzeln. Politische, soziale, kirchliche und religiöse Momente trafen zusammen. Seit 1519 gewann sie das Übergewicht in Ostfriesland, seit 1522 in Pommern, Livland (durch Knöpken, Tegetmaier, Briesmann und Lohmüller), Schlesien, Preußen (durch den Hochmeister Albrecht von Brandenburg, der 1522 durch Osiander auf dem Reichstag zu Nürnberg gewonnen wurde), Mecklenburg, seit 1523 in Frankfurt a. M., Nürnberg (durch Osiander [s. d.] und den Ratsschreiber Lazarus Spengler), Straßburg (woselbst Matthes Zell schon seit 1518 das Evangelium predigte, an den sich später Capito [s. d.], Butzer [s. d.], Hedio und Fagius anschlossen), Schwäbisch-Hall (durch Johann Brenz [s. d.]), seit 1524 in Magdeburg, Bremen und Ulm. Freilich folgten die süddeutschen Städte schon jetzt teilweise in Lehre und Gottesdienstordnung mehr demjenigen Typus der Reformation, der in der benachbarten Schweiz seine Heimat hatte. Hier erhob seit 1519 der humanistisch gebildete Ulrich Zwingli (s. d.) in Zürich seine volkstümliche Rede für die Reformation der Kirche und der Sitten. Durch das Studium der Heiligen Schrift zu einer selbständigen religiösen Überzeugung gelangt, sagte er sich rascher und entschiedener als Luther von den Prinzipien des Katholizismus los, sobald ihm einmal deren Gegensatz zum biblischen Christentum klar geworden war (s. Reformierte Kirche). Auf seine Veranlassung erließ der Große Rat (1520) ein Gebot, dass alle Prediger des Freistaats sich allein an die heiligen Evangelien und die Schriften der Apostel halten sollten, und durch Disputationen brach er der Sache der Reformation bald auch in andern schweizerischen Städten Bahn. In Basel entschied sich Ökolampadius (s. d.) für die Reformation, in Bern Bertold Haller (s. d.) und Nikolaus Manuel (s. d.). Nur das Landvolk in den Gebirgskantonen, am Alten hangend und von den Mönchen und Priestern geleitet, verstattete den reformierten Ideen keinen Eingang; ja, die drei Waldstätte nebst Zug und Luzern schwuren einander, jeden Verächter der Messe und der Heiligen zu töten. Als einzelne blutige Gewalttaten den Ernst ihres Beschlusses bewiesen, blieben die reformierten Kantone die Antwort nicht schuldig. Bei Kappel floss (11. Okt. 1531) das erste im Religionskampf vergossene Blut; auch Zwingli fiel.
In Deutschland war das Kurfürstentum Sachsen unter Johann dem Beständigen (1525-32) das erste Land, in dem die Reformation die gesetzliche Genehmigung erhielt; auf Grundlage des Visitationsbüchleins erfolgte die Kirchenvisitation 1528-29. Etwa gleichzeitig führte Landgraf Philipp von Hessen 1527 sein Land durch Lambert von Avignon auf der Homberger Synode der Reformation zu. Schon 1524 aber war die lange gärende Unzufriedenheit des hart belasteten Bauernstandes, durch die mächtige Bewegung, welche die Reformation in die niedern Schichten des Volkes brachte, gefördert, in offenen Aufstand gegen den weltlichen und geistlichen Adel zur Erlangung von Christen- und Menschenrechten ausgebrochen und hatte blutig unterdrückt werden müssen. Diese Vorgänge trugen vornehmlich dazu bei, Luther in einer Richtung zu bestärken, die schon seit seiner Rückkehr von der Wartburg angebahnt worden war: neben der Selbstherrlichkeit des christlich-freien Bewusstseins oder Glaubens trat wieder die Bedeutung des äußern Kirchentums; das kühne Vorgehen wurde ermäßigt durch die Achtung vor der Geschichte. Leider erhob sich nun unter den Lehrern der evangelischen Kirche jener unselige Zwiespalt, der auf Jahrhunderte hinaus einen Riss in die kaum entstandene Gemeinschaft machte, zunächst als Streit über das heilige Abendmahl (s. d.). Alle Versuche, ihn durch Religionsgespräche beizulegen, scheiterten an Luthers leidenschaftlicher Heftigkeit. Diese Trennung war aber um so unzeitiger, als die Existenz der evangelischen Kirche noch so wenig gesichert war und den ersten Bündnissen, die 1526 hauptsächlich auf Betreiben des hessischen Landgrafen unter einigen evangelischen Reichsständen geschlossen wurden, sofort katholische Gegenallianzen gegenübertraten. Auf dem im Sommer des gleichen Jahres gehaltenen Reichstag zu Speyer hielten sich beide Teile schon fast die Wagschale, so dass der Reichsrezess vom 27. Aug. 1526 dahin lautete, bis zur Berufung eines allgemeinen Konzils solle sich jeglicher Stand in Bezug auf das Wormser Edikt so gegen seine Untertanen verhalten, wie er es vor Gott und dem Kaiser verantworten könne. Jedoch schon auf dem neuen Reichstag zu Speyer 1529 ward der Beschluss des vorigen wieder zurückgenommen, so dass die evangelischen Stände zu einer förmlichen Protestation schritten, welche die geschichtliche Veranlassung des Namens Protestanten geworden ist (s. Protestantismus). Der Kaiser verwarf die Protestation und schrieb einen Reichstag nach Augsburg aus. Jetzt hielten es die protestantischen Stände für angemessen, die Grund lehren ihres Glaubens in der Kürze zusammenzustellen und sie dem Kaiser vorzulegen. So entstand, unter grundsatzmäßigem Ausschluss der Schweizer Reformatoren, die Augsburgische Konfession (s. d.), die am 25. Juni 1530 verlesen ward, und zu der sich bald auch die nordischen Reiche Dänemark, Schweden und Norwegen sowie die Ostseeländer bekannten, während die oberdeutschen Reichsstädte Straßburg, Konstanz, Lindau und Memmingen in der Tetrapolitana bei ihrer Zwinglischen Auffassung beharrten. In Deutschland aber begann seitdem der Kampf um das gute Recht der Reformation, zu deren Schutz 1531 zwischen den protestantischen Ständen der Bund von Schmalkalden geschlossen wurde. Jetzt zog der Kaiser mildere Saiten auf, und es kam 23. Juli 1532 in Nürnberg zu einem Friedensschluss, worin den Gliedern des Schmalkaldischen Bundes das Verbleiben bei ihrer Lehre und bei ihrem Kultus bis zu einem allgemeinen Konzil oder bis zur Entscheidung eines neuen Reichstags zugesichert wurde. Als der Papst auf Mai 1537 ein solches Konzil nach Mantua ausschrieb, gab der Kurfürst von Sachsen seinen Theologen auf, die Glaubensartikel zu erwägen und zusammenzustellen, auf denen zu bestehen sein möchte, und so entstanden die von Luther (im Februar 1537) aufgesetzten Schmalkaldischen Artikel (s. d.), die den Gegensatz zum Katholizismus und die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der protestantischen Kirche weit bestimmter und schärfer als die Augsburgische Konfession aussprachen. Der kriegerisch gesinnte Landgraf Philipp von Hessen hatte inzwischen (1534) durch die Zurückführung des vom Schwäbischen Städtebund vertriebenen und vom Kaiser zugunsten seines Bruders Ferdinand des Thrones entsetzten Herzogs Ulrich von Württemberg dem protestantischen Glauben ein ganzes Land erobert. Ulrich übertrug die Reformation seines Landes Blarer (s. d.) und Schnepff (s. d.). Ohne Unterlass war inzwischen der Landgraf auch bemüht gewesen, den seit dem Marburger Gespräch (im Oktober 1529) besiegelten Zwiespalt der Wittenberger und Schweizer Reformatoren über die Abendmahlslehre zu beseitigen, und seine Bemühungen hatten wenigstens einen provisorischen Stillstand der Streitigkeiten durch den Abschluss der Wittenberger Konkordie (Mai 1536) zur Folge. Auch der neue Kurfürst von Brandenburg, Joachim II. (1535-71), bekannte sich seit 1539 offen zur evangelischen Lehre und führte dieselbe mit Hilfe des Bischofs von Brandenburg, Matthias von Jagow, in sein Gebiet ein; gleichzeitig wurden auch des eifrig katholischen Herzogs Georg von Sachsen Lande durch dessen Nachfolger Heinrich für die Reformation gewonnen. Selbst der Kurfürst von Köln, Hermann, Graf von Wied (s. Hermann 3), ließ 1543 einen Reformationsplan im Druck erscheinen, der im ganzen mit der evangelischen Lehre übereinstimmte. Doch scheiterte dieser Reformationsversuch am Widerstand seines Domkapitels. Dagegen wurde ein heftiger Feind der Reformation, Herzog Heinrich von Braunschweig, von Sachsen und Hessen aus seinem Lande verjagt (1542). Fast in allen Reichsstädten hatte die reformatorische Partei ein entschiedenes Übergewicht. Von weltlichen Fürsten war eigentlich nur noch der Herzog von Bayern, der sich jedoch der evangelischen Sympathien seines eignen Volkes und der Stände nur mit Mühe erwehren konnte, eine Stütze des Papsttums. In den nächstfolgenden Zeiten wurden die evangelischen Stände weniger beunruhigt. Der Kaiser war durch seine auswärtigen Unternehmungen sehr in Anspruch genommen und bedurfte der Reichshilfe gegen die Türken, die Ungarn bedrohten, und suchte auf den Religionsgesprächen (s. d.) zu Hagenau (1540), Worms (1540) und Regensburg (1541) eine Verständigung zwischen Protestanten und Katholiken herbeizuführen. Das Regensburger Kolloquium brachte einen angeblichen Religionsvergleich (Regensburger Interim, s. d.) zustande, den der Kaiser den Protestanten aufzwang. Das konnte Karl V. nur wagen, weil innere Zwistigkeiten im Lager der protestantischen Stände dem Schmalkaldischen Bund seine Kraft raubten. Die Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen (1539) rief eine tiefe, in heftiger Korrespondenz sich äußernde Missstimmung zwischen ihm und dem Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen (1532-47) sowie Ulrich von Württemberg hervor, die den Schritt ihres Bundesgenossen in scharfen Ausdrücken tadelten; der Landgraf, um sich vor der kaiserlichen hochnotpeinlichen Halsgerichtsordnung zu schützen, sah sich genötigt, Karl V. in einer die Interessen der Protestanten gefährdenden Weise gefällig zu sein. Die Beendigung des Krieges mit Frankreich (1544) gab dem Kaiser endlich freie Hand gegen die schmalkaldischen Verbündeten. Er nahm die Klage des kölnischen Domkapitels gegen den Erzbischof an und ließ eine Untersuchung gegen letztern einleiten.
Luther erlebte den Ausbruch des Krieges nicht, er starb 18. Febr. 1546 in Eisleben. Bald darauf ward wider den Kurfürsten von Sachsen und den Landgrafen von Hessen (20. Juli 1546) die Reichsacht ausgesprochen, und der Papst Paul III. predigte (4. Juli) einen Kreuzzug zur Ausrottung der Ketzerei. Nachdem im Spätjahr der Süden und im Frühjahr 1547 der Norden mit Hilfe des Herzogs Moritz von Sachsen unterworfen worden, zeigte der Kaiser plötzlich Mäßigung, indem er nur die Anerkennung des Ende 1545 eröffneten Konzils zu Trient von den Besiegten forderte. Ein Reichsgesetz, das am 15. März 1548 in Augsburg publiziert ward, ordnete an, wie es mit der Religion bis zum Austrag des Konzils gehalten werden solle. Dieses Interim (s. d.) ward vielen oberdeutschen Städten mit Gewalt aufgezwungen, indes der vom Kaiser mit dem sächsischen Kurhut begnadete Moritz vornehmlich unter Melanchthons Mitwirkung das Leipziger Interim (s. d.) ausarbeiten ließ. Während aber die Gewissen durch das aufgedrungene Interim auf das äußerste beunruhigt wurden, beschloss Moritz, durch eine kühne Tat seine verlorne Ehre wiederzugewinnen und damit dem Reich und der Kirche die Freiheit zurückzugeben. Die ihm übergebene Achtvollstreckung an Magdeburg gab ihm einen Vorwand zu Ausstellung eines Heeres, und so brach er 1552, nachdem er ein schamloses Bündnis mit Frankreich geschlossen, aus Thüringen auf und stand schon 22. Mai vor Innsbruck. Der Kaiser floh durch die Engpässe der Alpen, und es kam nun 29. Juli der Passauer Vertrag zustande, kraft dessen das Kammergericht zu gleichen Teilen mit Bekennern der beiden Kirchen besetzt und zur Abstellung der Klagen über verletzte Reichsgesetze sowie zur Einigung in den kirchlichen Angelegenheiten ein Reichstag in nahe Aussicht gestellt ward. Auf diesem Reichstag, der nach mancherlei Verhinderungen 1555 in Augsburg eröffnet ward, wurde das Recht der Reformation den Reichsständen trotz des vom römischen Stuhl dagegen erhobenen Protestes zuerkannt, aber der geistliche Vorbehalt (reservatum ecclesiasticum) aufgenommen, wonach jeder zur lutherischen Kirche übertretende Prälat ohne weiteres geistliche Würde und weltliche Stellung verlieren sollte. Den andersgläubigen Untertanen wurde das Recht des freien Abzugs zugestanden. Über die Aufrechthaltung dieses Friedens wachten das Corpus catholicorum und das Corpus evangelicorum (s. d.). Noch einmal machte das Wormser Religionsgespräch den Versuch (1557), eine Einigung der Katholiken und Protestanten in der Lehre herbeizuführen. Er war ebenso vergeblich wie der zweite Reformationsversuch des Erzbischofs Gebhard (s. d. 3) von Köln 1582. Die Gegenreformation (s. d.) erstickte hier sowie in Mainz, Trier, Steiermark und Kärnten bereits mit Hilfe der Jesuiten (s. d.) jede protestantische Regung. Der Westfälische Friede stellte endlich nicht bloß den Status quo des Passauer Vertrags und Augsburger Religionsfriedens 1648 wieder her, sondern dehnte auch die in beiden den Lutheranern gemachten Zugeständnisse auf die Reformierten aus. Aber die Sache der Reformation, wie sie endlich durch den Westfälischen Frieden zur rechtlichen Existenz gelangte, war nicht mehr die ursprüngliche. Fraglos hat schon den Reformatoren selbst zu einer folgerichtigen Durchführung der Grundsätze der Reformation vieles gefehlt. Ihre wiederholten Schwankungen und Unsicherheiten, ihre Zugeständnisse an das katholische System, ihre offenen Rückfälle und Selbstwidersprüche können und sollen nicht mehr verhehlt werden. Ihre Schuld ist aber verschwindend gering gegenüber denjenigen, die im weitern Verlauf der Geschichte jene Fehler, Missgriffe, Inkonsequenzen und katholisierenden Verirrungen nicht bloß nicht als solche begriffen, sondern sie vielmehr erst recht in ein System brachten. In der ersten Hälfte des 16. Jahrh. machte die Reformation die Runde durch die damalige zivilisierte Welt. Rom zitterte; sogar die romanische Welt schien ihr wie eine reife Frucht in den Schoß zu fallen. Aber schon im Verlauf der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. war der Protestantismus von sich selbst abgefallen und hatte die »reine Lehre« zu einem neuen Gesetzeskodex erhoben, den Theologendruck an die Stelle des Priesterjochs gesetzt. Anstatt die volle Kraft der religiösen Begeisterung und der sittlichen Erhebung nach außen zu wenden, verzehrten die Protestanten sich in Lehrgezänk nach innen und verfielen dem Irrtum, göttliche Wahrheit in ihren dogmatischen Formeln festgebannt zu haben. Jetzt folgte Niederlage auf Niederlage; die Jesuiten sogar trieben vielfach eine freiere Theologie als die orthodoxe Epigonenschaft der Reformation, und mit dem Sieg der Konkordienformel (1580) ward die anfängliche Siegesgeschichte der Reformation, wenigstens auf deutschem Gebiet, zur erschütternden Leidensgeschichte, ja zuweilen fast zur Tragikomödie.
Richtig gewürdigt wird die Sache der Reformation nur da, wo man sich entschließen kann, von den Mängeln ihrer Ausführung abzusehen und die leitende Idee ins Auge zu fassen, die nur einen durchaus neuen Ansatz zur Verwirklichung des christlichen Prinzips selbst bedeuten kann. Hatte sich dieses im Katholizismus eine einseitig religiöse und kirchliche Ausprägung gegeben, so läuft die Tendenz der Reformation durchaus auf ein im guten Sinne des Wortes weltliches Christentum, auf eine Verwirklichung des christlichen Prinzips vor allem im sittlichen Leben hinaus, daher es sich lediglich von selbst versteht, wenn die Reformation auf dem Gebiete der Kirchenbildung mit dem Katholizismus nicht wetteifern kann; sie bedeutet vielmehr im Prinzip nichts andres als die Zerstörung des »gesellschaftlichen Wunders«, das als Kirche über den natürlichen Organismen der sittlichen Welt stehen will. Von Haus aus suchte und fand daher die Reformation Fühlung mit dem Staat; sowohl in Deutschland als in der Schweiz sehen wir eigentümliche Formen des Staatskirchentums entstehen, das sich, wo die reformatorischen Prinzipien zu ungehemmter Entfaltung kommen, überall in ein eigentliches Volkskirchentum umzusetzen bestrebt ist. Anstatt einer von einer wunderbaren Legende als ihrer theoretischen Voraussetzung getragenen Kirche über den Völkern zu dienen, will die Reformation das religiöse Leben der Völker ihrer gesamten sonstigen Seinsweise eingliedern, so dass es zu einer gefunden Funktion eines einheitlichen, aus sich selbst heraus lebenden gesellschaftlichen Organismus wird. Darin liegt die politische und soziale Mission der Reformation beschlossen. S. Protestantismus. Die Bildnisse der bekanntesten Männer der Reformation zeigt beifolgende Tafel »Reformatoren«."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
4 Humanist
"Humanismus und Humanisten des Zeitalters der Renaissance. Als Pfleger wahrer Humanität (s. d.) und der studia humaniora nannten die Gelehrten zur Zeit der sogen. Wiedergeburt der Künste und Wissenschaften (rinascimento) oder des Wiederauflebens der klassischen, griechisch- römischen Kultur sich Humanisten (Gräzisten, Latinisten, Poeten, Oratoren). Die Bewegung des Humanismus ging von Italien aus, wo die Traditionen des alten Römertums naturgemäß am unmittelbarsten nachwirkten und zugleich die Nachbarschaft der byzantinisch griechischen Kulturwelt öftere Berührungen mit dieser brachte. Man pflegt als seine Ahnen mit gewissem Recht Dante Alighieri (1265-1321), Francesco Petrarca (1304-74) und Giovanni Boccaccio (1313-75) zu nennen. Ihrem Jahrhundert gehörten an die italienischen Lehrer des Griechischen Barlaam und Leonzio Pilato. Eigentliche Schule im Sinne des Humanismus machte jedoch erst der Grieche Manuel Chrysoloras, Lehrer des Griechischen in Florenz seit 1396, starb 1415 auf dem Konzil zu Konstanz. Wie schon er zugleich gegenüber der vom Islam drohenden Gefahr die Vereinigung der abendländischen und der morgenländischen Kirche eifrig betrieb, so gereichte das Unionskonzil zu Ferrara und Florenz (seit 1438) dem Humanismus zur besondern Förderung. Dessen eigentliche Seele, Kardinal Bessarion (1403-72), blieb in Italien und auf römischer Seite, als das Einheitswerk bald wieder zerfiel. In seinem Kreise war Georgios Gemistos Plethon (gest. 1455) als maßgebender Gelehrter verehrt. Nach der türkischen Eroberung Konstantinopels kamen mit manchen andern Landsleuten Georgios Trapezuntios, Theodoros Gaza und Konstantinos Laskaris nach Italien herüber. Hier hatte indes der Humanismus fürstliche Gönner gefunden an Cosimo de' Medici (1389-1464) in Florenz, Alfonso dem Großmütigen von Neapel (1400-1458), Papst Nikolaus V. (zuvor Thoma Parentucelli von Sarzano, 1398-1455, Papst seit 1447) u. a., denen als leuchtendstes Beispiel eines fürstlichen Mäcenas Lorenzo Magnifico Medici (1449-92) von Florenz sich anschloss. Unter ihrem Schutze fanden sich begabte Forscher, Redner, Dichter zusammen, wie Gian Francesco Poggio Bracciolini (1380-1459), Francesco Filelfo (1398-1481), Giovanni Gioviano Pontano (1426-1503), Enea Silvio Piccolomini (1405-64, als Papst Pius II. seit 1458), Poliziano, Pomponio Leto u. a. Mehrfach, wie in Neapel, Florenz, Rom etc., bildeten diese Gelehrten förmliche Gesellschaften: Akademien, deren von Platons Schule zu Athen entlehnte Bezeichnung dadurch in Europa für gelehrte Gesellschaften allgemein wurde. Besondere Aufmerksamkeit widmeten verschiedene unter ihren, wie Enea Silvio, Filelfo, Pier Paolo Vergerio (geb. 1349, gest. um 1430), Maffeo Vegio (1406-1458), Vittorino Ramboldini da Feltre (1378 bis 1446), Battista Guarino (1370-1460), der Erziehungswissenschaft. Doch stand nicht immer der sittliche Ernst unter den Humanisten auf gleicher Höhe mit dem wissenschaftlichen Eifer und dem Kunstgeschmack. Besonders bekannt als kühner Kritiker der Kirchengeschichte (»De donatione Constantini«) ist Lorenzo Valla (1406-57). Glänzende Nachblüten des Humanismus sah auch noch das 16. Jahrh. in Italien, namentlich unter Papst Leo X. (Giovanni Medici 1475 bis 1521, Papst seit 1513); dieser Zeit gehören neben andern berühmten Humanisten an die Kardinäle Pietro Bembo (1470-1547) und Jacopo Sadoleto (1477 bis 1547).
Nur allmählich und zumeist erst nach dem Aufkommen des Buchdrucks verbreitete der Humanismus sich auch über die Alpen.
Zuerst nach Frankreich, wo schon 1430 an der Pariser Universität Griechisch und Hebräisch gelehrt ward, und wo im 15. Jahrh. Johannes Laskaris, Gregorios Tiphernas, Georgios Hermonymos wirkten, im 16. Jahrh. Guillaume Budé (Budäus, 1467-1540), die gelehrten Buchdrucker Robert Estienne (Stephanus, 1503-59) und sein Sohn Henri (1528-98) bis zur Übersiedelung nach Genf (1551), Marc Antoine Muret (1526-85), Isaak Casaubon (1559-1559-1614, seit 1608 in England) sowie der Italiener Julius Cäsar Scaliger (1484-1558) und sein Sohn Joseph Justus (1540-1609; seit 1593 in Leiden) blühten.
Aus Spanien sei Juan Luiz Vives (1492-1540) genannt, der jedoch meist in England und Belgien lebte,
aus England der unglückliche Kanzler Thomas Morus (1480-1535). Betreffs Englands ist daneben an die bedeutende Zahl großartiger Schulanstalten zu erinnern (Eton 1441 u. s. f.), die das Jahrhundert des Humanismus entstehen sah.
Besonders wohl vorbereitet fand der Humanismus den Boden in den deutschen Niederlanden durch die Brüder des gemeinsamen Lebens, deren Gesellschaft, durch Geert Groot (1340-84) von Deventer gestiftet, mit Vorliebe die Jugenderziehung betrieb. Hier erwuchsen für Deutschland die ersten bedeutenden Lehrer des Griechischen, Rudolf Agricola (Roelof Huysmann, 1443-85) und Alexander Hegius (van der Heck, 1433-93). Von dort gingen aus Johannes Murmellius, Rektor in Münster (1480-1517), Ludwig Dringenberg in Schlettstadt (dort Rektor 1441-77, gest. 1490) und mittelbar Dringenbergs Schüler Jakob Wimpheling (1450-1528), Konrad Celtes (Pickel, 1459-1508) u. a.
Als Häupter des Humanismus in Deutschland während der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrh. galten anerkannt Johannes Reuchlin von Pforzheim (Kapnio, 1455 bis 1522) und Desiderius Erasmus von Rotterdam (Geert Geerts; 1466-1536). Jener als Förderer hebräischer Studien, dieser als Herausgeber des griechischen Neuen Testaments und scharfer Kritiker der kirchlichen Missstände, arbeiteten auch der kirchlichen Reformbewegung vor, mit der fortan in Deutschland mehr und mehr der Humanismus verschmolz. Den Wendepunkt bezeichnet in dieser Hinsicht Reuchlins Streit mit dem getauften Juden Pfefferkorn und den Kölner Theologen, besonders bekannt durch die Spottschrift »Epistolae obscurorum virorum« (s. d.) des Crotus Rubianus, Ulrich von Hutten (1515-17) u. a. Als Vertreter dieses jüngern reformatorischen Humanismus ragen hervor: Philipp Melanchthon (Schwarzerd, 1497-1560), Joachim Camerarius (1500-74) und die vier berühmten praktischen Schulmänner Valentin Friedland, genannt Trotzendorf (1490-1556), in Goldberg und Liegnitz, Johannes Sturm (1507-81) in Straßburg, Michael Neander (1525-95) in Ilfeld und Hieronymus Wolf (1516-80) in Augsburg. Nirgends ist der Kampf des Humanismus mit der herrschenden Scholastik heftiger und dramatischer gewesen als eben in Deutschland.
In den religiösen Kämpfen des 17. Jahrh. jedoch verwischten sich die Grenzen der Parteien und die bezeichnenden Züge des Humanismus allmählich, so dass man die Ausläufer der humanistischen Philologie, namentlich in Holland, weiterhin kaum noch unter diesen Begriff fassen kann."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
5 Hutten, Ulrich von <1488 - 1523>: Gedichte von Ulrich von Hutten und einigen seiner Zeitgenossen / hrsg. von Aloys Schreiber [1761 - 1841]. -- Heidelberg : Engelmann, 1810. -- XXVIII, 163 S. : 1 Ill. (Kupferst.).
"Schreiber, Aloys Wilhelm, Historiograph, Schriftsteller, geb. 12.10.1761 Bühl (Baden), gest. 21.10.1841 Baden-Baden Der Sohn eines Kaufmanns studierte ohne Abschluss Theologie an der Univ. Freiburg/Breisgau, war seit 1784 Lehrer und Verwalter der Bibliothek am Gymnasium in Baden-Baden und lebte seit 1788 in Mainz, wo er zunächst als Kritiker und Theaterschriftsteller, später als Hofmeister tätig war. 1797 ging er nach Rastatt, übernahm die Schriftleitung des "Rastatter Congreß-Blatts", war 1805-13 Prof. der Ästhetik und Geschichte an der Univ. Heidelberg und danach Hofhistoriograph in Karlsruhe mit dem Titel eines Hofrats. Schreibers schriftstellerisches Werk umfasst Gedichte, Erzählungen (Romantische Erzählungen, 2 Bde., 1795), kulturgeschichtliche Schriften sowie Reiseschilderungen und -handbücher (u.a. Handbuch für Reisende am Rhein von Schaffhausen bis Holland, 1816, (5)1841). Er schrieb eine Badische Geschichte (1817) und ein Lehrbuch der Aesthetik (1809) und gab 1806-08 die "Badische Wochenschrift zur Belehrung und Unterhaltung für alle Stände" heraus."
[Quelle: Deutsche biographische Enzyklopädie & Deutscher biographischer Index. -- CD-ROM-Ed. -- München : Saur, 2001. -- 1 CD-ROM. -- ISBN 3-598-40360-7. -- s.v.]
6 Hutten, Ulrich von <1488 - 1523>: Ulrich von Hutten's Jugend-Dichtungen, didaktisch-biographischen und satyrisch-epigrammatischen Inhalts / zum erstenmal vollständig übersetzt und erläutert herausgegeben von Ernst Münch [1798 - 1841]. -- Stuttgart : Weise & Stoppani, 1838. -- XXIV, 400 S.
"Münch, Ernst Hermann Joseph, schweizerischer Bibliothekar, Historiker, Publizist, geb. 25.10.1798 Rheinfelden, gest. 9.7.1841 Rheinfelden Nach historischen und juristischen Studien in Freiburg/Breisgau war M. Oberamts- und Gerichtsschreiber in Rheinfelden. 1824 kehrte er als a.o.Prof. der historischen Hilfswissenschaften an die Univ. Freiburg zurück. Seit 1829 hatte er den Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Univ. Lüttich inne, den er jedoch aufgrund politischer Unruhen schon nach einem Jahr aufgeben musste. 1831 wurde er Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Stuttgart. Münch veröffentlichte u. a. eine Geschichte des Hauses Nassau-Oranien (1832-34) und gab Huttens vollständige Schriften (4 Bde., 1821-24) heraus. Seine Erinnerungen (1841/42) blieben unvollendet."
[Quelle: Deutsche biographische Enzyklopädie & Deutscher biographischer Index. -- CD-ROM-Ed. -- München : Saur, 2001. -- 1 CD-ROM. -- ISBN 3-598-40360-7. -- s.v.]
7 Hutten, Ulrich von <1488 - 1523>: Ulrichi Hutteni Equitis Germani Opera Quæ Reperiri Potuerunt Omnia / ed. Eduardus Böcking [1802 - 1870]. -- Lipsiæ : In Aedibus Teubnerianis, 1859 - 1870. -- 5 Bde + 2 Supplementbände ; 8º
"Böcking, Eduard, Rechtsgelehrter, geb. 20. Mai 1802 in Trarbach an der Mosel, gest. 3. Mai 1870 in Bonn, habilitierte sich 1826 in Berlin, ward daselbst 1829 zum außerordentlichen Professor ernannt, in demselben Jahre nach Bonn versetzt, wo er seit 1835 als ordentlicher Professor der Rechte wirkte. Böcking hat sich besonders durch treffliche Ausgaben juristischer Klassiker (Ulpian-Fragmente, 4. Aufl., Leipz. 1855; Gaius, 5. Ausg., das. 1866), des »Brachylogus« (Berl. 1829) und durch die große kritische Ausgabe der »Notitia dignitatum« (Bonn 1839-50, 5 Hefte; Index 1853) Verdienste erworben.
Auch gab Böcking eine Rezension und Übersetzung der »Mosella« des Ausonius (Berl. 1828), die später umgearbeitet nebst den Moselgedichten des Venantius Fortunatus (Bonn 1845) erschien.
Seine »Institutionen« (das. 1843, Bd. 1; 2. Aufl. als »Pandekten des römischen Privatrechts«, das. 1853, Bd. 1, und Leipz. 1855, Bd. 2, Lfg. 1) sind unvollendet geblieben.
Außerdem besorgte er (1846-48) eine Ausgabe von A. W. v. Schlegels sämtlichen deutschen, französischen und lateinischen Werken; sein letztes größeres Werk war die Ausgabe der gesammelten Werke Ulrichs v. Hutten (Leipz. 1859 bis 1862, 5 Bde.), nebst 2 Supplementbänden, die »Epistolae obscurorum virorum« enthaltend (das. 1864-70); voraus ging ein »Index bibliographicus Huttenianus« (das. 1858)."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
8 Strauß, David Friedrich <1808 - 1874>: Ulrich von Hutten. -- Leipzig : Brockhaus, 1858 - 1860
Teil 1: Vorübungen und Kampfspiele. -- 1858
Teil 2: Hutten im Kampf gegen Rom. -- 1858
(Teil 3: Gespräche von Ulrich von Hutten. -- 1860 [Darin erschien die hier wiedergegebene Vorrede])
9 Hierarchie
"Hiërarchie (griech., »Herrschaft der Heiligen«), im allgemeinen soviel wie Priesterherrschaft, so dass man mit Bezug auf fast alle einigermaßen entwickelten Religionen von Hierarchie reden könnte. Eine eigentliche Hierarchie hat sich nur in der römisch-katholischen Kirche entwickelt. Diese katholische Hierarchie, wie sie zwischen dem 8. und 11. Jahrh. im Abendland entstand und im 12.-14. Jahrh. ihre Blütezeit feierte, bedeutet vor allem die Ansprüche und die übergreifende Macht des Klerus über die bürgerliche Gesellschaft, über Staat und gesamtes Weltleben, während der kirchenrechtliche Begriff der Hierarchie sich allerdings auf die von Christus selbst den Aposteln und deren rechtmäßigen Nachfolgern gegebene Befugnis, den Gottesdienst zu verwalten und die Kirche zu leiten, beschränkt. Diese rechtmäßigen Nachfolger der Apostel bilden daher als Auserwählte Gottes den eigentlichen aktiven Teil der Kirche, den Klerus, wörtlich »das Erbteil Gottes«, gegenüber dem Laienstand. Das Tridentinische Konzil bedrohte sodann in konsequenter Weiterentwickelung jeden mit dem Bannfluch, der »leugnet, dass in der katholischen Kirche eine göttliche Hierarchie sei«, die besteht aus den drei göttlich eingesetzten Stufen des Bischofs, des Priesters und des Diakons; die übrigen, nämlich die des Subdiakons, des Akoluthen, des Exorzisten, des Lektors und des Ostiarius, werden als wenn auch durch ihr Alter ehrwürdige, doch menschliche Institutionen angesehen. Die drei erstgenannten höchsten Stufen mit der des Subdiakons bilden die Ordines sacri oder majores, die übrigen vier die Ordines non sacri oder minores. Die Hierarchia jurisdictionis seu regiminis gliedert sich in Papst, Kardinäle, Patriarchen, Exarchen, Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe, Archipresbyter, Presbyter, Archidiakonen und Diakonen, der tatsächlichen Situation nach in Papst, Bischöfe und Pfarrer.
Der Papst gilt als das Oberhaupt der ganzen Kirche: nach dem sogen. Papalsystem wird er als unumschränkter Monarch der Kirche angesehen, dem kraft göttlicher Einsetzung die ganze Fülle der Kirchengewalt (plenitudo potestatis) zustehen soll, während ihm nach dem Episkopalsystem (s. d.) nur eine beschränkte Gewalt zur Erhaltung der Einheit der Kirche und der Vorrang vor den übrigen Bischöfen eingeräumt, die Regierung der Kirche aber der Hauptsache nach in die Hände sämtlicher Bischöfe oder der allgemeinen Konzile gelegt wird.
Dem Papst zur Seite stehen mehrere Regierungs- und Justizkollegien, deren Inbegriff man Curia romana nennt, und das Kardinalkollegium nebst den Kongregationen.
Auf den Papst folgen die Patriarchen, deren Würde indes gegenwärtig nur noch eine titulare ist, dann die Primaten oder ersten Bischöfe der einzelnen Staaten, denen bei Nationalkonzilen der Vorsitz zusteht.
Wichtiger als diese Zwischenstufen sind die weiter abwärts folgenden Stufen der Erzbischöfe oder Metropoliten, die eine gewisse Kirchengewalt in einer aus mehreren bischöflichen Sprengeln bestehenden Provinz ausüben, und der Bischöfe, denen die Kirchengewalt in einem Sprengel zukommt, und die Konsistorien, Offizialate etc. als Regierungskollegien nach Art der Curia romana sowie die Domkapitel nach Art des Kardinalkollegiums zur Seite stehen.
An die Bischöfe schließen sich die geringen Prälaten an, die entweder über einen in keinem bischöflichen Sprengel liegenden Distrikt oder über eine zwar in einem bischöflichen Sprengel liegende, aber von der Gewalt des Bischofs eximierte Kirche (Kloster) eine gewisse Kirchengewalt, wie z. B. die Äbte, ausüben.
Die unterste Stufe dieser Hierarchie nehmen die Pfarrer ein, d. h. die Priester, denen in einer Parochie das Amt der Seelsorge übertragen ist.
Genaue Nachweise über den Personalbestand und den Organismus der römisch-katholischen Hierarchie gibt das u. d. T.: »La Gerarchia cattolica« in Rom jährlich erscheinende päpstliche Handbuch. Vgl. Scheuffgen, Die Hierarchie in der katholischen Kirche (Münst. 1897).
Das Wort Hierarchie wird zuweilen auch von der Rangordnung solcher Ämter gebraucht, die außerhalb des Gebietes des »Heiligen« liegen; so die Ausdrücke politische, militärische Hierarchie, Hierarchie des Staatsdienstes etc."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
10 jenen Bergen: Anspielung auf den Begriff Ultramontanismus
"Ultramontanismus (von lat. ultra montes, jenseits der Berge, also aus Rom) ist die Bezeichnung für eine papsttreue und streng nach dem Vatikan orientierte Haltung.
Zur Herausbildung des Begriffs im Mittelalter
Der Name geht auf das lateinische ultramontani zurück, einem im Mittelalter aufkommenden Sammelbegriff, der die in Italien dort lebenden deutschen Studenten, in Deutschland und Frankreich die Parteigänger des Papstes bezeichnete.
Die Entwicklung des Ultramontanismus vor 1870
Frankreich
Ursprünglich wurde mit dem Begriff eher abwertend (z.B. 1763 von Johann Nikolaus von Hontheim) eine Strömung der katholischen Kirche des 18. Jahrhunderts bezeichnet, die zuerst in Frankreich als Antwort auf den Gallikanismus und später den Bedeutungsverlust nach der Französischen Revolution entstanden war. Sie strebte an, den Vorrang des Papstes zu erhalten oder sogar zu verstärken und bekämpfte Aufklärung, Liberalismus und Protestantismus. Im Lyoner Missionsverein arbeiteten Laien und Kleriker eng zusammen im Kampf gegen die revolutionäre Forderung nach Menschenrechten, Volkssouveränität und Nation, indem ihr ein universalistischer Ansatz entgegengesetzt wurde, der die "göttlichen Gesetze" über die des Staates stellte. In gewisser Hinsicht hatte die Schwächung der französischen katholischen Kirche durch die mit der Revolution einhergehende Säkularisierung die innerkatholische nationale Gegenmacht zu Rom vernichtet und damit dem Ultramontanismus den Weg erleichtert.
Belgien
So nahm auch nach der belgischen Revolution von 1830 die Volksmission durch den katholischen Reveil stark zu. "Das dahinter stehende Konzept zielte auf die religiöse Erlösung der Gesellschaft und war getragen von romantischen Gedankengängen....(wie) Mittelaltersehnsucht und Papstverehrung." (Dr. Vincent Viaene, Leuven, auf der 16. Tagung des Schwerter Arbeitskreises Katholizismusforschung im November 2002)
Polen
Die Wiederbelebung frommer Traditionen nach dem Novemberaufstand 1830/31, ursprünglich aus dem Exil gesteuert, forcierte die Unterordnung des Klerus unter die Bischöfe und damit den Papst und wandte sich entschieden gegen die Gleichberechtigung anderer religiöser Gruppierungen. Damit war der Ultramontanismus auch ein wichtiger Motor bei der Ausbildung eines kirchenoffiziell getragenen Antisemitismus.
Deutschland
In Deutschland setzte der im 19. Jahrhundert erstarkende Ultramontanismus gegen den Reformkatholizismus die romkonforme Neubesetzung von Bischofsstühlen durch. Hierdurch kam als Gegenbewegung in der Zeit des Vormärz und der Märzrevolution 1848 eine Deutsch-katholische Bewegung in Gang.
Der Ultramontanismus bildete nach 1815 eine geistig- politische Bewegung, die auf die Restauration der Macht des Vatikans und der katholischen Monarchien hinarbeitete und deren durch die Aufklärung, die Französische Revolution, die Napoleonischen Kriege und insbesondere durch die Ausbreitung bürgerlicher Lebensweisen und Denkweisen bedrohte Stellung zu festigen suchte. Die Verfechter des Ultramontanismus verlangten die Anerkennung des Papstes als höchste weltliche Autorität; sie postulierten das Recht seiner Einmischung in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens sowie in die inneren Angelegenheiten der Staaten.
Diese Ansprüche führten zu Auseinandersetzungen zwischen Preußen und dem Vatikan (siehe Kölner Kirchenstreit), in denen die preußische Regierung den Standpunkt einnahm, "die Religion soll die Weltlichkeit stützen, ohne dass sich die Weltlichkeit der Religion unterwirft". Die Anhänger des Ultramontanismus forderten für den Papst auch die letzte Entscheidungsbefugnis in den Fragen der Wissenschaft. Weiterhin traten sie für die Vorherrschaft der katholischen Habsburger-Monarchie in Deutschland ein. Nach 1871 sammelten sich unter dem Banner des Ultramontanismus antipreußische, partikularistische und föderalistische Kräfte, die ihre ökonomischen Sonderinteressen durch die Reichseinigung und die Führung durch Preußen bedroht sahen.
Frömmigkeitspropaganda und nationalistische Polemik
Als Beweise für die Wahrheit der göttlichen Vorsehung, des Glaubens und der Kirche dienten der ultramontanen Mission insbesondere der Marienkult und die Popularisierung von Wallfahrtsorten wie Lourdes und der Reliquienverehrung, was einerseits Verzückung, andererseits wilde Proteste hervorrief.
So polarisierten sich die Positionen der mitteleuropäischen Gesellschaften, die vom Erstarken der Wissenschaft und Technik und damit der Aufklärung geprägt waren. Da sich die Protagonisten des liberalen Katholizismus eher elitär, aber die des Ultramontanismus eher sozial gaben, genoss diese Erweckungsbewegung in der nachrevolutionären Zeit und der Phase des beginnenden Kapitalismus durchaus eine gewisse Popularität.
Im Zeitalter des Nationalismus wurde der römisch-katholische universale Anspruch für unvereinbar mit der Sache des Vaterlandes gehalten. So wurde das Attribut ultramontan abschätzig für national unzuverlässige "vaterlandslose" Gesinnung verwendet.
Erstes Vatikanisches Konzil und Kulturkampf im Deutschen Reich
Einen Höhepunkt fand der Ultramontanismus 1870 im Ersten Vatikanum, das die Bedeutung des Papstamtes durch die päpstliche Unfehlbarkeit und sein universales Jurisdiktionsprimat außerordentlich steigerte und zur Abspaltung der Alt-Katholischen Kirchen in mehreren europäischen Ländern führte.
Im deutschen Kulturkampf kam es zu einem scharfen Konflikt zwischen dem Papst und Bismarck um die gesetzliche und kulturelle Souveränität des deutschen Reiches. Zeitweise siegten die Anti-Ultramontanen, aber schließlich erlangte das 1871 gegründete Zentrum eine so starke politische Basis, dass die meisten neuen zivilen Gesetze (Schulaufsicht, Priesterausbildung, Zivilehe) wieder abgeschafft oder zumindest stark gemildert wurden.
Vom Kulturkampf bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
Von Nationalsozialisten wird der Begriff Ultramontanismus generell als Negativbegriff für undeutsch unterschiedslos auf alle Katholiken angewandt.
Ultramontanismus seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
Seit 1950 ist das Wort außer in Fachkreisen aus der deutschen Sprache verschwunden, aber geistig-politisch wirkt der Ultramontanismus bis in die Gegenwart hinein. Hierzu zählt in gewisser Hinsicht die CDU als Nachfolgepartei des Zentrums, aber auch römisch-katholische Gewerkschaften und Arbeitnehmervereinigungen wie die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung, Studentenverbindungen (CV und KV), Jugendwerke und ähnliche Organisationen wie die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) oder das Kolpingwerk."[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ultramontanismus. -- Zugriff am 2005-01-29]
11 kann von mir nicht identifiziert werden
12 Bettelmönche
"Bettelmönche (Mendikanten), die Mönche solcher Klöster, die ihrer ursprünglichen Regel zufolge kein Eigentum besitzen durften, sondern auf milde, von ihnen einzusammelnde Gaben angewiesen waren, so die Franziskaner, Dominikaner, Augustiner, Serviten und Karmeliter. Gerade der Bettel brachte diese Mönche in beständige Verbindung mit dem Volk, dessen Prediger, Lehrer und Gewissensführer sie um so mehr wurden, als gerade die Armut eine dem Volk erkennbare und populäre Steigerung der Askese darstellte. Da sie mit Privilegien ausgestattet und der episkopalen Aussicht entzogen wurden, so dass sie z. B. überall predigen, Beichte hören, Messe lesen durften, so schlossen sie sich um so unbedingter an die römische Kurie an. Auch der Universitäten bemächtigten sie sich, und der Streit der Dominikaner und Franziskaner (Thomisten und Scotisten) beherrschte lange die Wissenschaft. Während die päpstliche Hierarchie den antihierarchischen, mystisch-asketischen Geist in den Spiritualen und Fraticellen der Franziskaner zu bekämpfen hatte und später der Augustinerorden fast ganz der Reformation beitrat, wurden die Dominikaner die Fanatiker der Inquisition und des bigottesten Aberglaubens. Für das Einsammeln der milden Gaben waren besondere Mönche, die sogen. Terminanten, bestellt, die zur Erleichterung ihres Geschäfts in den Städten eigne Terminhäuser hatten. Bald bildeten sich nach denselben Regeln auch Frauenorden und gewannen weite Verbreitung." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
13 Domherren
"Domherr (Domkapitular, Kanonikus, Stiftsherr), in der katholischen Kirche ein Mitglied des Domkapitels, d.h. einer Korporation, die sich aus den Geistlichen der Kathedralkirche zusammensetzt und dem Bischof bei der Regierung der Diözese beratend und beschließend zur Seite steht (s. Stift). Die protestantischen Domkapitel, die sich in Preußen und in Sachsen erhalten haben, tragen keinen kirchlichen Charakter, sind aber wegen der reichen Präbende, welche die weltlichen Domherren beziehen, für diese eine nicht unerhebliche Einnahmequelle." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
14 Ignatius von Loyola, Gründer des Jesuitenordens
"Ignatius von Loyola Gedenktag katholisch: 31. Juli, gebotener Gedenktag
Name bedeutet: der Feurige (latein.)
Gedenktag anglikanisch: 31. JuliOrdensgründer, Mystiker
* 24. Dezember (?) 1491 auf Schloss Loyola, dem heutigen Kloster San Ignacio de Loyola in der Provinz Guipúzcoa
† 31. Juli 1556 in RomIñigo López Oñaz de Recalde y Loyola wurde als zwölftes Kind einer baskischen Adelsfamilie im Schloss seiner Familie geboren. In seiner Jugend war er Bediensteter am Hof von Ferdinand V. von Kastilien. Er war ein Lebemann, kam mit dem Gesetz in Konflikt, sein Lebenstraum war eine Karriere beim Militär. Dann zwang ihn eine steinerne Kanonenkugel, die ihn 1521 bei der Verteidigung der Feste Pamplona gegen die Franzosen verletzte, für lange Zeit aufs Krankenbett zuhause im Schloss von Loyola. Während seiner Genesung las er religiöse Schriften und Heiligenlegenden, was neben mystischen Erlebnissen zu seinem Entschluss führte, sich einem geistlichen Leben zu verschreiben.
Nach der Genesung ging er 1522 für rund ein Jahr ins Kloster auf dem Montserrat bei Monistrol, um dort in strenger Askese Klarheit über sich und sein weiteres Leben zu gewinnen. Dort widerfuhr ihm eine gnadenhafte Erleuchtung; er weihte seine Waffen der Jungfrau Maria, der er künftig als geistlicher Ritter dienen wollte. In jener Zeit entstand auch der Entwurf zum Exerzitienbüchlein "Geistliche Übungen". Als Bettler pilgerte er 1523 bis 1524 nach Jerusalem, es folgten zehn Jahre Studium an einer Lateinschule in Barcelona und an den Universitäten Alcalá de Henares und Salamanca sowie ab 1528 in Paris.
Gegenüber seinen Mitstudenten profilierte er sich, indem er ihnen geistliche Anleitungen gab, mit sechs Kommilitonen gründete er 1534 eine fromme Bruderschaft mit den Gelübden der lebenslangen Armut und Keuschheit. Das machte ihn der Inquisition verdächtig. Es folgten Verhöre, Haft, schließlich aber der Freispruch. Gemeinsam mit seinen Gesinnungsgenossen, darunter Franz Xaver und Petrus Faber, wurde Ignatius 1537 zum Priester geweiht. Da der Plan zu missionarischer Tätigkeit in Palästina wegen des Krieges zwischen Venedig und den Türken scheiterte, begab sich die Bruderschaft nach Rom.
Unterwegs hatte Ignatius eine Vision: Gott selbst bat Jesus, Ignatius als Knecht anzunehmen, dieser stimmte zu und in Ignatius flammt eine starke Zuneigung zum Namen Jesu; seine neue Gemeinschaft nennt er fortan "Gesellschaft Jesu", "Jesuiten". Das Volk nannte die Pariser Professoren "Pilgerpriester". 1540 wurde der neue Orden von Papst Paul III. bestätigt, 1541 Ignatius zum Generaloberst des Ordens gewählt. Während dieser Zeit verfasste Loyola die "Großen Ordensregeln", die aber erst nach seinem Tod fertiggestellt wurden.
1548 vollendete er die "Geistlichen Übungen"; die Grundgedanken stammen aus der Zeit seines Einsiedlerlebens, Vorbild waren die 1500 erschienenen Übungen für das geistliche Leben des spanischen Abtes Garcia de Cisneros. Das Werk ist im Wesentlichen ein Leitfaden zur Meditation und religiösen Unterweisung. Vier Abschnitte regeln den Ablauf der täglichen Übungen, die zum Leben in Frömmigkeit führen sollen. Am Ende dieser Exerzitien steht der "miles christianus", der "Christenritter", der durch blinden, gläubigen Gehorsam gegenüber der Kirche den Verlockungen der Reformation widersteht. Starre Regeln innerhalb der Gemeinschaft wie einheitliche Ordenstracht oder feste Gebetszeiten kennt der Orden nicht.
Vor seinem Tod wünschte Ignatius, von Papst Paul IV. den letzten Segen zu erhalten, obwohl er wusste, dass dieser ihm nicht wohlgesonnen war. Der Sekretär von Ignatius nahm die Bitte nicht ernst, da er nicht an sein baldiges Ende glaubte. Doch in dieser Nacht starb Ignatius, ganz allein, ohne päpstlichen Segen und ohne Sterbesakramente.
Der Jesuitenorden war die Antwort auf das Zerbrechen des geschlossenen, unhinterfragt gültigen Systems der katholischen Kirche im Spätmittelalter. Kirche und Gesellschaft waren nun in verschiedene Bereiche auseinander gefallen, die Jesuiten machten sich nun zur Aufgabe, aus dem Getto der Traugebliebenen auszubrechen und in der - nicht zuletzt oft von der Reformation neu geprägten - Gesellschaft für die Lehre der Kirche zu streiten. Hierzu gehörte dann auch die breitgefächerte Tätigkeit in der Mission im Zuge des Kolonialismus. Die Ausbreitung des Ordens erfolgte sehr schnell, beim Tod des Ignatius zählte er bereits 1.000 Mitglieder. Sein Wahlspruch: "omnia ad maiorem Dei gloriam", "alles zur größeren Ehre Gottes".
Das monumentale Grab von Ignatius befindet sich in der Kirche Al Gesù in Rom; die Erdkugel über dem Altar ist aus dem größten je gefundenen Lapislazuli gefertigt. In seinem Geburtsort steht das riesige Jesuitenkolleg, dessen Gründung auf eine Schenkung von Königin Marianne von Österreich zurückgeht. Erhalten sind dort das Geburts- und das Krankenzimmer von Ignatius. Der Brauch des Ignatius-Wassers wurde 1866 von Papst Pius ausdrücklich bestätigt: Wasser wird geweiht, indem Gebete des Ignatius darüber gesprochen oder Reliquien eingetaucht werden, es hilft gegen Krankheiten, insbesondere bei Pestepidemien.
Kanonisation: Ignatius wurde 1609 selig und 1622 von Papst Gregor XV. heilig gesprochen. Für diese Feier wurde in Rom eigens die Kirche S. Ignazio erbaut.
Attribute: IHS-Zeichen, drei Nägel, flammendes Herz
Patron der Exerzitien und Exerzitienhäuser; der Kinder, Schwangeren und Soldaten; gegen Fieber, Zauberei, Gewissensbisse, Skrupel, Schwergeburt, Viehkrankheiten, Pest und Cholera"
[Quelle: http://www.heiligenlexikon.de/index.htm?BiographienI/Ignatius_von_Loyola.htm. -- Zugriff am 2005-01-29]
15 Zu den Jesuiten siehe:
Antiklerikale Karikaturen und Satiren XXI: Jesuiten / kompiliert und hrsg. von Alois Payer0. -- URL: http://www.payer.de/religionskritik/karikaturen21.htm. -- Zugriff am 2005-01-29
16 Dunkelmännerbriefe
"Epistolae obscurorum virorum (Briefe der Dunkelmänner), Titel einer Sammlung satirischer Briefe aus dem Anfang des 16. Jahrh. Ein 1506 getaufter Kölner Jude, Johann Pfefferkorn, suchte, von seinen frühern Glaubensgenossen angefeindet, aus Rache beim Kaiser Maximilian ein Mandat zur Verbrennung aller jüdischen Bücher, die Bibel ausgenommen, auszuwirken. Reuchlin, mit andern vom Kaiser über diesen Vorschlag befragt, sprach sich 1510 entschieden gegen ihn aus. Pfefferkorn gab darauf im April 1511 eine Schmähschrift gegen Reuchlin: »Der Handspiegel«, heraus, und dieser antwortete im Herbst 1511 in dem »Augenspiegel«. Da veröffentlichte die theologische Fakultät der Universität Köln, der Ketzermeister Jakob Hoogstraten an der Spitze, die an Anklagen gegen Reuchlin reichen »Articuli sive propositiones de iudaico favore etc.« (Köln 1512), denen ein gleichgestimmtes lateinisches Gedicht von Ortwin Gratius, Professor der klassischen Literatur an der Universität Köln, vorausging. Die darauf erfolgte »Defensio Reuchlini contra calumniatores suos Colonienses« (Tüb. 1513) fließt von persönlichen Angriffen gegen seine Gegner über. Zwar stellte ihm Gratius die »Praenotamenta contra omnem malevolentiam« (ohne Ort und Jahr) entgegen, doch Reuchlin suchte Deckung durch eine Sammlung an ihn gerichteter Briefe: »Clarorum virorum epistolae latinae, graecae et hebraicae variis temporibus missae ad J. Reuchlinum« (Tübing. 1514, 2. durch ein zweites Buch vermehrte Ausg., Hagenau 1519). Bald erregte der Streit die gesamte gebildete Welt. Auf Seiten der Kölner standen die theologischen Fakultäten von Mainz, Erfurt, Löwen und Paris, auf Seiten Reuchlins fast sämtliche Humanisten. Ein von den Kölnern anhängig gemachter Prozess wurde 1514 von dem Bischof von Speyer für Reuchlin entschieden; als diese jedoch nach Rom appellierten, wurde er lange verschleppt und endlich 1520 im Hinblick auf die Ausbreitung der Reformation zu ungunsten Reuchlins beendigt. In diesen Streit fallen die »Epistolae obscurorum virorum ad Ortuinum Gratium«. Sie bestehen
- aus den 41 Briefen der 1. und 2. Ausgabe, die angeblich in Venedig bei Minutius (absichtlich statt Manutius), in der Tat aber wohl zu Hagenau bei W. Angst im Herbst 1515 und Anfang 1516 erschienen:
- aus dem zur 3. Ausgabe (ebenfalls 1516) hinzugekommenen Anhang von 7 Briefen;
- aus der 1517 bei Froben in Basel erschienenen zweiten Sammlung mit 62 Briefen, wozu 4) in der 2. Ausgabe (ebenfalls 1517) nochmals ein Anhang von 8 Briefen kam.
Eine sogen. dritte Sammlung (zuerst 1689 gedruckt) umfaßt vermeintliche Seitenstücke dazu aus verschiedener Zeit und hat mit dem ursprünglichen Buch nichts mehr zu schaffen. Die Briefe sind als Gegenstück zu den »Epistolae clarorum virorum ad Reuchlinum« von angeblichen Gesinnungsgenossen des Gratius an diesen geschrieben und persiflieren in schlechtestem Küchenlatein die Unwissenheit und das Wohlgefallen an unnützen Spitzfindigkeiten, die Genusssucht und den Dünkel bei den Mönchen und Obskuranten; zugleich aber berichten sie von den Reuchlinisten und reden so selbst der Wissenschaft das Wort. Sie haben der Reformation wesentlich vorgearbeitet.
Nach den neuern Untersuchungen (vgl. Kampschulte, De Croto Rubiano, Bonn 1862, und »Die Universität Erfurt in ihrem Verhältnis zu dem Humanismus und der Reformation«, Trier 1858-60, 2 Bde.; Böckings Kommentar zu den Briefen im Supplement zu Huttens Werken, s. unten; Strauß, Ulrich von Hutten, 4. Aufl., Leipz. 1878) entstand die erste Anregung dazu in dem Kreise jüngerer Humanisten, der sich zu Erfurt um Mutianus sammelte; der demselben angehörige Crotus Rubianus (s. d.) kann mit ziemlicher Sicherheit als der Verfasser der ersten 41 Briefe bezeichnet werden.
Der Anhang zur ersten Sammlung und der Grundstock der zweiten stammen von Ulrich von Hutten, der Anhang zur zweiten rührt von verschiedenen, nicht mehr zu ermittelnden Verfassern her.
Unter den zahlreichen Gesamtausgaben sind die zu Frankfurt (1643), die von Münch (Leipz. 1827), von Rotermund (Hannov. 1827, 2 Bde.) und von Böcking (Leipz. 1858, 2. Aufl. 1864) hervorzuheben. Mit Kommentar und eingehenden bibliographischen Nachweisen finden sie sich in Böckings Ausgabe von »Hutteni opera« (Supplement, Leipz. 1864-69, 2 Bde.).
Eine Übersetzung ins Deutsche lieferte Binder (Stuttg. 1875; neue Ausg., Köstritz 1904). Eine Verteidigungsschrift Pfefferkorns 1516 sowie die »Lamentationes obscurorum virorum« (Köln 1518) vermochten den Epistolae nur lahme und gezwungene Witze entgegenzustellen.
Die »Epistolae novae obscurorum virorum ex Francofurto Moenano ad Dr. Arnoldum Rugium rubrum nec non abstractissimum datae« von G. Schwetschke (Frankf. 1849; neu hrsg. mit Erläuterungen, Halle 1875) behandeln das deutsche Reichsparlament, die »Epistolae obscurorum virorum de concilio Vaticano« von demselben (Leipz. 1872) das vatikanische Konzil."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
17 Machiavelli
"Machiavelli (spr. mackjawélli), Niccolò di Bernardo dei, einer der größten Staatsmänner und Geschichtschreiber Italiens, geb. 3. Mai 1469 in Florenz aus einer verarmten Patrizierfamilie, gest. 22. Juni 1527, ward 1498 an die Spitze der zweiten Kanzlei der florentinischen Republik gestellt, die dem Rate der Zehn beigegeben war, und mehrmals mit Missionen an den König von Frankreich, den Papst und den Kaiser betraut, über die er ausgezeichnete Staatsschriften an seine Behörde sandte. Als die Mediceer 1512 nach Florenz zurückkehrten, wurde M. abgesetzt und aus Florenz verbannt, ja sogar der Teilnahme an einer Verschwörung beschuldigt, eingekerkert und gefoltert, aber als unschuldig wieder freigelassen. Er lebte nun meist auf einer Besitzung zu San Casciano unweit Florenz und beschäftigte sich mit literarischen Arbeiten. Leo X. erforderte seit 1519 gelegentlich wieder sein Gutachten und verwendete ihn auch zu unbedeutenden Sendungen; auch der Kardinal Giulio de' Medici (Papst Clemens VII.) schenkte ihm Vertrauen; die Gunst seiner Mitbürger vermochte er jedoch nicht wiederzugewinnen. Seine Komödien (»Clizia«, »Mandragola«; letztere deutsch von A. Stern, Leipz. 1881; von Seliger, das. 1904), Nachahmungen des Plautus, zeichnen sich durch scharfe Charakteristik und witzigen Dialog aus, sind aber äußerst anstößig. Die »Istorie fiorentine« (Flor. 1532; deutsch von Neumann, Berl. 1809, 2 Bde., und von Reumont, Leipz. 1846, 2 Bde.) von 1215-1492 sind eins der vorzüglichsten Werke der italienischen Prosa, lebendig, anschaulich, in edlem Stil. Machiavellis berühmteste Werke sind seine »Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio« (Wien 1532 und 1630; deutsch von Grüzmacher, Berl. 1871), worin er die Verfassung des alten Rom als die vorzüglichste preist, »Dell' arte della guerra sette libri« und »Il Principe« (Rom 1535 u. ö.; lat., Leiden 1643; deutsch zuletzt von Eberhard, 2. Aufl., Berl. 1873; von Grüzmacher, das. 1870), 1514 abgefaßt und an Lorenzo de' Medici gerichtet, worin M. einen Fürsten schildert, der, wie Cesare Borgia, ohne Rücksicht auf Moral und Religion, durch Klugheit und konsequentes Handeln in dem von ihm unterjochten Staat seine Alleinherrschaft zu begründen weiß. Man hat daher eine Staatskunst, der alle sittliche Grundlage fehlt, und welche die Klugheit zur einzigen Richtschnur ihres Handelns macht, Machiavellismus oder machiavellistische Politik genannt; und gegen sie schrieb Friedrich II. seinen »Antimachiavell«. Demgegenüber haben Neuere, namentlich Herder, Macaulay und Ranke (»Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber«), im »Principe« mit Recht ein aus den Verhältnissen der Zeit und den damaligen Zuständen Italiens zu erklärendes politisches Werk erkannt, bestimmt, den italienischen Fürsten Anleitung zur Gewinnung und Erhaltung politischer Macht zu geben, damit auf der Grundlage dieser Macht die Wiedergeburt des von Fremdherrschaft und Bürgerkriegen befreiten Italiens erfolgen könne. »M. suchte die Heilung Italiens, doch der Zustand desselben schien ihm so verzweifelt, daß er kühn genug war, ihm Gift zu verschreiben« (Ranke). Gesamtausgaben von seinen Werken erschienen seit 1531 öfter, so zu Florenz 1813, 8 Bde.; 1826, 10 Bde., und in 1 Band 1833; hrsg. von Parenti, das. 1843; von Polidori, das. 1857; von Passerini u. Milanesi, das. 1873-79, 6 Bde. (nicht vollendet). Eine deutsche Übersetzung lieferte Ziegler (Karlsr. 1832-41, 8 Bde.). Eine Sammlung von Machiavellis Briefen veranstaltete Leo (Berl 1826). Ein Band Gesandtschaftsberichte erschien in Florenz 1858." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
18 Anhänger Epikurs, d.h. Lebemänner, Liebhaber sinnlicher Genüsse.
19 Ratzinger
"Joseph Kardinal Ratzinger (* 16. April 1927 in Marktl am Inn) ist Dekan des Kardinalskollegiums und Präfekt der Glaubenskongregation. Somit ist Joseph Kardinal Ratzinger einer der bedeutendsten Kardinäle, er wird oft auch als die "Rechte Hand" des Papstes bezeichnet.
Von 1946 bis 1951 absolvierte er ein Studium der Theologie und der Philosophie. 1951 empfing Ratzinger das Sakrament der Priesterweihe. Im Jahre 1953 promovierte Ratzinger zum "Dr. theol.", 1957 habilitierte er an der Universität München im Fach Fundamentaltheologie.
Ein Jahr später, 1958, wurde Ratzinger Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Freising und im gleichen Jahr noch Dozent an verschiedenen deutschen Universitäten (München, Münster, Tübingen und Regensburg) in den Fächern Fundamentaltheologie, Dogmatik und Dogmengeschichte.
Diese Arbeit machte Ratzinger bis in das Jahr 1977, war jedoch während des Zweiten Vatikanischen Konzils Berater des Kölner Erzbischofs Joseph Kardinal Frings. Außerdem ernannte man ihn 1976 zum Päpstlichen Ehrenprälaten.
Im März 1977 ernannte Papst Paul VI. Joseph Ratzinger zum Erzbischof von München und Freising, drei Monate später wurde er schon zum Kardinal erhoben.
Anfang Dezember 1981 erfolgte die Ernennung zum Präfekten der Glaubenskongregation.
1992 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Titularbischof der suburbikarischen Diözese Velletri- Segni. Ab 1998 war Ratzinger Subdekan des Kardinalskollegiums und wurde 2002 zum Dekan des Kardinalskollegiums und damit zum Titularbischof von Ostia gewählt."[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Ratzinger. -- Zugriff am 2005-01-29]
20 Das Konkordat zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl von 1855 brachte der katholischen Kirche den Höhepunkt ihres Einflusses. Der Kirche wurde Eherecht und Schulwesen unterstellt, der Klerus dem staatlichen Machtbereich entzogen, der Religionsfonds (von Joseph II. u.a. aus dem Vermögen aufgehobener kirchlicher Einrichtungen geschaffen) der katholischen Kirche übergeben. 1868 wurde das Konkordat durch die Maigesetze in wichtigen Punkten modifiziert, 1870 nach Verkündung des Unfehlbarkeitsdogmas von Österreich für unwirksam erklärt, durch staatliche Regelungen ersetzt und 1874 formell aufgehoben.
21 Baden hatte 1859 ein Konkordat mit Rom abgeschlossen. Eine aus Protestanten und Katholiken gemischten Deputation reichte beim Großherzog eine Petition gegen das Konkordat ein. Friedrich Wilhelm Ludwig Großherzog von Baden hob daraufhin das Konkordat auf. und die Verhältnisse der katholischen Kirche wurden durch Staatsgesetz geordnet.
22 Symbol(um): Glaubensbekenntnis
23 Rationalismus
"Rationalismus (v. lat. ratio, »die Vernunft«), in der Theologie die Denkweise, die in der menschlichen Vernunft die Quelle oder wenigstens den Maßstab der Religion und im sittlichen, zur Glückseligkeit führenden Handeln ihren eigentlichen Inhalt erblickt. Als innerhalb der Kirche anerkannte Denkweise konnte sich der theologische Rationalismus erst auf dem Boden des Protestantismus ausbilden, besonders seitdem in England die sogen. Freidenker (s. Deismus) nicht nur einzelne christliche Dogmen, sondern den Begriff der Offenbarung selbst einer strengen Kritik unterzogen, während die Freigeister (esprits forts) in Frankreich vollends als die wahre Philosophie einen platten Naturalismus zu begründen gesucht hatten. Anders gestalteten sich die Dinge in Deutschland, wo im sogen. Zeitalter der Aufklärung (s. d.) der ursprüngliche Supernaturalismus (s. d.) der protestantischen Theologie, der nur einen formalen, d. h. auf die systematische Darstellung der Dogmen gerichteten, Vernunftgebrauch gestattete, angeregt durch die dogmengeschichtlichen Studien, wie sie Semler (s. d.), die exegetischen, wie sie Ernesti (s. Hermeneutik) und J. D. Michaelis (s. d. 1) anbahnten, und die allgemein kulturhistorischen Impulse, wie sie von Lessing (s. d.) und Herder (s. d. 1) ausgingen, zu einer vorurteilslosern Prüfung des Bibelinhalts fortschritt. Vollendet erscheint dieser theologische Rationalismus erst in Kants Schrift »Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« (1793) mit ihrer Abzielung auf den reinen moralischen Vernunftglauben. In der Folge ward nun die positive Religion mehr und mehr bloß als äußere Handhabe der Moral betrachtet und das eigentlich Religiöse auf wenige abstrakte Sätze zurückgebracht. Gott, Freiheit und Unsterblichkeit waren die Lieblingsideen, um die sich der rationalistische Religionsunterricht und die rationalistische Predigt bewegten. Der Rationalismus hat ein Verstandeschristentum aufgestellt, dem, so ehrlich und treu es gemeint war, doch das Frische, Kräftige, Lebensvolle und Poetische des biblischen Christentums gänzlich abging. Diesen ins Platte und Triviale ausartenden Rationalismus pflegt man als Rationalismus vulgaris, d. h. ordinären Rationalismus, zu bezeichnen. Über dem Eifer in seiner Verurteilung hat man vielfach vergessen, dass der Emanzipation der weltlichen Kultur von der kirchlichen Führung, wie sie sich im Zeitalter des Rationalismus vollzog, auf protestantischem Boden Notwendigkeit zukam, wie denn auch der Rationalismus ein wesentliches Moment der reformatorischen Frömmigkeit, das sittliche Ideal der Pflichtübung, bewahrt und nach der Seite einer universellen Humanität erweitert hat. Als die vorzüglichsten Vertreter des wissenschaftlichen Rationalismus sind die Dogmatiker Wegscheider (s. d.) und Bretschneider (s. d. 2), der durch seine natürliche Wundererklärung epochemachende Exeget H. E. G. Paulus (s. d.) und der Kanzelredner Röhr (s. d.) hervorzuheben. Schleiermacher hat in seiner »Glaubenslehre« den Gegensatz zwischen Rationalismus und Supernaturalismus vor allem durch eine tiefere Erfassung des Begriffs der Religion überwunden." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
24 kategorischer Imperativ
"Der Begriff des »kategorischen Imperativs« stammt von KANT. »Die Vorstellung eines objektiven Prinzips, so wie es für einen Willen nötigend ist, heißt ein Gebot (der Vernunft), und die Formel des Gebotes heißt Imperativ« (Grundleg. zur Met. d. Sitt. WW. IV, 261). I
st die Handlung zu etwas anderem gut, so ist der Imperativ hypothetisch, wird sie als an sich gut vorgestellt, ist er kategorisch. Letzterer erklärt die Handlung für unbedingt notwendig, ist ein apodiktisches Prinzip, als Imperativ der Sittlichkeit (l.c. IV, 262 ff.).
Der kategorische Imperativ ist das formale Prinzip der Sittlichkeit (s. d.), er entspringt der »Würde« des Menschen, der praktischen Vernunft (s. d.) in ihm, bestimmt die Form der Willenshandlungen a priori (s. d.); er deutet darauf hin, dass der Mensch an sich das Glied einer intelligiblen Welt (s. d.) ist, ist der Ausdruck des »reinen« Willens dieser (l.c. S. 270 ff.).
»Die praktische Regel ist jederzeit ein Produkt der Vernunft, weil sie Handlung, als Mittel zur Wirkung, als Absicht vorschreibt. Diese Regel ist aber für ein Wesen, bei dem Vernunft nicht ganz allein Bestimmungsgrund des Willens ist, ein Imperativ, d. i. eine Regel, die durch ein Sollen, welches die objektive Nötigung der Handlung ausdrückt, bezeichnet wird, und bedeutet, dass, wenn die Vernunft den Willen gänzlich bestimmte, die Handlung unausbleiblich nach dieser Regel geschehen wurde« (Krit. d. prakt. Vern. S. 22).
Der kategorische Imperativ ist
»derjenige, welcher nicht etwa mittelbar durch die Vorstellung eines Zweckes, der durch die Handlung erreicht werden könne, sondern der sie durch die bloße Vorstellung dieser Handlung selbst (ihrer Form), also unmittelbar als objektiv notwendig denkt und notwendig macht« (WW. VII, 19).
Der sittliche Imperativ gebietet kategorisch, unbedingt, ohne Rücksicht auf »materiale« Motive (auf Nutzen, Lust u.s.w.). Er lautet:
»Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne« (Krit. d. prakt. Vern. S. 36).
»Handle nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass die zu allgemeines Gesetz werde« (WW. IV, 269).
Ein praktischer Imperativ ist:
»Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst« (WW. IV, 277)."
[Quelle: Eisler, Rudolf <1873-1926>: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. -- 2. völlig neu bearb. Aufl. -- Berlin : Mittler, 1904. -- 2 Bde. -- Bd. 1. -- S. 500]
25 Klopstock
"Klopstock, Friedrich Gottlieb, bahnbrechender deutscher Dichter, geb. 2. Juli 1724 in Quedlinburg, gest. 14. März 1803 in Hamburg, war das älteste unter 17 Kindern des Advokaten Klopstock Die Ausbildung des Dichters, vom Vater früh vorzugsweise auf körperliche Entwickelung gerichtet, fand in dieser Hinsicht besondere Förderung durch den Umstand, dass die Familie um 1735 auf das in Pacht genommene Amtsgut Friedeburg bei Quedlinburg zog. 1737 wurde Klopstock Schüler des Gymnasiums in letzterer Stadt, 1739 trat er in die Schule zu Pforta. Dort wurde er mit den altklassischen Schriftstellern genau vertraut und fasste frühzeitig den Plan zu einem nationalen Heldenepos über Heinrich den Vogler, der aber unter dem Eindruck von Miltons »Verlornem Paradies« bald durch den des »Messias« verdrängt wurde. Klopstock wählte mit sicherm Gefühl einen Gegenstand, in dem der bedeutendste Gehalt jener Zeit, die pietistisch vertiefte religiöse Stimmung, verkörpert werden konnte. Schon in seiner Abschiedsrede über die großen Epiker, die er 21. Sept. 1745 in Pforta hielt (abgedruckt in Cramers »Klopstock«, Bd. 1), wies er auf die große Lebensaufgabe, die ihm vorschwebte, hin. In Jena, wohin sich' Klopstock im Herbst 1745 begab, um Theologie zu studieren, entstanden die drei ersten Gesänge des »Messias« und zwar in Prosa. Die anfängliche Absicht, das Gedicht überhaupt in ungebundener Rede abzufassen, die besonders in dem Widerwillen des Dichters gegen den Modevers, den Alexandriner, wurzelte, wurde erst während Klopstocks Studienzeit in Leipzig (seit Ostern 1746) aufgegeben, wo er den Anfang seines Gedichts, zuerst am Erfolg zweifelnd, in Hexameter umgoss, und dieser Übergang zu dem antiken Metrum sollte für die moderne Dichtung höchst bedeutsam werden. In Leipzig trat Klopstock in Verbindung mit dem Kreis junger Poeten, die, von der Gottschedschen Richtung abgefallen, in den sogen. »Bremer Beiträgen« (s. d.) ihr literarisches Organ hatten. Diese »Beiträge« brachten denn auch (1748 im 4. Band) die drei ersten Gesänge von Klopstocks »Messias« in die Öffentlichkeit. Klopstock, der auch als Lyriker bereits in Leipzig produktiv gewesen war und dort einige seiner schönsten Oden (»Der Lehrling der Griechen«, »An die Freunde« (Wingolf), »An Giseke«, »Die künftige Geliebte«) gedichtet hatte, war inzwischen als Hauslehrer einer angesehenen Familie nach Langensalza gegangen, hauptsächlich um der Schwester seines Vetters Schmidt, Marie Sophie, nahe zu sein, die bei einem Besuch in Leipzig in Klopstock eine leidenschaftliche, doch unerwiderte Neigung entfacht hatte und in Klopstocks Dichtungen unter dem Namen »Fanny« verewigt ist. Die Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen, die Gegenliebe des Mädchens zu erwerben, bewog neben andern Umständen den Dichter, einer Einladung Bodmers nach Zürich zu folgen. Im Juli 1750 traf er hier ein. Unterdessen war das anfängliche Schweigen über das Messiasfragment in Deutschland dem lauten Lärm eines heftigen literarischen Streites gewichen. Der Professor der Philosophie G. F. Meier in Halle, der Gothaer Rektor Stuß u. a. sprachen sich anerkennend aus, während Gottsched energisch, aber völlig fruchtlos, die Begeisterung für den »Messias« bekämpfte. In Zürich enttäuschte Klopstocks jugendliches, genussfrohes Auftreten und Verhalten (vgl. die Ode »Zürchersee«) Bodmer und dessen alte Freunde, die einen »heiligen« Dichter erwartet hatten. Bodmer zürnte in unfreundlichster Weise; Klopstock aber ging in seinem überreizten Selbstgefühl einen Schritt zu weit, so dass ein Bruch erfolgte, der vor Klopstocks Weggang aus Zürich (im Februar 1751) nur notdürftig geheilt werden konnte. Inzwischen hatte Klopstock durch Vermittelung des Ministers Grafen Bernstorff vom König Friedrich V. von Dänemark einen Gnadengehalt von 400 Reichstaler erhalten, damit er in Kopenhagen den »Messias« mit guter Muße und »ohne Distraktion« beendigen könne. Auf der Hinreise lernte Klopstock in Hamburg die für sein Gedicht begeisterte Meta Moller kennen, die im Juni 1754 seine Gattin wurde. Die ersten Jahre seiner sehr glücklichen Ehe sahen den Dichter auch auf dem Höhepunkt seines dichterischen Schaffens. 1755 war der »Messias« bis zum zehnten Gesang beendigt und in doppelter Ausgabe erschienen. Um dieselbe Zeit entstanden Klopstocks früheste prosaische Abhandlungen; 1757 machte der Dichter mit dem »Tod Adams« den ersten dramatischen Versuch, und gleichzeitig war er besonders fruchtbar in der Gattung des geistlichen Liedes. 1758 nahm der Tod seine treue Meta (Cidli nannte sie der Dichter in den schönen an sie gerichteten Oden) während eines Besuches in Hamburg ihm von der Seite, und mit diesem Ereignis schließt Klopstocks glücklichster Lebensabschnitt. In den Jahren 1762-64 verweilte der Dichter in Quedlinburg und Halberstadt im Familienkreis; 1763 wurde er zum dänischen Legationsrat ernannt. In die nächsten Jahre fällt Klopstocks Beschäftigung mit der altnordischen Dichtung und Mythologie; die unklar-idealisierenden Vorstellungen, die er sich von der heidnischen Vorzeit der Germanen bildete, spiegeln sich von nun an vielfach in seinen Schriften wider; in manchen Fällen hat er aus seinen ältern Schriften die mythologischen Namen des klassischen Altertums entfernt und sie durch germanische ersetzt. Neben der Fortführung des »Messias« entstand in der nächstfolgenden Zeit unter anderm das dramatische Bardiet »Die Hermannsschlacht« (1769), von dem angeregt sich das wesenlose, bombastisch- rhetorische Bardenwesen in der deutschen Literatur üppig ausbreitete. Die Hoffnungen, die der Dichter in den letzten 60er Jahren auf den neuen Kaiser, Joseph II., setzte, erfüllten sich in keiner Weise. 1770, nach dem Sturze seines Gönners Bernstorff, siedelte Klopstock nach Hamburg über. Durch die Sammlung seiner Oden, welche die Landgräfin Karoline von Darmstadt, und die inkorrekte, die der Dichter Dan. Schubart kurz vorher veröffentlicht hatten, sah er sich veranlasst, selbst eine Ausgabe (Hamb. 1771) zu besorgen, die er Bernstorff widmete. Nach Bernstorffs Tode (1772) wohnte Klopstock eine Zeitlang im Hause von dessen Gemahlin in Hamburg; dann bezog er das Haus eines Herrn v. Winthem daselbst, dessen Witwe später (1791) seine zweite Frau und die treue Pflegerin seines Alters wurde. 1772 ward das Trauerspiel »David« beendigt, 1773 der »Messias« endlich abgeschlossen. Weit über Deutschlands Grenzen hinaus war der Ruhm des Gedichts erschollen. Übertragungen, unter anderm in die italienische, französische und englische Sprache, machten es dem Auslande zugänglich. 1774 erschien die wunderliche Prosaschrift »Die deutsche Gelehrtenrepublik«, die auf Subskription gedruckt wurde. Wie tief und stark die Verehrung und Begeisterung für Klopstock im allgemeinen, besonders aber bei der damaligen Jugend war, zeigt am deutlichsten das Verhältnis, in dem die Mitglieder des Göttinger Dichterbundes (s. d.) zu dem Dichter des »Messias« standen. Sie sahen in Klopstock ihr Ideal und unbedingtes Vorbild. Klopstock trat auch in persönliche Beziehung zu ihnen, und als er 1774 der Einladung, die Markgraf Karl Friedrich von Baden an den »Dichter der Religion und des Vaterlandes« zum dauernden Besuch an seinem Hofe hatte ergehen lassen, folgte, verweilte er in Göttingen im Kreise der begeisterten Verehrer. Von des Dichters damaliger Einkehr in Goethes Wohnhaus berichtet »Dichtung und Wahrheit«. Schon im Frühjahr 1775 verließ Klopstock, des Hoflebens müde, Karlsruhe und traf im Juni wieder in Hamburg ein, wo er die letzten 28 Jahre seines Lebens in zunehmender Stille und Zurückgezogenheit verbrachte. Verdrossen durch die kühle Aufnahme der »Gelehrtenrepublik« und seiner seltsamen linguistischen Versuche (»Fragmente über Sprache und Dichtkunst«, 1779 und 1780), spann sich der Dichter immer mehr in seiner Sonderstellung ein. Der Odendichtung blieb er bis wenige Jahre vor seinem Tode treu; wenn auch einige seiner herrlichsten Oden, unter anderm »An Freund und Feind«, in die letzten Jahrzehnte seines Lebens fallen, so litt doch seine spätere Lyrik noch mehr als die frühere an Unverständlichkeit und Schwerfälligkeit des Ausdrucks. Mehr und mehr der deutsch-patriotischen Richtung sich ergebend (die Dramen: »Hermann und die Fürsten« und »Hermanns Tod« sind Zeugnisse hierfür), nahm Klopstock auch lebhaften Teil an den damaligen großen weltgeschichtlichen Vorgängen im Ausland. Schon der nordamerikanische Unabhängigkeitskrieg hatte ihn hoch begeistert, die Einberufung der französischen Reichsstände feierte er durch die Ode »Etats généraux« (1788). Ein Dekret, das ihn nebst andern freiheitsfreundlichen Ausländern zum Bürger der französischen Republik ernannte (1792), war die Anerkennung für diese und ähnliche Kundgebungen. Seiner Enttäuschung, die nicht lange auf sich warten ließ (den Entwickelungsgang der Revolution missbilligte er in einem Schreiben an den Präsidenten des Konvents sehr nachdrücklich), gab er gleichfalls poetischen Ausdruck (Ode »Mein Irrtum«). Am 2. Juli 1824 ward zu Quedlinburg und Altona Klopstocks Säkularfeier begangen und ihm in ersterer Stadt ein Denkmal errichtet, 2. Juli 1874 in Quedlinburg, Schulpforta und anderwärts das 150jährige Jubiläum des Dichters gefeiert. Die historische Bedeutung von Klopstocks Schaffen ist sehr groß. Er befreite die deutsche Dichtung aus den Banden trockner Verstandeskultur, in der sie jahrzehntelang befangen gewesen war, und verlieh ihr durch die Tiefe, Kraft und Wahrheit des religiösen Gefühls, das ihn ganz erfüllte, eine Schönheit und Größe, die zuvor in Deutschland unbekannt gewesen war. Durchaus Lyriker, von seltener Gewalt des Pathos, und zugleich ein sorgfältig feilender Künstler, erweckte Klopstock in den stillen Herzen der dem öffentlichen Leben meist fernstehenden Menschen jener Zeit die idealste Begeisterung für Religion, deutsche Art, Freiheit, Liebe und Freundschaft, die mehrere Generationen beglückt und gehoben hat. Er ist der bedeutendste Vertreter der großen Periode der Empfindsamkeit, so wie Lessing und Kant die bedeutendsten Vertreter der Aufklärung sind: erst in Goethe und Schiller fanden diese beiden Kulturströmungen harmonischen Ausgleich. Zugleich aber übte Klopstock entscheidenden Einfluss auf die Entwickelung des poetischen Stils: seine Sprache bietet in ihrer gedrängten Kürze eine Fülle ausdrucksvoller Schönheit, sie ist individuell und von dem Hergebrachten stark abweichend; doch ist sie oft allzu kühn, dunkel und hier und da fast ungenießbar geschraubt. Seine metrischen Neuerungen waren dagegen größtenteils glücklich: die antiken Vers- und Strophenformen sind zwar nicht einwandfrei von Klopstock gehandhabt worden, aber sie bilden zu dem erhabenen Inhalt seiner Dichtung das passende Gewand; die »freien Rhythmen«, die er einführte (zuerst in der Ode »Die Genesung«, 1754), haben sich bis auf die Gegenwart als sehr wertvolles Ausdrucksmittel erwiesen. Klopstocks Talent war einseitig auf eine bestimmte Form der »sentimentalischen« Lyrik beschränkt; sein »Messias« ist als Epos verfehlt und nur durch die lyrischen Schönheiten erfreulich, seine Dramen sind unbedeutend, seine theoretischen Arbeiten schrullenhaft. Aber er hat das Gefühlsleben seiner Zeit wie kein andrer erschlossen und dadurch auf die junge Dichtergeneration einen kaum zu ermessenden Einfluss gewonnen."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
26 Nathan
"Nathan der Weise ist ein dramatisches Gedicht in fünf Akten von Gotthold Ephraim Lessing, veröffentlicht 1779, uraufgeführt 1783. Es ist in fünfhebigen jambischen Versen verfasst. Der "Nathan" ist eigentlich der letzte Anti-Goeze, Lessings Auseinandersetzung mit dem Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Goeze. Lessings Beschäftigung mit dem Stoff reicht aber nachweislich bis ca. 1750 zurück. Kern des Stückes, die Erzählung der "Ringparabel" vor dem Sultan (siehe unten), wird bereits bei Giovanni Boccaccio in dessen Geschichtensammlung "Dekameron" berichtet, reicht aber tatsächlich bis etwa um 1100 zurück, wo sie von spanischen Juden erfunden wurde.
In der Figur Nathans des Weisen setzte Lessing seinem Freund Moses Mendelssohn ein literarisches Denkmal.
Von historischem Interesse für die Entstehung des Stückes ist auch die Auseinandersetzung mit Hermann Samuel Reimarus im Fragmentenstreit.
InhaltDie Handlung spielt zur Zeit der Kreuzzüge (Dritter Kreuzzug) in Jerusalem. Als der Jude Nathan von einer Geschäftsreise zurückkommt, erfährt er, dass seine Tochter Recha von einem christlichen Tempelherrn aus einem Feuer gerettet wurde. Dieser Tempelherr verdankt sein Leben der Begnadigung durch den muslimischen Herrscher, Sultan Saladin. Dieser hatte ihn begnadigt, weil er seinem (des Sultans) verstorbenen Bruder Assad ähnlich sah. Nathan überredet/überzeugt den Tempelherrn zu einem Besuch, um den Dank seiner Tochter entgegenzunehmen.
Sultan Saladin hat Geldsorgen, deshalb plant er Nathan eine Fangfrage zu stellen und dessen Antwort zu nutzen, um Geld von ihm zu bekommen. Er fragt Nathan nach der "wahren Religion". Dieser antwortet mit der Ringparabel (siehe unten).
Der davon tief beeindruckte Sultan bittet daraufhin, Nathans Freund sein zu dürfen.
Der Tempelherr hat sich unterdessen in Recha verliebt und möchte sie heiraten, obwohl sie die Tochter eines Juden ist. Als er aber herausfindet, dass Recha adoptiert ist und ihre leiblichen Eltern Christen waren, wendet er sich an den Patriarchen von Jerusalem. Dieser versucht daraufhin, Nathan eine Falle zu stellen. Am Ende stellt sich heraus, dass Recha und der Tempelherr Geschwister und die Kinder von Assad sind. Nathan, der kein leiblicher Verwandter ist, wird als Vater im Sinne der Seelenverwandtschaft anerkannt.
RingparabelIn der Schlüsselszene des Dramas lässt Saladin, der muslimische Eroberer Jerusalems, Nathan zu sich rufen und legt ihm die Frage vor, welche der drei monotheistischen Religionen er denn für die wahre halte. Aus Gründen, die hier im einzelnen außer Betracht bleiben können (die aber viel mit Nathans berechtigter Sorge um sein eigenes Leben und das seiner Tochter zu tun haben dürften), nimmt Nathan davon Abstand, die eigene Religion (das Judentum) für die einzig wahre zu erklären. Statt dessen antwortet er mit einem Gleichnis. In diesem Gleichnis besitzt ein Mann ein wertvolles Familienerbstück: einen Ring, der über die magische Eigenschaft verfügt, seinen Träger „den Menschen angenehm“ zu machen. Dieser Ring wurde über viele Generationen hinweg vom Vater auf den Sohn vererbt, und zwar (falls mehrere Söhne vorhanden waren) stets an jenen, den der Vater am meisten liebte. Nun hat aber der Mann, von dem die Erzählung handelt, drei Söhne, die ihm alle gleichermaßen lieb sind, sodass er nicht weiß, wem von den dreien er den Ring hinterlassen soll. Schließlich behilft er sich, indem er von einem Goldschmied zwei weitere Ringe herstellen lässt, die beide dem ursprünglichen Ring aufs Haar gleichen. Er hinterlässt jedem Sohn einen Ring, wobei er jedem versichert sein Ring sei der echte. Nach dem Tode des Vaters kommt es zum Rechtsstreit. Die drei Söhne ziehen vor den Kadi und verlangen, er solle feststellen, welcher von den drei Ringen der echte sei. Der Richter aber ist außerstande dies zu ermitteln. So erinnert er die drei Männer daran, dass der echte Ring die Eigenschaft habe, den Träger bei allen anderen Menschen beliebt zu machen; wenn aber dieser Effekt bei keinem der drei eingetreten sei, dann könne das wohl nur heißen, dass der echte Ring verlorengegangen sein müsse. Jedenfalls solle ein jeder von ihnen trachten, die Liebe aller seiner Mitmenschen zu verdienen; wenn dies einem von ihnen gelinge, so sei er der Träger des echten Ringes.
Wirkung und Diskussion der RingparabelDie Ringparabel gilt als ein Schlüsseltext der Aufklärung und als pointierte Formulierung der Toleranzidee. Dem zugrunde liegt die Analogie, dass der Vater für Gott, die drei Söhne für die drei Religionen (Christentum, Islam und Judentum) und der Richter für Nathan selbst stehen. Die Aussage der Parabel wäre demnach, dass Gott die drei Religionen gleichermaßen liebe. Eine andere Interpretation ist, dass Gott die Religion am meisten liebe, die von allen Menschen angenommen und respektiert wird und die alle Menschen eint.
Gleichermaßen lässt sich auch außerhalb der Aufklärung die Bedeutung finden, dass die "Wahrheit", also die wahre Gottesschau (in diesem Fall hinter dem christlichen Charisma- und Liebessymbol versteckt) tatsächlich verloren gegangen ist (so sie denn jemals in expliziter Form vorlag und nicht nur als implizite Offenbarung). Die Religionen als Gruppierungen, welche diesem Ideal zustreben, seien ihm ähnlich nah aber gleichzeitig auch ähnlich fern. Die Tradition, immer dem "liebsten" Sohn die Wahrheit zu vererben lässt sich deuten als Verweis auf das Prophetenwesen, weshalb die Ähnlichkeit der abrahamitischen Religionen untereinander und des gesamten Monotheismus (welcher näher an der Wahrheit liegt als Animismus oder Polytheismus, vermutlich ferner als der Pantheismus) zu Recht postuliert wird. Mit der Parabel jedoch wird auch unterstellt, man müsse das Wirken Gottes an seinen Resultaten in der Welt festmachen können, um ihnen Sein zuzuweisen.
Zur Vorgeschichte der Ringparabel, siehe die Erzählung von Saladins Tisch bei Jans dem Enikel (13. Jahrhundert)."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Nathan_der_Weise. -- Zugriff am 2005-01-29]
27 Hengstenberg
"Hengstenberg, Ernst Wilhelm, Theolog, geb. 20. Okt. 1802 zu Fröndenberg in der Grafschaft Mark, gest. 28. Mai 1868 in Berlin, der einflußreichste Vorkämpfer der neulutherischen Orthodoxie des 19. Jahrh., widmete sich in Bonn philosophischen und orientalischen Studien und veröffentlichte schon in seinem 22. Jahr eine Übersetzung der »Metaphysik« des Aristoteles (Bonn 1824, Bd. 1) und eine Bearbeitung der »Moallakah« des Amrilkaïs (das. 1823). Während seines akademischen Lebens beteiligte er sich lebhaft an den damaligen burschenschaftlichen Bestrebungen. In Basel, wo er 1823-24 als Hauslehrer lebte, vollzog sich in ihm eine religiöse Wandlung nach der Seite der strengen Orthodoxie. Sofort habilitierte er sich 1824 an der philosophischen und 1825 (jetzt schon als ausgesprochener Gegner des Rationalismus und Hegelianismus) an der theologischen Fakultät zu Berlin, wo er 1826 außerordentlicher, 1828 ordentlicher Professor der Theologie wurde. Unter seinen wissenschaftlichen Arbeiten, die indessen vollständig im Dienste der dogmatischen Tendenz stehen, nennen wir: »Christologie des Alten Testaments« (Berl. 1829-35, 3 Bde.; 2. Aufl. 1854-58); »Beiträge zur Einleitung ins Alte Testament« (das. 1831-39, 3 Bde.); »Kommentar über die Psalmen« (das. 1842-47, 4 Bde.; 2. Aufl. 1849-52); »Das Hohelied Salomonis« (das. 1853); »Das Evangelium Johannis« (das. 1861-64, 3 Bde.; 2. Aufl. 1869-71, 2 Bde.); »Die Offenbarung Johannis« (das. 1849-1851, 2 Bde.; 2. Aufl. 1862); »Die Weissagungen des Propheten Ezechiel« (das. 1867-68, 2 Bde.). Den weitgreifendsten Einfluss hat Hengstenberg durch seine 1827 gegründete »Evangelische Kirchenzeitung« ausgeübt, ein Parteiorgan der rücksichtslosesten Unduldsamkeit." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
28 Stahl
"Stahl, Friedrich Julius, hervorragender Schriftsteller im Fache des Staatsrechts und Kammerredner, geb. 16. Jan. 1802 in München von jüdischen Eltern, gest. 10. Aug. 1861 in Brückenau, trat 1819 in Erlangen zur protestantischen Kirche über und habilitierte sich im Herbst 1827 als Jurist in München. In demselben Jahr erschien seine erste größere Schrift: »Über das ältere römische Klagenrecht« (Münch. 1827). Von Schelling angeregt, schrieb er: »Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht« (Heidelb. 1830-1837, 2 Bde. in 3 Abtlgn.; 5. Aufl. 1878), sein wissenschaftliches Hauptwerk, das trotz großer Mängel epochemachend für die Geschichte der Staatswissenschaft ist. Stahl trat darin der naturrechtlichen Lehre schroff entgegen und begründete seine Rechts- und Staatslehre »auf der Grundlage christlicher Weltanschauung«. 1832 ward Stahl zum außerordentlichen Professor in Erlangen, im November zum ordentlichen Professor für Rechtsphilosophie, Pandekten und bayrisches Landrecht in Würzburg ernannt. Später kehrte er nach Erlangen zurück und lehrte hier Kirchenrecht, Staatsrecht und Rechtsphilosophie. 1840 als Professor der Rechtsphilosophie, des Staatsrechts und Kirchenrechts nach Berlin berufen, 1849 von König Friedrich Wilhelm IV., der ihm seine Gunst zuwandte, zum lebenslänglichen Mitgliede der damaligen Ersten Kammer, des spätern Herrenhauses, ernannt, wurde Stahl hier und 1850 im Erfurter Parlament, dem er angehörte, der Hauptwortführer der Reaktion. Auch auf kirchlichem Gebiete benutzte er seine Stellung als Mitglied des evangelischen Oberkirchenrats (1852-58) zur Lockerung der Union, zur Stärkung des lutherischen Konfessionalismus und zur Erneuerung der Herrschaft der orthodoxen Geistlichkeit über die Laienwelt. Der politische Umschwung infolge der Erhebung des Prinz-Regenten und der Sturz des Ministeriums Manteuffel brachen auch Stahls Herrschaft im Oberkirchenrat und veranlassten 1858 seinen Austritt aus dieser Behörde. Von seinen Schriften sind noch hervorzuheben: »Die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protestanten« (Erlang. 1840, 2. Aufl. 1862); »Über Kirchenzucht« (Berl. 1845, 2. Aufl. 1858); »Das monarchische Prinzip« (Heidelb. 1845); »Der christliche Staat« (Berl. 1847, 2. Aufl. 1858); »Die Revolution und die konstitutionelle Monarchie« (das. 1848, 2. Aufl. 1849); »Was ist Revolution?« (1.-3. Aufl., das. 1852); »Der Protestantismus als politisches Prinzip« (das. 1853, 3. Aufl. 1854); »Die katholischen Widerlegungen« (Berl. 1854); »Wider Bunsen« (gegen dessen »Zeichen der Zeit«, 1.-3. Aufl., das. 1856); »Die lutherische Kirche und die Union« (das. 1859, 2. Aufl. 1860). Nach seinem Tod erschienen: »Siebenzehn parlamentarische Reden« (Berl. 1862) und »Die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche« (2. Aufl., das. 1868)." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
29 Vilmar
"Vilmar, August Friedrich Christian, Theolog und Literarhistoriker, geb. 21. Nov. 1800 zu Solz in Kurhessen, gest. 30. Juli 1868 in Marburg, studierte in Marburg Theologie, trat 1821 in den Kirchen- und Schuldienst, 1831 in die kurhessische Ständeversammlung und wurde, nachdem er sich vom Liberalismus abgewandt, kurz darauf Mitglied der obern Kirchen- und Schulkommission und 1833 Direktor des Gymnasiums in Marburg. Im März 1850 wurde er mit dem Prädikat Konsistorialrat zum vortragenden Rat in das Ministerium des Innern berufen. Mit dem Rücktritte des Ministeriums Hassenpflug fiel auch er 1855 und wurde Professor der Theologie in Marburg. In seinen amtlichen Stellungen wie auch als Herausgeber der Wochenschrift »Der hessische Volksfreund« (1848-51) und der »Pastoral-theologischen Blätter« (1861-66) hat Vilmar auf die Entwickelung einer streng hierarchischen Richtung hinzuwirken gesucht, einer Richtung, die auch in seinen »Schulreden über Fragen der Zeit« (Marb. 1846; 3. Aufl., Gütersl. 1886) und in der »Theologie der Tatsachen wider die Theologie der Rhetorik« (Marb. 1856; 4. Aufl., Gütersl. 1876) hervortritt. Erfreulicher war sein Wirken auf dem Gebiete der deutschen Literaturgeschichte, namentlich zeichnen sich die Vorlesungen über die »Geschichte der deutschen Nationalliteratur« (Marb. 1845; 26. Aufl., fortgesetzt von A. Stern, 1905) durch Lebendigkeit der Darstellung und durch seines Verständnis für die altdeutsche Dichtung aus. Kleinere Arbeiten sind: »Anfangsgründe der deutschen Grammatik« (8. Aufl., neu bearbeitet von Kauffmann, Marb. 1888); »Deutsche Altertümer im Heliand« (das. 1845, 2. Aufl. 1862); »Zur Literatur Johann Fischarts« (das. 1846, 2. Aufl. 1865); das »Deutsche Namenbüchlein« (das. 1855, 6. Aufl. 1898); »Handbüchlein für Freunde des deutschen Volksliedes« (das. 1867, 3. Aufl. 1886); »Idiotikon von Kurhessen« (das. 1868; Nachträge von Pfister, 1886 u. 1894) und »Lebensbilder deutscher Dichter und Germanisten« (Frankf. 1869; 2. Aufl. von Koch, 1886). Die Schrift »Zur neuesten Kulturgeschichte Deutschlands« (Frankf. 1858-67, 3 Tle.) stellt seine Wirksamkeit in den Revolutions- und Restaurationsjahren dar. Aus seinem Nachlass wurden herausgegeben: »Die deutsche Verskunst« (hrsg. von Grein, Marb. 1870; neu bearbeitet von Kauffmann u. d. T.: »Deutsche Metrik«, 2. Aufl. 1907); »Theologische Moral« (Gütersl. 1871, 3 Bde.); »Lehrbuch der Pastoraltheologie« (das. 1872); »Kirche und Welt oder die Aufgaben des geistlichen Amtes« (das. 1872-73, 2 Bde.); »Dogmatik« (das. 1874-75, 2 Bde.; im Auszug 1895) und »Collegium biblicum. Praktische Erklärung der Heiligen Schrift« (das. 1879-88, 6 Bde.; 1. Bd. in 2. Aufl. 1908). Seine Biographie schrieb Leimbach (Hannov. 1875)." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
30 Zu den Feiern 1859 zum 100. Geburtstag von Friedrich Schiller (1759 - 1805) vgl. folgenden Bericht von Friedrich Nietzsche:
"Die Schillerfeier in Pforta
Den 8. 12. 1859Der hundertjährige Geburtstag Schillers hatte bei allen Verehrern des großen Deutschen den Wunsch einer allgemeinen Gedächtnisfeier angeregt. Und nicht nur die Gebildeten, nein, auch die untern Stände des Volkes nahmen lebhaft an diesem Nationalfeste Anteil. Über die Grenzen Deutschlands hinaus war das Gerücht hiervon gedrungen; fremde Länder, ja ferne Erdteile trafen großartige Vorbereitungen zu diesem Tage, so dass man wohl behaupten kann, dass noch kein Schriftsteller ein allgemeineres Interesse hervorgerufen hat, als Schiller. Aber wodurch konnte man den Dichter würdiger feiern, als durch die Aufführung seiner hohen Werke? Was vermöchte uns mehr an ihn zu erinnern, als seine eignen Geistesprodukte, der Spiegel seines großen Geistes? Und so wurden auch an diesem Tage in allen Schauspielhäusern nur schillersche Stücke gegeben, in geschlossenen Gesellschaften vorzügliche Szenen aus seinen Dramen aufgeführt, ja fast in jedem Hause wurde er auf irgendeine Weise gefeiert; ein Band aber schlang sich um alle Herzen, das Band der Liebe und Verehrung für den großen Toten. Auch Pforta wollte nicht hinter den allgemeinen Bestrebungen zurückbleiben: schon lange Zeit vorher waren Vorbereitungen zu diesem Tag getroffen. Am Mittwoch fand eine Vorfeier im Turnsaal statt, der hierzu festlich ausgeschmückt war. Eine große Menschenmenge hatte sich in ihm versammelt; der Name »Schiller« schwebte auf aller Munde, und aller Augen auf seiner lorbeerbekränzten Büste. Zuerst wurden die Piccolomini von den Primanern gelesen; die Rolle des Wallenstein hatte Herr Prof. Koberstein übernommen. — Eine hehre Heldengestalt trat vor unsre Augen, die sich kühn über die beengenden Verhältnisse des Lebens hinwegsetzt, einem Ziele nur nachstrebend, das in des Herzens tiefsten Grunde verborgen liegt und alle Handlungen lenkt und leitet. Um sie eine Schar von Feldherrn; die einen in feiger Selbstsucht die Heldengröße ihres Herrn verkleinernd, die andern treu ihm allein ergeben und für sein Wohl wie um das ihrige besorgt. Diesen gegenüber erscheint ein kaiserlicher Hofmann, in allen Schlichen und Redekünsten gewandt, aber doch an der gewaltigen Majestät Wallensteins scheiternd. Und nur ein Schiller konnte uns in so klaren Umrissen den großartigen Charakter dieses Helden vorführen, der über seine Zeit erhaben stolz auf alles Niedrige niederblickt. —
Den zweiten Teil der Vorfeier bildete die Aufführung der Glocke, komponiert von Romberg. Dieses edle Werk versetzte uns durch die Gewalt der Töne in all die Situationen und Lebensbilder, die die Glocke vor uns aufrollt. Wir gerieten in Angst bei der Verwirrung der Feuersbrunst, wir trauerten mit bei den ernsten Klagegesängen, wir wurden erschreckt über die wilden Melodien der Revolution, bis sich unsre Gemüter wieder in der Milde der Friedenschöre beruhigten. Kaum waren die letzten Töne verklungen, da betrat Herr Prof. Koberstein die Bühne und beschloss mit dem edlen Epilog Goethes die Vorfeier. —
Am folgenden Tage fielen die Lektionen der Feier wegen aus. Um zehn Uhr war wiederum Aktus im Turnsaal, der mit zwei schillerschen Chören »Frisch auf, Kameraden« und »Freude, schöner Götterfunken« begann. Gedichte einiger Primaner zu Ehren Schillers wechselten nun mit Arien und Balladen ab, bis endlich Herr Prof. Koberstein die Bühne betrat und die Festrede hielt. Er vergegenwärtigte uns in derselben die Zeit vor Schillers Auftreten und entwickelte dann seine literarische Wichtigkeit für die deutsche Nation und schloss endlich mit dem Gedanken »dieses Nationalfest sei ein bedeutsames Vorzeichen für das wiedererwachte deutsche Nationalgefühl, und man könne an diese Feier schöne Hoffnungen für die Zukunft knüpfen.« —
Nach dem Festessen war dann allgemeiner Spaziergang bis drei Uhr. Die folgenden Stunden verbrachte jeder mit Lesen von Schillers Werken usw. bis endlich Tanz bis zehn Uhr die Feierlichkeiten beschloss. Die Primaner indessen vergnügten sich bei einem Ball noch bis spät in die Nacht hinein. Der folgende Morgen führte uns wieder in das Gleis des gewöhnlichen Lebens: ein hoher und edler Gedanke war aber allen geblieben, nämlich den Manen Schillers ein würdiges Totenopfer gebracht zu haben. —
[Friedrich Nietzsche <1844 - 1900>: Die Schillerfeier in Pforta. -- 1859]
31 Iuvenalis (ca. 60 - 140 n. Chr.), Saturae 2,24
32 den Vater Schillers: Johann Caspar Schiller (1723 - 1796), dieser nahm, noch Jüngling, als Feldscher in bayrischen Diensten am Österreichischen Erbfolgekrieg teil und ließ sich dann 1749, nach dem Frieden heimgekehrt, in Marbach als Wundarzt nieder.
33 wie Joseph, dem Zimmermann, die Vaterschaft an Jesus abgesprochen wird zugunsten des Heiligen Geistes (Jungfrauengeburt)
34 wie Jesus von Nazareth eine Himmelfahrt angedichtet wird
35 Schiller
"Schiller, Johann Christoph Friedrich von (hierzu Tafel »Schiller-Bildnisse«), der populärste und gefeiertste deutsche Dichter, geb. 10. Nov. 1759 in Marbach am Neckar, gest. 9. Mai 1805 in Weimar. Sein Großvater Johannes Schiller lebte in dem bei Waiblingen gelegenen Dorfe Bittenfeld als Bäcker und Schultheiß, sein Vater, Johann Kaspar (1723-1796), nahm, noch Jüngling, als Feldscher in bayrischen Diensten am Österreichischen Erbfolgekrieg teil und ließ sich dann 1749, nach dem Frieden heimgekehrt, in Marbach als Wundarzt nieder. Hier heiratete er im Juli d. J. die Tochter des Bäckers und Löwenwirts Kodweis, Elisabeth Dorothea (1732-1802; vgl. E. Müller, Schillers Mutter, Leipz. 1894). Schillers Vater (vgl. Brosin, Schillers Vater, Leipz. 1879) war eine aufstrebende Willensnatur, tief religiös, von unantastbarem Charakter, rastlos tätig. Die Dürftigkeit seines Einkommens ließ den Chirurgus Schiller 1757 wieder Kriegsdienste nehmen und als württembergischer Fähnrich gegen den großen Preußenkönig nach Schlesien mitziehen. Während er, nach der Heimkehr 1759 zum Leutnant befördert, nahe bei Kannstatt im Übungslager stand, schenkte ihm seine Gattin im Hause ihrer Eltern zu Marbach den ersten und einzigen Sohn, unsern Dichter. Der Militärdienst des Vaters führte die Familie während der nächsten Jahre an verschiedene Orte, endlich 1763 nach Lorch. Hier erhielt der Knabe bei dem Ortspfarrer Moser (dem ein Erinnerungszeichen in den »Räubern« gilt) den ersten regelmäßigen Unterricht. Ende 1766 wurde der Vater zur Garnison nach Ludwigsburg berufen, wo unser Dichter die Lateinschule besuchte, bis ihn der Herzog zu Anfang 1773 als Zögling in seine mit einer Abteilung für künftige Zivildiener verbundene militärische Pflanzschule auf der Solitüde kommandierte, die, noch 1773 zu einer herzoglichen Militärakademie erweitert, 1775 nach Stuttgart verlegt und Ende 1781, nach Schillers Austritt, als »Hohe Karlsschule« (s. Karlsschule) zu einer Art Universität erhoben wurde. Schiller hegte ursprünglich den Plan, Theologie zu studieren, musste ihn aber nach seinem Eintritt in die Akademie aufgeben und entschied sich für die Rechtswissenschaft, später für die Medizin. Dass der in beschränkten Verhältnissen geborne Knabe eine freie Weltbildung erwarb, war wesentlich der halb militärischen, halb wissenschaftlichen Lieblingsanstalt des Herzogs zu danken. Unter den Lehrern befanden sich mehrere begabte und anregende, in die Gedankenwelt der Jugend liebevoll eingehende Männer, wie z. B. der von Schiller hochverehrte J. F. v. Abel (vgl. Aders, J. F. Abel als Philosoph, Berl. 1893); dass an der Anstalt die philosophischen Disziplinen gegenüber den klassisch-philologischen entschieden bevorzugt wurden, war ein Umstand, dessen Folgen in der weitern Entwickelung Schillers noch lange nachwirkten. Die kasernenartige Disziplin mit allen ihren Kleinlichkeiten konnte freilich bei Naturen wie Schiller nur den ungestümen Freiheitsdrang fördern. Schillers Neigung zur Poesie war zunächst durch Klopstocks »Messias« genährt worden. Tiefer und unmittelbarer wirkten die dramatischen Produkte der Sturm- und Drangperiode auf ihn ein; Leisewitz' »Julius von Tarent«, Klingers Erstlingsdramen und Goethes »Götz« regten ihn zur Nacheiferung an. Den stärksten Einfluss auf Schillers Richtung und Bildung gewannen aber Plutarch und J. J. Rousseau: ob er schon damals Schriften Rousseaus gelesen hat, ist ungewiss; aber mit dessen Grundanschauungen wurde er vertraut, und sie erweckten seinen ungestümen Freiheitsdrang (vgl. Johannes Schmidt, Schiller und Rousseau, Berl. 1876). Seit 1776 erschienen im »Schwäbischen Magazin« einzelne Proben seiner Lyrik. 1777-78 begann die Ausarbeitung seines Trauerspiels: » Die Räuber«. Um den literarischen Bestrebungen freier huldigen zu können, ersehnte Schiller seine alsbaldige Entlassung aus der Militärakademie. Aber die 1779 eingereichte Abhandlung »Philosophie der Physiologie« wurde um ihres »zu vielen Feuers« willen vom Herzog abgelehnt; erst im Dezember 1780 erreichte Schiller auf Grund seiner Abhandlung »Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen« (Stuttg. 1780) das ersehnte Ziel. Er wurde zum Medikus ohne Portepee beim Grenadierregiment des Generals Auge mit 18 Gulden Monatsgage ernannt und erfuhr damit, da Herzog Karl eine gute Versorgung in Aussicht gestellt hatte, eine neue Enttäuschung. Von Dichtungen entstanden in dieser Zeit hauptsächlich noch die überschwänglichen Oden »An Laura«, zu denen eine Stuttgarter Hauptmannswitwe, Frau Vischer, den ersten Anlass gegeben haben mag. Es herrscht in ihnen wie in fast allen Jugenddichtungen Schillers jene ungeläuterte Kraftgenialität, die am gewaltigsten in den »Räubern« zum Ausbruch kam. Seit Goethes »Götz« und »Werther« hatte kein dichterisches Erzeugnis solchen Eindruck auf die Zeitgenossen gemacht. Ganz von Rousseauschen Ideen erfüllt, hinreißend durch die Wucht dramatischen Lebens, erzielte das Werk bei der ersten Aufführung, die im Januar 1782 auf der Mannheimer Hof- und Nationalbühne mit Iffland in der Rolle des Franz Moor stattfand, auch in der von dem Intendanten H. v. Dalberg beeinflussten, manche Verschlechterung aufweisenden Bühnenbearbeitung Schillers einen großartigen Erfolg. Beglückt hierdurch, widmete sich der Dichter bald der Vollendung seiner zweiten Tragödie: »Die Verschwörung des Fiesco zu Genua«. Gleichzeitig gab er aus Opposition gegen F. G. Stäudlins »Schwäbischen Musenalmanach« eine »Anthologie auf das Jahr 1782« heraus, die zum größten Teil Dichtungen von ihm selbst darbot. Aber während seine literarische Tätigkeit in diesem Aufschwung begriffen war, zogen schwere Wetter über Schiller heraus. Im Mai hatte er einer Wiederholung der »Räuber« mit Frau v. Wolzogen, der Mutter zweier ihm befreundeten Karlsschüler, beigewohnt und war deshalb heimlich nach Mannheim gereist. Diese Reise und der Umstand, dass eine Stelle in den »Räubern« in Graubünden Anstoß erregt hatte, zogen ihm außer einer Arreststrafe (während deren Abbüßung er »Kabale und Liebe« konzipierte) das Verbot des Herzogs zu, fernerhin »Komödien« oder sonst dergleichen zu schreiben. Das gab den Anstoß zu dem Plan Schillers, sich durch die Flucht dem Druck des heimischen Despotismus zu entziehen. In der Nacht vom 22. zum 23. Sept. 1782, während die ganze Bevölkerung durch ein glänzendes Hoffest in Anspruch genommen war, verließ der Dichter in Begleitung seines treuen Freundes, des Musikers Andreas Streicher, Stuttgart, am 24. traf er in Mannheim ein (vgl. A. Streicher), Schillers Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in Mannheim von 1782-1785, Stuttg. 1836; Neudrucke von Hans Hofmann, Berl. 1905, in Landsbergs »Museum«, das. 1905, und in Reclams Universal-Bibliothek). Er brachte den »Fiesco« fast vollendet mit, der aber bei den Mannheimer Theaterleitern zunächst wenig Beifall fand. Auch fühlte sich Schiller in Mannheim nicht sicher genug; Ende September wanderte er daher mit Streicher weiter nach Frankfurt, dann nahmen die Freunde im Dorf Oggersheim bei Mannheim in armseliger Wirtsstube Wohnung und hausten dort sieben entbehrungsreiche Wochen hindurch, während deren größere Bruchstücke des bürgerlichen Trauerspiels »Luise Millerin« (später »Kabale und Liebe« betitelt) ausgeführt und der »Fiesco« umgearbeitet wurde, ohne aber auch jetzt zur Ausführung angenommen zu werden. Anfang Dezember öffnete sich dem Dichter ein besserer Zufluchtsort. Einer schon in Stuttgart an ihn ergangenen Einladung der Frau v. Wolzogen folgend, begab er sich auf deren Gut Bauerbach bei Meiningen. »Fiesco« war inzwischen von dem Mannheimer Buchhändler Schwan in Verlag genommen worden und erschien alsbald (1783). Der Plan dieses Werkes, dessen Stoff dem Dichter durch eine Empfehlung Rousseaus anziehend geworden war, hatte während der Ausarbeitung erhebliche Veränderungen erfahren: aus einem republikanischen Freiheitsdrama war ein »Gemälde des wirkenden und gestürzten Ehrgeizes« geworden, eine Schöpfung ungleichen Wertes, in der Charakterzeichnung teils sehr gelungen (Fiesco, Mohr), teils verfehlt, im Aufbau anfechtbar, in der Sprache oft kraftvoll, oft bombastisch. In der winterlichen Stille des Bauerbacher Aufenthalts, wo Schiller von Liebe zu Charlotte v. Wolzogen, der Tochter seiner Gönnerin, ergriffen wurde, gelang ihm die Vollendung der »Luise Millerin«, und im März 1783 entwarf er den »Don Carlos«. Der freundschaftliche Verkehr mit dem Meininger Bibliothekar Reinwald, der später Schillers Schwester Christophine heiratete, brachte dem Dichter Unterhaltung und Förderung in seine oft beklemmende Einsamkeit. Im Juli 1783 kehrte er nach Mannheim zurück, wo er im August von dem Intendanten Dalberg, der sich jetzt wieder entgegenkommend zeigte, zum Theaterdichter für die dortige Bühne engagiert wurde. Im April 1784 ging »Kabale und Liebe« zuerst über die Mannheimer Bretter und fand begeisterten Beifall. In diesem Stück hatte Schiller die vollendetste seiner Jugendtragödien, das höchste Meisterwerk in der neuen Gattung des bürgerlichen Trauerspiels geschaffen. Es stellte Zustände der traurigsten damaligen Wirklichkeit dar mit gelegentlich greller Zeichnung, aber doch mit echt poetischer Leidenschaft und Kraft der Charakteristik. Der Erfolg hob Schillers Lebensmut, ohne den materiellen Bedrängnissen des auch von Krankheit oft heimgesuchten Dichters ein Ende zu bereiten. Erfreulich war ihm die Aufnahme in die vom Kurfürsten protegierte Kurpfälzische Deutsche Gesellschaft (Februar 1784), in der er sich (26. Juni) durch den Vortrag seiner noch ganz in moralisierenden Anschauungen befangenen Abhandlung: »Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet«, einführte. Inzwischen war Schiller an die Ausarbeitung des »Don Carlos« gegangen, wobei er sich zum erstenmal im Drama des fünffüßigen Jambus bediente (vgl. Zarncke, Über den fünffüßigen Jambus etc., in den »Goethe-Schriften«, Leipz. 1897). Den ersten Akt des Werkes, von dem Schiller größere Bruchstücke in seiner Zeitschrift »Rheinische Thalia« (später einfach »Thalia«, zuletzt »Neue Thalia«) veröffentlichte, las er Weihnachten 1784 am Darmstädter Hof in Gegenwart des Herzogs Karl August von Weimar vor, der ihm darauf den Titel eines herzoglichen Rates verlieh. Nur langsam gedieh die Fortsetzung des Dramas, besonders auch infolge der leidenschaftlichen Wirren, in die Schiller durch die Liebe zu Charlotte v. Kalb geriet; hiervon legen die Gedichte »Freigeisterei der Leidenschaft« und »Resignation« interessantes Zeugnis ab. Dazu kam drückende Geldnot. Aber auch Unannehmlichkeiten mit den Schauspielern und dem Intendanten verleideten ihm den Aufenthalt in Mannheim, so dass Schiller gern der Einladung mehrerer Verehrer (die ihm schon im Juni 1784 Beweise ihrer hingebenden Bewunderung gegeben hatten), nach Leipzig zu kommen, folgte. Ende April traf Schiller dort ein, wo die Schwestern Minna und Dora Stock sowie deren Verlobte Ferd. Huber und später Gottfried Körner, die Seele dieses ideal gesinnten Kreises, ihm mit feinsinnigem Verständnis entgegenkamen und Körner ihm Befreiung von seiner materiellen Not bereitete. Nach Monaten voll enthusiastischen Glückes, während deren Schiller in dem nahe bei Leipzig gelegenen Dorfe Gohlis wohnte, folgte er dem neuvermählten Freunde Körner im September nach Dresden, wo er das Lied »An die Freude« schrieb und den »Don Carlos« langsam zum Abschluss brachte. Diese Dichtung, deren Plan während der Ausarbeitung wesentliche Veränderungen erfahren hatte (vgl. Elster, Zur Entstehungsgeschichte des »Don Carlos«, Halle 1889), offenbarte des Dichters pathetisches Freiheitsgefühl in hinreißender Vollendung und enthielt in der Schilderung von Liebe und Freundschaft eine Reihe ergreifender Szenen, die das früher von Schiller Geleistete wesentlich übertrafen; doch die Einheit der Handlung war während der langen Entstehung verloren gegangen. In den Erzählungen »Der Verbrecher aus Infamie« (später »Der Verbrecher aus verlorner Ehre«) und »Der Geisterseher« (gedruckt 1789; vgl. A. v. Hanstein, Wie entstand Schillers »Geisterseher«?, Berl. 1903) bewies Schiller, dass ihm auch die Gabe des Erzählers keineswegs abging, und in den durch die Gespräche mit Körner angeregten »Briefen des Julius an Raphael« setzte er die philosophischen Erörterungen seiner akademischen Jahre mit größerm Erfolg fort. Während des Dresdener Aufenthalts wurde der Dichter abermals in ein leidenschaftliches Herzensverhältnis gezogen, aus dem er sich nur unter schweren Kämpfen befreite. Ein Fräulein Henriette v. Arnim hatte ihn in ihre Fesseln geschlagen. Im Juli 1787 riss Schiller sich von Dresden los. Eine Aufforderung Schröders, sein Talent für dessen Bühne zu verwerten und nach Hamburg zu kommen, lehnte er ab; Frau v. Kalb wünschte ihn in Weimar zu sehen, wohin ihn noch andre Interessen zogen.
So langte Schiller im Juli 1787 in der Musenstadt an, wo er achtungsvolle Aufnahme fand und die herzlichen Beziehungen zu Charlotte v. Kalb erneuerte. Ende 1787 besuchte er in Rudolstadt die Witwe des Oberjägermeisters v. Lengefeld, die er nebst ihren geistvollen und liebenswürdigen Töchtern Karoline und Lotte bereits 1784 in Mannheim flüchtig gesprochen hatte. Im Mai 1788 siedelte er in das nahe bei Rudolstadt gelegene Dorf Volkstedt über; am 9. Sept. lernte er im Lengefeldschen Hause Goethe kennen, zu dem sich aber einstweilen noch kein näheres Verhältnis herausbildete. Inzwischen hatte Schiller die »Geschichte des Abfalls der Niederlande« auszuarbeiten begonnen, deren erster und einziger Teil 1788 erschien, eine Schrift, die bei unzulänglicher Quellenkritik doch überall die geistvolle Auffassung und Darstellung des Dichters verrät. Daneben entstanden mehrere Gedichte, so im März 1788 »Die Götter Griechenlands«, jene berühmte Klage um die heimgegangene »Religion der Schönheit«, deren elegische Wahrheit die Polemik F. Leop. v. Stolbergs nicht aufzuheben vermochte; und durch die Lektüre Homers und die Übertragung Euripideischer Stücke versuchte Schiller, das Griechentum sich trotz mangelnder Sprachkenntnis näherzubringen. Im November kehrte er nach Weimar zurück. Sein Herz jedoch blieb in Rudolstadt, wo er den Schwestern Karoline v. Beulwitz (die in ihrer Ehe nicht glücklich war) und Lotte v. Lengefeld gleich lebhafte Neigung widmete.
Im Dezember erhielt er durch Goethes Vermittelung einen Ruf als außerordentlicher (zunächst unbesoldeter) Professor der Geschichte nach Jena, dem er trotz einiger Bedenken gern folgte. Nachdem er im Winter sein inhaltreiches Gedicht »Die Künstler« unter Wielands Anteil und nach mannigfaltigen Änderungsvorschlägen Wielands langsam abgeschlossen hatte, trat er sein Lehramt im Mai mit der Vorlesung »Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?« an und wurde von der Studentenschaft mit Jubel begrüßt. Schiller, der im ganzen nur fünf Semester Vorlesungen gehalten hat, übte auch als Dozent auf einen engern Kreis von Zuhörern, unter denen Friedrich v. Hardenberg (Novalis) besonders genannt sei, einen starken Eindruck aus. Seit 1790 gab er eine Sammlung historischer Memoiren heraus und bald, 1791-93, trat er in Göschens »Historischem Damenkalender« mit einer neuen, umfangreichen Arbeit, der »Geschichte des Dreißigjährigen Krieges«, hervor, in der namentlich die ausgezeichneten Charakterbilder Wallensteins und Gustav Adolfs neben der durchweg fesselnden Darstellung zu rühmen sind. Im Juli 1789 hatte sich das Verhältnis des Dichters zu Lotte v. Lengefeld zum völligen Herzensbund gestaltet, und nachdem der Herzog Karl August zu Ende des Jahres einen kleinen Jahresgehalt (von 200 Tlr.) bewilligt hatte, schritten die beiden 22. Febr. 1790 in dem Dorfe Wenigenjena bei Jena vor den Altar. Das reiche, wenn auch durch fast erdrückende Arbeitslasten etwas beeinträchtigte Glück, das Schiller an Lottens Seite fand, erfuhr aber schon nach wenigen Monaten durch die schwere Erkrankung Schillers eine tiefgreifende Störung. Ein Brustleiden, von dem sich Schiller niemals wieder ganz erholen sollte, kam Anfang Januar im Hause des Koadjutors Karl v. Dalberg in Erfurt in einem Besorgnis erregenden Anfall zum Ausbruch, ein Rückfall im Mai ließ das Schlimmste befürchten, auch eine Erholungsreise nach Karlsbad, die Schiller im Sommer antrat, brachte keine Genesung; und besonders bedrückend für den leidenden Dichter war es, dass er, aller Erwerbsmittel beraubt, dem grauen Gespenst der Not entgegensah. In dieser Lage kam unerwartete Hilfe aus weiter Ferne. Ein eifriger Verehrer Schillers, der dänische Dichter Jens Baggesen, hatte auf die falsche Nachricht von Schillers Tod in Hellebeck auf Seeland eine empfindsame Gedächtnisfeier veranstaltet; als er erfuhr, dass Schiller noch lebe, aber unter materieller Bedrängnis schwer leide, veranlasste er zwei hochgestellte Teilnehmer jener Feier, den Grafen Ernst Heinrich v. Schimmelmann (geb. 1747, seit 1784 dänischer Finanzminister) und den Prinzen Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Augustenburg (geb. 1765, Schwiegersohn des Königs, seit 1790 Leiter des Unterrichtswesens in Dänemark), den gefühlvollen Worten die edle Tat folgen zu lassen und dem großen Dichter über seine Not hinwegzuhelfen. Sie taten es, indem sie Schiller in der denkbar zartesten Form, ohne irgendeine Gegenforderung und allein von reinster Menschenliebe getrieben, für drei Jahre eine jährliche Unterstützung von 1000 Tlr. (3600 Mk.) anzunehmen baten. Schiller griff bewegten Herzens zu, und unabsehbar reich war der Segen jener Gabe. Denn sie setzte den Dichter instand, seinem Genius in stiller Sammlung die Klärung und Bereicherung zuteil werden zu lassen, an der ihn die Hast des Gelderwerbes behindert hätte: er vertiefte sich in die Kantsche Philosophie, durch die seine Weltanschauung und seine Kunstübung eine wesentliche Umgestaltung erfuhr und erst zu jener Höhe emporstieg, die wir in den nun bald folgenden Meisterwerken Schillers bewundern. Vor allem den ästhetischen Problemen zugewandt, legte er die Ergebnisse seines Nachdenkens in einer Reihe gehaltvoller Abhandlungen nieder, die einen dauernden Gewinn der Kunstlehre bedeuten. Auf die noch sehr anfechtbaren Aufsätze »Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen« und »Über die tragische Kunst«, die er 1792 in der »Thalia« veröffentlichte, folgten interessante, aber in der Hauptsache gleichfalls noch misslungene Versuche, die von Kant gegebene subjektive Grundlegung des Schönen durch eine Charakteristik des ästhetischen Objekts zu ergänzen; sie sollten in einer unvollendet gebliebenen Schrift »Kallias« genauere Erörterung finden, für die uns die ausführlichen Briefe an Körner vom Februar 1793 Ersatz bieten dürften. Schön sind nach Schiller die Objekte des Lebens dann, wenn sie, in Analogie zu dem transzendentalen Freiheitsbegriff der Kantschen Lehre, auf freier Selbstbestimmung zu beruhen scheinen, wenn sie also, obwohl der Erscheinungswelt angehörend, an jener transzendentalen Freiheit teilnehmen, kurz: schön ist nach Schiller die Freiheit in der Erscheinung. Über diese keineswegs einwandfreie Formel hinaus gelangte Schiller in der Abhandlung »Über Anmut und Würde« (1793), in der er eine wertvolle Kennzeichnung zweier ästhetischer Lebensbegriffe gibt: er erblickt die Anmut dort, wo sich Neigung und Pflichtgebot in der Seele zu vollkommener Harmonie zusammengefunden haben, Würde dagegen in dem Sieg der Vernunft über die sinnliche Regung. Sein Bestes bot er aber in der Schrift »Über die ästhetische Erziehung des Menschen«, die aus Briefen, die Schiller an den Herzog von Augustenburg richtete, hervorgegangen sind (die Originale sind durch eine Feuersbrunst verloren gegangen, eine Abschrift wurde von Michelsen, Berl. 1876, veröffentlicht; vgl. Breul, Die ursprüngliche und die umgearbeitete Fassung der Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, in der »Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur«, Bd. 28, das. 1884). Eine vollständige Wiedergeburt der in politischen Wirrnissen verkommenen Menschheit (Schiller, anfangs ein Freund der französischen Revolution, hatte sich seit der Hinrichtung Ludwigs XVI. mit Abscheu von ihr abgewandt) erwartet er hier allein durch eine ästhetische Veredelung der Gefühle und Triebe; er findet, zu Kants subjektivistischer Auffassung zurückkehrend, den ästhetischen Zustand dort, wo der Mensch die Eindrücke der den Lebensstoff uns darbietenden Sinnlichkeit frei auf sich wirken lässt, ohne ihn durch die Eingriffe seines Begehrens und seiner Vernunft zu verändern, wo er sich an ihnen wie an einem freien Spiel ergötzt; Schiller erblickt in dem von ihm genauer charakterisierten Spieltrieb das Bezeichnende des ästhetischen Verhaltens. Von gleichgroßer Bedeutung wie diese Schrift ist die Abhandlung »Über naive und sentimentalische Dichtung«, die er in den »Horen« 1795 und 1796 veröffentlichte: in ihr sucht er namentlich in der Beschreibung der subjektiven (sentimentalischen) Auffassungsweise eine Reihe charakteristischer Grundstimmungen (das Pathetische, Satirische, Elegische und Idyllische) in sehr fruchtbringender Weise zu unterscheiden.
Schillers Gesundheit besserte sich langsam; eine mit der Gattin unternommene Reise in die schwäbische Heimat (vom August 1793 bis Mai 1794) tat ihm wohl, erfreute ihn durch das Wiedersehen mit den geliebten Eltern und brachte ihm die für die Folge wertvolle geschäftliche Verbindung mit dem Buchhändler Cotta. Mit ihm einigte er sich über die Herausgabe der Monatsschrift »Die Horen« (1795-97) und des »Musenalmanachs« (1795-1800), und die Sorge für jene Zeitschrift veranlasste ihn, auch Goethe als Mitarbeiter zu werben und damit eine Verbindung anzuknüpfen, die für seine geistige Entwickelung noch bedeutsamer wurde als das Studium der Kantschen Philosophie. Goethe sagte seine Beteiligung zu, und Schiller gewann den größten Mann der Zeit durch den an ihn gerichteten, von tiefstem Verständnis zeugenden Brief vom 23. Aug. 1794 sowie durch die bei einem längern Besuch in Goethes Haus im September ausgetauschten Gespräche zum innigst teilnehmenden Freunde. Es stellte sich bei der jetzigen Entwickelung von Schillers Geistesleben eine weitgehende Übereinstimmung der Grundanschauungen der beiden Dichter heraus. Der Segen dieses Bundes war unermessbar: Goethes stockende Produktion wurde durch Schillers anfeuernde Teilnahme zu reichster Betätigung angeregt, Schiller fand in dem anschaulichen Denken und der rastlosen Vielseitigkeit des neuen Freundes ein immer aufs neue tief von ihm bewundertes Vorbild. So erblühte denn beiden ein neuer Lenz des Lebens und der Dichtung. Bald sich abwendend von den abstrakten Begriffsgespinsten der Philosophie, eröffnete Schiller gemeinschaftlich mit Goethe in den scharfgeschliffenen Epigrammen der »Xenien«, die im »Musenalmanach« für 1797 erschienen (beste Ausg. von Erich Schmidt und Suphan, Weim. 1893), ein glänzendes Strafgericht gegen die charakterlose Minderjährigkeit der meisten Führer der zeitgenössischen Poesie und Wissenschaft, und im nächsten Bande des Almanachs bot Schiller (ebenso wie Goethe) einen großen Teil jener eindrucksvollen Balladen dar, die seine Beliebtheit beim Publikum steigerten und befestigten (vgl. Elster im »Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts«, 1904): durch geistvolle Behandlung des Schicksalsproblems, sittliche Hoheit, bewegt dramatisches Leben und eine weitgehende Deutlichkeit der Darstellung schuf Schiller hier einen ganz neuen Typus dieser poetischen Gattung. Vor allem aber betrat er nach jahrelangem Zögern jetzt als ein völlig Veränderter wiederum das Gebiet der dramatischen Dichtung: nachdem er den schon 1791 entworfenen Plan des »Wallenstein« 1796 gänzlich umgearbeitet hatte, führte er das Werk 1799 zu glorreichem Abschluss. Bereichert durch die Ideen von Realismus und Idealismus, die er in der Abhandlung »Über naive und sentimentalische Dichtung« ausgeführt hatte, seine geistvollen Gedanken über das Problem des Schicksals mannigfach verwertend und allein mit der reinen Liebe des Künstlers, ohne einseitige Parteinahme für die Gestalten seiner Dichtung schaffend, entwarf er ein dramatisches Charaktergemälde von tiefgreifender tragischer Gewalt, das alle seine bisherigen Leistungen in den Schatten stellte (vgl. Kühnemann, Die Kantischen Studien Schillers und die Komposition des »Wallenstein«, Marb. 1889). In dem nächsten Drama, »Maria Stuart« (1800), erweiterte er die historische Überlieferung durch glückliche Erfindungen, wählte unter Anlehnung an den »König Ödipus« des Sophokles einen eigenartigen, an die analytische Technik sich anlehnenden Bau und zeichnete namentlich in dem packenden dritten und dem hoheitsvollen fünften Akte das zu Herzen greifende Bild einer durch die Schläge des Schicksals geläuterten liebenswerten Sünderin. Auch in dem nächsten Werke, der »Jungfrau von Orleans« (1801), wich er in der Gestaltung der von vielen Dichtern behandelten Geschichte der Jeanne d'Arc in wesentlichen Zügen von der Überlieferung ab, hob aber den Kern der romantisch wunderreichen Vorgänge in stimmungsvollster Poesie eindrucksvoll heraus, wenn auch die Fülle der an sich sehr gelungenen lyrischen Einlagen, die Kampfszenen und der große Aufzug etwas opernhaft erscheinen und die tragische Schuld der plötzlich von Liebe zum Feinde des Vaterlandes ergriffenen Heldin nicht überzeugend herausgearbeitet ist. Vollends in der an Leisewitz' »Julius von Tarent« und an einzelne antike Motive (Herodot, Hygin) angelehnten »Braut von Messina« (1803) geht Schiller in kühner Neubelebung der antiken Schicksalsauffassung und des Chors der griechischen Tragödie in der Nichtachtung der Norm des zeitgemäßen Lebensgehaltes recht weit und verstößt auch öfters gegen die Gesetze der Wahrscheinlichkeit; aber die Tragik dieses Werkes ist erschütternd, und die Sprache, namentlich in den Chorgesängen, von hinreißendem Zauber. Von allen ästhetischen Experimenten frei hielt er sich bei der Behandlung des von Goethe ihm überlassenen Stoffes des »Wilhelm Tell« (1804). Unter engem Anschluss an die poetisch brauchbare Überlieferung (namentlich Tschudi), erschloss er in dem durch köstliche Milieuschilderung ausgezeichneten Werke die gewaltige Freiheitsbewegung des nationalen Gesamtbewusstseins, machte, pedantischen Regeln zum Trotz, das ganze Volk der Eidgenossen zum Helden des Dramas, isolierte (Goethes Winken folgend) die Person des Tell in einer bedeutsamen Parallelhandlung und erfüllte das durch glänzende Einzelheiten hervorragende Drama mit dem hinreißenden Pathos seiner großen und liebenswerten Seele. Auch in den Fragmenten seines »Demetrius« (beste Ausg. von Kettner, Weim. 1894), in denen er einen dem lange gehegten Plan des »Warbeck« nahe verwandten Gegenstand behandelte, bewährte er in der psychologischen Vertiefung des Hauptproblems (Demetrius erfährt erst im Verlauf der Handlung, dass er nicht der berechtigte Erbe des Thrones ist, und spielt gleichwohl seine Rolle weiter), in der glänzenden Bühnenszene des polnischen Reichstags, dem Monolog der Marfa etc. die höchste Vollendung seiner Kunst.
Neben diesen Meisterdramen verfasste Schiller eine Reihe tiefsinniger Reflexionsgedichte (»Das Ideal und das Leben«, »Das Glück«, »Der Tanz«, »Nänie« etc.), großartige lyrische Kulturgemälde von zum Teil welthistorischen Perspektiven (»Das Eleusische Fest«, »Der Spaziergang«, »Das Lied von der Glocke« etc.), übersetzte und bearbeitete mehrere Dramen, wie Picards »Der Neffe als Onkel« und »Der Parasit«, Gozzis »Turandot«, Racines »Phädra«, Shakespeares »Macbeth« u.a., und schrieb das zierliche höfische Gelegenheitsstück »Die Huldigung der Künste«. Er war, nachdem er 1798 zum ordentlichen Honorarprofessor ernannt worden war, 1799 nach Weimar übergesiedelt, wo er an der idealistischen Bühnenreform Goethes tätigen Anteil nahm und die letzten Jahre seines Lebens sorgenfrei ganz ausschließlich seinen poetischen Arbeiten sich zuwenden konnte. 1802 wurde er auf Veranlassung des Herzogs Karl August vom Kaiser geadelt; der Jahresgehalt, den der Herzog 1799 auf 400 Tlr. erhöht hatte, wurde dem Dichter, als er 1804 eine Aufforderung, nach Berlin überzusiedeln, abgelehnt hatte, auf das Doppelte bemessen; von Jahr zu Jahr steigerte sich die Liebe und Verehrung, die Schiller, soweit die deutsche Zunge klang, entgegengebracht wurde. Aber seine von früher Jugend an zarte Gesundheit erholte sich nicht wieder von den schweren Erschütterungen der 1790er Jahre; am 9. Mai 1805, zwischen 5 und 6 Uhr abends, endete ein sanfter Tod das Leben des Dichters, ehe er noch das 46. Jahr vollendet hatte. Der Trauer, die ganz Deutschland ergriff, wollte Goethe in einem Entwurf gebliebenen dramatischen Spiel Ausdruck geben; ausgeführt wurde von ihm der Epilog zu einer am 10. Aug. 1805 in Lauchstädt veranstalteten dramatischen Ausführung der »Glocke«; nach vielen Jahren, 1826, schrieb er noch das Terzinengedicht »Im ernsten Beinhaus war's, wo ich erschaute«, das der Erinnerung an den edlen Freund tiefsinnigen Ausdruck verleiht.
Neben der Wucht der Affekte und der unbeirrbaren Klarheit des sittlichen Willens zeichnet sich Schiller von Jugend an durch die Kraft des abstrakt begrifflichen Denkens aus; der deduktive, nicht der induktive Verstand war bei ihm stark entwickelt; in seiner Phantasietätigkeit überwiegt die Kombinationsgabe: die Fülle neuer Einfälle zerstört ihm gelegentlich, namentlich in den Werken der Jugend, die Einheit der Komposition; die Anschaulichkeit seiner Phantasie ist geringer bei ihm entwickelt, nimmt aber in den Jahren seiner Reise unter bewusster Beherzigung von Goethes Vorbild bedeutend zu. Der am meisten hervorragende Zug seines Wesens ist aber der unvergleichliche Idealismus seiner Weltanschauung, durch den er als die hehrste Lichtgestalt der deutschen Literatur der edelste Erzieher und der von hoch und niedrig gleich innig verehrte Liebling der Nation geworden ist.
Denkmäler in Erz und Stein erinnern an ihn an zahlreichen Orten. Am 8. Mai 1839 wurde die erste Schillerstatue (von Thorwaldsen) in Stuttgart, 4. Sept. 1857 das Doppelstandbild Schillers und Goethes (von Rietschel) in Weimar enthüllt. Andre Statuen von ihm sind in Mannheim (von K. Cauer, 1862), Mainz (von Scholl, 1862), München (von Widnmann, 1863), Frankfurt a. M. (von Dielmann, 1864), Hannover (von Engelhard), Hamburg (von Lippelt, 1864), Berlin (von Reinh. Begas, 1871), Wien (von Schilling, 1876, s. Tafel »Wiener Denkmäler I«), Marbach (von Rau, 1876), Ludwigsburg (von v. Hofer, 1883) u.a. errichtet. Während Schillers Aufenthalt in Stuttgart 1794 modellierte sein Jugendfreund Dannecker (s. d.) seinen Kopf und führte danach später mehrere vortreffliche Büsten aus. Die besten Porträte Schillers sind die von Graff (1786) und von Ludovika Simanowitz (1793); s. beifolgende Tafel. Auch hat das dankbare Andenken an den Lieblingsdichter der Nation an mehreren Orten Schillervereine hervorgerufen, und der 1859 in Dresden entstandene Verein zur Unterstützung verdienter und hilfsbedürftiger deutscher Schriftsteller trägt seinen Namen (s. Schillerstiftung)."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
36 Voltaire
"Voltaire (François Marie Arouet; Voltaire ist ein Anagramm aus Voltaire le jeune), der berühmte französische Aufklärer, Streiter für die Gerechtigkeit, Gegner der Kirche (»Ecrasez l'infâme«), geb. 1694 in Paris, gest. daselbst 1778, lebte eine Zeitlang (1726-29) in London, wo er von den Deisten (Tindal u.a.) und von der Newtonschen mechanistischen Naturauffassung beeinflusst wurde, die er in verschiedenen Schriften populär darstellte. Voltaire ist kein systematischer Philosoph, sondern vor allem ein Vorkämpfer für eine freie Weltanschauung, welche Aberglauben, Wunderglauben, kurz allen Supranaturalismus ausschließt, ohne dass er aber Atheist ist (»Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer; mais toute la nature nous crie qu'il existe«). So skeptisch sich Voltaire in vielen Dingen äußert, so wenig er an die Möglichkeit einer Metaphysik glaubt, in Bezug auf den Gottesbegriff ist er ein überzeugter Deist, der sich des kosmologischen, teleologischen und moralischen Gottesbeweises bedient (Traité de métaphys., ch. 2). Den Leibnizschen Optimismus freilich (den er selbst früher teilte) persifliert er schonungslos, ohne aber Pessimist zu sein, da er an einen Fortschritt glaubt. In seinen philosophischen Anschauungen ist sich Voltaire nicht immer gleich geblieben, dazu war er viel zu viel Skeptiker. So lässt er denn die Annahme einer Seelensubstanz (»toutes les vraisemblances sont contre elles«) und einer absoluten Willensfreiheit fallen und hält an der Annahme der Unsterblichkeit nur aus moralischen Gründen fest. Er nimmt den hypothetischen Gedanken Lockes (von dem er auch sonst beeinflusst ist) ernst, nämlich dass Gott der Materie die Fähigkeit des Empfindens ganz wohl habe verleihen können. Vermöge der ihm von Gott verliehenen Kraft (»principe d'action«) ist der lebende Mensch selbst das denkende Wesen (»l'être réel appelé homme comprend, imagine, se souvient, désire, veut, se meut;« »il y a pourtant un principe d'action dans l'homme. Oui; et il y a partout;« »nous sommes des machines produites... par l'éternel géomètre«).
Der Geist hat keine angeborenen Begriffe (»qu'il n'y a point d'idées innées dans l'homme«), sondern schöpft alles aus der Erfahrung und aus seinem Wesen. Unsere Vorstellungen entspringen aus den Empfindungen; alle Erkenntnis entspringt aus der Fähigkeit der Verbindung und Ordnung (»de composer et d'arranger«) unserer Vorstellungen (»l'expérience, appuyée du raisonnement«). Die Freiheit des Menschen ist nicht Freiheit des Willens, sondern des Handelns (»pouvoir d'agir«). Gott ist frei, sofern er alles denken und alles tun kann, was er will. Der Mensch hat die beschränkte Macht, nach der Vernunft und nach seinem Willen zu handeln, wobei die einen Menschen freier sind als die anderen. Der Wille ist durch die Ideen, die wir haben, insbesondere die Idee dessen, was uns gut erscheint, determiniert, wobei Wille und Verstand nur Abstraktionen sind. Mein Handeln ist frei, wenn es willensgemäß ist, mein Wollen aber ist notwendig (»Quand je peux faire ce que je veux, voilà ma liberté; mais je veux nécessaire ce que je veux«, Philos. ignor. XIII, 70; »nous suivons irrésistiblement notre dernière idée;« »tout ce qui se fait est absolument nécessaire«). Die Verantwortlichkeit bleibt deshalb doch bestehen.
Wie in der Natur eine universale Gesetzlichkeit besteht (Gravitation), so untersteht auch das menschliche Leben allgemeinen Bedingungen (Bedeutung des Milieu, Konstanz der menschlichen Natur verbunden mit Änderung ihrer Gewohnheiten). In der Geschichte (der Ausdruck »philosophie de l'histoire« stammt von Voltaire) wechseln Fortschritt und Rückschritt miteinander ab. Zu berücksichtigen sind die Anschauungen und Sitten der Völker (der »esprit des nations«). Ohne Eigenliebe kann keine Gesellschaft entstehen und bestehen, da sie auf wechselseitigen Bedürfnissen beruht (»c'est l'amour de nous-mêmes qui assiste l'amour des autres; c'est par nos besoins mutuels que nous sommes utiles au genre humain«). Die Menschen haben alle denselben Sittlichkeitskern (»le même fond de morale«), eine grobe Vorstellung von Recht und Unrecht, die ihnen notwendig, Bedingung jeder Gesellschaft ist. Die Idee des Rechten ist etwas Natürliches, etwas durch Gefühl und Vernunft allgemein Erworbenes (»L'idée de justice me paraît tellement une vérité du premier ordre, à laquelle tout l'univers donne son assentiment«). Allgemeingültig wie die Gravitation ist auch die Moral; die Natur bleibt sich stets gleich, wie Newton sagt, ihre Gesetze (die Gesetze des göttlichen Mathematikers) sind unveränderlich (»lois invariables«)."
[Quelle: Eisler, Rudolf <1873-1926>: Philosophen-Lexikon : Leben, Werke und Lehren der Denker. -- Berlin : Mittler, 1912. -- 889 S. -- S. 796ff.]
"Voltaire, François-Marie, Arouet de (1694-1778). Von ihm rührt die obszöne Travestie der französischen Nationalheiligen Jeanne d'Arc her, in der er mit großem Behagen seiner Blasphemie gegen die Religion und seinem beißenden Spott gegen die Kirche und den Klerus sowie gegen die französische Mätressenwirtschaft Raum gab. Durch einen Diebstahl von Voltaires Manuskripten wurde das Werk der Öffentlichkeit zugeführt. Den Druck unter dem Titel: »La Pucelle d'Orléans, poème divisé en quinze livres, par M. de V***. Louvain (Frankfurt) 1755. 12°, 161 S.« veranstaltete der Kapuziner Maubert in Frankfurt. Ihm folgten natürlich zahllose Ausgaben, die später auf 20 Bücher oder Gesänge vermehrt wurden und kostbare Ausstattungen erfahren haben. Die Publikation der »Pucelle« löste schwere Angriffe auf V. aus, der sogar einige Stellen, wie das Eselsabenteuer, für unterschoben erklärte und 1762 eine von ihm selbst kastrierte Ausgabe veranstaltete. Die Dichtung beginnt mit dem Liebesglück König Karls und Agnes Sorels, indessen die Engländer Frankreich verheeren. Der hl. Dionys, über die Schlaffheit Karls erzürnt, erscheint den vom Feinde bedrängten Stadtvätern von Orleans und prophezeit ihnen, dass Frankreich, so wie es durch ein Weib ins Unglück gestürzt wurde, durch eine Jungfrau gerettet würde. Es ist dies Jeanne d'Arc, das Kind der Liebe eines Mönches mit einer Bäuerin. Ein englischer Mönch aber, Don Grisbourdon, hat aus Zaubersprüchen erfahren, dass Frankreichs Los innig mit Johannas Jungfernschaft verbunden ist, weshalb er mit einem Eseltreiber beschließt, diese zu Englands Heil zu erobern. Johanna wird von ihm eingeschläfert, aber während sich die beiden Übeltäter um ihre Jungfernschaft streiten, kommt der hl. Dionys, verjagt sie und bringt Johanna die geheiligten Waffen. Außerdem erscheint ein geflügelter Esel, der Johanna zu Karl bringen soll, doch gelangt sie zuerst ins englische Heer, wo sie dem Feldherrn, Hans Chandos, Schwert und Hose wegnimmt und seinem Pagen die französischen Lilien auf den Hintern malt. Bei Karl angelangt, eifert Dionys den König zu Taten an und, nachdem Johannas Jungfernschaft geprüft wurde, soll der Kampf beginnen. Die verlassene Agnes macht sich indessen in Begleitung Bonneaus auf, um Karl zu suchen, gelangt in das Gasthaus, wo Johanna weilt, stiehlt ihr Chandos' Hosen und ihren Panzer, wird aber von den Engländern aufgegriffen und vor Chandos geführt, der ihr die Hosen auszieht und sie notzüchtigen will. Da stürmt Johanna das Lager, die Engländer werden geschlagen, wobei aber Johanna und Dunois in dem Tumult von den ihren getrennt werden und sich allein befinden. Nun erscheint ein Hündchen und führt sie in ein von Conculix, der am Tage Mann, in der Nacht Weib ist, bewohntes Zauberschloss. Dieses wollüstige Ungeheuer versucht vergebens, an den beiden seine Lust zu stillen. Johanna und Dunois sollen verbrannt werden. Aber als sie am Scheiterhaufen stehen, kommt Grisbourdon auf seinem Esel durch die Lüfte und bewegt Conculix, sie freizulassen, da er sie mit ihm teilen wolle. Grisbourdon wird aber von Johanna, als er sich in ein hübsches Mädchen verwandelt und auf Dunois und den Eseltreiber großen Eindruck macht, aus Eifersucht erstochen und fährt zur Hölle. Agnes ist inzwischen in Chandos' Kleidern aus dem englischen Lager entflohen, doch der Page Montros eilt ihr nach und bringt sie in einem Gasthof unter, wo ein Bettelmönch sie in seine Gewalt bekommt, der aber bald von Montros abgelöst wird. Mitten in ihrem Liebesglück überfallen sie die Engländer, worauf Agnes in ein Kloster entflieht, wo sie Buße tun will. Das will ihr aber nicht gelingen, da die eine der Oberinnen ein verkleideter Jüngling ist und sie alsbald um ihre guten Vorsätze bringt. Nun dringen die Engländer in das Kloster ein und veranstalten mit den Nonnen wüste Orgien, so dass St. Dionys einzugreifen beschließt. Aber auch St. Georg, der Schutzpatron der Engländer, erscheint und die beiden Heiligen bekämpfen sich, so dass der Erzengel Gabriel herbeieilen und Ordnung machen muss. Karl, der nun Agnes sucht, kommt inzwischen in das Schloss Cutendres, wo er Montros trifft, der Agnes dorthin geführt hat und sich mit ihr dort zärtlich unterhält. Noch weiß der König nicht, dass Agnes sich dort aufhält, erfährt es aber und eilt zu ihr, als sie gerade wieder mit dem Pagen eine Liebesstunde verbringt. Der Page versteckt sich zwar, wird aber entdeckt und rettet sich durch eine Lüge. Chandos überwindet indessen Johanna und will sie entjungfern, was der hl. Dionys zu verhindern weiß. Nunmehr besiegt Dunois die Engländer. Karl ist zwar bei Orleans siegreich gegen die Engländer, aber es spaltet sich die Erde und Agnes mit Montros und anderen Mädchen und Helden versinken in das Zauberschloss des Conculix. Johannas Esel macht ihr indessen eine brünstige Liebeserklärung, wird aber von Dunois verjagt. Die bei Conculix Gefangenen können nur erlöst werden, wenn sich einer von ihnen für die anderen hingibt, was Tyrconel übernimmt. Nun kommt der Esel in das Zauberschloss und entführt Agnes zu ihrem Karl, worauf sich Johanna ihm endlich hingibt. Der Sinn des ganzen Epos ist wohl der, einer vergeistigten Heiligkeit den gröbsten Materialismus entgegenzusetzen und sie damit zu verhöhnen, da sich in der Wirklichkeit hinter allem Schein dieser geheiligten Traditionen nur der Materialismus geltend machte. In Voltaires »Pucelle« meint Strauss, genoss das 18. Jahrhundert sich selbst in seiner Frivolität. Die »Pucelle« wurde in die meisten Weltsprachen übersetzt, in das Englische, Spanische, Italienische und Deutsche. Die erste deutsche Übersetzung erschien als: »Das Mädgen von Orleans. Ein Heldengedicht in 18 Gesängen. M. 8 obsz. Kupf. London 1763. 8°«, eine spätere Paris 1787. Sehr interessant, mit zahlreichen Zeitanspielungen durchflochten, ist eine Bearbeitung: »Das Mädchen von Orleans. Travestiert und frei übersetzt. 3 Bde. M. 1 Kupf. Neugallien (Berlin) 1793, 8°«, die sehr frei dem Original folgt."
[Quelle: Bilderlexikon der Erotik : Universallexikon der Sittengeschichte und Sexualwissenschaft / Institut für Sexualforschung. --
Wien, 1928-1932. -- CD- ROM-Ausgabe: Berlin : Directmedia, 1999. -- (Digitale Bibliothek ; 19). -- ISBN 3932544242. -- S. 7982. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie diese CD-ROM bei amazon.de bestellen}]
37 Preußische Union
"In Preußen bestand seit Generationen in dem. reformierten Herrscherhaus, besonders bei dem Großen Kurfürsten, Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I., der Wunsch nach kirchlicher Einigung des Landes. Er hatte in § 39 des Allgemeinen Preußischen Landrechts von 1794 einen ersten Ausdruck gefunden. Der Verwirklichung, die Friedrich Wilhelm III. sich als Klammer zwischen den östlichen und westlichen Provinzen seines Landes dachte und für die Reformationsjubelfeier des Jahres 1817 plante, kam der Unionsschluss in Nassau zuvor. Aber aus der kritischen Beurteilung der dortigen Vorgänge gewann der Unions-Aufruf des Königs vom 27.9.1817 seine besondere Gestalt: er war kein Edikt, das die Union verordnete, sondern nur die feierliche Anregung zu ihrer kirchlichen Durchführung. Der Aufruf selbst hat daher keinen kirchenverändernden Inhalt. Lediglich dort, wo die Gemeinden ihm folgten, war Union im Sinne der Kabinettsorder als Konsensus-Union begründet. Wie die Union allgemein ausgelegt wurde, zeigte Schleiermachers Vorwort zur 1. Aufl. seiner Glaubenslehre (1821): ihm scheine »keine dogmatische Scheidewand zwischen beiden Kirchengemeinschaften zu bestehen«; er habe daher dies Werk »nach den Grundsätzen der ev. Kirche« ausarbeiten können. Diese Bezeichnung der Kirche konnte in der Tat bald amtlich übernommen werden. Die Einführung der Agende seit 1822 ( Agendenstreit) brachte die Kultus-Union, deren Recht auch Altenstein voll anerkannte. Nachdem sich die aus der Erweckung (: I, 5b; Luthertum: II, 2) herkommenden schlesischen Altlutheraner ( Luthertum: III B) 1830 aus Protest gegen die bekenntnismäßigen Folgen der Union gerade in Schlesien von der Landeskirche getrennt hatten, betonte der König in seiner Kabinettsorder vom 28.2.1834, dass die Bekenntnisschriften überall in unveränderter Gültigkeit stünden, der Beitritt zur Union Sache des freien Entschlusses sei und die vorgeschriebene einheitliche Agende nichts mit der Union zu tun habe. Die ev. Generalsynode, die vom 2.6.-29.8.1846 in Berlin tagte, stellte mit Recht fest, dass in Preußen nur die Gesamtkirche und die theologischen Fakultäten uniert seien, und versuchte die erstrebte volle Einheit durch Neuformulierung der Ordinationsverpflichtung und Aufstellung eines Lehrkonsensus (Nitzsch S. 127) zu erreichen; die Beschlüsse fanden jedoch nicht die königliche Bestätigung. Lediglich die Kirchenbehörden konnten ihre Mitglieder auf die Wahrung der Union verpflichten; gleichzeitig wurden sie in dem Erlass vom 6.3.1852 angewiesen, »das Recht der verschiedenen Konfessionen« und die auf ihm. ruhenden Einrichtungen »zu schützen und zu pflegen«. Die Kabinettsorder vom 12.7.1853 suchte beides festzuhalten: den geltenden, altüberlieferten Bekenntnisstand und die bisherigen Ergebnisse der Union. Für neugegründete Gemeinden freilich, wie sie vor allem in den westlichen Teilen Preußens entstanden, galt der Konsensus der Bekenntnisse als Bekenntnisgrundlage." [Quelle: Alfred Adam <1899 - >. -- In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG3). -- Bd. 6. -- 1963. -- Sp. 1141]
38 Um die neue Agende entstand der sog. Agendenstreit
"Agénde (Kirchenagende, v. lat. agenda, »was getan werden soll«), in der alten Kirche Bezeichnung für sämtliche gottesdienstliche Handlungen, im Mittelalter insbes. für die Messe und das Offizium, diente als Name eines die kirchlichen Gebete, Ansprachen und Segnungen zusammenfassenden Buches, vor der Reformation äußerst selten (ein solches hieß im Mittelalter sacerdotale, manuale, rituale), häufiger in den Reformationskirchen, die jedoch ihre Vorschriften für den Gottesdienst meist unter dem Namen der Kirchenordnungen gegeben haben. Unter den lutherischen Agenden und Kirchenordnungen des 16. Jahrh. schließen sich einige eng an die katholischen Gebräuche an, wie die Brandenburger Kirchenordnung von 1540, die österreichische Agende von 1571; andre, wie die herzoglich preußische Kirchenordnung von 1525, die braunschweigische von 1528 etc., stellen sich ganz auf den von Luther in der »Formula missae« (1523) eingenommenen Standpunkt, während die württembergischen Kirchenordnungen von 1536 und 1555 sowie die Pfälzer von 1554 etc. den katholischen Ordo missalis gänzlich verlassen und durch radikalere Umgestaltung des Gottesdienstes ein reformiertes Gepräge erhalten. In der reformierten Kirche unterscheiden sich die Kirchenordnungen des 16. Jahrh., je nachdem sie einen mehr Zwinglischen Typus (so die Züricher und die Baseler, beide von 1529) oder einen mehr Calvinischen (wie die verschiedenen Genfer von 1536 und 1541 etc.) tragen; in den deutsch-reformierten Kirchenordnungen zeigt sich, wie in der Kirchenordnung des Pfalzgrafen Friedrich von 1563 und den hessischen von 1566 und 1573, eine lutheranisierende, resp. unierende Tendenz. Ebenfalls aus einer Vermittelung zwischen der reformierten und lutherischen Gottesdienstordnung ist das vielfach auf altkirchliche Gebräuche zurückgreifende »Common Prayer Book«, die anglikanische Agende, hervorgegangen (vgl. Anglikanische Kirche). Gegen den Schluss des 18. Jahrh. tauchen in den protestantischen Kirchen Agenden auf, die einen von denen der Reformationszeit abweichenden, dem Geiste der Aufklärung und des Rationalismus sich anpassenden Charakter tragen. Die Rückkehr zu den Gottesdienstordnungen des 16. Jahrh. beginnt mit der preußischen Agende seit 1816 (vgl. Agendenstreit), und nach dem Vorbilde Preußens erfolgte auch in den andern evangelischen Landeskirchen Deutschlands eine Rückbildung zu den alten agendarischen Formeln, soz. B. in Württemberg durch das Kirchenbuch von 1843, in Bayern durch den Entwurf einer Agende von 1857, in Sachsen durch den Entwurf einer Agende für die evangelisch-lutherische Landeskirche von 1878 etc." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
"Agendenstreit, ein Streit, der sich an die Einführung der preußischen Hofagende 1816, bez. 1822 knüpfte. Es beteiligten sich daran nicht nur die bedeutendsten Theologen, wie von entgegengesetzten Standpunkten aus Schleiermacher und Augusti, sondern auch König Friedrich Wilhelm III. selbst. Von Schleiermacher wurde namentlich das episkopale Recht des Königs, liturgische Anordnungen zu treffen, angegriffen. Der 1826 für die Unionskirche entschiedene Agende gab den nächsten Anlass zur Bildung der altlutherischen Kirche. Als nach langer Vorbereitung der preußische Oberkirchenrat 1893 einen Entwurf zu einer neuen, verbesserten und vermehrten Gestalt der Agende herausgab, erhob sich nicht nur von Seiten der gesamten liberalen Theologie wegen der Stellung, die dem Apostolikum bei Taufe, Konfirmation und nach den Beschlüssen der Generalsynodalkommission auch bei der Ordination eingeräumt wurde, sondern auch von Seiten liturgischer Autoritäten der lebhafteste Widerspruch dagegen. Dennoch wurde 10. Nov. 1894 die neue Agende mit einigen unwesentlichen Modifikationen durch die außerordentliche Generalsynode einstimmig angenommen (Kirchengesetz vom 18. Juni 1895)."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
39 Claus Harms
"Harms, Klaus, namhafter prot. Theolog, geb. 25. Mai 1778 zu Fahrstedt in Süderdithmarschen, gest. 1. Febr. 1855 in Kiel, unterstützte seinen Vater, einen Müller, bis 1797 in dessen Geschäft, besuchte alsdann zwei Jahre das Gymnasium zu Meldorf und widmete sich hierauf in Kiel dem Studium der Theologie. Nachdem er 1802-06 Hauslehrer gewesen, wurde er Diakonus zu Lunden und 1816 Archidiakonus an der Nikolaikirche in Kiel. Inzwischen war er von der Gefühlsreligion Schleiermachers zur streng kirchlichen Gläubigkeit vorgeschritten. Seine bei Gelegenheit der Reformationsjubelfeier u. d. T.: »Das sind die 95 Theses oder Streitsätze Luthers ... und mit andern 95 Thesen als mit einer Übersetzung aus 1517 in 1817 begleitet« (Kiel 1817) veröffentlichte Schrift gab das Signal zu einem immer energischern Vorgehen der Restaurationstheologie. Trotz vieler Angriffe wurde H. 1835 Hauptpastor und Propst zu Kiel, 1841 Oberkonsistorialrat; 1849 trat er wegen eines Augenübels zurück. Unter seinen zahlreichen, meist praktisch-erbaulichen Schriften sind als die bedeutendsten hervorzuheben: »Winterpostille« (Kiel 1808) und »Sommerpostille« (das. 1815; von beiden 6. Aufl., Leipz. 1846); »Neue Winterpostille« (Altona 1825) und »Neue Sommerpostille« (das. 1827); »Pastoraltheologie« (das. 1830-34, 3 Bde.; 3. Aufl. 1878; zuletzt Gotha 1891); aus seinem Nachlass erschien eine Sammlung Predigten (»Des Christen Glauben und Leben«, Hamb. 1869). Vgl. »Harms' Lebensbeschreibung, verfasst von ihm selber« (2. Aufl., Kiel 1851; zuletzt Gotha 1888); Baumgarten, Denkmal für Klaus Harms (Braunschw. 1855); Kaftan, Klaus Harms (Vortrag, Basel 1875); Lüdemann, Erinnerung an Klaus Harms. und seine Zeit (Kiel 1878)." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
40 Schleiermacher
"Schleiermacher, Friedrich Ernst Daniel, geb. 21. November 1768 in Breslau als Sohn eines reformierten Geistlichen, auf dem Gymnasium der Brüdergemeinde zu Niesky herangebildet, studierte auch in deren Seminar zu Barby Theologie, trat aber 1787 aus der Gemeinde aus und ging nach Halle, wo er Theologie und Philosophie studierte. 1790-93 war er Hauslehrer im Hause des Grafen Dohna-Schlobitten zu Finkenstein, 1794-96 Hilfsprediger in Landsberg a. d. Warthe, 1796-1802 Prediger an der Charité in Berlin, 1802-04 Hofprediger in Stolpe. 1804 wurde er a. o. Professor in Halle: er ging aber 1807 nach Berlin, wo er 1809 Prediger an der Dreifaltigkeitskirche und 1810 Professor der Theologie (aber verbunden mit philosophischen Vorlesungen), 1811 Mitglied, 1814 Sekretär der Akademie der Wissenschaften wurde und wo er am 12. Februar 1834 starb. Als Denker ist Schleiermacher eine allen Extremen abgeneigte, zur Synthese geneigte, tief religiöse Natur, von Plato, Spinoza, Kant, Fichte und Schelling beeinflusst; namentlich an letzteren knüpft er in seinem Systeme des »Ideal-Realismus« an. In den »Vertrauten Briefen über die Lucinde« (1800 anonym erschienen) nimmt sich Schleiermacher der viel geschmähten Schrift F. v. Schlegels an und betont das Verbundensein von Sinnlichkeit, und Geistigkeit in der Liebe, in welcher die wahre Unendlichkeit liegt.
In seiner Erkenntnis- und Seinslehre, welche er als »Dialektik« bezeichnet, stellt Schleiermacher eine Synthese von Idealismus und Realismus her. Die Wissenschaften überhaupt gliedert Schleiermacher in Physik (Naturphilosophie) und Ethik (Geistesphilosophie). Die Physik ist Naturkunde und Naturwissenschaft, die Ethik Geschichtskunde und Sittenlehre. Die Physik stellt das Vernunftwerden der Natur, die Ethik das Naturwerden der Vernunft dar. Die Philosophie ist Dialektik, welche die Prinzipien des Philosophierens enthält. Philosophieren heißt, den »inneren Zusammenhang alles Wissens machen«; Philosophie ist das »höchste Denken mit dem höchsten Bewusstsein«, vollkommene Entwicklung des Bewusstseins. Die Dialektik ist Kunstlehre des Denkens, Organon des Wissens, d.h. der Sitz aller Formeln seiner Konstruktion, die Kunst des Begründens, die Kunst des Symphilosophierens. Alles Wissen ist nämlich ein gemeinschaftliches Denken, nicht bloß Übereinstimmung des Denkens mit dem Sein, sondern auch der Denkenden untereinander. Das Wissen ist dasjenige Denken, welches in der Identität der denkenden Subjekte gegründet ist und zugleich dem Sein entspricht. Denken und Sein »korrespondieren« miteinander; das Wissen ist ein Denken, »welches die Beziehungen eines bestimmten Seins zur Organisation richtig ausdrückt«.
Mit der Idee des Wissens ist gesetzt »eine Gemeinsamkeit der Erfahrung und eine Gemeinsamkeit der Prinzipien unter allen mittelst der Identität der Vernunft und der Organisation in allen«. Erkenntnis entsteht durch das Zusammenwirken der sinnlichen, »organischen« Funktion und der »intellektuellen« Funktion der Vernunft. Durch erstere wird der Stoff des Wissens gegeben, durch letztere die Form derselben erzeugt. »In allem Denken ist die Vernunfttätigkeit der Quell der Einheit und Vielheit, die organische Tätigkeit aber der Quell der Mannigfaltigkeit.« »Ohne Einheit und Vielheit ist die Mannigfaltigkeit unbestimmt; ohne Mannigfaltigkeit ist die bestimmte Einheit und Vielheit leer.« Durch das Geöffnetsein des geistigen Lebens nach außen (durch die Organisation) kommt das Denken zum Gegenstand oder zu seinem Stoffe, durch seine sich immer gleiche Tätigkeit (Vernunft) kommt es zu seiner Form. Im Erkennen sind Rezeptivität und Spontaneität vereinigt. Ideales und Reales entsprechen einander (Logisch-ontologischer Parallelismus). »Da nun die Vernunfttätigkeit gegründet ist im Idealen, die organische aber als abhängig von den Einwirkungen der Gegenstände im Realen: so ist das Sein auf ideale Weise ebenso gesetzt wie auf reale, und ideales und reales laufen parallel nebeneinander fort als modi des Seins« (vgl. Spinoza, Schelling). Die Anschauungsformen, Raum und Zeit, sind subjektiv und objektiv zugleich. Sie sind »die Art zu sein der Dinge selbst, nicht nur unserer Vorstellungen«. Der Raum ist das »Außereinander des Seins«, die Zeit das »Außereinander des Tuns«. Die Kategorien sind als Anlagen dem Geiste angeboren, entstehen aus der Vernunft, dem »Orte« der Kategorien, sind subjektiv und objektiv zugleich. Das Denken hat die Form des Begriffs und des Urteils, die einander wechselseitig voraussetzen. Der Begriff entspricht dem Fürsichsein der Dinge, den »substantiellen Formen«, das Urteil dem Zusammensein, der Wechselwirkung der Dinge. Dem höheren Begriff entspricht das Sein als Kraft, dem niederen das Sein als Erscheinung (Dialekt. S. 509 f.); Kraft ist sich wirksam beweisendes Sein. Dem Urteil entspricht die »Tatsache«. Jedes Sein ist frei als Kraft, aber der Notwendigkeit unterworfen, sofern es im Zusammenhang mit, anderen betrachtet wird. Freiheit des Willens ist innere, geistige Determination, Entwicklung aus sich selbst. Das Selbstbewusstsein ist der Punkt, in welchem Denken und Sein unmittelbar identisch sind. Die Seele ist die Einheit des Ich in Bezug auf den Organismus.
Die absolute Einheit des Idealen und Realen liegt in Gott, dem »transzendentalen Grund« von beiden, den wir nur in der relativen Identität des Denkens und Wollens, im Gefühl haben. Welt und Gott sind Korrelate, aber nicht identisch. Denn Gott ist Einheit ohne Vielheit, die Welt Vielheit ohne Einheit; die Welt ist raum-zeitlich, Gott raum- und zeitlos und die Negation aller Gegensätze. Aber die Welt ist nicht ohne Gott, Gott nicht ohne die Welt zu denken. Gott ist die »volle Einheit« der Welt, ewiges Leben, aber als Absolutes unpersönlich und nicht außerhalb der Welt, die Gesetzmäßigkeit derselben nicht (durch Wunder) durchbrechend.
Die Religion ist nicht intellektualistisch zu fassen, nicht als Inbegriff von Dogmen, sondern als Anschauung und Gefühl, wodurch das Unendliche im Endlichen selbst erfasst, erlebt wird. Das Wesen der Religion ist das »schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl«, in welchem wir unser Verhältnis zum Unendlichen, Ewigen unmittelbar erfassen. Wir betrachten hier alles Endliche als Darstellung des Unendlichen und handeln hiernach, tun alles mit (nicht aus) Religion. Unser Sein und Leben fühlen wir als ein »Sein und Leben in und durch Gott«. In den »Monologen« betont Schleiermacher, jeder Mensch solle auf seine Weise die Menschheit und deren reines Wesen darstellen. Die Unsterblichkeit der Religion besteht darin, mitten in der Ewigkeit eins zu werden mit dem Unendlichen. Doch lehrt Schleiermacher in dem Werke »Der christliche Glaube«, der Glaube an die ewige Fortdauer der menschlichen Persönlichkeit sei in dem Glauben an die Unveränderlichkeit der Vereinigung des göttlichen Wesens mit der menschlichen Natur in Christi Persönlichkeit enthalten. Die christliche Kirche beruht auf der Idee der Erlösung durch Christus und auf der Forderung dauernder, innerer Frömmigkeit. Religion und Philosophie sind einander koordiniert, beide sind gleichberechtigt.
Die Ethik Schleiermachers ist, bei aller Anerkennung des Wertes der Individualität, universalistisch, sie ist ferner idealistisch-teleologisch und dem Kern nach »Güterlehre«. Die Ethik ist im weiteren Sinne das Erkennen des Wesens der Vernunft, eine »beschauliche« Wissenschaft, nicht eigentlich normativ oder doch nicht im Gegensatz zur Naturwissenschaft; Sollen und Sein sind auf beiden Gebieten Asymptoten. Die Ethik ist der Ausdruck des Handelns der Vernunft auf die Natur, dessen Erzeugnis Einheit von Vernunft und Natur ist, Ausdruck des immer schon angefangenen, aber nie vollendeten Naturwerdens der Vernunft. Sie stellt dar ein »potentiiertes Hineinbilden und ein extensives Verbreiten der Einigung der Vernunft mit der Natur«. Die Sätze der Sittenlehre sind keine Gebote, sondern darstellend. Die Ethik gliedert sich in Güterlehre, Tugendlehre, Pflichtlehre.
Ein Gut ist jedes »Einssein bestimmter Seiten von Vernunft und Natur«. Höchstes Gut ist der »organische Zusammenhang aller Güter, also das ganze sittliche Sein unter dem Begriff des Gutes ausgedrückt«, die »Gesamtheit der Wirkungen der menschlichen Vernunft in aller irdischen Natur«. Die Vernunft ist als Kraft in der Natur überall »organisierende (»bildende«) Tätigkeit«, ferner ist sie »symbolisierend« (»bezeichnend«), die Vernunft selbst erkennen lassend. Jedes »Symbol«, d.h. Ineinander von Vernunft und Natur, ist auch »Organ« der Vernunft. Ferner ist das sittliche Handeln teils ein sich immer und überall gleiches, teils ein individuell verschiedenes. Das Ziel des sittlichen Handelns (der »bildenden« Tätigkeit) ist, »dass die ganze menschliche Natur, und mittelst ihrer die ganze äußere, in den Dienst der Vernunft gebracht werde«. Alles, was in der Vernunft ist, soll sein Organ in der Natur finden. Die Gebiete des sittlichen Handelns sind Verkehr, Eigentum, Denken, Gefühl. Ihnen entsprechen als ethische Verhältnisse Recht, Geselligkeit, Glaube, Offenbarung und die ethischen Güter oder Organismen: Staat, Gesellschaft,. Schule, Kirche. Das Höchste ist der beständige Kulturfortschritt der Menschheit.Die Tugend ist die »Kraft der Vernunft in der Natur«, die Kraft, aus welcher die sittlichen Handlungen hervorgehen, die Vernunft und Sittlichkeit im einzelnen Menschen. Als »reiner Idealgehalt des Handelns« ist sie »Gesinnung«, als unter die Zeitform gestellte Vernunft »Fertigkeit«. Als ein Insichaufnehmen ist die Tugend »erkennende«, als Aussichhinstellen »darstellende« Tugend, welche Gegensätze sich durchkreuzen. »Die Gesinnung im Erkennen ist Weisheit; die Gesinnung im Darstellen ist Liebe. Das Erkennen unter die Zeitform gestellt, ist Besonnenheit; das Darstellen unter die Zeitform gestellt, ist Beharrlichkeit« (Kardinaltugenden). Die Pflicht ist die Bewegung zum sittlichen Ziele, die Sittlichkeit als in der einzelnen Tat produzierende sich abdrückend. Es gibt Rechts- und Liebespflichten, Berufs- und Gewissenspflichten. Allgemeine Forderung ist: Handle in jedem Augenblick mit der ganzen sittlichen Kraft und die ganze sittliche Aufgabe anstrebend. Hierbei ist die eigene Individualität zur Geltung zu bringen. »Die sittliche Idee muss sich bei verschiedenen Menschen mannigfaltig aussprechen« (Politik, S. 1). Der Staat ist eine Art Organismus; er besteht da, wo er ein Gegensatz von Obrigkeit und Untertan ist. Die Kunst enthält die Momente der Begeisterung und Besinnung, ist freie Produktivität.
Von Schleiermacher beeinflusst sind Brandis, H. Ritter, Braniß (teilweise von Hegel), George, Romang, Rothe, F. Vorländer, A. Helfferich, G. Weißenborn, K. Schwarz, F. Eberty, Ueberweg, Strauß u. a."
[Quelle: Eisler, Rudolf <1873-1926>: Philosophen-Lexikon : Leben, Werke und Lehren der Denker. -- Berlin : Mittler, 1912. -- 889 S. -- S. 640ff.]
41 Schaubrote
"Schaubrote (hebr. lechem happanim, Denkbrote), zwölf ungesäuerte Brotkuchen aus Weizenmehl, nach der Zahl der zwölf israelitischen Stämme, wurden von den Kehathiten für jeden Sabbat neu bereitet, im Heiligen der Stiftshütte und des Tempels auf einem mit Goldblech überzogenen, mit einem Goldkranz umzogenen Tisch (Schaubrottisch, schulchan happanim) von Akazienholz mit Weihrauch in zwei Reihen aufgestellt und fielen den Priestern zu. Jedes Brot war 10 Handbreit lang, 5 Handbreit breit und 7 Fingerbreit dick. Vgl. 3. Mos. 24, 4 ff." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
42 Strauß, David Friedrich <1808 - 1874>: Das
Leben
Jesu /
kritisch
bearbeitet
von
David
Friedrich
Strauss ... -- Tübingen : Osiander, 1835 - 1836. -- 2 Bde
; 8º
"DAS LEBEN JESU. Kritisch bearbeitet Theologisches Werk von David Friedrich Strauss, erschienen 1835/36. – Diese berühmteste Abhandlung des damals siebenundzwanzigjährigen Theologen erschien sechs Jahre vor L. Feuerbachs Wesen des Christentums (1841) und ist das erste bedeutende, seinerzeit gewaltiges Aufsehen erregende Werk der linkshegelianischen Schule. In einer der Aufklärung verwandten, aber von ihr durch die Art des historischen Bewusstseins unterschiedenen Betrachtungsweise stellt Strauß das, was sich nach einer kritischen Prüfung der Quellen über die Geschichtlichkeit Jesu, insbesondere seiner Wunder, sagen lässt, in profanwissenschaftlicher Denk- und Sprechweise dar.
Strauß verwahrt sich einerseits gegen die Versuche des Rationalisten Rudolf Paulus und seiner Vorgänger, die Wunderberichte durch ganz natürliche Vorgänge unzureichend und gewaltsam zu erklären, hält andererseits einen »den bekanntesten und sonst überall geltenden Gesetzen des Geschehens« widerstreitenden göttlichen Eingriff in die Naturordnung für unmöglich und versucht das vielschichtige Problem zu lösen, indem er alle Wundererzählungen der Evangelien dem Bereich des Mythos zuweist. Besonders im Johannes-Evangelium sieht Strauß einen im Vergleich zu den Synoptikern verstärkten mythologischen Zug, der wohl aus einer Abwehrstellung gegen Doketismus und Gnosis zu erklären sei.
Schon Eichhorn, Gabler und De Wette hatten zur Erklärung der Bibelüberlieferung den Mythosbegriff – allerdings immer unter einschränkender Rücksichtnahme auf den Glauben – eingeführt, doch wurde diese Methode erst von Strauß unter rein historischem Aspekt auf die Erforschung des Lebens Jesu angewandt. Strauß war der Ansicht, dass seine Evangelienkritik den Kern der christlichen Religion nicht antaste. Denn wenn er auch darin von Hegel abwich, dass er die Historizität der neutestamentlichen Berichte bestritt, so sieht er – wie Hegel in den Evangelien – im Mythos den Ausdruck einer Wahrheit, die mit derjenigen der Philosophie weitgehend übereinstimmt. Die Religion stellt damit der Philosophie gegenüber nichts grundsätzlich anderes und Selbständiges, sondern eine Stufe in einem Entwicklungsprozess dar und erweist sich angesichts des inzwischen erreichten Standes des Geistes als etwas Vorläufiges, das zu durchschauen und hinter sich zu lassen Pflicht des Einsichtigen ist. So wird aus dem historischen Jesus die »Idee der Menschheit«; der lebendige Gott der Bibel verflüchtigt sich in das »Unendliche«, ist von der Seinsweise der »Idee«.
Nachdem Strauß in verschiedenen Auflagen des Werks seinen Standpunkt immer wieder modifiziert hatte, wollte er in der 1864 verfassten, »für das deutsche Volk« bearbeiteten Version ein weniger skeptisches Bild des Lebens Jesu geben. Er hält zwar weiterhin daran fest, dass die zahlreichen Mythen das historische Bild Jesu mehr oder weniger verschleiern, doch sei es nicht unmöglich, aus den Evangelien einen geschichtlichen Gehalt herauszulösen. Den Sinn seiner kritischen Untersuchung sieht er jedoch auch hier nicht so sehr in der Ermittlung historischer Details als vielmehr in der »Fortbildung der Christusreligion zur Humanitätsreligion, worauf alle edleren Bestrebungen dieser Zeit gerichtet sind«.Die erste Fassung des Leben Jesu löste eine ungeheure Bewegung in der deutschen protestantischen und katholischen Theologie aus. Die Stellungnahmen und Gegenschriften von bedeutenden und unbedeutenden Wissenschaftlern wuchsen ins Unübersehbare. Plötzlich zum berühmtesten und berüchtigtsten Theologen seiner Zeit geworden, zerstörte Strauß mit diesem Werk zugleich seine theologische Laufbahn. In der Vorrede zu Gespräche von Ulrich von Hutten (1860) schreibt er: »Ich könnte meinem Buch grollen, denn es hat mir . . . viel Böses getan . . . Es hat meinen Lebensgang einsam gemacht. Und doch, bedenke ich, was aus mir geworden wäre, wenn ich das Wort, das mir auf die Seele gelegt war, verschwiegen, wenn ich die Zweifel, die in mir arbeiteten, unterdrückt hätte – dann segne ich das Buch, das mich zwar äußerlich geschädigt, aber die innere Gesundheit des Geistes und Gemüts mir, und ich darf mich trösten, auch manchem anderen noch, erhalten hat.« Der weiteren Leben-Jesu-Forschung gab Strauß entscheidende Anregungen; so konzentrierten sich z. B. Holtzmann und die Tübinger Schule zunächst auf die Quellenanalyse, insbesondere auf das Verhältnis des Johannes-Evangeliums zu den Synoptikern. Da Strauß »die Theologie vor eine Reihe von Fragen gestellt hat, zu denen sie, wie zu denen Feuerbachs, vielleicht bis heute noch nicht durchgreifend Stellung genommen hat« (K. Barth), reicht die Nachwirkung seines Werks weit über das 19. Jh. hinaus, und das Problem, das es behandelt, gewann besonders für die protestantische Kirche nach der Mitte des 20. Jh.s noch einmal eine neue Aktualität."
[Quelle: Harald Landry. -- In: Kindlers Neues Literaturlexikon. -- München : Kindler, ©1996. -- s.v.]
43 Zum Folgenden siehe die klassische Darstellung von Albert Schweitzer:
Schweitzer, Albert <1875 - 1965>: Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. -- 2., neu bearb. und verm. Aufl. -- Tübingen : Mohr, 1913. --
XII, 659 S. ; 24 cm. -- [1. Aufl. unter dem Titel: Von Reimarus zu Wrede : eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (1906)]
44 Herodot
"Herodotos (Herodot), der erste eigentliche Geschichtsschreiber der Griechen, geb. um 484 v. Chr. zu Halikarnassos in Karien, gest. um 425 (ungewiss, ob in Athen oder Thurii), aus angesehenem Geschlecht, floh vor dem Tyrannen seiner Vaterstadt, Lygdamis, nach Samos; zurückgekehrt, wirkte er zum Sturz des Lygdamis mit, verließ aber bald wieder infolge der Ungunst seiner Mitbürger seine Heimat für immer und begab sich nach Athen, wo er 445 öffentlich einen Teil seines Geschichtswerkes vorlas und eine Staatsbelohnung von 10 Talenten erhielt. Dann schloss er sich der 444 von Athen gegründeten Kolonie Thurii in Unteritalien an, die ihm eine zweite Heimat wurde. Von dort muss er Athen, wo er zu den bedeutendsten Männern, wie Perikles und Sophokles, in freundschaftlichen Beziehungen stand, noch mehrfach besucht haben. Den historischen und geographischen Stoff zu seinem Geschichtswerk hatte Herodotos zumeist selbst auf verschiedenen Reisen (nach dem Schwarzen Meer bis zum Kimmerischen Bosporus, nach Cypern, Ägypten, Kyrene, Tyros, durch Ägypten von Naukratis bis Elephantine und durch das persische Reich von der Küste bis nach Susa) gesammelt. Den Namen eines »Vaters der Geschichte« führt er, weil er zuerst ein großes, welthistorisches Ereignis darzustellen unternahm und zuerst den Plan eines groß angelegten Geschichtswerkes fasste. Dieses von den Alexandrinern in neun, mit den Namen der Musen bezeichnete Bücher geteilte Werk hat zum Hauptgegenstand die Kämpfe zwischen den Barbaren und Hellenen, insbes. die beiden großen Perserkriege. Herodotos beginnt mit der Geschichte der Lyder, deren König Krösos zuerst das griechische Kleinasien angegriffen hatte, geht dann auf die Perser, die Besieger der Lyder, über, von diesen auf die Ägypter, Babylonier und Skythen, die der Reihe nach den Persern unterlegen waren, um vom fünften Buch an die Kriege der Griechen mit den Barbaren in zusammenhängender Darstellung zu schildern. Zahlreiche Abschweifungen innerhalb der einzelnen Teile geben Nachrichten aller Art über Länder und Völker, die den Hauptereignissen näher oder ferner lagen. Da dem Verfasser die Schilderung des Schauplatzes der von ihm mit behaglicher Breite erzählten historischen Begebenheiten und des Zustandes der für ihn in Betracht kommenden Gebiete besonders am Herzen lag, so stellt das Werk, das einen dreihundertjährigen Zeitraum bis zum Jahre 479 umfasst, den ganzen Umfang der geschichtlichen und der geographischen Kenntnis seiner Zeit dar (s. Skizze 1 der »Karten zur Geschichte der Erdkunde« im 6. Bd.). Bei Herodotos ist der Historiker vom Geographen gar nicht zu trennen; hierin ist er der erste in einer Reihe von Forschern und Denkern, zu der im Altertum Polybios und Strabon, in der Neuzeit E. Curtius und Karl Ritter, Friedrich Ratzel und H. Nissen gehören. Hat sein Werk einerseits nach seinem Aufbau eine mehr epische Einheit, so wird anderseits das Ganze von der einheitlichen Grundidee getragen, dass alle Geschichte Ergebnis einer sittlichen Weltordnung sei, und dass jede Überhebung über die durch die ewige Ordnung gezogenen Schranken den »Neid der Gottheit« erregt und die rächende Nemesis auf das Haupt des Schuldigen und seiner Nachkommen zieht. Streitig ist die Entstehungsart des Werkes: ob Herodotos schon von vornherein nach festem Plan die einzelnen Bestandteile nacheinander teils in Athen, teils in Thurii ausgearbeitet (vgl. Kirchhoff, Über die Entstehungszeit des herodotischen Geschichtswerkes, 2. Aufl., Berl. 1878), oder zu verschiedenen Zeiten einzelne Teile selbständig aus- und diese dann schließlich zu einem Ganzen zusammengearbeitet (vgl. Bauer, Die Entstehung des Herodotischen Geschichtswerkes, Wien 1878) habe. Der Abschluss mit der Einnahme von Sestos, einem wenig bedeutenden und zum Endpunkt nicht eben geeigneten Ereignis, lässt vermuten, dass es unvollendet ist. Geschrieben hat Herodotos, wiewohl von Geburt Dorier, wie seine Vorgänger, die Logographen, in ionischem Dialekt; mit dessen Weichheit und Flüssigkeit im Einklang steht die Einfachheit des Stils und die Naivität der Erzählung. Der Hauptwert des Werkes liegt in dem überaus reichen Inhalt, in der Fülle von Nachrichten über fast alle Völker der damals bekannten Erde. Zwar war Herodotos noch weit von kritischer Geschichtsforschung entfernt, wenn er auch keineswegs kritiklos schrieb; jedenfalls war er eifrig bemüht, die Wahrheit zu ergründen, und hat auch, was er selbst gesehen und erlebt, scharf beobachtet und meist richtig dargestellt: haben doch viele lange bezweifelte Nachrichten über fremde Länder neuere Forschungen überraschend bestätigt. Manche Irrtümer erklären sich daraus, dass er im Verkehr mit den Fremden auf Dolmetsche angewiesen war und sich mit Vorliebe an die Priester wendete, die ihn in abergläubische oder täuschende Auffassungen hineinzogen. Gegenüber Nichtgriechen hat kein Grieche solchen Gerechtigkeitssinn gezeigt wie Herodotos; bezüglich der griechischen Verhältnisse hat ihn eine Vorliebe für Athen zu einzelnen ungerechten Urteilen, namentlich über Korinth und Theben, verleitet. Auch seine religiöse Anschauung hat bisweilen die Objektivität seiner historischen Auffassung beeinträchtigt." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
45 Euhemerus
"Euhemerus oder Euhemeros (* um 340 v. Chr. † um 260 v. Chr.) war ein griechischer Philosoph, Schriftsteller und Mythenautor, geboren in Messana auf Sizilien (oder Chios, Tegea oder Messene auf dem Peloponnes), lebte um 300 v. Chr. am Hof von des mazedonischen Königs Kassander. Er ist hauptsächlich bekannt durch seine Heiligen Aufzeichnungen, eine philosophisch-utopischer Reiseroman, die auf archaischen Inschriften basiert, die er auf seinen verschiedenen Reisen durch Griechenland gefunden haben wollte. Er verlässt sich besonders auf einen Bericht zur frühen Geschichte, den er während einer Reise entlang der Küste Arabiens, die er im Auftrag Kassanders, seines Freunds und Mäzens, unternahm, auf der Insel Panchea in einem Tempel auf einer goldenen Säule entdeckt habe. Es gibt keinen Zweifel, dass die Insel nicht existiert.
In seinem Werk systematisiert er zum ersten Mal eine altorientalische (vielleicht phönizische) Methode, die Volksmythen zu interpretieren, behauptend, dass die Götter, die die Hauptobjekte volkstümlicher Verehrung seien, ursprünglich Helden und Eroberer gewesen seien, die dadurch einen Anteil an der Verehrung ihrer Subjekte verdient hätten. Dieses System ist weit verbreitet, und besonders die frühen Christen nahmen es als Bestätigung ihres Glaubens, dass die antike Mythologie lediglich eine Ansammlung von Fabeln aus menschlischer Eingebung gewesen sei. Euhemerus war ein standhafter Verfechter der kyrenäischen Philosophie, und von manchen antiken Schriftstellern wird er als Atheist bezeichnet. Sein Werk wurde von Ennius ins Lateinische übersetzt, das Original jedoch ging verloren, und von den Übersetzungen sind auch nur ein paar kurze Fragmente erhalten.
Diese rationalisierende Interpretationsmethode ist als Euhemerismus bekannt. Es gibt keinen Zweifel, dass sie wahre Elemente enthält, da bei den Römern die stufenweise Vergötterung der Ahnen und die Apotheose der Kaiser ein wesentliches Merkmal der religiösen Entwicklung waren, und es sogar bei einfachen Leuten möglich ist, die Herkunft der Familie und der Stammesgötter bis zu großen Häuptlingen und Kriegern zurück zu verfolgen. Alle Theorien über Religionen, die der Verehrung der Ahnen und dem Totenkult große Bedeutung beimessen, sind in großem Maße euhemeristisch. Aber als einzige Erklärung für den Ursprung der Gottesidee ist dies in der vergleichenden Religionswissenschaft nicht akzeptiert. Dennoch war sie im Frankreich des 18. Jahrhunderts eine beachtliche Modeerscheinung: Der Abbé Banier war in seiner Mythologie et la fable expliqués par l'histoire offen euhemeristisch; andere führende Euhemeristen waren Clavier, Sainte-Croix, Raoul Rochette, Em. Hoffmann und in hohem Maße Herbert Spencer."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Euhemerus. -- Zugriff am 2005-01-30]
46 Kirchenväter
"Kirchenväter (lat. Patres Ecclesiae) heißen im Sprachgebrauch der katholischen Kirche diejenigen Kirchenschriftsteller (s. d.), denen
- antiquitas competens (»gehöriges Alter«),
- doctrina orthodoxa (»rechtgläubige Lehrweise«),
- sanctitas vitae (»heiliges Leben«) und
- ausdrückliche oder stillschweigende approbatio ecclesiae (»kirchliche Anerkennung«)
zukommt.
Aus der Gesamtheit dieser Kirchenväter hat die Kirche einer kleinern Zahl den Grad der Kirchenlehrer (Doctores Ecclesiae) beigelegt, als deren besonderes Merkmal die eruditio eminens (»hervorragende Gelehrsamkeit«) gilt. Außer den vier wirkungsvollsten Schriftstellern der alten abendländischen Kirche, Gregor d. Gr., Augustin, Ambrosius und Hieronymus, gelangten zu dieser Würde noch die Abendländer Hilarius von Poitiers, Petrus Chrysologus, Leo d. Gr. und Isidor von Sevilla, die Morgenländer Athanasius, Basilius d. Gr., Cyrill von Jerusalem, Gregor von Nazianz, Chrysostomus und Johannes von Damaskus (dieser erst 1890)."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
47 Sagen
"Sage heißt ein Bericht über eine geschichtliche Begebenheit, in dem sich mit dem Tatsächlichen das Erfundene, mit dem Natürlichen und Begreiflichen das Übernatürliche und Unbegreifliche mischt. Mit dem Gerücht und der Tradition hat die Sage die unbekannte Herkunft gemein; doch ist das Gerücht nur ein schwankendes, vorübergehendes Gerede über ein gleichzeitiges Ereignis, die Tradition eine mündliche oder schriftliche Fortpflanzung einer Nachricht über die Zeit ihres Geschehens hinaus, ohne dass dabei eine Veränderung des wirklich Geschehenen nach bestimmter Richtung stattzufinden braucht. Aus dem Gerücht kann durch Tradition eine Sage werden, wenn Gedächtnis, Phantasie und Volksglaube sich ihrer bemächtigen. Im Andenken an seine großen Männer schmückt die Phantasie eines Volkes deren Taten unbewusst und unabsichtlich aus und erhöht sie über das Menschliche; nur auf die Hauptidee gerichtet, lässt sie Nebenumstände fort, bildet sie um oder schafft völlig andere Lebensverhältnisse. Die Sage wirft willkürlich Personen, Ereignisse, Orte und Zeiten durcheinander, verbindet Götter und Helden, hält aber an bekannten Namen und Orten fest und erzählt nicht zeit- und ortlos wie das Märchen. Während das Märchen poetischer ist, ist die Sage historischer. Sagen, Märchen und Geschichte begleiten den Menschen von heimatswegen als ein guter Engel. Vgl. Deutsche Sagen von den Gebrüdern Grimm. 3. Aufl. 1891. I, S. VII - IX. J. Braun, d. Naturgesch. der Sage. München 1864." [Quelle: Kirchner, Friedrich <1848 - 1900> ; Michaelis, Carl: Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe / Friedrich Kirchner. Neubearb. von Carl Michaelis. -- 5. Aufl. / neubearb. von Carl Michaelis. -- Leipzig : Dürr, 1907. -- V, 708 S. -- (Philosophische Bibliothek ; 67). -- S. 518]
48 Viertes Evangelium = Johannesevangelium
49 Humboldt, Alexander von <1769 - 1859>: Kosmos : Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. -- Stuttgart und Tübingen : J. G. Cotta'scher Verlag, 1845 - 1862. -- 5 Bde. (in 6) ; 8º
"KOSMOS. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung Naturwissenschaftliches Werk in fünf Bänden von Alexander von Humboldt, erschienen 1845 bis 1862.
Die Anfänge dieses Werks, in dem Humboldt das gesamte, zu seiner Zeit verfügbare Wissen über die Erde zu versammeln suchte und das ihn bis an sein Lebensende beschäftigte, gehen zurück auf Vorlesungen des Autors an der Berliner Akademie (1827/28). Neben den von Humboldt in den Jahren 1807–1827 in Paris ausgewerteten Ergebnissen seiner Lateinamerikareise (1799–1804) fließen auch die Erfahrungen seiner Expedition in das asiatische Russland ein, die Humboldt 1829 im Auftrage des Zaren unternahm; Humboldt führte zahlreiche magnetische und geodätische Messungen durch, überließ aber die wissenschaftliche Auswertung der Reise seinem Mitarbeiter G. Rose (Asie Centrale. Recherche sur les chaînes de montagnes et la climatologie comparée, 3 Bde., 1843).
Humboldts Interesse war auf die Darstellung des Gesamtzusammenhangs gerichtet; in den Prolegomena zum Kosmos heißt es:
»Alles Wahrnehmbare, das ein strenges Studium der Natur nach jeglicher Richtung bis zur jetzigen Zeit erforscht hat, bildet das Material, nach welchem die Darstellung zu entwerfen ist . . . Ein beschreibendes Naturgemälde . . . soll aber nicht bloß dem Einzelnen nachspüren; es bedarf nicht zu seiner Vollständigkeit der Aufzählung aller Lebensgestalten, aller Naturdinge und Naturprozesse. Der Tendenz endloser Zersplitterung des Erkannten und Gesammelten widerstrebend, soll der ordnende Denker trachten, der Gefahr der empirischen Fülle zu entgehen.«
Und obgleich die Darstellung der »Einheit in der Totalität« unvollständig bleibt, weist die »Sehnsucht« nach dem Wissenszuwachs in die Zukunft, in einer, für Humboldt typischen Weise, die sich gegenüber jedem modernen Verwertungsgedanken fremd zeigt:
»Eine solche Sehnsucht knüpft fester das Band, welches nach alten, das Innerste der Gedankenwelt beherrschenden Gesetzen alles Sinnliche an das Unsinnliche kettet; sie belebt den Verkehr zwischen dem, ›was das Gemüt von der Welt erfasst, und dem, was es aus seinen Tiefen zurückgibt‹.«
Ähnlich wie Herder in seinen Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit nimmt die Darstellung bei Humboldt ihren Ausgang in der Beschreibung des Universums und endet in der des Menschengeschlechts. Der erste Band – und der dritte und vierte Band greifen spezielle Gebiete detaillierter auf – skizziert astronomische Nebel- und Sternhaufen, das Sonnensystem, schließlich Gestalt, Dichte und geophysikalische Gesetze der Erde selbst, darunter Erdwärme, Erdmagnetismus, Entstehung der Gebirge und Bau der Vulkane, schließlich Meeres- und Klimakunde samt der Verbreitung und Formenwelt der Tiere und Pflanzen. Die Grenze der physischen Welt ist erreicht, wie es im ersten Band des Werks heißt,
»wo die Sphäre der Intelligenz beginnt und der ferne Blick sich senkt in eine andere Welt. Das Naturgemälde bezeichnet die Grenze und überschreitet sie nicht.«
Ein »Naturgemälde« hat Humboldt in seinen Ansichten der Natur (1808) gegeben, der Kosmos geht darüber hinaus, wenn er gleichsam den Weg der Darstellung umkehrt und im zweiten Band die menschliche Erforschung der Natur verfolgt, als »Geschichte der Erkenntnis eines Naturganzen, gleichsam als Geschichte von der Einheit in den Erscheinungen und vom Zusammenhang der Kräfte im Weltall«. In sieben historischen Stufen – von den phönizischen Seefahrern im vorantiken Mittelmeer über Rom, die arabischen Wissenschaften und schließlich Mittelalter, Renaissance und die Zeit der großen Forschungsreisen und Weltumsegelungen – schildert Humboldt die Genese des menschlichen Bildes von der Natur, um am Schluss, anhand der Erfindung des Fernrohres, wieder im Weltall anzukommen. Es gehört zum heute nicht mehr nachvollziehbaren Universalismus Humboldts, dass zwischen die naturwissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen Darstellungen Kapitel über die menschliche Einbildungskraft gestreut sind, Reflexionen über die Wirkungen der Natur auf das menschliche Gemüt, wie sie in Dichtung, Malerei und auch in der Gartenkunst ihre Vergegenständlichung gefunden haben.
»Die Naturansicht«, so bemerkt Humboldt, »soll allgemein, sie soll groß und frei« sein und »nicht durch Motive . . . der relativen Nützlichkeit beengt« werden. Sein Gemälde der Natur, und darin folgt er seinem großen Vorbild Goethe, solle vor allem die Harmonie des Naturganzen vor Augen treten lassen und sich in seiner Wirkung auf den Rezipienten kaum von einem Kunstwerk unterscheiden: »Möge dann die unermessliche Verschiedenartigkeit der Elemente, die in ein Naturbild sich zusammendrängen, dem harmonischen Eindruck von Ruhe und Einheit nicht schaden, welcher der letzte Zweck einer jeden literarischen oder rein künstlerischen Komposition ist.«
Humboldt betrachtet im Sinne Kants und Herders als höchstes Ziel seines vom Idealismus weitgehend beeinflussten Forschens,
»in der Mannigfaltigkeit die Einheit zu erkennen . . . der erhabenen Bestimmung des Menschen eingedenk den Geist der Natur zu ergreifen, welcher unter der Decke der Erscheinungen verhüllt liegt. Auf diesem Wege reicht unser Bestreben über die Grenze der Sinnenwelt hinaus, und es kann uns gelingen, die Natur begreifend den rohen Stoff empirischer Anschauung gleichsam durch Ideen zu beherrschen.«
Doch hebt er ausdrücklich gegen die zeitgenössische, von Hegel bestimmte Philosophie hervor, diese Einheit nicht »durch Ableitung aus wenigen, von der Vernunft gegebenen Grundprinzipien«, sondern auf der Grundlage »der durch die Empirie gegebenen Erscheinungen« gewonnen zu haben. Seine Wissenschaftslehre schließt sich eng an die Goethes an, mit dem er in Jena und Weimar enge Verbindung hatte. Beide forschen letzten Endes nicht nach einheitlichen Begriffen, sondern nach den die Natur stets erneuernden und formenden Gestalten und Kräften; doch teilt der von der Naturwissenschaft her argumentierende Humboldt keineswegs die Abneigung Goethes gegen Mathematik, Statistik und Technik, sondern wertet diese in weitestem Umfang aus. Dadurch gelingt es ihm, die Naturwissenschaften nicht nur durch neue Erkenntnisse in der Geographie der Pflanzen, der Zoologie, der Astronomie, der Geologie, der Mineralogie, der Statistik und der Nationalökonomie zu bereichern. Darin liegt die Hauptbedeutung dieses Werks, in dem die wissenschaftlichen Daten in eine vollendete sprachliche Form gekleidet sind und das schon kurz nach Erscheinen in nahezu alle europäischen Sprachen übertragen wurde. Humboldt selbst konnte seine Arbeit am Kosmos nicht mehr vollenden; der fünfte und letzte Band erschien postum und enthält neben den Registern die unvollendeten Manuskripte des Forschers."
[Quelle: Meinhard Prill. -- In: Kindlers Neues Literaturlexikon. -- München : Kindler, ©1996. -- s.v.]
50 Humboldt, Alexander von <1769 - 1859> ; Varnhagen von Ense, Karl August <1785 - 1858>: Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den Jahren 1827 bis 1858 : nebst Auszügen aus Varnhagen's Tagebüchern, und Briefen von Varnhagen und andern an Humboldt. -- Leipzig : Brockhaus, 1860. -- XV, 400 S. ; 8º
51 Rätsel der Sphinx
"Die Sphinx (von griechisch: sphingo = erwürgen) der griechischen Mythologie war die Tochter von Typhon und Echidna und somit Schwester von Hydra, Chimäre, Kerberos und Orthos. Sie galt als Dämon der Zerstörung und des Pechs. Sie war ein geflügelter Löwe mit dem Kopf einer Frau; teilweise wird sie auch als Frau mit den Tatzen und Brüsten einer Löwin, einem Schlangenschwanz und Vogelflügeln dargestellt. Sie hielt sich außerhalb von Theben auf und gab den vorbeikommenden Reisenden das Rätsel der Sphinx auf: "Welches Lebewesen geht am Morgen auf vier Füßen, am Mittag auf zwei und am Abend auf drei?". Diejenigen, die das Rätsel nicht lösen konnten, wurden von ihr erwürgt. Ödipus löste das Rätsel, die Antwort lautet "der Mensch": als Baby krabbelt er auf allen Vieren, läuft als Erwachsener auf zwei Beinen und braucht im Alter einen Stock als drittes Bein. Als Ödipus das Rätsel löste, stürzte sich die Sphinx von ihrem Felsen und starb." [Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Sphinx_%28griechisch%29. -- Zugriff am 2005-01-30]
52 Tübinger Schule: Ferdinand Christian Baur und seine Schüler: Zeller, Schwegler, Köstlin, Hilgenfeld. Ihr Organ sind die »Theologischen Jahrbücher«, die von 1842-57 erschienen,
"Baur, Ferdinand Christian, berühmter prot. Theolog, geb. 21. Juni 1792 in Schmiden bei Cannstatt, ward 1817 Professor am theologischen Seminar zu Blaubeuren u. 1826 ordentlicher Professor zu Tübingen, wo er 2. Dez. 1860 starb. Nach Herausgabe seiner »Symbolik u. Mythologie, oder die Naturreligion des Altertums« (Stuttg. 1824-25, 3 Bde.) bebaute er in epochemachender Weise die Gebiete der Dogmengeschichte, der kirchlichen Symbolik und der biblischen Kritik. Zuerst auf dem Standpunkt Schleiermachers stehend, schloss er sich schon in seinen Schriften über »Das manichäische Religionssystem« (Tübing. 1831) und »Die christliche Gnosis, oder die christliche Religionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Entwickelung« (das. 1835) der Hegelschen Schule an, der er dann m seiner philosophischen Behandlung der gesamten Kirchengeschichte treu geblieben ist. Den eigentlichen Glanzpunkt seiner historischen Forschungen bildete das dogmengeschichtliche Feld, teils in den umfassenden Monographien: »Die christliche Lehre von der Versöhnung in ihrer geschichtlichen Entwickelung von der ältesten Zeit bis auf die neueste« (Tübing. 1838), »Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes« (das. 1841-43, 3 Bde.), teils in seinem »Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte« (Stuttg. 1847, 3. Aufl. 1867) und in seinen »Vorlesungen über die christliche Dogmengeschichte« (Leipz. 1865-67, 3 Bde.). Ein zweites, verwandtes Gebiet, auf dem Baur wirkte, ist die Symbolik im kirchlichen Sinne; er verteidigte den Lehrbegriff der evangelischen Kirche gegen Möhlers »Symbolik« in seiner Schrift »Der Gegensatz des Katholizismus und Protestantismus« (Tübing. 1834, 2. Aufl. 1836). Mit Vorliebe endlich wandte er sich der Urgeschichte des Christentums zu. Wo man früher im apostolischen Zeitalter nur Frieden und Einheit gesehen hatte, da suchte er den Kampf entgegengesetzter Richtungen nachzuweisen, eines jüdisch-gesetzlichen Messiasglaubens und des von Paulus eingeführten Prinzips der gesetzesfreien Weltreligion. Aus der Auseinandersetzung, in der beide Richtungen anderthalb Jahrhunderte lang miteinander begriffen waren, ging dann die katholische Kirche hervor; als Denkmäler dieses kirchenbildenden Prozesses seien unsre neutestamentlichen Schriften entstanden, meist im 2. Jahrh. Vor dem Jahre 70 bleiben als echte Schriften nur bestehen die vier größern Briefe des Paulus und die Offenbarung des Johannes. Zusammengefasst sind die auf die Apostelgeschichte und die Paulinischen Briefe sich beziehenden Untersuchungen in dem Werke »Paulus, der Apostel Jesu Christi« (Stuttg. 1845; 2. Aufl., Leipz. 1866-67, 2 Tle.), seine die evangelische Überlieferung betreffenden Studien dagegen in den »Kritischen Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, ihr Verhältnis zueinander, ihren Ursprung und Charakter« (Tübing. 1847), wozu als Nachtrag kommt die Schrift »Das Markus-Evangelium nach seinem Ursprung und Charakter« (das. 1851). Die von Baur und seinen Schülern, wie Zeller, Schwegler, Köstlin, Hilgenfeld (s. d.), verfolgte kritische Richtung, als deren Organ die »Theologischen Jahrbücher« von 1842-57 erschienen, bezeichnet man mit dem Namen der Tübinger Schule. Vgl. Baurs Schrift »Die Tübinger Schule und ihre Stellung zur Gegenwart« (Tübing. 1859, 2. Aufl. 1860) und Zeller, Vorträge und Abhandlungen, S. 267 ff., 354 ff. (Leipz. 1865). Diese Schule brach einer durchaus neuen Anschauung des Urchristentums Bahn, die gewiss auf vielen Punkten anfechtbar, aber schon darum epochemachend ist, weil sie zuerst die allgemein gültigen Gesetze der Geschichtswissenschaft auf diesem Gebiet zur Anwendung gebracht hat. Die beste Gesamtdarstellung gibt Baur selbst in dem Werke »Das Christentum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte« (Tübing. 1853, 3. Aufl. 1863). Daran schließen sich: »Die christliche Kirche vom Anfang des 4. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts« (Tübing. 1859; 2. Aufl. Leipz. 1863); »Die christliche Kirche des Mittelalters« (das. 1861, 2. Aufl. 1869); »Die Kirchengeschichte der neuern Zeit« (das. 1863); »Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts« (das. 1862, 2. Aufl. 1877). Vgl. auch Baurs Werk »Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung« (Tübing. 1852)." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
53 Ewald
"Ewald, Georg Heinrich August, berühmter Orientalist und Theolog, geb. 16. Nov. 1803 in Göttingen, gest. daselbst 4. Mai 1875, studierte in seiner Vaterstadt seit 1820 Theologie und die orientalischen Sprachen und schrieb, noch Student: »Die Komposition der Genesis« (Braunschw. 1823). Er ward 1824 Repetent bei der theologischen Fakultät in Göttingen, 1827 außerordentlicher, 1831 ordentlicher Professor der Philologie und 1835 Nominalprofessor der orientalischen Sprachen. Als einer der »Göttinger Sieben« 1837 seines Amtes entlassen, folgte er 1838 einem Ruf als ordentlicher Professor der Philosophie (seit 1841 der Theologie) nach Tübingen, kehrte aber, vom König von Württemberg inzwischen in den persönlichen Adelstand erhoben, 1848 in seine frühere Stellung nach Göttingen zurück. Infolge seiner Verweigerung des Huldigungseides wurde er 1867 auf sein Ansuchen von der preußischen Regierung, übrigens unter Belassung seines Gehaltes, in den Ruhestand versetzt und dafür von der Welfenpartei in den Reichstag geschickt, wo er leidenschaftlich die Neugestaltung Deutschlands bekämpfte. In seinen frühern Werken: »De metris carminum arabicorum« (Braunschw. 1825), »Kritische Grammatik der hebräischen Sprache« (Leipz. 1827), die er später kürzer als »Grammatik der hebräischen Sprache« (das. 1828, 3. Aufl. 1838) und sodann noch wiederholt als »Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache« (8. Aufl., Götting. 1870) bearbeitete, sowie in seiner »Grammatica critica linguae arabicae« (Leipz. 1831-33, 2 Bde.) u. a. trat er namentlich für die Grammatik und Metrik der orientalischen Sprachen bahnbrechend auf. Seine alttestamentlichen Studien fasste er zusammen in den Werken: »Die poetischen Bücher des Alten Bundes« (Götting. 1835-39, später wieder hrsg. in 2. u. 3. Aufl., 4 Bde.), »Die Propheten des Alten Bundes« (2. Aufl., das. 1867-68, 3 Bde.) und endlich in seinem Hauptwerk: »Geschichte des Volkes Israel« (3. Aufl., das. 1864-68, 7 Bde.), zu dem noch ein Band: »Die Altertümer des Volkes Israel« (3. Aufl., das. 1866), als Anhang erschien. Ewald ist nach Gesenius, den er an Vielseitigkeit und Tiefe überragt, wenn er ihm auch an Unbefangenheit nicht gleichkommt, der eigentliche Schöpfer der historisch- vergleichenden Methode in der semitischen Sprachwissenschaft und Philologie und unübertroffen an liebevoller Versenkung in den Geist des hebräischen Altertums. Dem Neuen Testament trat Ewald näher in den meistens in einem schroffen Gegensatz zu der sogen. Tübinger Schule stehenden Werken: »Die drei ersten Evangelien übersetzt und erklärt« (Götting. 1850; 2. Aufl., das. 1871-72, 2 Bde.); »Die Sendschreiben des Apostels Paulus« (das. 1857); »Die Johanneischen Schriften« (das. 1861-62, 2 Bde.) u. a. Eine abschließende systematische Darstellung seiner theologischen Anschauung von der biblischen Religion enthält »Die Lehre der Bibel von Gott oder Theologie des Alten und Neuen Bundes« (Leipz. 1871-76, 4 Bde.). Seine politischen und kirchenpolitischen Ansichten verfocht Ewald mit maßloser Heftigkeit und krankhafter Selbstüberschätzung in zahllosen Aufsätzen und Broschüren. Leider atmen auch seine rein wissenschaftlichen Arbeiten schon früh diesen unseligen Geist der Empfindlichkeit und des Unfehlbarkeitsdünkels." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
54 Ewald, Heinrich <1803 - 1875>: Geschichte Christus' und seiner Zeit. -- Göttingen : Dieterich, 1855. -- 450 S. ; 8º. -- (Geschichte des Volkes Israel bis Christus / von Heinrich Ewald ; Bd. 5)
55 Matthäusevangelium 14, 15ff.
"15Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Dies ist eine Wüste, und die Nacht fällt herein; Lass das Volk von dir, dass sie hin in die Märkte gehen und sich Speise kaufen.
16Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht not, dass sie hingehen; gebt ihr ihnen zu essen.
17Sie sprachen: Wir haben hier nichts denn fünf Brote und zwei Fische.
18Und er sprach: Bringet sie mir her.
19Und er hieß das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel und dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk.
20Und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was übrigblieb von Brocken, zwölf Körbe voll.
21Die aber gegessen hatten waren, waren bei fünftausend Mann, ohne Weiber und Kinder."[Luther-Bibel 1912]
56 Johannesvangelium 2, 1ff.
"1Und am dritten Tag ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa; und die Mutter Jesu war da.
2Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen.
3Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein.
4Jesus spricht zu ihr: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.
5Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.
6Es waren aber allda sechs steinerne Wasserkrüge gesetzt nach der Weise der jüdischen Reinigung, und ging in je einen zwei oder drei Maß.
7Jesus spricht zu ihnen: Füllet die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan.
8Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun und bringet's dem Speisemeister! Und sie brachten's.
9Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, woher er kam (die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten), ruft der Speisemeister den Bräutigam
10und spricht zu ihm: Jedermann gibt zum ersten guten Wein, und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren; du hast den guten Wein bisher behalten.
11Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn."[Luther-Bibel 1912]
57 Weiße, Christian Hermann <1801 - 1866>: Die Evangelienfrage in ihrem gegenwärtigen Stadium. -- Leipzig : Breitkopf ; Härtel, 1856. -- VIII, 292 S.
"Weiße, Christian Hermann, Philosoph, geb. 10. Aug. 1801 in Leipzig, gest. daselbst 19. Sept. 1866, studierte in Leipzig, schloss sich der Hegelschen Philosophie an, die er später mit dem theistischen Element der Schellingschen positiven Philosophie versetzte, und war mit I. H. Fichte (s. d. 2) einer der Gründer des neuen spekulativen Theismus und bekämpfte den pantheistischen Idealismus Hegels. 1846 wurde er ordentlicher Professor der Philosophie an der Universität seiner Vaterstadt. Seine sehr zahlreichen Arbeiten erstreckten sich vornehmlich auf das ästhetische und religionsphilosophische, die spätesten auch auf das Gebiet der Evangelienkritik. Zu den erstern gehören sein der dialektischen Form nach streng im Hegelschen Geist entwickeltes, dem theistisch gefärbten Inhalt nach von ihm sich losmachendes »System der Ästhetik als Wissenschaft von der Idee der Schönheit« (Leipz. 1830, 2 Bde.; das 1872 von Seydel unter demselben Titel herausgegebene Buch enthält Weißes letzte Kollegienhefte) und die nach seinem Tode von R. Seydel gesammelten, teilweise höchst geistreichen »Kleinen Schriften zur Ästhetik« (das. 1867) sowie die »Kritik und Erläuterung des Goetheschen Faust« (das. 1837). Seine religionsphilosophischen Ideen entwickelte Weiße in den Schriften: »Die Idee der Gottheit« (Dresd. 1833); »Die philosophische Geheimlehre von der Unsterblichkeit des menschlichen Individuums« (das. 1834); »Theodicee in deutschen Reimen von Nikodemus« (das. 1834); »Grundzüge der Metaphysik« (Hamb. 1835); »Die evangelische Geschichte, kritisch und philosophisch bearbeitet« (Leipz. 1838, 2 Bde.); »Philosophische Dogmatik oder Philosophie des Christentums« (das. 1855-62, 3 Bde.); »Die Evangelienfrage« (das. 1856) und »Psychologie und Unsterblichkeitslehre« (hrsg. von Seydel, das. 1869)." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
58 Johannesevangelium 11, 1ff.
"1Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus, von Bethanien, in dem Flecken Marias und ihrer Schwester Martha.
2(Maria aber war, die den HERRN gesalbt hat mit Salbe und seine Füße getrocknet mit ihrem Haar; deren Bruder, Lazarus, war krank.)
3Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: HERR, siehe, den du liebhast, der liegt krank.
4Da Jesus das hörte, sprach er: Die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch geehrt werde.
5Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus.
6Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er zwei Tage an dem Ort, da er war.
7Darnach spricht er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen!
8Seine Jünger sprachen zu ihm: Meister, jenes Mal wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dahin ziehen?
9Jesus antwortete: Sind nicht des Tages zwölf Stunden? Wer des Tages wandelt, der stößt sich nicht; denn er sieht das Licht dieser Welt.
10Wer aber des Nachts wandelt, der stößt sich; denn es ist kein Licht in ihm.
11Solches sagte er, und darnach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft; aber ich gehe hin, dass ich ihn auferwecke.
12Da sprachen seine Jünger: HERR, schläft er, so wird's besser mit ihm.
13Jesus aber sagte von seinem Tode; sie meinten aber, er redete vom leiblichen Schlaf.
14Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben;
15und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dagewesen bin, auf dass ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm ziehen!
16Da sprach Thomas, der genannt ist Zwilling, zu den Jüngern: Lasst uns mitziehen, dass wir mit ihm sterben!
17Da kam Jesus und fand ihn, dass er schon vier Tage im Grabe gelegen hatte.
18Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, bei fünfzehn Feld Weges;
19und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten über ihren Bruder.
20Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen; Maria aber blieb daheim sitzen.
21Da sprach Martha zu Jesus: HERR, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben!
22Aber ich weiß auch noch, dass, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben.
23Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder soll auferstehen.
24Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am Jüngsten Tage.
25Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe;
26und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?
27Sie spricht zu ihm: HERR, ja, ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.
28Und da sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach: Der Meister ist da und ruft dich.
29Dieselbe, als sie das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm.
30(Denn Jesus war noch nicht in den Flecken gekommen, sondern war noch an dem Ort, da ihm Martha war entgegengekommen.)
31Die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, da sie sahen Maria, dass sie eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen: Sie geht hin zum Grabe, dass sie daselbst weine.
32Als nun Maria kam, da Jesus war, und sah ihn, fiel sie zu seinen Füßen und sprach zu ihm: HERR, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben!
33Als Jesus sie sah weinen und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und betrübte sich selbst
34und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: HERR, komm und sieh es!
35Und Jesus gingen die Augen über.
36Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn so liebgehabt!
37Etliche aber unter ihnen sprachen: Konnte, der den Blinden die Augen aufgetan hat, nicht verschaffen, dass auch dieser nicht stürbe?
38Da ergrimmte Jesus abermals in sich selbst und kam zum Grabe. Es war aber eine Kluft, und ein Stein daraufgelegt.
39Jesus sprach: Hebt den Stein ab! Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: HERR, er stinkt schon; denn er ist vier Tage gelegen.
40Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen?
41Da hoben sie den Stein ab, da der Verstorbene lag. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast.
42Doch ich weiß, dass du mich allezeit hörst; aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, dass sie glauben, du habest mich gesandt.
43Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!
44Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit dem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löset ihn auf und lasset ihn gehen!
45Viele nun der Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn.
46Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte."[Luther-Bibel 1912]
59 Johannesvangelium 19, 23f.
" 23Die Kriegsknechte aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegsknecht ein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von obenan gewirkt durch und durch.
24Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll. (Auf dass erfüllet würde die Schrift, die da sagt: »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen.«) Solches taten die Kriegsknechte."[Luther-Bibel 1912]
60 pantheistischen Hang, der von Hegel stammt: Nach Hegel ist das Absolute die Weltvernunft, der ewige dialektische Prozess, der zum Selbstbewusstsein des Absoluten führt (Encykl. § 87; Log. III, 327; Phänom. S. 16). Gott ist »der lebendige Prozess, sein Anderes, die Welt, zu setzen« (Naturphilos. S. 22). In der »absoluten Religion« manifestiert sich Gott als absoluter Geist (Encykl. § 564). »Gott ist nur Gott, insofern er sich selber weiß; sein Sich-wissen ist ferner sein Selbstbewusstsein im Menschen, und das Wissen des Menschen von Gott, das fortgeht zum Sich-wissen des Menschen in Gott« (l.c. S. § 564). »Dass der Mensch von Gott weiß, ist nach der wesentlichen Gemeinschaft ein gemeinschaftliches Wissen, d. i. der Mensch weiß nur von Gott, insofern Gott im Menschen von sich selbst weiß« (WW. XII, 496). Das göttliche Wesen stellt sich dar: »α) als in seiner Manifestation, bei sich selbst bleibender, ewiger Inhalt; β) als Unterscheidung des ewigen Wesens von seiner Manifestation, welche durch diesen Unterschied die Erscheinungswelt wird, in die der Inhalt tritt; γ) als unendliche Rückkehr und Versöhnung der entäußerten Welt mit dem ewigen Wesen, das Zurückgehen desselben aus der Erscheinung in die Einheit seiner Fülle« (Encykl. § 566).
61 Fichte
"Fichte, Johann Gottlieb, berühmter Philosoph, geb. 19. Mai 1762 zu Rammen an in der Oberlausitz als der Sohn eines Bandwebers, gest. 27. Jan. 1814 in Berlin, zeichnete sich als Knabe durch regen Geist und seltenes Gedächtnis aus, kam, 12 Jahre alt, auf die Stadtschule nach Meißen und bald nachher nach Schulpforta, bezog 1780 die Universität, zuerst Jena, dann Leipzig, um Theologie zu studieren, wurde aber bald zur Philosophie geführt und neigte sich dem entschiedenen Determinismus zu. Während seiner Studienzeit in Leipzig hatte er mit bitterer Not zu kämpfen. Von 1788-90 Hauslehrer in Zürich, wo er seine nachherige Gattin (seit 1793), Johanna Rahn, eine Nichte Klopstocks, kennen lernte, seit 1790 wieder in Leipzig, dann für kurze Zeit Hauslehrer in Warschau, warf er sich während mehrerer Jahre mit großem Eifer auf das Studium Kants, ging, um dessen persönliche Bekanntschaft zu machen, 1792 nach Königsberg und schrieb, um sich bei demselben würdig einzuführen, binnen vier Wochen seinen »Versuch einer Kritik aller Offenbarung« (Königsb. 1792, 2. Aufl. 1793). Diese Schrift war so ganz im Geiste der kritischen Philosophie, dass sie für ein Werk Kants gehalten wurde, bis dieser selbst den Verfasser nannte, empfahl und dadurch mit einemmal zum berühmten Mann machte. Fichte privatisierte hierauf einige Zeit in Zürich, verheiratete sich, hielt Vorlesungen, wurde mit Pestalozzi genauer bekannt und beteiligte sich unter dem Eindruck des benachbarten Frankreich u. der republikanischen Schweiz lebhaft (obgleich nur theoretisch) an der Politik. In den anonym erschienenen Schriften: »Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution« (Jena 1793) und die »Zurückforderung der Denkfreiheit, an die Fürsten Europas« (das. 1794) beurteilte er aus dem Freiheitsbegriff der Kantschen Philosophie den gegebenen Staat und trat für die Rechtmäßigkeit der französischen Umwälzung ein. Im Mai 1794 trat Fichte eine Professur in Jena an. Für seine (überaus erfolgreichen) Vorlesungen ließ er zwei Lehrbücher drucken, das eine, in Form eines Programms, war die Schrift »Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogen. Philosophie« (Weim. 1794, 2. Aufl. 1798), das andre enthielt das neue System selbst: »Grundlage und Grundriss der gesamten Wissenschaftslehre« (Jena 1794, 2 Tle.; 3. Aufl. 1802). Um auf die moralische Bildung der Studierenden noch direkter einzuwirken, eröffnete er im Wintersemester 1794/95 Vorlesungen »Über die Moral für Gelehrte« und veröffentlichte eine Schrift: »Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten« (Jena 1794). Als er aber auch das akademische Leben der Studenten reformieren wollte, verwandelte sich die ursprüngliche Begeisterung der Studenten für Fichte in solchen Hass gegen ihn, dass er, von der Regierung ohne Schutz gelassen, Jena im Sommer 1795 verlassen musste und sich einige Zeit in Osmannstädt bei Weimar aufhielt. Außer vielen einzelnen Abhandlungen in Journalen erschienen von ihm damals die »Grundlage des Naturrechts« (Jena 1796, 2 Tle.) und das »System der Sittenlehre« (das. 1798), das als Gegenstück des Naturrechts zu betrachten ist. In dem »Philosophischen Journal« von Niethammer und Fichte (Bd. 8, Heft 1, Jena 1798) erschien ein Aufsatz von Forberg: »Entwickelung des Begriffs Religion«, wonach die Religion nur ein praktischer Glaube an eine moralische Weltordnung sein sollte. Fichte hatte demselben eine einleitende Abhandlung: »Über den Grund unsers Glaubens an eine göttliche Weltregierung«, vorausgeschickt, deren Grundgedanke war: »Unser sittliches Handeln sei unmittelbar Glaube an eine Ordnung der Dinge, in der das Gute nur aus dem Guten hervorgehen könne, d. h. an eine moralische Weltordnung, und diese sei das Göttliche selbst«. Bald nach dem Bekanntwerden jener Aufsätze erschien ein anonymes Schriftchen u. d. T.: »Schreiben eines Vaters an seinen Sohn über den Fichteschen und Forbergschen Atheismus«, infolgedessen die kursächsische Regierung zu Dresden das »Philosophische Journal« verbot und in einem Requisitionsschreiben an den weimarischen Hof die Bestrafung der Herausgeber des Journals verlangt e, zugleich aber drohte, andernfalls ihren Untertanen den Besuch der Universität Jena zu verbieten. Fichte, überzeugt, der Angriff sei nicht so sehr gegen den Atheismus als vielmehr gegen den freien Menschengeist gerichtet, schrieb die »Appellation an das Publikum. Eine Schrift, die man erst zu lesen bittet, ehe man sie konfisziert« (Jena u. Leipz. 1799). Der Herzog von Weimar, dem Fichte diese Schrift überreichte, wollte Fichte schonen und die Sache damit abmachen, dass er Fichte einen Verweis durch den akademischen Senat erteilen lassen wollte. Fichte, davon in Kenntnis gesetzt, erklärte in einem Brief an den Kurator der Universität, den Geheimrat Voigt in Weimar, den Verweis nicht hinnehmen zu können, indem er zugleich anzeigte, dass er einen solchen mit Einreichung seiner Dimission beantworten werde. Schon 29. März gelangte ein Reskript an den akademischen Senat, das diesen beauftragte, Fichte und Niethammer einen Verweis zu erteilen, und zugleich bemerkte, dass man Fichtes Dimission annehme. Fichte, der diese Wendung nicht erwartet hatte, versuchte eine Zurücknahme der höchsten Entschließung zu veranlassen, erhielt aber eine abschlägige Antwort. Im Juni 1799 ging er nach Berlin, wo man ihn auf die Entscheidung des Königs hin duldete. In die Zeit dieses ersten Berliner Aufenthalts, während dessen er viel mit Friedr. Schlegel, Schleiermacher, Tieck verkehrte, fällt die Veröffentlichung der Schriften: »Über die Bestimmung des Menschen« (Berl. 1800), »Der geschlossene Handelsstaat«, worin er die Ausführung seiner allgemeinen Staatslehre darzutun suchte, und »Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters«, dargestellt in Vorlesungen, gehalten zu Berlin 1804-1805 (das. 1806), denen »Über das Wesen des Gelehrten« (das. 1806) folgte. Es waren dies öffentliche Vorlesungen, die er im Sommer 1805 in Erlangen (damals preußisch) gehalten hatte, wohin er als Professor berufen war, mit der Bestimmung, nur im Sommer daselbst zu lesen. Als bald darauf jene Katastrophe eintrat, die Preußens Macht ganz zu vernichten drohte, ging Fichte, um nicht unter französische Herrschaft zu kommen, nach Königsberg und 1807 über Kopenhagen wieder nach Berlin. Als die Regierung den Entschluss fasste, in Berlin eine Universität zu errichten, wurde Fichte mit der Ausarbeitung eines Planes beauftragt, der später u. d. T.: »Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höhern Lehranstalt« (Stuttg. 1817) gedruckt erschien, aber auf W. v. Humboldts und Schleiermachers Rat als unpraktisch zurückgelegt ward. Höchst einflussreich dagegen wirkte Fichte durch seine »Reden an die deutsche Nation, gehalten im Winter 1807 bis 1808« (Berl. 1808), in denen er darauf hinwies, dass das gesunkene deutsche Volkstum nur durch eine ganz neue Erziehung wiederherzustellen sei. Seit 1810 hielt Fichte als Professor an der neuen Universität Vorträge, als deren Früchte die Schriften: »Die Wissenschaftslehre in ihrem ganzen Umfang« (Berl. 1810) und »Die Tatsachen des Bewusstseins« (Tübing. 1817) zu betrachten sind. Beim Beginn des Befreiungskrieges, in den ersten Monaten des Jahres 1813, erbot sich Fichte, das Hauptquartier als religiöser Redner zu begleiten, wurde aber abschlägig beschieden. Im Wintersemester 1813/14 hatte er seine Vorlesungen wieder angefangen, als seine vortreffliche Frau nach fünfmonatiger aufopfernder Krankenpflege vom Lazarettfieber befallen wurde. Sie genas; aber Fichte, von derselben Krankheit ergriffen, erlag ihr.
Fichte war ein fester, unbeugsamer Charakter von stärkster Willens- und Tatkraft, voll des edelsten Enthusiasmus, konsequent in seinen Ansichten, auf deren volle Einheit er drang, dabei nicht frei von Übertreibungen; damit hängt es zusammen, dass er eigenwillig und intolerant gegen fremde Überzeugungen, ja ohne Verständnis für solche war, auch die Tatsachen nicht genügend berücksichtigte. Sein Freund und Arzt Hufeland bezeichnete sein Wesen treffend mit den Worten: »Sein Grundcharakter war die Überkraft«. Kein andrer deutscher Philosoph hat für die nationale Größe und Wiedergeburt des deutschen Volkes eine so opfermutige Begeisterung selbst gehegt und bei andern geweckt wie Fichte Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Philosophen I«.Fichtes Philosophie knüpfte an Kant, und zwar an dessen idealistischen Faktor an. Kant hatte die Erfahrung für ein Produkt aus zwei Faktoren, einem idealistischen und einem realistischen, erklärt. Jenen, das erkennende Subjekt, betrachtete er als den Urheber der Form, diesen, das sogen. Ding an sich, als die Ursache der Materie der Erfahrungserkenntnis. Ohne die a priori im Erkenntnisvermögen gelegenen reinen Anschauungsformen des Neben- und Nacheinander (des Raumes und der Zeit) würden wir Kant zufolge keine räumlich und zeitlich angeordneten Sinnesempfindungen, ohne das seiner Qualität nach übrigens unbekannt bleibende Ding an sich überhaupt keine Empfindungen haben. Das Dasein desselben erkennen wir eben mittels des Daseins der Empfindungen in uns. Da wir uns nicht bewusst sind, diese selbst in uns hervorgebracht zu haben, so schließen wir nach dem Kausalgesetz, dass sie von irgend einer von uns selbst verschiedenen Ursache, einem Ding an sich, hervorgebracht seien, ein solches demnach wirklich existiere. Fichte bezeichnete diese Folgerung als einen Fehlschluss. Fällt aber so der von Kant festgehaltene realistische Faktor der Erfahrungserkenntnis weg, so bleibt nur der idealistische übrig, d. h. die Empfindungen (als Materie der Erfahrung) sind ebensogut subjektiven Ursprungs wie die Verknüpfung derselben im Neben- und Nacheinander (als Form und Erfahrung). Das einzige daher, aus dem die tatsächlich im Bewusstsein vorhandene Vorstellungswelt wirklich erklärt werden kann und daher auch muss, ist das Subjekt, das, da außer ihm nichts existiert, notwendig der Erzeuger seiner gesamten Vorstellungswelt sein muss. Fichte glaubte so Kants Ansichten in dessen eignem Sinne weiter zu bilden, dass die Unterscheidung zwischen Ding an sich und Erscheinung gewiss nur vorläufig gelte. Kant erklärte dies 1799 für einen Irrtum und Fichtes Wissenschaftslehre für ein ganz verfehltes System, worauf Fichte in seiner Selbstüberhebung erwiderte: »der heilige Geist in Kant habe wahrer als Kants individuelle Persönlichkeit gedacht«.
Die Aufgabe, die Kants Philosophie sich gesteckt hatte, die gegebene Erfahrung aus zwei Faktoren zu konstruieren, wurde von Fichte insofern beschränkt, als er sie aus einem einzigen, dem Subjekt oder dem Ich, konstruierte, zugleich aber dahin bestimmte, dass Philosophie in Wissenschaft, d. h. in ein konsequentes, auf einem durch sich selbst gewissen Fundament aufgebautes System, in dem ein Satz den andern und das Fundament alle trägt, zu verwandeln sei. Ersterer Umstand gab Fichtes Philosophie den idealistischen, letzterer den Charakter einer Wissenschaftslehre, d. h. einer Anweisung, wie ein durchaus und streng wissenschaftliches Wissen zustande zu bringen sei. Dass unter dem Subjekt, also dem Ich, sein eignes persönliches (das Ich des Individuums Fichte) gemeint sein sollte, als spiegele er selbst sich die Welt nur vor und sei eigentlich mit seiner Phantasmagorie allein im Weltraum vorhanden, erklärte Fichte selbst für einen »unsinnigen und bodenlosen Idealismus und Egoismus«, den ihm »beleidigte Höflinge und ärgerliche Philosophen« angedichtet hätten. Das Ich wird von ihm (wie das Erkenntnisvermögen von Kant) nicht im individuellen, sondern im allgemeinen Sinne gefasst, um begreiflich zu machen, wie in einem solchen und durch ein solches ein Wissen überhaupt zustande komme; es ist das absolute Ich oder die Ichheit. Die Vorstellungen, von deren Erzeugung das Ich nichts weiß, sind ebensogut durch dasselbe selbst hervorgebracht wie diejenigen, bei denen es sich seines Hervorbringens bewusst ist. Es findet daher zwar nach wie vor ein Unterschied statt zwischen Vorstellungen, die im Bewusstsein angetroffen werden, aber scheinbar nicht vom Subjekt herrühren, und solchen, von denen das Subjekt sich bewusst ist, sie hervorgebracht zu haben; aber auch die scheinbar nicht vom Ich herrührenden Vorstellungen rühren von diesem ebensogut her wie die von ihm selbst als von ihm herrührend gewussten. Was überhaupt im Subjekt vorhanden ist, ist durch dieses gesetzt; dasjenige, bei dem das Subjekt (das Ich) dieser Setzung sich nicht bewusst ist, betrachtet es zwar als durch ein andres (ein Nicht-Subjekt, Nicht-Ich) gesetzt, aber nur, um es schließlich als seine Setzung (durch das Subjekt gesetzt) wieder zurückzunehmen. Die drei Stufen dieses Prozesses, das Setzen des Ichs, das Setzen des Nicht-Ichs und der gegenseitigen Einschränkung des Ichs und Nicht-Ichs, die Fichte als Thesis, Antithesis und Synthesis bezeichnet, bilden das Instrument, durch das Fichte die ganze Erfahrungswelt in Taten des Ichs und die sogen. Transzendentalphilosophie, als Wissen von dem Zustandekommen der Erfahrung, in Selbstbewusstsein des Ichs, als Wissen von diesen Taten als den seinigen, auflöst. Wie Raum und Zeit, die Formen der Empfindungen, müssen diese selbst als Taten des Ichs aufgezeigt werden. Für Fichte war es die eigentümliche Aufgabe der Wissenschaftslehre, zu zeigen, wie die unwillkürlichen Vorstellungen, das Sehen, Hören etc., aus eigner, zwar nicht gesetzloser, aber durch nichts andres als durch die Natur des tätigen Subjekts selbst gebundener Tätigkeit hervorgehen. Diese, die handelnde Intelligenz, findet sich bei ihrer Produktion zwar in »unbegreifliche Schranken« eingeschlossen; dieselben sind aber nichts weiter als die Folgen ihres eignen Wesens, Gesetze der Intelligenz, und indem diese die Nötigung, von der ihre bestimmten Vorstellungen begleitet sind, fühlt, empfindet sie nicht einen Eindruck von außen, sondern ihr eignes Gesetz.
Durch diese Gesetze ist die Gestalt dieser Welt als das notwendige Produkt des in »unbegreifliche Schranken« ihres Wesens eingeschlossenen Handelns der Intelligenz begründet, d. h. die Welt unsrer Vorstellungen kann keine andre sein, als die Natur der Intelligenz es gestattet. Keineswegs aber sind dadurch jene Schranken selbst und das in ihnen sich bewegende Handeln der Intelligenz begreiflich gemacht. Soll dieses kein zweckloses und die hervorgebrachte Welt kein unbegreifliches und trügerisches Spiel sein, so muss ihm und dadurch auch der sinnlichen Erscheinungswelt irgend ein Zweck, eine vernünftige Absicht, allerdings nicht außerhalb des Subjekts, da außer dem Ich nichts existiert, sondern innerhalb desselben, zugrunde liegen. Dieser Zweck, dessen Erweis Fichte in der Sittenlehre versucht, liegt darin, dass das Ich Selbstzweck und die Erscheinung einer Welt das einzige Mittel, d. h. die Bedingung zur Erreichung desselben ist. Handeln, das Wesen des Ichs, ist zugleich dessen absolute Bestimmung, und da es ohne Erscheinung einer bestimmten Welt zu einem bestimmten Handeln nicht kommen könnte, so liegt die Produktion der Erscheinungswelt auf dem Wege zwischen dem Ich, wie es (potentialiter, der Möglichkeit nach) an sich und (actualiter, der Wirklichkeit nach) infolge seiner eignen Selbstverwirklichung für sich ist. Kann Wirksamkeit überhaupt, also auch jene des Ichs, gar nicht gedacht werden ohne den Gegensatz von Innen und Außen, Subjekt und Objekt, von etwas, wovon sie ausgehen, und etwas, auf das sie hingehen muss: so bildet der absolut durch das Ich selbst gesetzte Zweck das eine, der rohe Stoff der Welt das andre Ende; die Setzung und Bewältigung des letztern zur Realisierung und Bewährung des erstern macht die Bestimmung des Ichs aus. »Unsre Welt«, lehrt Fichte, »ist das versinnlichte Material unsrer Pflicht; dies ist das eigentliche Reelle in den Dingen, der wahre Grundstoff aller Erscheinung.« Die Realität der Welt beruht nicht auf einem Wissen, sondern (ähnlich wie nach Kants Postulierungsmethode der praktischen Vernunft für diese das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele) auf einem bloßen Glauben, der seinerseits in der Notwendigkeit wurzelt, das Pflichtgebot zu realisieren, das sich ohne eine Welt nicht realisieren lässt. Die aus der ursprünglichen Einrichtung unsrer (subjektiven) Natur ausgeborne (idealistische) Welt ist daher zwar nur das Spiegelbild dieser, die Offenbarung unsrer selbst; das Ganze aber ist eine durchaus moralische Anordnung und dient moralischen Zwecken. »Diese lebendige moralische Ordnung ist Gott«; eines andern bedürfen wir nicht und können keinen andern fassen, denn der Schluss, dass, wo Ordnung sich kundgebe, ein Ordner vorauszusetzen sei, »wird durch den Verstand gemacht und gilt nur auf dem Gebiet der sinnlichen Erfahrung«. Ihm Bewusstsein zuschreiben, hieße ihn in Schranken einschließen, d. h. vermenschlichen; ein Bewusstsein ohne Schranken wäre ein »für uns ganz unbegreifliches Wissen«; »jeder Begriff von der Gottheit würde ein Abgott«. Das einzige wahrhaft Absolute, das erste und einzige An-sich, das dem Menschen gegeben ist, ist »das Postulat einer übersinnlichen Weltordnung«.
In der ersten Periode Fichtes, der die Schriften bis zum Jahr 1800 angehören, bildet das Postulat der übersinnlichen Weltordnung den Endpunkt, in den Schriften der zweiten Periode (1800-1814), namentlich in der Schrift von der Bestimmung des Menschen, den Ausgang. Wird jene, »d as einzige wahre Absolute«, »Gott«, von den unbegreiflichen Schranken, in denen das menschliche Ich als handelnde Intelligenz sich »gefangen« findet, aufsteigend nur erreicht, wenn die Schranke von diesem schlechthin weggedacht, die endliche Intelligenz zur unendlichen (ebendarum »für uns unbegreiflichen«) erweitert wird, so kann umgekehrt, vom Absoluten ausgehend, zum Menschlichen nur herabgestiegen werden, wenn das an sich Schrankenlose in die Schranken des menschlichen Bewusstseins gefasst, das unendliche Ich zum endlichen (ebendarum »begriffenen«) verengert wird. Damit ist zugleich ausgesprochen, dass das unendliche Ich nicht in einem, sondern nur in einer unendlichen Menge endlicher Ichs Verwirklichung finden kann, deren jedes für sich ebensosehr ein (in sich beschlossenes) Ich wie im Verhältnis zu den übrigen ein (für diese abgeschlossenes) Nicht-Ich darstellt und durch Erfüllung seiner besondern den auf dasselbe entfallenden Teil der allgemeinen Bestimmung, der Selbstverwirklichung des Absoluten (der moralischen Ordnung, Gottes), realisiert und dadurch (auf seinem Standpunkt) die »übersinnliche Welt«, das »einzige Absolute«, mit verwirklicht. Wie auf dem Standpunkt der Sittenlehre zwischen dem Ich als Selbstzweck und dessen Verwirklichung die sinnliche Scheinwelt als Mittel und Bedingung zu dieser, so liegt zwischen dem Absoluten (der zu realisierenden moralischen Ordnung) und dessen Verwirklichung die Welt der endlichen Ichs, d. h. die in einer Vielheit leiblich getrennter Vernunftwesen vollzogene Versinnlichung der Übersinnlichen als Mittel und Bedingung seiner Selbstrealisierung. Die Phasen, welche die letztere nacheinander durchläuft, gaben Fichte den Anhaltspunkt zu einer ebenso großartigen wie tief ethischen Philosophie der Geschichte, deren Grundlage die Einheit des Menschengeschlechts in Gott, deren Endziel die Wiedervereinigung desselben in diesem ist. In der »Anweisung zum seligen Leben« (vom Jahr 1806) werden von ihm drei Perioden unterschieden. Dass diese seine spätere Philosophie, die Hegel verhöhnte, von seiner anfänglichen nur dem Ausdruck nach verschieden sei, hat Fichte ausdrücklich (gegen Schelling) behauptet. Eine eigentliche Schule hat Fichte nicht gebildet, sondern es haben nur einzelne, namentlich Schad, Mehmel, Cramer, Schmidt, Michaelis u. a., seine Lehre adoptiert. Gleichwohl ist Fichtes Einfluss auf die folgende Entwickelung der deutschen Philosophie so bedeutend, dass in ihm allein der Schlüssel zu allem Verständnis der Neuern liegt, indem nicht nur Schelling und Hegel auf der von ihm zuerst eingeschlagenen Bahn der Spekulation weiterschritten, sondern selbst deren Antipode Herbart durch das im Fichteschen »Ich« liegende Problem auf die Grundaufgabe seiner Metaphysik hingeleitet worden zu sein selbst bekennt, Schopenhauer aber in der ersten Hälfte seiner Weltanschauung, in der »Welt als Vorstellung«, ganz mit Fichte übereinstimmt. Auch neuerdings gewinnt Fichtes Lehre wieder Einfluss."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
62 Feuerbach
"Feuerbach, Ludwig Andreas, berühmter Philosoph, geb. 28. Juli 1804 in Landshut, gest. 13. Sept. 1872 auf dem Rechenberg bei Nürnberg, hatte während seiner Gymnasialzeit in Ansbach eine entschieden religiöse Richtung, studierte in Heidelberg Theologie, ward durch Daubs Vorlesungen für die Philosophie Hegels gewonnen, ging, um letztern zu hören, 1824 nach Berlin, habilitierte sich 1828 zu Erlangen als Privatdozent der Philosophie, machte jedoch als Dozent wenig Glück und wurde als entschiedener Hegelianer angefeindet. Seine anonym erschienene Schrift »Gedanken über Tod und Unsterblichkeit« (Nürnb. 1830; 3. Aufl., Leipz. 1876; neu hrsg. von Jodl, Stuttg. 1903), in der er eine Religion, die sich ein Jenseits als Ziel setze, einen Rückschritt nannte und den Glauben an die Unsterblichkeit psychologisch erklärte, wurde konfisziert, sein Gesuch um eine außerordentliche Professur wiederholt (zuletzt 1836) abgeschlagen, Aussichten auf eine Professur an andern Universitäten erfüllten sich auch nicht, so dass er die akademische Laufbahn verließ, um sich nach Ansbach und (seit 1836) auf das drei Stunden von diesem entfernte Schloss Bruckberg in literarische Einsamkeit zurückzuziehen. Hier, wo er 1837 mit seiner treuen Lebensgefährtin Berta Loew, die daselbst Mitbesitzerin einer Fabrik war, eine glückliche Ehe schloss, sind in ländlicher Muße bis zum Jahr 1860, wo er auf den bei Nürnberg gelegenen Rechenberg übersiedelte, fast alle seine Hauptwerke entstanden. Nachdem er bereits unter dem unpassenden Titel: »Abälard und Heloise« (Ansb. 1833; 4. Aufl., Leipz. 1889) in humoristisch-philosophischen Aphorismen eine Parallele zwischen der realen und idealen Seite des Lebens veröffentlicht hatte, begann er mit seiner »Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie« (Ansb. 1833-1837, 2 Bde.), die sich, wie seine »Kritiken auf dem Gebiete der Philosophie« (das. 1835), durch klassische Schärfe der Charakteristik auszeichnete, den Kampf der Vernunft gegen die Theologie, des Wissens gegen den Glauben, den er im dritten Band: »Pierre Bayle nach seinen für die Geschichte der Philosophie und der Menschheit interessantesten Momenten« (das. 1838) in pikanter Weise fortsetzte, und wobei dieser selbst wie die vorgenannten Denker seinen persönlichen Ansichten zur Folie dienten. Seit 1837 trat er in Verbindung mit Ruge und den »Halleschen Jahrbüchern«, später »Deutschen Jahrbüchern«, wodurch sich sein Bruch nicht nur mit der Theologie, sondern auch mit der Hegelschen Philosophie vollzog, die er in Naturalismus umbildete, obgleich er Hegel noch in der Schrift »Über Philosophie und Christentum« (Ansb. 1839) gegen die »fanatischen Verketzerer aller Vernunfttätigkeit« in Schutz nahm. In der Schrift »Zur Kritik der Hegelschen Philosophie« (1839) erklärte er alle Spekulation, die über die Natur und den Menschen hinaus will, mit dürren Worten für »Eitelkeit«, den absoluten Geist für eine »Schöpfung des subjektiven Menschengeistes«; in der Rückkehr zur Natur fand er die einzige »Quelle des Heils«. In seinem Hauptwerk: »Das Wesen des Christentums« (Leipz. 1841, 4. Aufl. 1883; neu hrsg. von Bolin, Stuttg. 1903), zeigte sich der Zerfall mit der ganzen christlichen Philosophie. Der Satz, den auch Schleiermacher gelegentlich aufstellt, dass der angeblich nach Gottes Ebenbild geschaffene Mensch vielmehr umgekehrt das Göttliche nach seinem eignen Ebenbild schaffe, wird hier zum Ausgangspunkt der Naturgeschichte des Christentums. Die Theologie wird zur Anthropologie, die Feuerbach allmählich für die Universalphilosophie ansah. Feuerbach erklärt die Religion für einen Traum des Menschengeistes, Gott, Himmel, Seligkeit für durch die Macht der Phantasie realisierte Herzenswünsche; was der Mensch Gott nenne, sei das Wesen des Menschen ins Unendliche gesteigert und als selbständig gegenübergestellt; homo homini deus! Zur Ergänzung ließ er dem »Wesen des Christentums« die Schrift »Das Wesen der Religion« (Leipz. 1845), mehrere Aufsätze in den »Deutschen Jahrbüchern«, das Schriftchen »Das Wesen des Glaubens im Sinn Luthers« (Leipz. 1844, 2. Aufl. 1855) und die »Vorlesungen über das Wesen der Religion« (zuerst im Druck erschienen das. 1851, neue Ausg. 1892) folgen, die sämtlich »die Aufgabe der neuern Zeit, die Verwandlung und Auflösung der Theologie in die Anthropologie«, zu fördern bestimmt waren. Die »Vorlesungen« wurden ursprünglich im Winter 1848/49 zu Heidelberg infolge einer an Feuerbach von Seiten der dortigen Studentenschaft ergangenen Einladung gehalten und bezeichneten, wie das »tolle Jahr« selbst, einen Wendepunkt in Feuerbachs Leben. Er zog sich von nun an von dem öffentlichen Leben in philosophische Einsamkeit zurück und wandelte seinen anthropologischen Naturalismus in Materialismus um. Das Werk »Theogonie, oder von dem Ursprung der Götter nach den Quellen des klassischen, hebräischen und christlichen Altertums« (Leipz. 1857, 2. Aufl. 1866), das den Grundgedanken der Vorlesungen über das Wesen der Religion, dass die Götter »personifizierte Wünsche« seien, wiederholt, erregte nicht entfernt mehr das Aufsehen seiner literarischen Vorläufer. Der Materialismus hat bei ihm seinen stärksten Ausdruck erhalten in einer bekannten Rezension von Moleschotts »Lehre der Nahrungsmittel für das Volk« (1850) mit dem Worte: »Der Mensch ist, was er isst«. Diese letzte Gestalt seiner Philosophie enthält Feuerbachs letztes Werk, dessen Titel und Resultat jenem seines ersten verwandt, dessen philosophischer Standpunkt aber das gerade Gegenteil jenes des ersten ist, die Schrift »Gottheit, Freiheit und Unsterblichkeit vom Standpunkt der Anthropologie« (Leipz. 1866, 2. Aufl. 1890). In seinen letzten Lebensjahren (1868 und 1869) schrieb er ethische Betrachtungen nieder, die unvollendet geblieben und erst aus seinem Nachlass herausgegeben worden sind. Feuerbachs äußere Verhältnisse hatten sich trübe gestaltet; 1860 verlor er durch unverschuldete Unglücksfälle seine liebgewordene Heimat auf dem Bruckberger Schloss sowie die bescheidene Rente, die bis dahin dem Philosophen ein beschränktes, aber unabhängiges Einkommen gesichert hatte. Die Existenz auf dem Rechenberg bei Nürnberg (1860-72) wurde durch zahlreiche Beweise von Freundschaft, die ihm aus allen Ländern und aus allen Ständen (auch aus dem Bauernstand) zukamen, verschönert. Dass der als Materialist verrufene Philosoph des Humanismus als Mensch reiner Idealist, human im besten Sinne des Wortes war, dafür legen sein echt deutsches Familienleben, seine rührende Liebe zur Gattin und (einzigen) Tochter Eleonore und seine Wahrheits- und Menschenliebe atmende Korrespondenz Zeugnis ab. Feuerbachs sämtliche Werke sind (Leipz. 1846-66) in 10 Bänden erschienen, neu herausgegeben von Bolin u. Jodl (Bd. 1 u. 6, Stuttg. 1903). Besonders in den 1840er Jahren hat Feuerbach großen Einfluss ausgeübt; seine Anschauungen über Religion und ihren Ursprung sind auch jetzt noch von Bedeutung." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
63 z.B. als Hofprediger
64 Apostolisches Symbolum = Apostolisches Glaubensbekenntnis
"Apostolisches Glaubensbekenntnis
Das Apostolische Glaubensbekenntnis ist eine fortgebildete Variante des altrömischen Glaubensbekenntnisses aus dem 2. Jahrhundert, welches wahrscheinlich aus einem noch älteren Taufbekenntnis entstanden ist.
Es wird von den westlichen christlichen Kirchen allgemein anerkannt. In der Kirche von England hat es eine herausragende Bedeutung, da es morgens und abends zu rezitieren ist. In der Katholischen Kirche ist es das Taufbekenntnis (in Frage- und Antwortform, auch bei der Tauferneuerung) sowie der Anfang des Rosenkranzgebets. In der östlichen Kirche ist es im allgemeinen unbekannt; dort wird stattdessen das Nicäische Glaubensbekenntnis verwendet. Das Apostolische Glaubensbekenntnis enthält aber keine Aussagen, die in der Ostkirche irgendwie umstritten wären.
Im 20. Jahrhundert wuchs seine Bedeutung in Folge der ökumenischen Bewegung, da es eine allen Kirchen akzeptable Formulierung des christlichen Glaubens darstellt. Hierzu wurde 1971 eine dem heutigen Sprachgebrauch angepasste Form eingeführt, die unten zitiert wird. Ebenso die alte Fassung nach dem Kleinen Katechismus von Dr. Martin Luther
Eine Parallelentwicklung stellt das Nicäische Glaubensbekenntnis dar.
Lateinisch Ökumenisch-Deutsch Luther: Kleiner Katechismus Credo in deum patrem omnipotentem,
creatorem coeli et terrae;
Et in Iesum Christum,
filium eius unicum, dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu sancto,
natus ex Maria virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus et sepultus,
descendit ad inferna,
tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad coelos,
sedet ad dexteram dei patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos;
Credo in Spiritum sanctum,
sanctam ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
et vitam aeternam. Amen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde;
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todesam dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten;
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholischea Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
Schöpfer Himmels und der Erde.
Ich glaube an Jesum Christum,
Gottes eingebornen Sohn, unsern Herrn,
der empfangen ist vom Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontio Pilato,
gekreuziget, gestorben und begraben,
niedergefahren zur Hölle,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren gen Himmel,
sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
eine heilige christliche Kirche,
die Gemeinde der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung des Fleisches
und ein ewiges Leben. Amen.
1In reformierten Kirchen wird der Ausdruck "katholische Kirche" oft durch "christliche Kirche" bzw. "allgemeine Kirche" ersetzt, um sich von der römisch-katholischen Kirche abzugrenzen. Katho lisch bedeutet in diesem Sinne jedoch nicht die römisch-katholische Kirche, sondern die allgemeine Kirche (gr. katholikos = allgemein), also die Gemeinschaft aller Christen. [Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Apostolisches_Glaubensbekenntnis. -- Zugriff am 2005-01-21. -- leicht verändert]
65 Augsburgische Confession
"Augsburgische Konfession (Confessio Augustana), das vornehmste symbolische Buch der Lutheraner, auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 dem Kaiser Karl V. überreicht. Am 14. März 1530, gleich nach Empfang des kaiserlichen Ausschreibens zum Reichstag, das eine beide Teile befriedigende Ordnung der hinsichtlich der Religion schwebenden Fragen verhieß, beauftragte Kurfürst Johann von Sachsen die Wittenberger Theologen Luther, Melanchthon, Jonas und Bugenhagen, ihm ein Gutachten über die zwiespältigen Artikel, »beide im Glauben und auch in andern äußerlichen Zeremonien« auszuarbeiten. Die Genannten überreichten dem Kurfürsten zu Torgau ein in 10 Artikel gefasstes »Bedenken, was kaiserlicher Majestät der Zeremonien halber und was dem anhängig anzuzeigen sein soll« (sogen. Torgauer Artikel). Diese vom Kurfürsten gebilligten Artikel verarbeitete Melanchthon zu einer »Apologie«. Bei der Ankunft in Augsburg zeigte sich, dass mit diesem Rüstzeug nicht auszukommen sein werde, vielmehr auch die wichtigsten Glaubensartikel in die Arbeit aufzunehmen seien. Nunmehr arbeitete Melanchthon zwischen dem 4. und 11. Mai eine »Konfession« in 17 Artikeln aus, der die 15 auf dem Marburger Religionsgespräch beendeten Artikel (sogen. Marburger Artikel) in der erweiterten Gestalt, die ihnen Luther zum Zwecke der Vorlage auf der Ständeversammlung zu Schwabach im Oktober 1529 gegeben hatte (sogen. Schwabacher Artikel), zu Grunde gelegt wurden. Dieses Bekenntnis fand die Billigung des auf der Feste Koburg zurückgebliebenen Luther. Artikel 18-21 fügte Melanchthon nachträglich hinzu und suchte außerdem durch fortgesetztes Feilen und Andern seiner Arbeit jede Schärfe gegen Rom zu nehmen. In einem zweiten Teil, Artikel 22-28, wurde der Hauptinhalt der Torgauer Artikel, die abzustellenden Missbräuche betreffend, hinzugefügt. Vorrede und Schluss schrieb der sächsische Kanzler Brück. Die dergestalt entstandene »Konfession« zerfällt in zwei Teile. In dem ersten (Artikel 1-21) wird die evangelische Lehre in einer Weise erörtert, die das Bestreben möglichster Annäherung an den katholischen Lehrbegriff durchweg erkennen lässt; überall wird die Übereinstimmung des Bekenntnisses mit der Lehre der Kirchenväter nachzuweisen gesucht. Nicht minder versöhnlich ist der zweite Teil (Artikel 22-28) gehalten, der von beider Gestalt des Sakraments, vom Ehestande der Priester, von der Messe, von der Beichte, vom Unterschiede der Speisen, von Klostergelübden und von der Bischöfe Gewalt handelt. Artikel 26 und 28 haben in den Torgauer Artikeln keine Parallele. Diesen »sächsischen Ratschlag« machten nach längeren Verhandlungen die andern evangelischen Stände zu ihrem Kollektivbekenntnis. Ihre Unterschrift gaben außer dem Kurfürsten Markgraf Georg von Ansbach, Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg, Landgraf Philipp von Hessen, Fürst Wolfgang von Anhalt (das lateinische Exemplar wurde wohl auch vom Kurprinzen Johann Friedrich und Herzog Franz von Braunschweig-Lüneburg unterschrieben), sowie die Städte Nürnberg und Reutlingen, zu denen im Verlauf des Reichstags Weißenburg (in Franken), Heilbronn, Kempten und Windsheim hinzutraten. Die vier oberdeutschen Städte Straßburg, Konstanz, Memmingen und Lindau verweigerten wegen der in der Augsburgischen Konfession enthaltenen lutherischen Abendmahlslehre ihre Unterschrift und ließen durch die Straßburger Theologen Bucer und Capito eine aus 23 Artikeln bestehende, in der Polemik gegen römische Lehre und Praxis schärfere, das Schriftprinzip stärker betonende Bekenntnisschrift (sogen. Confessio Tetrapolitana, Vierstädtebekenntnis) ausarbeiten. Am Nachmittag des 25. Juni 1530 wurde im Saale des Bischofshofes der deutsche Text der Augsburgischen Konfession vor dem Kaiser durch den sächsischen Kanzler Beier verlesen. Das deutsche und das lateinische Exemplar wurden dem Kaiser übergeben. Das lateinische ist später erst nach Brüssel, dann nach Spanien gewandert und dort vernichtet worden; das deutsche kam in das Mainzer Archiv und ist verschollen. Die Tetrapolitana kam nur im Ausschuss der katholischen Fürsten zur Verlesung.
Auf den Rat der katholischen Stände hatte der Kaiser inzwischen eine Anzahl katholischer Theologen, darunter Eck, Faber, Cochläus und Wimpina, mit einer Widerlegung der Konfession beauftragt. Die ihm 12. Juli lateinisch und deutsch eingereichte Arbeit (sogen. Confutatio) war so schroff gehalten, dass sie das Bestreben, die Protestierenden in möglichst milder Form der Kirche wieder zuzuführen, nur geschädigt haben würde. Vielfach umgestaltet und immer wieder gemildert gelangte sie 3. Aug. zur öffentlichen Verlesung, wurde aber den evangelischen Ständen nicht ausgehändigt. Als Antwort auf die Konfutation verfasste Melanchthon die unter dem Namen der Apologie der Augsburgischen Konfession (s. d.) bekannte Rechtfertigungsschrift. Auch dem Vierstädtebekenntnis setzten die katholischen Theologen auf Befehl des Kaisers eine Konfutation entgegen, die erst 25. Okt. zur Verlesung kam.Die Augsburgische Konfession fand als Lehrnorm der lutherischen Landeskirchen sehr schnell Verwendung, und seit dem Schmalkalder Tage von 1535 waren alle neu aufzunehmenden Bundesglieder auf »die reine Lehre unsrer Konfession« verpflichtet. Auch erlangte die A. K. eine hohe staatsrechtliche Bedeutung, insofern sie allen kirchlich-politischen Verhandlungen der spätern Zeit zu Grunde gelegt und sowohl der Passauer Vertrag (1552) als der Augsburger und der Westfälische Friede nur mit denen geschlossen ist, die sich ausdrücklich zur Augsburgischen Konfession bekannt hatten. Da die deutschen Reformierten und selbst Calvin die A. K. unterschrieben, wurde sie aus einem Bekenntnis des Luthertums zu dem des Protestantismus überhaupt. Doch gilt dies nur von der veränderten Augsburgischen Konfession. Melanchthon nämlich hörte nicht auf, die von ihm verfasste Schrift als sein geistiges Eigentum anzusehen und trug kein Bedenken, daran zu ändern. Noch während des Reichstags und trotzdem der Kaiser den Druck untersagt hatte, waren von unberufener Hand mehrere deutsche und eine lateinische Ausgabe erschienen. Ihre Fehlerhaftigkeit bestimmte Melanchthon zu einer im Frühjahr 1531 im Druck erschienenen Redaktion (sogen. editio princeps), welche die verloren gegangenen (s. oben) Originale ersetzen muss, wenn auch kein Zweifel besteht, dass sie, namentlich in der deutschen Fassung, von der ursprünglichen Fassung in manchen Punkten stark abweicht: die ursprüngliche A. K. ist den Gegnern noch weiter entgegengekommen als die im Druck erhaltene. Indessen galt diese Ausgabe den Zeitgenossen als authentische Wiedergabe des vor Kaiser und Reich bekannten evangelischen Glaubens. In den spätern Ausgaben seit 1540 hat nun Melanchthon namentlich in der Lehre vom Abendmahl in Gemäßheit seiner eignen veränderten Lehrauffassung Änderungen vorgenommen, die von den strengen Lutheranern (Flacianern) verworfen wurden. Diese besorgten 1561 einen unveränderten Abdruck der Ausgabe von 1531 (sogen. Conf Aug. invariata), die später in das Konkordienbuch aufgenommen wurde. Die staatsrechtliche Geltung der Ausgabe von 1540 (sogen. Conf. Aug. variata) wurde dadurch indessen nicht beeinträchtigt. Ja, an manchen Orten, z. B. in Brandenburg, ist später ausdrücklich wieder die Variata als gültige Bekenntnisform proklamiert worden. Vgl. Plitt, Einleitung in die Augustana (Erlang. 1867-68, 2 Bde.); Kolde, Die A. K. lateinisch und deutsch, kurz erläutert (Gotha 1896). Eine kritische Ausgabe veranstaltete Tschackert: »Die unveränderte A. K. deutsch und lateinisch, nach den besten Handschriften uns dem Besitze der Unterzeichner« (Leipz. 1901). Über die katholischen Gegenschriften: I. Ficker, Die Konfutation des Augsburgischen Bekenntnisses (Leipz. 1891); Paetzold, Die Konfutation des Vierstädtebekenntnisses (das. 1900).
Die Repetitio confessionis augustanae saxonica ist eine neue Bekenntnisschrift, die Melanchthon 1551 ausarbeitete, damit sie dem Tridentiner Konzil vorgelegt werde, und die fast in allen deutschen Landen gebilligt und unterzeichnet worden ist."
[Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]
66 Schleiermacher, Friedrich <1768-1834>: Predigten über das Evangelium Marci und den Brief Pauli an die Kolosser /gehalten von Friedrich Schleiermacher. Hrsg. von Friedrich Zabel. -- Berlin : Herbig, 1835. -- 2 Teile ; 448 S. ; 401 S.
67 nämlich 1835
Zurück zu Religionskritik