

Fachliche Korrespondenz: mailto:
hausarzt@payer.de
Anfragen zur Website: mailto: payer@payer.de
Zitierweise / cite as:
Blessing, Susanne <1957 - >: Gesundheitsökonomie. -- 2. Evidence-based Medicine und Health Technology Assessment. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- Fassung vom 2006-01-17. -- URL: http://www.payer.de/arztpatient/gesundheitsoekonomie02.htm
Erstmals publiziert: 2006-01-08
Überarbeitungen: 2006-01-17 [Ergänzung]
Anlass: Gesundheits"reform"
Copyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Verfasserin. Für zitierte Texte liegt das Copyright bei den jeweiligen Urhebern.

Dieser Inhalt ist unter einer
Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Arzt und Patient von Tüpfli's Global Village Library
οίδα ουδέν ειδώς
"Ich weiß, dass ich nichts weiß"
Abb.: Evidence-based Arzt
(©Hemera)"No test based upon a theory of probability can by itself provide any valuable evidence of the truth or falsehood of a hypothesis."
Frei übersetzt: Kein Test, der auf einer Wahrscheinlichkeitstheorie beruht, kann von sich aus nützliche Belege für die Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer Hypothese liefern.
Jerzy Neyman [1894 - 1981] und Egon Pearson [1895 - 1980] <Erfinder der Hypothesentests>. -- In: Philosophical Transactions of the Royal Society of London ; A. -- 231 (1933).
[Neyman-Pearson zitiert und übersetzt in: Beck-Bornholdt, Hans-Peter<1950 - > ; Dubben, Hans-Hermann <1955 - >: Der Schein der Weisen : Irrtümer und Fehlurteile im täglichen Denken. -- Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. -- 270 S. : Ill., graph. Darst. ; 19 cm. -- (rororo ; 61450 : rororo science). -- ISBN 3-499-61450-2. -- S. 193f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Geschönt, geschlampt, gelogen Weil positive Studienergebnisse eher publiziert werden, nehmen es viele Forscher in der Medizin nicht so genau mit der Statistik.
Von Robert Matthews
Abb.: Robert A.J. Matthews, geb. 1959, MA(Oxon) CPhys MInstP FRAS
[Bildquelle: http://www.robertmatthews.org/. -- Zugriff am 2006-01-05]Es gibt eine gute Nachricht für schwer gestresste Frauen: Laut einer Studie aus Dänemark liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Brustkrebs erkranken, um 40 Prozent unter dem Erkrankungsrisiko anderer Frauen. Und nun die schlechte Nachricht: Laut einer anderen Studie, die kürzlich von schwedischen Forschern durchgeführt wurde, ist ihr Brustkrebsrisiko doppelt so hoch.
Ja was nun? Zwei Studien, beide von angesehenen Forschern durchgeführt und in führenden medizinischen Zeitschriften veröffentlicht, und doch stehen die Ergebnisse in krassem Widerspruch? Das ist zwar verblüffend, aber keineswegs ungewöhnlich. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine Studie erscheint, deren Resultate früheren Forschungsergebnissen widersprechen: Starkstromleitungen und Leukämie, Salzkonsum und Bluthochdruck, Herzerkrankungen und Sport - die Resultate pendeln mal in diese, mal in jene Richtung, ohne je zu definitiven Erkenntnissen zu führen. Im Jahr 2002 machten zwei der angesehensten medizinischen Zeitschriften innert weniger Wochen mit zwei Studien über den Zusammenhang zwischen Rauchen und Brustkrebs Schlagzeilen. Die erste meinte, einen solchen Zusammenhang bewiesen zu haben, die zweite dementierte ihn rundweg.
Ganz ähnlich verhält es sich mit neuen Therapien: Kaum hat ein Forscherteam einen Durchbruch verkündet, kommt ein zweites Team des Wegs und wirft alles über den Haufen. In den frühen 1990er Jahren glaubte man, dass die Hormonersatztherapie das Risiko von Herzerkrankungen bei Frauen halbiere. 2002 bewies eine großangelegte Studie, dass Hormonersatz keinerlei Nutzen bringt.
Was geht hier vor? Weshalb kommen so viele Studien zu widersprüchlichen Ergebnissen? Das fragen nicht nur immer mehr Wissenschafter, sondern auch eine verunsicherte Öffentlichkeit. Die Antwort lässt Zweifel an der Zuverlässigkeit medizinischer Forschungsergebnisse aufkommen, auch wenn sie in führenden Fachzeitschriften publiziert wurden.
Wissenschafter stehen unter einem beträchtlichen Publikationsdruck, um ihre akademische Stellung und die Finanzierung ihrer Projekte zu sichern. Daher besteht die berechtigte Sorge, dass sie «ungünstige» Ergebnisse absichtlich unterschlagen und sich auf Resultate konzentrieren, die ihre Veröffentlichungschancen erhöhen. Außerdem wird je länger, desto deutlicher, dass viele Forscher selbst die einfachsten Methoden, mit denen sich Fehler bei der Interpretation medizinischer Versuchsreihen eingrenzen ließen, nicht beherrschen.
Am beunruhigendsten dabei ist, dass die meisten Forscher bis heute auf statistische Methoden vertrauen, von denen man seit über 40 Jahren weiß, dass sie zu irreführenden Ergebnissen führen. Anstatt die Plausibilität eines Ergebnisses zu berücksichtigen, stellen sie stur auf die statistische Signifikanz ab, die schon durch ihre Definition in einem gewissen Anteil der Studien zu einem irreführenden Resultat führen muss (siehe Seite 53). Kein Wunder also, dass ein Grossteil der medizinischen Forschung, die heutzutage in Fachzeitschriften publiziert wird, im günstigsten Fall wenig stichhaltig, im schlimmsten Fall einfach falsch ist.
Wie ihre Kollegen in anderen akademischen Disziplinen stehen auch die Mediziner seit einigen Jahren unter steigendem Publikationsdruck: Schreib oder stirb, lautet das Motto. Aber erst in jüngster Zeit hat man damit begonnen, die Auswirkungen dieser Devise auf die Zuverlässigkeit der medizinischen Forschung zu untersuchen. Die Ergebnisse sind beunruhigend.
Abb.: An-Wen Chan MD, DPhil
[Bildquelle: http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/7823.html. -- Zugriff am 2006-01-05]Ein Forscherteam unter Leitung von An-Wen Chan vom Centre for Statistics in Medicine, Oxford, hat die Originaldaten von über 100 veröffentlichten Berichten über klinische Versuchsreihen unter die Lupe genommen. Das Team suchte nach Hinweisen darauf, dass «ungünstige» negative Ergebnisse in den publizierten Artikeln weggelassen wurden, um die Chancen einer Veröffentlichung zu erhöhen. Bei über der Hälfte der überprüften Versuchsreihen stießen die Statistiker auf erhebliche Diskrepanzen zwischen den ursprünglichen Zielen der Studie und den berichteten Resultaten, was die Vermutung erhärtet, dass die Forscher einfach ihre Daten nach publizierbarem Material durchkämmt haben. Daran scheint für Laien nichts Schlechtes zu sein, doch Statistiker wissen: Weil jedes signifikante Resultat mit geringer Wahrscheinlichkeit durch eine zufällige Verteilung der Messwerte zustande kommt, kann man letztlich in jedem Datenberg signifikante Resultate finden, wenn man nur lange genug danach sucht.
[An-Wen Chan; Asbjørn Hróbjartsson ; Mette T. Haahr ; Peter C. Gøtzsche ; Douglas G. Altman: Empirical Evidence for Selective Reporting of Outcomes in Randomized Trials: Comparison of Protocols to Published Articles. -- JAMA. -- May 26, 2004. -- 291: 2457 - 2465.]
Das Team um Chan entdeckte außerdem, dass schädliche Therapiewirkungen, die sich während der klinischen Testphase einstellten, oft nur unvollständig beschrieben wurden und dass zentrale Fragen wie etwa Schmerzintensität und Überlebensrate in den Berichten entweder vernachlässigt oder ganz weggelassen wurden.
In ihrem 2004 im «Journal of the American Medical Association» (JAMA) erschienenen Bericht weisen die Autoren darauf hin, dass man diese Auslassungen bei der Lektüre der veröffentlichten Aufsätze schlechterdings nicht erkennen kann, und fordern deshalb die umfassende Offenlegung der Ziele und Ergebnisse jeder medizinischen Studie. Solche Forderungen scheinen besonders bei Forschungen angezeigt, die von der Industrie finanziert werden.
Abb.: Cary Gross MD
[Bildquelle: http://rwjcsp.yale.edu/faculty.php. -- Zugriff am 2006-01-05]2003 wertete ein Team um Cary Gross von der Yale University School of Medicine über 1000 Studien daraufhin aus, ob sich ein Zusammenhang zwischen den Resultaten dieser Studien und ihrer Finanzierung zeige. Das Ergebnis: 80 Prozent der industriefinanzierten Forschungen kamen zu positiven Ergebnissen, während es bei unabhängigen Forschern nur knapp 50 Prozent waren.
[Justin E. Bekelman; Yan Li; Cary P. Gross: Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research: A Systematic Review. -- JAMA. -- Jan 2003. -- 289: 454 - 465. ]
Man könnte versucht sein, diese Diskrepanz dadurch zu erklären, dass die Industrie einen besseren Riecher für wirksame Therapeutika hat. Aber das Team von Gross fand heraus, dass in industriefinanzierten Versuchsreihen die Arzneimittel oft mit Placebos oder mit schwachen Alternativpräparaten verglichen wurden, um möglichst eindrückliche Resultate zu erzielen. Der Effekt war gelegentlich dramatisch. So wiesen zum Beispiel über die Hälfte der industriefinanzierten Studien zu einem bestimmten Arzneimittel gegen Herzkrankheiten positive Ergebnisse aus, während exakt dieselbe Substanz in keiner einzigen der unabhängigen Studien für wirksam befunden wurde.
Die Erkenntnisse von Gross und seinen Kollegen wurden 2003 im «Journal of the American Medical Association» veröffentlicht. Die Autoren halten diese Diskrepanzen nicht zuletzt deshalb für besorgniserregend, weil der Anteil an industriefinanzierten Forschungen beständig steigt. Inzwischen werden rund zwei Drittel der klinischen biomedizinischen Forschung in den USA durch die Industrie unterstützt - das ist doppelt so viel wie 1980.Um des Problems der selektiven Veröffentlichung positiver Resultate Herr zu werden, verlangen führende medizinische Fachzeitschriften von ihren Autoren, alle klinischen Versuche bereits in der Planungsphase zu registrieren. So soll verhindert werden, dass Versuche mit negativen Resultaten unter den Teppich gekehrt werden. Seit 2003 können solche Studien auch dem «Journal of Negative Results» [Webpräsenz: http://www.jnrbm.com/. -- Zugriff am 2006-01-05] zur Veröffentlichung unterbreitet werden.
Trotz dem Druck, der auf den Wissenschaftern lastet, ist die selektive Berichterstattung von Forschungsergebnissen noch nicht zur Regel geworden. Die meisten Forscher fühlen sich nach wie vor verpflichtet, die Wahrheit über die Wirkung neuer Substanzen herauszufinden, wie auch immer sie aussieht. Aber sowenig man an ihren Motiven zweifeln darf, so berechtigt ist doch die Empörung über ihren Dilettantismus. Um es geradeheraus zu sagen: Viele Forscher begreifen die Methoden nicht, mit denen sie zu ihren Ergebnissen gelangen.
In meiner Analyse aller in einem Jahrgang der führenden Zeitschrift «Nature» erschienenen Aufsätze fand ich heraus, dass 20 Prozent der Autoren die statistischen Verfahren, die sie verwenden, nicht verstehen. Zu ganz ähnlichen Schlüssen kommt eine Studie der Universität Gerona in Spanien, die den beiden maßgeblichen Forschungszeitschriften «Nature» und «British Medical Journal» eine Unzahl statistischer Fehler nachweisen konnte.
Obschon die meisten dieser Fehler trivial waren, wurden mehrere Prozent doch als so gravierend eingeschätzt, dass sie die Forschungsergebnisse verfälscht haben könnten. Diese Erkenntnisse sorgten zu Recht für Empörung. Der «Economist» entrüstete sich über die «schlampige Statistik, die eine Schande für die Wissenschaft» sei.
Die Statistiker wiederum hat daran nur schockiert, dass andere Leute sich darüber aufregten. Hatten sie nicht schon seit Jahrzehnten die kläglichen statistischen Analysen moniert, mit denen Forscher selbst in den angesehensten Zeitschriften zu publizieren wagten?In der medizinischen Forschung spielen statistische Methoden eine entscheidende Rolle. Man verwendet sie, um abzuschätzen, wie groß ein klinischer Versuch angelegt werden muss, um die Wirksamkeit einer neuen Substanz zu erweisen, aber auch, um die Überzeugungskraft der Ergebnisse einzuschätzen. Zumindest sollte es so sein. In Wirklichkeit versuchen die meisten Forscher einfach so viele Probanden zu bekommen, wie ihr Budget zulässt, und hoffen, die Versuchsgruppe sei hinreichend groß, um eine echte Wirkung zu erkennen. Sobald die Daten vorliegen, jagt man sie durch eine Statistiksoftware und hofft, dass dabei wenigstens ein «statistisch signifikantes» Ergebnis herausspringe, das zur Veröffentlichung in einer bedeutenden Fachzeitschrift tauge.
[...]
Um es einfach auszudrücken: Die statistischen Methoden, die routinemäßig von den Forschern eingesetzt werden, lassen stets einen zentralen Faktor unberücksichtigt, der die Glaubwürdigkeit eines jeden Resultats beeinflusst: seine Plausibilität.
Wenn Wissenschafter die Ergebnisse einer klinischen Versuchsreihe zur Wirksamkeit eines neuen Medikaments auswerten, benutzen sie Computerprogramme, die ihnen sagen, ob der Anteil von Patienten, deren Zustand sich nach Einnahme der Substanz verbesserte, wesentlich höher sei als bei alternativen Behandlungsmethoden. Sind die Unterschiede gering, kann es sich um einen Zufall handeln. Ist der Unterschied jedoch groß genug, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Zufallsergebnisses, und das Resultat gilt als «statistisch signifikant».
Dafür steigt die Wahrscheinlichkeit, dass solche Resultate in wichtigen Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Aber die statistische Signifikanz sagt überhaupt nichts über die Plausibilität des behaupteten Zusammenhangs aus. Sie verstößt vielmehr grundsätzlich gegen eine elementare Maxime jeder Wissenschaft: Je außergewöhnlicher die Behauptung, desto aufwendiger muss die Beweisführung sein.
Es gibt verschiedene Methoden zur Berücksichtigung von Plausibilität, und wenn man diese Methoden auf die Ergebnisse klinischer Forschung anwendet, gelangt man zu erschütternden Erkenntnissen: Eine Vielzahl statistisch signifikanter Resultate erweisen sich als bedeutungslose Zufälle.
Dass es gefährlich ist, sich allein auf statistische Signifikanz zu verlassen, ist schon seit vielen Jahren bekannt. Dennoch entblöden sich selbst ernst zu nehmende medizinische Zeitschriften nicht, die abenteuerlichsten Behauptungen zu publizieren. Ein klassisches Beispiel erschien 2001 im «British Medical Journal». Es handelte sich um einen Aufsatz, der scheinbar zwingende Beweise für die medizinische Wirksamkeit von Gebeten erbrachte. Laut Studie stiegen die Heilungsaussichten in statistisch signifikantem Masse, wenn für die Patienten gebetet wurde - und sei es Jahre nachdem sie das Krankenhaus verlassen hatten! Das Ergebnis dieser Forschung legte nahe, dass Gebete auch rückwirkend helfen können, und prompt wurden Forderungen laut, unsere Vorstellungen über Zeit und Raum zu überdenken. In Wirklichkeit zeigt die Forschung nur, zu welch unsinnigen Schlüssen man kommt, wenn man bei der Auswertung neuer Daten ihre Plausibilität außer Acht lässt.
[...]
Allmählich beginnen die maßgeblichen medizinischen Zeitschriften die Gefahren zu erkennen, die sich durch die fehlerhafte Anwendung statistischer Methoden in die Forschung einschleichen. Dass sie bis heute nichts dagegen unternommen haben, ist ein Skandal. Und solange sich an ihrer Veröffentlichungspolitik nichts ändert, kann man nur jedem, der sich fragt, ob er brandneue, aber unwahrscheinliche Forschungsergebnisse ernst nehmen soll, nur raten: Vergiss es!
Robert Matthews ist Wissenschaftsjournalist und zurzeit Gastdozent an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Aston University, Birmingham.
Übersetzung: Robin Cackett, Berlin."
[Quelle: Robert Matthews. -- In: Statistik : zählen und gezählt werden. -- NZZ Folio : die Zeitschrift der Neuen Zürcher Zeitung. -- Januar 2006. -- S. 28 - 30]
Die heute fast allgemein akzeptierte Definition von Evidence-based Medicine — Evidenzbasierter Medizin (EbM) ist:
"Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research." "EbM ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. Die Praxis der EBM bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestmöglichen externen Evidenz aus systematischer Forschung." David L. Sackett ; William M. C. Rosenberg, J. A. Muir Gray, R. Brian Haynes, W. Scott Richardson: Evidence-based medicine: What it is and what it isn't. British Medical Journal. -- 312 (1996). -- S. 71-72. -- http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/312/7023/71. -- Zugriff am 2005-12-28 Deutsche Übersetzung: David L. Sackett ; William M. C. Rosenberg, J. A. Muir Gray, R. Brian Haynes, W. Scott Richardson: Was ist Evidenzbasierte Medizin und was nicht?. -- . -- http://www.ebm-netzwerk.de/grundlagen/grundlagen/definitionen. -- Zugriff am 2005-12-28
Die deutsche Übersetzung des Begriffs mit "Evidenzbasierte Medizin" ist irreführend, "Beweisbasierte Medizin" wäre besser, doch hat sich die irreführende Übersetzung durchgesetzt und wird darum auch hier verwendet.
Inhaltlich versteht man unter Evidenzbasierter Medizin:
"Unter Evidenz-basierter Medizin (EbM) oder evidenzbasierter Praxis im engeren Sinne versteht man eine Vorgehensweise des medizinischen Handelns, individuelle Patienten auf der Basis der besten zur Verfügung stehenden Daten zu versorgen. Diese Technik umfasst
- die systematische Suche nach der relevanten Evidenz in der medizinischen Literatur für ein konkretes klinisches Problem,
- die kritische Beurteilung der Validität der Evidenz nach klinisch-epidemiologischen Gesichtspunkten;
- die Bewertung der Größe des beobachteten Effekts sowie
- die Anwendung dieser Evidenz auf den konkreten Patienten mit Hilfe der klinischen Erfahrung und der Vorstellungen der Patienten.
Die EbM ist ein Paradigmenwechsel in der Medizin und beruht auf der Anwendung wissenschaftlicher Methoden, die das ganze Spektrum medizinischer Tätigkeit beinhalten und auch lang etablierte medizinische Traditionen, die noch nie systematisch hinterfragt wurden, kritisch werten."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Evidence-Based_Medicine. -- Zugriff am 2005-12-28]
"Die Idee der evidenzbasierten Medizin lässt sich auf das in der 2. Hälfte des im 18. Jahrhundert von britischen Ärzten entwickelte Konzept der "medical arithmetic" zurückführen (William Black: Arithmetic and Medical Analysis of the Diseases and Mortality of the Human Species, London 1789). [Dieser Titel lässt sich bibliographisch nicht verifizieren, gemeint ist wohl: Black, William: A comparative view of the mortality of the human species, at all ages; and of the diseases and casualties by which they are destroyed or annoyed, etc. -- London : C. Dilly, 1788. -- XVI, 430 S. ; 8º.]
Erstmalig findet sich die Bezeichnung in dem 1793 publizierten Artikel "An attempt to improve the Evidence of Medicine" des schottischen Arztes George Fordyce (zitiert bei U. Tröhler: To Improve the Evidence of Medicine. The 18th Century British Origins of a Critical Approach. Edinburgh, Royal College of Physicians of Edinburgh).
[Tröhler, Ulrich <1943 - >: To improve the evidence of medicine : the 18th century British origins of a critical approach. -- Edinburgh : Royal College of Physicians of Edinburgh, ©2000. -- XI, 147 S. : Ill. ; 25 cm. -- ISBN 0854050566]
[...]
Das 1972 erschienene Buch "Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services" von Professor Archie Cochrane [1909 - 1988], einem britischen Epidemiologen, markiert den Beginn der aktuellen internationalen Bemühungen um "Evidence-based Medicine". Seine weiteren Arbeiten führten zu einer zunehmenden Akzeptanz von klinischer Epidemiologie und kontrollierten Studien. Cochrane wurde dadurch gewürdigt, dass ein internationales Netzwerk zur Wirksamkeitsbewertung in der Medizin - die Cochrane Collaboration [siehe unten!] - nach ihm benannt wurde.
Abb.: Einbandtitel
[Bildquelle: http://www.caerdydd.ac.uk/schoolsanddivisions/divisions/insrv/libraryservices/research/
milestonesinwelshmedicine/timeline1951-1980.htm. -- Zugriff am 2005-12-29][Cochrane, A. L. (Archibald Leman) <1909 - 1988>: Effectiveness and efficiency: random reflections on health services. -- [London] : Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1972. -- XI, 92 S. : Ill. ; 23 cm. -- (The Rock Carling Fellowship ; 1971). -- ISBN 0900574178]
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Evidence-Based_Medicine. -- Zugriff am 2005-12-28]
Abb.: Professor Archibald Leman Cochrane, CBE FRCP FFCM, (1909 - 1988), Begründer der Evidence-based Medicine
[Bildquelle: http://www.cochrane.org/docs/archieco.htm. -- Zugriff am 2005-12-28]"Archibald Leman Cochrane wurde 1909 im schottischen Kirklands, Galashiels, geboren. Er absolvierte das King's College in Cambridge mit einem Master in Science (1930) und einem Master of Arts (1934). Von 1933 an widmete er sich dem Studium der Psychoanalyse in Berlin, Wien und Den Haag und unterzog sich auch selbst einer Analyse bei einem Schüler Sigmund Freuds, Theodor Reik. 1934 begann er dann seine medizinische Ausbildung am University College Hospital in London.
Er unterbrach sein Studium beim Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs, schloss sich 1935 der freiwilligen 'Spanish Medical Aid Committee's Field Ambulance Unit' an und erlebte als Sanitäter die Belagerung von Madrid und die Schlachten von Jarama und Brunete.
Zurückgekehrt, qualifizierte er sich 1938 als Arzt und arbeitete am West London Hospital, später als wissenschaftlicher Assistent am University College.
1940 bis 1945 diente er im 2. Weltkrieg als Captain im Royal Army Medical Corps. 1941 geriet er dabei auf Kreta in deutsche Gefangenschaft und erlebte seine Zeit als Kriegsgefangener in den Lagern von Thessaloniki, Hildburghausen, Elsterhorst und Wittenberg-am-Elbe - immer im Einsatz als 'medical officer' für seine Mitgefangenen.
1946 schloss er dank eines Stipendiums sein Diplom in Epidemiologie an der London School of Hygiene & Tropical Medicine ab. Dort arbeitere er mit Austin Bradford Hill, einem der Entwickler der randomisierten, kontrollierten Studie.
Bei einem Forschungsaufenthalt in den Vereinigten Staaten (1947-48) wandte sich sein Interesse den Problemen der Röntgendiagnostik von Lungentuberkulose und deren epidemiologischen Implikationen zu. Er wurde Mitglied einer Forschungseinheit des Medical Research Council in Cardiff (1949 - 1959), die sich mit dem Krankheitsbild der Staublunge bei Bergarbeitern befasste. Pioniercharakter hatte die von ihm betreute epidemiologische Studie 'Rhonda Fach Scheme' - eine Untersuchung der Thoraxerkrankungen in der Bevölkerung zweier walisischer Bergabeiter Gemeinden. Hier zeichnete sich Cochranes weiteres Interesse ab: die Förderung der Durchführung und Anwendung von randomisierten klinischen Studien, die Bewertung von Screening Massnahmen und Versorgungsforschung.
1960 - 1969 hatte Archie Cochrane die 'David Davies' Professur für Tuberkulose und Thoraxerkrankungen an der Welsh School of Medicine in Cardiff inne, 1969 wurde er Direktor der Abteilung Epidemiolgie des Medical Research Council.
1972 publizierte er die weithin beachtete Rock Carling Lecture "Effectiveness and Efficiency", die die internationale Debatte auslöste, aus der heraus die Methoden der Evidenzbasierten Medizin wie auch die Cochrane Collaboration enstanden.
1972 - 1975 war Archie Cochrane der erste Präsident der Faculty of Community Medicine of the Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom.
1974 zog er sich, vielfach mit akademischen Würden ausgezeichnet, aus dem Berufsleben zurück, blieb dem Medical Research Council aber verbunden. Er vervollständigte die Verlaufsstudien (20 Jahre und 30 Jahre) des Rhonda Fach Scheme und hielt die Dunham Vorlesung in Harvard, USA - eine der höchsten Auszeichnungen, die einem nicht US-Bürger gewährt wurde.
1988 starb Archibald Leman Cochrane in Dorset im Alter von 79 Jahren.
Posthum veröffentlich ein Freund, Max Blythe, 1989 Cochrane's Autobiographie 'One Man's Medicine', die er von 1985 - 1988 in Zusammenarbeit mit Cochrane zusammengestellt hatte. Archibald Leman Cochrane bedachte in seinem Nachlass das Green College, Oxford, mit 300.000 Pfund. Er verband dies mit dem Wunsch, die Summe im Forschungsbereich der randomisierten, klinischen Studie einzusetzen. "
[Quelle: http://www.cochrane.de/de/Biographie_Archie_Cochrane.htm. -- Zugriff am 2006-01-01]

Abb.: ®Logo
1993 wurde die Cochrane Collaboration (CC) gegründet. Webpräsenz: http://www.cochrane.org/. -- Zugriff am 2006-01-01
In Deutschland ist die Cochrane Collaboration durch Das Deutsche Cochrane Zentrum (DCZ) am Universitätsklinikum Freiburg i. Br. vertreten. Webpräsenz: http://www.cochrane.de/. -- Zugriff am 2006-01-01
"Arbeitsgebiet & Ziele der CC Die Cochrane Collaboration (CC) ist eine internationale gemeinnützige Organisationmit dem Ziel, aktuelle Informationen und Evidenz zu therapeutischen Fragen allgemein verfügbar zu machen, um Medizinern Entscheidungen zu erleichtern und Patienten aufzuklären. Dies wird vor allem durch die Erstellung, Aktualisierung und Verbreitung systematischer Übersichtsarbeiten ("systematic reviews") erreicht. Die Cochrane Collaboration wurde 1993 gegründet und nach dem britischen Epidemiologen Sir Archibald Leman Cochrane benannt.
Das wichtigste Produkt der Collaboration ist die Datenbank systematischer Übersichtsarbeiten, die "Cochrane Database of Systematic Reviews", welche vierteljährlich als Teil der Cochrane Library publiziert wird.
Die systematischen Übersichtsarbeiten werden von den z.Zt. 50 international besetzten Cochrane Review Groups (CRG) erstellt und aktualisiert. Die Mitglieder dieser Gruppen - Forscher, Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Ärzte, Patienten u.a. - haben ein gemeinsames Interesse daran, verlässliche und aktuelle Erkenntnisse zusammenzufassen, die relevant sind im Hinblick auf Prävention, Behandlung und Rehabilitation bestimmter Gesundheitsprobleme oder Problemgebiete. Editorial Teams (Redaktionsteams) der CRGs koordinieren die Erstellung und Aktualisierung der Reviews und achten darauf, dass alle Arbeiten nach den hohen Qualitätsstandards der Cochrane Collaboration durchgeführt werden. Experten verbessern die Methodik, nach denen Cochrane Reviews erstellt werden; andere Mitarbeiter ergänzen wichtige Aspekte und Perspektiven für Verbraucher (Patienten). Unsere Webseiten informieren über die Verschiedenen Rollen und über die Möglichkeiten, Mitarbeit einzubringen.
Die Aktivitäten der Collaboration werden von einer demokratisch gewählten Steering Group geleitet und von den Mitarbeitern der weltweit vertretenen Cochrane Entitäten (Zentren, Review Groups, Methods Groups, Fields/Networks) unterstützt.
Das Cochrane Manual [http://www.cochrane.org/admin/manual.htm. -- Zugriff am 2006-01-01] enthält alle Grundsätze der Cochrane Collaboration, Zuständigkeitsbereiche der verschiedenen Gruppen (Entities), etc."
Die Cochrane Collaboration unterhält die Cochrane Library, eine Datenbank systematischer Übersichtsarbeiten. Die Volltexte sind kostenpflichtig. Abstracts können kostenlos durchsucht werden. Webzugang zu den Abstracts: http://www.cochrane.de/de/browse.htm. -- Zugriff am 2006-01-01
Beispiel eines Cochrane-Abstract:
"From The Cochrane Library, Issue 2, 2005. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. All rights reserved. Medical treatments for the maintenance therapy of reflux oesophagitis and endoscopic negative reflux disease (Cochrane Review)
Donnellan C, Sharma N, Preston C, Moayyedi P
ABSTRACT
A substantive amendment to this systematic review was last made on 04 August 2004. Cochrane reviews are regularly checked and updated if necessary.
Background: Gastro-oesophageal reflux disease (GORD) - reflux of stomach contents +/- bile into the oesophagus causing symptoms such as heartburn and acid reflux - is a common relapsing and remitting disease which often requires long-term maintenance therapy. Patients with GORD may have oesophagitis (inflammation of the oesophagus) or a normal endoscopy (endoscopy negative reflux disease or ENRD).
Objectives: To assess the effects of continuous maintenance therapy in adults with GORD (both ENRD and healed oesophagitis).
Search strategy: We searched Cochrane Central Register of Controlled Trials (The Cochrane Library Issue 2, 2003), MEDLINE (1966 to 2003), EMBASE (1980 to 2003), CINAHL (1982-2003), and the National Research Register (Issue 2, 2003) and reference lists of articles. We also contacted manufacturers and researchers in the field.
Selection criteria: Randomised controlled studies comparing PPIs, H2RAs, prokinetics, sucralfate and combinations either in comparison to another treatment regimen or to placebo in adults with reflux oesophagitis and ENRD.
Data collection and analysis: One author extracted data from included trials and a second author carried out an unblinded check. Two authors independently assessed trial quality. Study authors were contacted for additional information.
Main results: Maintenance of patients with healed oesophagitis: For a healing dose of PPI (generally the standard dose given by the manufacturer) versus placebo, the relative risk (RR) for oesophagitis relapse was 0.26 (95% confidence interval (CI) 0.19 to 0.36); versus H2RAs the RR was 0.36 (95% CI 0.28 to 0.46) and versus maintenance PPIs the RR was 0.63 (95% CI 0.55 to 0.73). However overall adverse effects were also more common and headaches were more common when comparing healing PPIs to H2RAs.For a maintenance dose of PPI (half of the standard dose) versus placebo, the RR for oesophagitis relapse was 0.46 (95% CI 0.38 to 0.57) and versus H2RAs the RR was 0.57 (95% CI 0.47 to 0.69). Overall adverse effects were more common. H2RAs were of marginal help but beneficial for symptomatic relief. Prokinetics and sucralfate were also more effective than placebo. For ENRD patients: Limited data with one RCT showed benefit for omeprazole 10 mg once daily over placebo (RR 0.4; 95% CI 0.29 to 0.53).
Authors' conclusions: The findings in this review support the long-term treatment of oesophagitis to prevent relapse, both endoscopically and symptomatically. Healing doses of PPIs are more effective than all other therapies, although there is an increase in overall adverse effects compared to placebo, and headache occurrence compared to H2RAs. H2RAs prevent relapse more effectively than placebo, demonstrating a role for PPI-intolerant patients. Prokinetics and sucralfate both show benefit over placebo, but the former is no longer licenced. There is only limited data for ENRD.
Citation: Donnellan C, Sharma N, Preston C, Moayyedi P. Medical treatments for the maintenance therapy of reflux oesophagitis and endoscopic negative reflux disease. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD003245.pub2. DOI: 10.1002/14651858.CD003245.pub2.
This is an abstract of a regularly updated, systematic review prepared and maintained by the Cochrane Collaboration. The full text of the review is available in The Cochrane Library (ISSN 1465-1858)."[Quelle: http://www.cochrane.org/cochrane/revabstr/AB003245.htm. -- Zugriff am 2006-01-01]
Gründe für die verbreitete Beschäftigung mit Evidenzbasierter Medizin sind:
Dieser Problematik suchte man beizukommen
Außerdem gibt man sich der Vision (oder Illusion?) hin, durch eine entsprechend normierte internationale Kooperation könne man in internationaler Arbeitsteilung, mit allgemein akzeptierten Methoden nachprüfbar einen wissenschaftlich jeweils allgemein akzeptierten Kanon medizinischen Wissens erarbeiten.
Von Seiten der Gesundheitspolitik erwartet man, durch Durchsetzung einer - letztendlich - Kochbuchmedizin ("lege artis") die Gesundheitsversorgung
zu machen.
Wesentlich zur Verbreitung Evidenzbasierter Medizin im deutschsprachigen Raum beigetragen hat das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin DNEbM e.V. Im Februar 2005 hatte der Verein über 600 Mitglieder.
Webpräsenz: http://www.ebm-netzwerk.de/. -- Zugriff am 2005-12-29
"Vorstellung des Netzwerkes "Evidenzbasierte Medizin" (EbM) Als prioritäre Zielsetzungen des Netzwerkes wurden auf dem ersten Gründungstreffen identifiziert:
- die Integration der Mitglieder des Netzwerkes und der sie tragenden wissenschaftlichen Disziplinen und Arbeitsbereiche
- der Aufbau einer offenen Informations- und Kommunikationsplattform
- die Entwicklung von Aus-, Weiter- und Fortbildungscurricula und -modellen
- die Abstimmung laufender EbM-bezogener Forschung, Ausbildung und Praxis
- die Durchführung von Evaluations- und Forschungsprojekten
- die Weiterentwicklung von Theorie, Methoden und Ethik der EBM
Am 6. Oktober 2000 wurde in Berlin das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin gegründet. Das Netzwerk versteht sich als interdisziplinäres und multiprofessionelles Forum aller an dieser Thematik Interessierten.
Die Ziele des Vereins sind:
- Bündelung aller Aktivitäten, die sich im deutschsprachigen Raum mit "Evidenzbasierter Medizin bzw. "Evidenz-basierter Gesundheitsversorgung" beschäftigen.
- Förderung wissenschaftlicher und klinischer Tätigkeiten
- Durchführung des Jahreskongresses
- Durchführung von "train-the-trainer"-Seminaren auf dem Gebiet der Anwendung evidenzbasierter Medizin
- Durchführung von Lehrkonferenzen und Workshops"
[Quelle: http://www.ebm-netzwerk.de/wir_ueber_uns/index_html. -- Zugriff am 2005-12-29]
Unter anderem durch Bücher wie

Abb.: Einbandtitel
Evidenzbasierte Therapie-Leitlinien / hrsg. von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. -- 2., überarb. und erw. Aufl.Verleger: Köln : Dt. Ärzte-Verl., 2004. -- 469 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm. -- ISBN: 3-7691-0446-3. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
oder
Abb.: EinbandtitelKompendium evidenzbasierte Medizin = Clinical evidence concise / Günter Ollenschläger ... (Hrsg.). Aus dem Engl. von Michael Herrmann und Katja Stahl. -- 4. Aufl. -- Bern [u.a.] : Huber, 2005. -- XXXVIII, 1000 S. ; 22 cm. -- Originaltitel: Clinical evidence concise (2005). -- ISBN 3-456-84193-0. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
versucht Evidenzbasierte Medizin, Eingang in die medizinische Praxis zu finden.
Eine knappe, empfehlenswerte Einführung ist:

Abb.: Einbandtitel
Evidenz-basierte Medizin : Praxis-Handbuch für Verständnis und Anwendung der EBM ; 42 Tabellen / hrsg. von Gerd Antes ... Mit Beitr. von G. Antes ... [Zeichn.: Günther Bosch. In Zsarb. mit dem Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (DNEbM) und dem Deutschen Cochrane Centrum]. -- Stuttgart [u.a] : Thieme, 2003. -- IX, 145 S. : graph. Darst. ; 24 cm. -- ISBN 3-13-135681-2. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}.
Matthias Schrappe und Karl W. Lauterbach schlagen auf der Grundlage eines älteren Vorschlags von F. M. Laforce (1987) und eines neueren der Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) (von C. M. Clancy, 1997) ein kombiniertes Ration für Therapiestudien vor, das an den Kölner Universitätskliniken Verwendung findet:
Wertung der wissenschaftlichen Absicherung von Empfehlungen zu Diagnostik und Therapie: Evidence-based Medicine als Instrument des Qualitatsmanagements Categories for strength of each recommendation (LaForce 1987) key category A good evidence to support a recommendation for use B moderate evidence to support a recommendation for use C poor evidence to support a recommendation for or against D moderate evidence to support a recommendation against use E good evidence to support a recommendation against use AHCPR-Categories for quality of evidence on which recommendations are made (Clancy 1997) key type of evidence Ia evidence obtained from meta-analysis of randomized controlled trials Ib evidence obtained from at least one randomized controlled trial IIa evidence obtained from at least one well-designed controlled study without randomization IIb evidence obtained from at least one other type of well-designed quasi-experimental study III evidence obtained from well-designed non-experimental studies (comparative, correlation or case studies) IV evidence obtained from expert committee reports or opinions and/or clinical experiences of respected authors
[Quelle der Tabelle: Schrappe, Matthias <1955 - > : Lauterbach, Karl W. <1963 - >: Evidence-based Medicine : Einführung und Begründung. -- In: Gesundheitsökonomie, Qualitätsmanagement und evidence based medicine : eine systematische Einführung ; mit 99 Tabellen / hrsg. von Karl W. Lauterbach ; Matthias Schrappe. -- 2., überarb. und erw. Aufl. -- Stuttgart : Schattauer, 2004. -- XVI, 573 S. : Ill., graph. Darst. ; 25 cm -- ISBN 3-7945-2287-7. -- S. 60 - 69; dort S. 67. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Wenn es darum geht, bakterielle Infektionen mit Antibiotika, schwere allergische Reaktionen mit Antiallergika (auch Kortison) oder einen Zuckerkranken mit einer Insulintherapie zu behandeln, fragt heutzutage kaum jemand nach randomisierten Vergleichsstudien. Die Unterschiede zwischen behandelten Patienten und solchen ohne Behandlung sind zu augenfällig. In der heutigen Zeit sind die Ergebnisunterschiede von vergleichbaren Therapien meistens eher klein bis marginal, so dass bessere Studien konzipiert werden müssen, um relevante Unterschiede aufzeigen zu können. Neue Medikamente bringen jeweils nur einen geringfügig größeren Nutzen – bei jedoch nicht selten deutlich höheren Preisen. Diese Beobachtungen passen gut in ein neues Zeitalter des medizinischen «Grenznutzens», bei dem vermehrter Aufwand keinen entsprechend vermehrten Nutzen mit sich bringt. EBM ist der medizinischen Nutzenforschung zuzuordnen mit besonderem Augenmerk auf dem Patientennutzen. In einfachen Worten formuliert, bedeutet EBM eigentlich nichts anderes, als dass man versucht, die über Jahre gültigen Abklärungsmöglichkeiten und Therapieschemata bezüglich Nutzen (längeres Überleben, niedrigere Krankheitshäufigkeit bei chronisch Kranken, bessere Lebensqualität u.a.m.) für den Patienten zu überprüfen.
Der Nutzen der evidenzbasierten Medizin
Ein ausgezeichnetes Beispiel für den Patientennutzen in der EBM ist mit Sicherheit die viele Jahre mit Überzeugung durchgeführte Operation/Rekonstruktion der Bänder im Sprunggelenk nach einem Bänderriss. Als eine evidenzbasierte Studie durchgeführt und die Therapie (Rekonstruktion der Bänder mittels Operation) überprüft wurde, indem man zwei vergleichbare Patientengruppen bildete und die erste Gruppe operierte und die zweite nur konservativ (keine Operation) behandelte, konnte zwischen den beiden Gruppen bezüglich Resultat kein Unterschied festgestellt werden. Die Patientengruppe, welche keine Rekonstruktion der Bänder erfuhr, erlitt bezüglich Schmerzen oder Bewegungseinschränkung keine Nachteile.
Das gesamte medizinische Wissen verdoppelt sich derzeit alle fünf Jahre, wobei einzelne Fachgebiete eine sehr viel stärkere Dynamik aufweisen. Bei der Fülle des be- und entstehenden Wissens ist der einzelne Arzt zunehmend überfordert, das für ihn Bedeutsame zu bestimmen. Die EBM setzt sich das Ziel, die Qualität der veröffentlichten medizinischen Daten zu bewerten und damit auch zu verbessern. Dadurch dient EBM dem Patienten, dem einzelnen Arzt, der einzelnen Forschungseinrichtung und dem Gesundheitswesen. Allerdings ist die EBM selbst noch eine junge Wissenschaft, die sich ebenfalls weiterentwickeln wird. Dennoch bildet sie das Kernstück der Fähigkeit, medizinische Daten zu interpretieren.
Obwohl die Ärzteschaft bezüglich EBM noch gespalten ist, gibt es immer mehr Ärzte, welche ein Umdenken befürworten und von lokalen Traditionen der Krankenbehandlung zu den gesicherten statistischen Fakten der EBM übergehen.
[...]
Um auf die etwas provokativ formulierte Frage im Titel zurückzukommen: EBM ist weder eine neue Religion, noch bietet sie Antworten auf alle Fragen in der Medizin an. EBM ist aber einerseits ein gutes Hilfsmittel, um die Qualität in der medizinischen Diagnostik und Therapie zu verbessern, und andererseits könnte die EBM mithelfen, die Kosten im Gesundheitswesen zumindest zu dämpfen."
[Quelle: Dr. med. Dario Fontanel <Oberarzt, Medizinische Klinik, Kantonsspital Winterthur>: Evidenzbasierte Medizin (EBM) – eine neue Religion oder gar die Anwort auf alle Fragen in der Medizin?. -- http://www.ksw.ch/mederkl_evidenzmed.htm. -- Zugriff am 2005-12-28]
Das Verfasserkollektiv des Artikels in der deutschen Wikipedia fasst die Kritikpunkte an Evidenzbasierter Medizin so zusammen:
"Kritik an der evidenzbasierten Medizin Die wesentlichen Argumente der Kritiker sind folgende:
- Ärzte haben sich "ohnehin schon immer" wie gefordert verhalten.
- Eine gute Beweisführung ist in vielen Bereichen der Medizin nicht durchführbar oder zu umständlich. Fast alle ärztlichen Handlungen, die komplett unstrittig sind, sind nicht evidenzbasiert und werden es nie sein.
- Fehlen von bewiesenem Nutzen und Fehlen von Nutzen sind nicht das Gleiche. So helfen zum Beispiel Umschläge mit "essigsaurer Tonerde" als Hausmittel gegen Fieber, obwohl diese noch keinem Doppelblindversuch unterworfen wurden.
- Je mehr Daten in großen Studien zusammen gezogen werden, um so schwieriger wird es, den Durchschnittspatienten der Studie mit dem Patienten zu vergleichen, der - im Hier und Jetzt - vor seinem Arzt sitzt.
- Kausalitäten können lange ungeklärt bleiben. Statistisch kann man oft nur von Korrelationen sprechen, manchmal von gesicherten Zusammenhängen. Aus anderen als statischen Zusammenhängen (etwa Zellversuche, Tierversuche) kann man manchmal auf eine sichere Kausalität schließen (beispielsweise bei vielen Infektionskrankheiten).
- Weiter werden Trugschlüsse bei den Endpunkten (Surrogat-Marker) von medizinischen Studien diskutiert.
- EBM wird von manchen (Medizin-)Statistikern mit folgender Argumentation kritisiert: So sind Studien mit einer großen Anzahl nicht ohne weiteres auf einen speziellen Einzelfall anwendbar. Große Zahlen liefern ein statistisch gesehen genaues Ergebnis, von dem man nicht weiß, auf wen es zutrifft. Kleine Zahlen liefern ein statistisch gesehen unbrauchbares Ergebnis, von dem man aber besser weiß, auf wen es zutrifft. Schwer zu entscheiden, welche dieser Arten von Unwissen die nutzlosere ist. (Beck-Bornholdt, Dubben 2003).
Abb.: Einbandtitel["«Liebe Bettina, euer Goldstandard erscheint mir wirklich etwas närrisch. Wie Thomas in Kapitel 17 festgestellt hat, sind Studien und Statistik ohnehin überflüssig, wenn die Experten so gut sind, wie sie glauben. Die Evidenz-Blasierten wollen vernünftige Studien und zu diesem Zweck die Experten abschaffen, die aber zur vernünftigen Planung unerlässlich sind. Niemand kann garantieren, dass die Studien bei optimalen Dosen durchgeführt werden. Deshalb gelten die Ergebnisse nur für die verwendeten Dosen. Führt man eine kleine Studie durch, erhält man ein ungenaues Ergebnis für ein klar umschriebenes Problem. Führt man eine große Studie durch, ist das Ergebnis genau, aber man weiß nicht, wofür es gilt. Bitte sag mir doch: Was kann man mit medizinischen Studien machen?»
Abb.: Puerto Rico
[Bildquelle: NASA]«Karriere», antwortet Bettina nachdenklich. «Auf Kosten anderer nach Puerto Rico fahren. Sich wichtig vorkommen, solange man nicht hinter die Kulissen des faulen Zaubers geschaut hat. Und sich ziemlich schlecht fühlen, wenn man nicht mehr an das Studien-Voodoo glaubt. Ich fange an, Thomas zu verstehen, wenn er verkündet, er will eine Pommesbude aufmachen.»"
Quelle: Beck-Bornholdt, Hans-Peter<1950 - > ; Dubben, Hans-Hermann <1955 - >: Der Schein der Weisen : Irrtümer und Fehlurteile im täglichen Denken. -- Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. -- 270 S. : Ill., graph. Darst. ; 19 cm. -- (rororo ; 61450 : rororo science). -- ISBN 3-499-61450-2. -- S. 222. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
- EBM wird aus Karriere- und finanziellen Gründen stark vorangetrieben.
Abb.: Immer weiter, immer weiter auf der Karriereleiter!
(©MS Office)Bei allen vorhandenen Problemen hat sich die evidenzbasierte Medizin in folgendem Punkt als erfolgreich bewiesen: Von der Kanzel herab getätigte Äußerungen "medizinischer Experten" sind mehr als bisher hinterfragbar geworden (eminenzbasierte Medizin). Ein Mindestmaß an überprüfbaren Belegen reicht nicht mehr aus, eine zunehmend skeptische Kollegenschaft zu beeindrucken. Behauptungen müssen durch Argumente ersetzt werden, die die einschlägige medizinische Literatur untermauern muss. Medizinisches Wissen ist mehr als bisher hinterfragbar geworden."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Evidence-Based_Medicine. -- Zugriff am 2005-12-28]
Eine Sicht aus dem anglo-amerikanischen Raum:
"Criticism of evidence-based medicine
- Critics of evidence-based medicine maintain that good evidence is often deficient in many areas, that lack of evidence and lack of benefit are not the same, and that the more data are pooled and aggregated, the more difficult it is to compare the patients in the studies with the patient in front of the doctor, i.e. EBM applies to populations, not necessarily to individuals. In The limits of evidence-based medicine, Tonelli argues that "the knowledge gained from clinical research does not directly answer the primary clinical question of what is best for the patient at hand." Tonelli suggests that proponents of evidence-based medicine discount the value of clinical experience.
- Although evidence-based medicine is quickly becoming the "gold standard" for clinical practice and treatment guidelines, there are a number of reasons why most current medical and surgical practices do not have a strong literature base supporting them.
- First, in some cases, conducting randomized controlled trials would be unethical--such as in open-heart surgery--although observational studies are designed to address these problems to some degree.
- Second, certain groups have been historically under-researched (women, racial minorities, people with many co-morbid diseases) and thus the literature is very sparse in areas that do not allow for generalizeability.
- Third, the types of trials considered 'gold standard' (i.e. randomized double-blind placebo-controlled trials) are very expensive and thus funding sources play a role in what gets investigated. For example, the government funds a large number of preventive medicine studies that endeavor to improve public health as a whole, while pharmaceutical companies fund studies intended to demonstrate the efficacy and safety of particular drugs.
- Fourth, the studies that are published in medical journals may not be representative of all the studies that are completed on a given topic (published and unpublished) or may be misleading due to conflicts of interest (i.e. publication bias). Thus the array of evidence available on particular therapies may not be well-represented in the literature.
- Fifth, there is an enormous range in the quality of studies performed, making it difficult to generalize about the results.
- Large randomized controlled trials are extraordinarly useful for examining discrete interventions for carefully defined medical conditions. The more complex the patient population, the conditions, and the intervention, the more difficult it is to separate the treatment effect from random variation. Because of this, a number of studies obtain insignificant results, either because there is insufficient power to show a difference, or because the groups are not well-enough 'controlled'.
- Evidence-based medicine has been most practised when the intervention tested is a drug. Applying the methods to other forms of treatment may be harder, particularly those requiring the active participation of the patient because blinding is more difficult.
- In managed healthcare systems evidence-based guidelines have been used as a basis for denying insurance coverage for some treatments some of which are held by the physicians involved to be effective, but of which randomized controlled trials have not yet been published."
[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine. -- Zugriff am 2005-12-28]
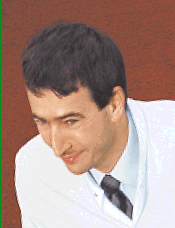
Abb.: Prof. Dr. med. Feraydoon Niroomand
[Bildvorlage:
http://www.evkmh.de/_pdf/punct_3_05.pdf. -- Zugriff am 2006-01-02]
Prof. Dr. med. Feraydoon Niroomand (geb. 1960), seit 2005 Chefarzt für Kardiologie am Ev. Kranken- und Versorgungshaus Mühlheim a. d. Ruhr, erläutert fachlich sehr fundiert erkenntnistheoretische, formallogische, ethische, statistische und technische Unzulänglichkeiten der Evidenzbasierten Medizin anhand von Beispielen aus der kardiovaskulären Medizin:
"Die Beschränkungen der EbM sind vielschichtig. Sie bestehen in erkenntnistheoretischen, formal logischen, ethischen, statistischen und technischen Unzulänglichkeiten . Diese sollen an Beispielen aus der kardiovaskulären Medizin erläutert werden. Erkenntnistheorie
Im Jahr 1927 zeigte der Physiker Werner Heisenberg in der nach ihm benannten Unschärferelation, dass zwei kanonische Messgrößen, deren Produkt die Wirkung ist, zum Beispiel der Ort und der Impuls eines Elementarteilchens, nicht gleichzeitig mit beliebiger Messgenauigkeit erfasst werden können. Mit einem ähnlichen Problem der Unvereinbarkeit in der Kenntnisgewinnung sind klinische Studien behaftet. Es ist prinzipiell nicht möglich, gleichzeitig Ergebnisse zur Wirkung eines Medikaments bei der Behandlung eines Krankheitsbildes und zur Behandlung individueller Patienten zu erzielen.
Das Problem liegt in der Definition der Einschlusskriterien. Sind diese offen und weit gefasst, wie beispielsweise in der ALLHAT-Studie (nomen est omen: ein Hut für alle) zur arteriellen Hypertonie, so kann man zwar ermitteln, welches Präparat statistisch am besten abschneidet, hat aber für den einzelnen Patienten kaum mehr als eine seichte Hilfestellung. Anschaulicher gesagt: Ein Radfahrer kann die Tour de France gewinnen, ohne bei einer einzigen Etappe (einem einzigen Patienten) Erster (das beste Präparat) gewesen zu sein. In den großen Studien versucht man, diesem Problem mit Subgruppen-Analysen zu begegnen, was in wenigen, besonders ausführlich untersuchten Fällen eine Annäherung an das Grundproblem bringen kann. In der Regel reicht aber die statistische Aussagefähigkeit („power“) nicht aus, um selbst große Unterschiede bei den Subgruppen zu diskriminieren. Da sich dann die Ergebnisse für die Subgruppen nicht signifikant vom Gesamtergebnis unterscheiden (können), wird impliziert, dass dieses auch für sie zutrifft. Durchaus legitim ist die Annahme, dass der Nutzen innerhalb einer Population nach vernünftigem Ermessen auch auf einzelne Patienten übertragen werden kann. Das vernünftige Ermessen leitet sich aus persönlicher und kommunizierter Erfahrung sowie dem physiologisch/pathophysiologischen Verständnis ab, von dem man manchmal den Eindruck gewinnt, es sei der Todfeind der EbM-Apologeten.
Das andere Extrem bilden Studien mit engen Einschlusskriterien. Ein Beispiel hierfür ist die erste MADIT-Studie zur Verhütung des plötzlichen Herztodes mit implantierbarem Defibrillator. Eingeschlossen wurden ausschließlich Patienten nach Herzinfarkt, mit einer deutlich verminderten Pumpfunktion des Herzens (linksventrikuläre Auswurffraktion unter 35 Prozent), einer komplexen ventrikulären Extrasystolie im Langzeit-EKG, Auslösbarkeit einer anhaltenden Kammertachykardie unter programmierter elektrischer Stimulation des Herzens und fehlendem Ansprechen der auszulösenden Tachykardie auf Medikamente. Hier sind die Patienten, die von der Behandlung profitieren, zwar relativ gut definiert, sie machen jedoch nur einen sehr kleinen Prozentsatz, etwa ein Prozent, der Postinfarktpatienten aus. Um die Analogie aus der Tour de France nochmals zu bemühen: Ein Fahrer kann zwar eine Etappe gewinnen, im Gesamtklassement (der weiter gefassten Patientenpopulation) aber auf den letzten Platz landen. Diese Beschränkung ist kein Problem des guten oder schlechten Studiendesigns, sondern eine unausweichliche Folge der Methode.
Im Allgemeinen ist der Patient in Herz-Kreislauf-Studien männlich, Kaukasier und zwischen 55 und 75 Jahren alt. Dagegen existieren überhaupt keine, wenige oder lediglich ignorierte Daten zu Frauen (circa 50 Prozent der Erdbevölkerung), Nicht-Kaukasiern (circa 90 Prozent der Weltbevölkerung), Alten (circa ein Drittel der Patienten in einer internistischen Klinik in Deutschland) und jungen Patienten (< 55 Jahre), die in der kardiovaskulären Medizin zwar relativ selten anzutreffen sind, die aber am längsten von der Behandlung profitieren könnten.
Die Einhaltung der EbM erfordert bei der Behandlung eines Patienten mit koronarer Herzkrankheit und Herzinsuffizienz eine Therapie mit Acetylsalizylsäure, einem Betablocker, einem ACE-Hemmer, einem Aldosteronantagonisten und einem Statin. Bereits dieses „Minimalprogramm“ lässt sich nicht in allen möglichen Kombinationen durchuntersuchen. Die vermeintliche Evidenz, dass diese Medikamente auch in Kombination ihren günstigen Effekt haben, basiert auf ihrer (teilweise) unterschiedlichen biologischen Wirkung und der zufälligen Abfolge der Studien.
So wurden Betablocker in Herzinsuffizienzstudien an Patienten untersucht, die bereits mit einem ACE-Hemmer behandelt waren; die Betablocker konnten dabei eine weitere Abnahme der Sterblichkeit dieser Patienten bewirken. Es ist damit aber nicht gesagt, dass Patienten, die einen Betablocker erhalten, auch von einem ACE-Hemmer profitieren. Für die genannte Medikamentenkombination, geschweige denn irgendeine Dosierung, gibt es keine Evidenz. Es ist eine stark vereinfachende und in Anbetracht der wenigen Untersuchungen zu diesem Thema zweifelhafte Annahme, dass die günstigen Wirkungen der einzelnen Therapien beliebig additiv sind.
Ethik
Andererseits ist es ethisch kaum zu vertreten, dass einem Patienten eine „erwiesenermaßen“ lebensverlängernde Therapie vorenthalten wird. Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist noch nicht in Sicht. Inzwischen sind selbst Dreifachkombinationen mit gleichem Angriffspunkt, zum Beispiel Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems mit ACE-Hemmer, AT1-Rezeptorantagonisten und Aldosteron-Antagonisten, zur Behandlung der Herzinsuffizienz in Erprobung. Es ist nach den neuesten Untersuchungen nicht unwahrscheinlich, dass auf Grundlage der Evidenzbasierten Medizin das „Minimalprogramm“ für Patienten mit koronarer Herzkrankheit und Herzinsuffizienz demnächst aus Betablocker, Statin, ACE-Hemmer, AT1-Rezeptorblocker, Aldosteronantagonisten, Aspirin, Clopidogrel und/oder oralem Thrombin-Inhibitor bestehen wird.
Eine Studie hat eine umso größere Chance, mit relativ wenigen Patienten in relativ kurzer Zeit zu einem positiven Ergebnis zu führen, je häufiger der Endpunkt, im „Idealfall“ das Sterben des Patienten, eintritt. Eine Analyse aller Studien zur Sekundärprävention des plötzlichen Herztodes mittels implantierbarem Defibrillator hat gezeigt, dass ausschließlich Patienten mit einer hochgradig eingeschränkten Pumpfunktion des Herzens, insbesondere im hohen Lebensalter und bei hochgradiger Einschränkung ihrer körperlichen Belastbarkeit, von der Implantation des Defibrillators profitieren. Die keinesfalls übertriebene Schlussfolgerung der EbM hieraus müsste lauten, dass man alte Menschen, die bereits bei der Verrichtung ihrer einfachen täglichen Bedürfnisse Atemnot verspüren, mit dieser sehr kosten- und ressourcenintensiven Therapie versorgen soll, diese andererseits einem jungen, weitgehend gesunden Menschen, der ein substanzielles Risiko hat, am nächsten Morgen plötzlich tot umzufallen, aber vorenthalten darf (und vielleicht bald muss).
Eine Behandlung schwerstkranker Patienten, die sich aus vielen Studien nach EbM ableiten lässt, hat neben der manchmal unmenschlichen auch eine unterschätzte finanzielle Seite. Bei der Berechnung der Kosten je gewonnenem Überlebenszeitraum werden lediglich die unmittelbar aus der untersuchten Behandlung resultierenden Kosten gewertet. Dies müsste hinterfragt werden, denn bei der Berechnung sollten sämtliche Behandlungskosten dieser Patienten für den gewonnenen Lebenszeitraum zugrunde gelegt werden. Die Implantation eines Defibrillators nach den Kriterien der EbM verhindert vielleicht den plötzlichen Herztod durch eine Herzrhythmusstörung zugunsten eines Siechtums auf einer kardiologischen Intensivstation. Angesichts der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Ausgaben für die medizinische Versorgung auf die beiden letzten Lebensjahre entfallen, sollte es ein Anliegen sein, bei den Kostenberechnungen die real anfallenden Gesamtkosten zu ermitteln und eine Betrachtung der Lebensqualität in den gewonnenen Lebenszeitraum mit einzubeziehen. Dies darf nicht dahingehend fehlinterpretiert werden, dass man Alten und Schwerkranken keine optimale Behandlung zukommen lassen soll. Es zeigt stattdessen, dass viele therapierelevante Faktoren vorliegen können, die in die Ergebnisse der EbM nicht einfließen und die deshalb leider immer häufiger ignoriert werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass man vor lauter „Evidenz“ die Wünsche des Patienten nicht nur übersieht, sondern gar nicht erst aufkommen lässt.
Das zweite Problem mit der Ethik zielt in die entgegengesetzte Richtung. Es besteht darin, dass die Kunst differenzierten ärztlichen Handelns zunehmend durch gleichgeschaltete Behandlungsmethoden an immer größeren und heterogeneren Patientenpopulationen ersetzt wird. Ist die Zahl der Untersuchten groß genug und die Behandlung mit einem relativ geringen Risiko verbunden, so kann das Ergebnis für das gesamte Kollektiv „signifikant“ positiv ausfallen, obwohl nur ein geringer Anteil der Behandelten tatsächlich profitiert. Das Ausmaß des präventiven Nutzens wird dabei beschönigend dargestellt, indem die eigentlich irrelevante, aber zahlenmäßig beeindruckendere relative Risikoreduktion in den Vordergrund gerückt wird. Für die eigentlich relevante Zahl der erforderlichen Behandlungen, um ein Ereignis zu verhindern („number needed to treat“), gelten derzeit Größenordnungen von 100 bis 200 noch als seriös. Kaum diskutiert wurde bislang das ethische Problem, wie vielen Menschen man eine Medikation zumuten darf, die ihnen gar nichts nützt, um einem aus dieser Gruppe zu helfen.
Aufgrund des geringen Risikos im Gesamtkollektiv zeigen diese Studien in der Regel keine Reduktion für schwerwiegende Endpunkte durch das untersuchte Medikament. Deshalb werden kombinierte Endpunkte gewählt, die so unterschiedliche Ereignisse wie Mortalität und Zahl der Krankenhausaufnahmen vermischen, womit dann suggeriert wird, dass ein Präparat auch die Mortalität im untersuchten Kollektiv günstig beeinflusst. Um bei einer ökonomischen Betrachtung etwaigen Illusionen vorzubeugen: Es gibt kaum etwas Teureres im Gesundheitswesen als die mit einer medizinischen Maßnahme verbundene Primärprävention bei nur leicht Erkrankten oder gar Gesunden, und auch für diesen Bereich wird die EbM nach Kräften missbraucht.
Statistik
In den von John Canton postum veröffentlichten Schriften des englischen Pastors und Mathematikers Thomas Bayes wird erstmals dargelegt, dass die Wahrscheinlichkeit für die richtige Vorhersage eines statistischen Tests von der A-priori-Wahrscheinlichkeit der Testvorhersage abhängig ist. Beispiel: Ein 65-jähriger Patient mit langjährigem schwerem Nikotinabusus, Diabetes mellitus, arterieller Hypertonie und einer Hypercholesterinämie zeigt im Belastungs-EKG horizontale ST-Streckensenkungen in zwei konsekutiven Brustwandableitungen. Am gleichen Tag zeigt das Belastungs-EKG einer 35-jährigen Frau mit atypischen pektanginösen Beschwerden und einer positiven Familienanamnese, sonst aber fehlenden Risikofaktoren, die gleichen Veränderungen wie ihr männlicher Kollege zuvor. Obwohl der gleiche Test in diesem Fall ein identisches Ergebnis liefert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass im ersten Fall tatsächlich eine koronare Herzerkrankung vorliegt, ungleich größer. Dieser grundlegende Tatbestand wird bei der Beurteilung von Studienergebnissen gänzlich ignoriert. Ein Grund hierfür besteht vor allem darin, dass die A-priori-Wahrscheinlichkeit (pretest probability) für die Studienhypothese kaum zu ermitteln ist. Sie kann allenfalls grob abgeschätzt werden. Aber nur dann lässt sich überhaupt aussagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine neue Behandlung im Falle eines positiven Studienergebnisses besser ist. Wenn man beispielsweise eine A-priori-Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent veranschlagt, liegt die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Überlegenheit eines positiv getesteten Präparats aus einer Studie mit einer „power“ von 80 Prozent und einem Signifikanzniveau von fünf Prozent (den heute üblichen Standards für ein signifikantes Studienergebnis), lediglich bei 78 Prozent und nicht, wie man meinen könnte, bei 95 Prozent. Bei 50 Prozent hätte man auch würfeln können.
Der Goldstandard der EbM ist die prospektive, randomisierte und kontrollierte Studie mit großer statistischer Sicherheit (hohe „power“, niedriges Signifikanzniveau) bei ausreichend langer Nachverfolgung der Patienten. Um dem gerecht zu werden, braucht man vor allem Zeit. Zeit um eine ausreichend große Zahl an Patienten lange genug untersuchen zu können. „Multi-center-Studien“ lösen dieses Zeitproblem nur partiell und sind mit eigenen Schwächen behaftet. Studien, die einen Überlebensvorteil für die koronare Bypass-Operation bei bestimmten Patienten (natürlich die schwerstkranken) mit koronarer Herzkrankheit belegen, sind – gemessen an den rasanten Fortschritten in der Medizin – sehr alt. Sie stammen vom Anfang der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts.
Seither haben sich die bereits erwähnten medikamentösen Behandlungen (Aspirin, Betablocker, ACE-Hemmer, Aldosteron-Antagonisten und Statine) etabliert, die im Schnitt die Mortalität jeweils um etwa 20 Prozent reduzieren. In Kombination ergibt sich daraus eine theoretische Senkung der Sterblichkeit um etwa 67 Prozent . Würde man diese prognostisch relevanten medikamentösen Wirkungen mit der historischen Kontrolle von Bypass-Operationen vergleichen (eine allerdings unseriöse Vorgehensweise), ergäbe sich eine gewaltige prognostische Überlegenheit der medikamentösen Therapie. Neuere Studien vergleichen die koronare Bypass-Operation mit der alternativen Ballonangioplastie (PTCA) der Koronararterien. Wann immer eine dieser Studien abgeschlossen wurde, war die Behandlung mit PTCA (und in gewissem Umfang auch die der Bypass-Operationen) in einem wesentlichen Punkt weiterentwickelt worden. Zunächst waren es die implantierten Gefäßstützen (Stents), dann die verbesserten medikamentösen Maßnahmen zur Hemmung der Blutplättchen (ADP-Antagonisten, GPIIb/IIIa-Antagonisten) und zuletzt die mit Medikamenten beschichteten Stents, nicht zu vergessen die verbesserte adjuvante medikamentöse Therapie. So kann heute der einzige verbliebene „EbM-Vorteil“ der Bypass-Operationen, die geringe-re Häufigkeit von später notwendig werdenden Revaskularisationsmaßnahmen, bei optimaler konservativer Therapie und der Verwendung beschichteter Stents, in Zweifel gezogen werden. Anders ausgedrückt: Wann immer der Hase meint, das Ziel als Erster durchlaufen zu haben, steht ein neuer Igel bereits da.
Sehr genau genommen mit der EbM haben es die Londoner Mediziner Nicolas Wald und Malcom Law. Sie griffen zum „höchsten Gut“ der EbM, der Metaanalyse von Studien mit hoher Bonität, und zeigen, was man alles damit machen kann. Aus den Daten dieser Studien berechneten sie den prognostischen Nutzen einer Polypille, bestehend aus der Kombination eines Statins, Azetylsalicylsäure, einem Thiazid-Diuretikum, einem ACE-Hemmer, einem Betablocker sowie Folsäure. Nach der Auswertung ihrer Studie sollte diese Polypille von jedem ab dem 56. Lebensjahr eingenommen werden. Die Lebenserwartung der so Behandelten würde im Durchschnitt um elf Jahre steigen, in Deutschland also von derzeit durchschnittlich 81 Jahren auf 92 Jahre. Das bedeutete die Einnahme von (mindestens) sechs verschiedenen Pharmaka über einen Zeitraum von 36 Jahren. Rund 45 Millionen Menschen würden täglich dieser Behandlung bedürfen. Veranschlagt man einen Tagespreis von fünf Euro, so entstünden für diese rein präventive Maßnahme jährliche Behandlungskosten von mehr als 82 Milliarden Euro. Mit diesem „Einjahresbetrag“ ließe sich die gesamte Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Medizin über einen Zeitraum von 330 Jahren bezahlen. Haben wir wirklich ein so schlechtes Zutrauen in unsere Forschung und unsere Medizin, dass wir auch nur erwägen, unsere Ressourcen in dieser Weise zu verteilen?
Polypille für alle
Da die Empfehlung für die Polypille auf Evidenzbasierter Medizin beruht, wurde sie nicht nur in einer der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften publiziert, sondern ihre Schlussfolgerungen werden durchaus ernst genommen. Dabei werden geradezu exemplarisch alle hier erhobenen Einwände ignoriert. Nachfolgend seien einige der zugrunde gelegten Primärpräventions-Studien, besonders die an Probanden mit einem niedrigen kardiovaskulären Risiko, näher beleuchtet.
Aspirin wurde bereits von 27 359 gesunden Probanden (BMD-, PHS-, TPT-, HOT- und PPP-Studie) zur Primärprävention im Durchschnitt fünf Jahre lang eingenommen. Ein Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit ließ sich nicht nachweisen. Es konnten 1,47 vaskuläre Ereignisse pro tausend behandelter Patienten pro Jahr verhindert werden . Auch für Betablocker gibt es keine Daten, die bei der Primärprävention eine Mortalitätsreduktion zeigen. Für ACE-Hemmer zeigt eine Studie an Hochrisikopatienten (manifeste Atherosklerose oder Diabetes mellitus plus einem weiteren Risikofaktor) eine geringe Reduktion der Mortalität. Dabei mussten allerdings 54 Patienten fünf Jahre lang mit einer hohen Dosis (zehn Milligramm) Ramipril behandelt werden, um einen Todesfall zu verhindern. Bei 3 304 gesunden Probanden, die über im Mittel fünf Jahre mit dem Cholesterinsenker Lovastatin behandelt wurden, traten innerhalb des Studienzeitraums 17 kardiovaskuläre Todesfälle auf, verglichen mit 25 bei den 3 301 Kontrollpatienten.Die angeführten Beispiele zeigen, dass Ärzte auch in Zukunft nicht durch mit Studiendaten gefütterte Computerprogramme ersetzt werden können. Bei aller Euphorie über EbM sollte das kritische Nachdenken über ärztliches Handeln nicht auf der Strecke bleiben. Den Ärzten muss bewusst sein, dass mit dieser Methode auch Manipulationen von gewaltiger sozioökonomischer Bedeutung stattfinden; gerade deshalb sollte eine unabhängige Unterstützung klinischer Studien, zum Beispiel durch Krankenkassen, private Förderinitiativen oder gar öffentliche Haushaltsmittel angeregt werden. Dringend erforderlich ist die Erfassung aller Patienten in Registern sowie die fortlaufende wissenschaftliche Auswertung dieser Register. Surrogatparameter sind, häufig zu Recht, für die Bewertung von Therapien in Verruf geraten. Es ist aber vorstellbar, dass eine darauf konzentrierte Forschung in der Lage sein könnte, einfache Surrogatmarker zu identifizieren, die gut mit dem gewünschten therapeutischen Effekt korrelieren. Dadurch könnte die individuelle Anpassung von Therapien drastisch vereinfacht werden. Die hier aufgeführten kritischen Anmerkungen zeigen auch die relative Beschränktheit der momentanen therapeutischen Möglichkeiten und implizieren damit das Primat, unsere Forschungsanstrengungen und insbesondere die Bereitstellung von Ressourcen für die Forschung drastisch zu intensivieren, um kurative Therapieansätze zu entwickeln. Damit wäre ein Großteil der genannten Probleme beseitigt.
Epidemiologische Daten zeigen, dass bereits die Schulbildung enormen Einfluss auf die Prävalenz kardialer Risikofaktoren wie Übergewicht, Hypertonie, Diabetes und Nikotinmissbrauch hat. Vielleicht sollten gerade ambitionierte Ärzte deshalb einen Teil ihrer Zeit – statt mit der Durchführung einer neuen Medikamentenstudie – mit der Abhaltung einer Stunde Schulunterricht zum Thema Gesundheit verbringen. Neben dem primär präventiven Nutzen würde es vielleicht dazu führen, besser informierte Patienten zukünftig auch besser in Therapieentscheidungsprozesse einzubinden."[Quelle:
Niroomand, Feraydoon: Evidenzbasierte Medizin : Das Individuum bleibt auf der Strecke. -- In: Deutsches Ärzteblatt. -- 101. -- Ausgabe 26 (2004-06-25). --Seite A-1870 / B-1560 / C-1496. -- Online: http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=42480. -- Zugriff am 2006-01-02. -- Dort auch Nachweise.]

Abb.: Prof. Dr. med. Matthias Schrappe (1955 - ), Seit 9/2005 Hauptamtlicher
Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Witten-Herdecke gGmbH, Seit
12/2005 Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung des
Gesundheitswesens
Matthias Schrappe und Karl W. Lauterbach antworten auf Einwände gegen Evidence-based Medicine so:
"Evidence-based Medicine sieht sich zahlreichen kritischen Stellungnahmen gegenüber, auf die abschließend eingegangen werden soll.
- Eines der häufigsten Argumente hebt hervor, dass sich nur ein kleiner Teil der klinischen Entscheidungen durch Evidence-based Medicine abbilden ließe. Die Angaben über den Prozentsatz der Entscheidungen, die durch EBM abgesichert sind, liegen zwischen 20 und 80%. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Rückgriff auf die Definition von Evidence-based Medicine; durch den Begriff der „besten verfügbaren externen Informationen" (Sackett et al. 1996) wird klargestellt, dass nicht ein elitäres, absolutes Maß angelegt wird, sondern dass die Absicherung durch EBM je nach Situation und Vorhandensein wissenschaftlicher Erkenntnis vorgenommen werden sollte.
- Ein anderes Argument besagt, es gebe keinen strukturellen Unterschied zwischen Evidence-based Medicine und der „konventionellen guten Medizin": Das Missverständnis liegt darin, dass Evidence-based Medicine als Methode in keiner Weise implizieren will, dass die Praktizierung der „besten Medizin" nicht schon immer das Ziel der medizinischen Tätigkeit war. Es handelt sich lediglich um ein Instrument, die Entscheidungsgrundlagen nach einem systematischen Verfahren sichtbar zu machen. Wie zu Beginn ausgeführt, stellt diese explizite Vermittlung der Entscheidungsgrundlagen das konstituierende Element von Evidence-based Medicine dar.
- Der Vorwurf, bei der Evidence-based Medicine handele es sich um Kochbuch-Medizin, ist sehr ernst zu nehmen, insbesondere dann, wenn sich (ausschließlich) der Gedanke der Einsparung finanzieller Ressourcen durchsetzen sollte und die qualitätssteigernden Aspekte zurückgedrängt werden. Die Zukunft wird zeigen, inwieweit die Ärzteschaft Evidence-based Medicine als Instrument verstehen lernt, sich bei der Formulierung und Vermittlung eines rationellen Leistungsangebotes als ein aktiver und seiner Entscheidungsgrundlagen sicherer Verhandlungspartner darzustellen. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls zu klären sein, inwiefern sich Evidence-based Nursing als Methode der Pflegewissenschaften als eigene Disziplin neben EBM etabliert oder ob es zu einem Zusammenwirken beider Richtungen kommt.
- Das Argument, Evidence-based Medicine sei innovationsfeindlich, gibt vor, durch den Evaluationsprozess würden „wirksame" Verfahren aus der klinischen Routine ferngehalten werden. Hierzu ist auf vier Aspekte hinzuweisen:
- Die vorliegenden Erkenntnisse weisen darauf hin, dass die Transformation von der wissenschaftlichen Erkenntnis in die klinische Routine eher zu lange dauert und hierdurch Qualitätsdefizite auftreten (Antman et al. 1992).
- Liegen Studien vor, die einen Nutzen für die Patienten erweisen, muss nach Evaluation durch EBM die politische Diskussion geführt werden, inwieweit diese Methoden eingeführt und erstattet werden.
- Sind die wissenschaftlichen Studien, die die Wirksamkeit der innovativen Methode beweisen, jedoch noch nicht abgeschlossen, ist die Fortsetzung der Studien dringend anzuraten, insbesondere, um die Patienten vor dem Einsatz unbewiesener Methoden zu schützen.
- Der wichtigste Aspekt besteht jedoch darin, dass vor Initiierung neuer Studien eine gründliche Begutachtung des aktuellen Kenntnisstandes gefordert werden sollte, wozu man sich der Methodik von EBM bedienen sollte."
[Quelle: Schrappe, Matthias <1955 - > : Lauterbach, Karl W. <1963 - >: Evidence-based Medicine : Einführung und Begründung. -- In: Gesundheitsökonomie, Qualitätsmanagement und evidence based medicine : eine systematische Einführung ; mit 99 Tabellen / hrsg. von Karl W. Lauterbach ; Matthias Schrappe. -- 2., überarb. und erw. Aufl. -- Stuttgart : Schattauer, 2004. -- XVI, 573 S. : Ill., graph. Darst. ; 25 cm -- ISBN 3-7945-2287-7. -- S. 60 - 69; dort S. 68f. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Health Technology Assessment = "Gesundheits-Technikfolgen-Abschätzung"
"Was ist HTA? Health
= Gesundheit
Technology
= Verfahren, Prozedur, Struktur, Technologie
Assessment
= Bewertung, BeurteilungHTA ist die systematische Bewertung von Verfahren und Technologien, die einen Bezug zur gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung haben.
HTA beurteilt die Aspekte
- Sicherheit,
- Wirksamkeit,
- Kosten im Vergleich zum Nutzen sowie
- epidemiologische Fragestellungen.
Ferner sind auch
- soziale,
- rechtliche und
- ethische Effekte
zu berücksichtigen.
Für HTA werden vorhandene Forschungserkenntnisse und Informationen beschafft und gewertet, in einem Bericht zusammengefasst, Schlussfolgerungen abgeleitet sowie Handlungsempfehlungen für die Gesundheitsversorgung gegeben.
[...]Der Begriff Technologien in der gesundheitlichen Versorgung bezieht sich auf
- Arzneimittel,
- Instrumente,
- Geräte,
- medizinische und chirurgische Verfahren,
- unterstützende Systeme sowie
- Organisations- und Managementsysteme.
Beurteilt werden
- die experimentelle Wirksamkeit ( Efficacy),
- die Wirksamkeit im Alltag ( Effectiveness),
- die vergleichende Bewertung der Wirksamkeit (Comparative Effectiveness) sowie
- die Wirtschaftlichkeit (Efficiency)
einer Technologie.
Was sind die Aufgaben und Ziele von HTA?
- Bewertung von Gesundheitsleistungen und Optimierung des Gesundheitssystems
- Bereitstellung von Informationen mit dem Ziel den Gesundheitszustand der Bevölkerung zu verbessern und die finanziellen Ressourcen effektiver zu verteilen
- Lieferung von Informationen als Grundlage für Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des Gesundheitswesens
- Überprüfung etablierter Verfahren und Einschätzung neuer Technologien
- Erkennung von Wissens- und Forschungsdefiziten
- Unterstützung bei der Prioritätensetzung zukünftiger Forschungsaktivitäten
[Quelle: http://www.dimdi.de/static/de/hta/methoden/. -- Zugriff am 2005-12-30]
"Warum ist HTA notwendig? Entscheidungen im Gesundheitswesen und in der Gesundheitspolitik sind auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu treffen, d.h. sie müssen evidenzbasiert sein.
Hier setzt HTA an: Vorhandene medizinische, ökonomische, ethische, juristische sowie soziale Informationen werden systematisch aufbereitet und mit Handlungsempfehlungen in einem HTA-Bericht dargestellt. Die Ergebnisse werden veröffentlicht und stehen gesundheitspolitischen Entscheidungsträgern als übersichtliche und evidenzbasierte Arbeitsgrundlage zur Verfügung.
So hilft HTA die unkontrollierte Verbreitung unzweckmäßiger Technologien im deutschen Gesundheitssystem zu verhindern, sowie die damit verbundene finanzielle Belastung zu mindern und die Qualität medizinischer Versorgung zu steigern.
HTA trägt - durch eine frühzeitige umfassende Bewertung - dazu bei innovative Verfahren schnell ins Gesundheitssystem zu integrieren sowie unnötige und daher kostenintensive Verfahren zu entfernen."
[Quelle: http://www.dimdi.de/static/de/hta/methoden/. -- Zugriff am 2005-12-30]
Webpräsenz von DAHTA@DIMDI: http://www.dimdi.de/static/de/hta/index.htm. -- Zugriff am 2005-12-30
"HTA in Deutschland Das Bundesgesundheitsministerium (heute BMGS) finanzierte von 1995 bis 2001 das Projekt "Aufbau einer Datenbasis für die Evaluation von medizinischen Verfahren und Technologien". In dem an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) durchgeführten Projekt wurden eine Datenbank zu Health Technology Assessment (HTA) aufgebaut sowie Methoden für die Durchführung von HTA und die Erstellung von HTA-Berichten entwickelt.
Mit der Gesundheitsreform 2000 institutionalisierte der Gesetzgeber die wesentlichen Aufgaben des Projekts. Dem DIMDI wurde die Aufgabe erteilt, Daten zur Bewertung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von medizinischen Verfahren und Prozessen zu erheben und auszuwerten.
Abb.: ®LogoDies führte zur Einrichtung der Deutschen Agentur für HTA des DIMDI - DAHTA@DIMDI. Sie ist nicht nur für die genannten Aufgaben verantwortlich, sondern repräsentiert das Thema HTA auch in der Öffentlichkeit im In- und Ausland.
Im GKV-Modernisierungsgesetz (GMG), das am 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist, werden die Verbesserung der Qualität der Krankenversorgung und eine effizientere Verteilung verfügbarer finanzieller Mittel weiter in den Mittelpunkt der gesundheitlichen Versorgung gerückt. So wird ein fachlich unabhängiges, rechtsfähiges Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) - in der Verantwortung der Selbstverwaltung - gegründet. Das IQWiG stellt die wissenschaftliche Grundlage zu den unterschiedlichsten medizinischen Themen. Diese unterstützt den G-BA bei der Entscheidung, welche Therapien und Maßnahmen in Zukunft durch die gesetzliche Krankenversicherung finanziert werden sollen.
Aufgaben von DAHTA@DIMDIDAHTA@DIMDI entwickelt ein datenbankgestütztes System mit Informationen zur Bewertung der Wirksamkeit oder Effektivität sowie der Kosten medizinischer Prozeduren und Verfahren. In diesem Informationssystem ist auch der Zugang zu nationalen und internationalen Datenbanken sowie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich HTA möglich. Darüber hinaus erteilt die Agentur Forschungsaufträge zur Erstellung von HTA-Berichten.
Bei ihren Aufgaben wird die DAHTA von zwei Gremien unterstützt: dem Kuratorium HTA und dem Wissenschaftlichen Beirat.
Im Kuratorium sind Vertreter der Selbstverwaltungspartner, der Verbraucher und der Industrie repräsentiert. Es berät DAHTA@DIMDI bei der Festlegung und Auswahl von Fragestellungen für die HTA-Berichte.
Dagegen sind im Wissenschaftlichen Beirat Wissenschaftler aller Disziplinen vertreten, deren fachliches Know-how die Grundlage für die Bewertung medizinischer Technologien darstellt. Der Beirat berät DAHTA@DIMDI außerdem in methodischen Fragen zur Erstellung von HTA-Berichten.
Das Informationssystem HTADas Informationssystem HTA bietet Zugang zu nationalen und internationalen Ressourcen sowie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich HTA.
Für alle Beteiligten im Gesundheitswesen, einschließlich Wissenschaft und Patienten, sind die Informationen via Internet und in Form von Büchern aus der Schriftenreihe HTA des DIMDI verfügbar.
Neben HTA-Berichten werden auch Grundlageninformationen und Literaturdatenbanken mit wissenschaftlichen Studien, ergänzende HTA-bezogene Informationen sowie Methoden für HTA bereitgestellt.
Darüber hinaus werden Informationen über HTA in Pressemitteilungen, Infoblättern und Newsletter des DIMDI sowie in der DAHTA-Datenbank und auf Symposien von DAHTA@DIMDI verbreitet.
Die Forschungsförderung HTAIm Rahmen des HTA-Programms werden HTA-Berichte erstellt. Diese treffen Aussagen zu Nutzen, Risiken, Kosten sowie ethisch-sozialen und juristischen Auswirkungen medizinischer Prozeduren und Verfahren auf die gesundheitliche Versorgung. Bearbeitet werden vorrangig Fragestellungen, für die aktuell gesundheitspolitischer Entscheidungsbedarf besteht.
Für das HTA-Programm stehen seit 2000 jährlich etwa 750.000 EUR zur Verfügung. Dafür können pro Jahr zu rund 15 Fragestellungen Berichte in Auftrag gegeben werden.
Gemäß dem GMG besteht zukünftig auch die Möglichkeit, dass DAHTA@DIMDI im Auftrag des neuen Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit HTA-Berichte erstellen lässt. "
[Quelle: http://www.dimdi.de/static/de/hta/dahta/index.htm. -- Zugriff am 2005-12-30]
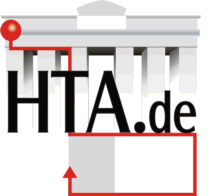
Abb.: ®Logo
In Deutschland gibt es auch den "Verein zur Förderung der Technologiebewertung im Gesundheitswesen (Health Technology Assessment) e.V." -- Webpräsenz: http://www.health-technology-assessment.de/. -- Zugriff am 2005-12-30
"Der HTA-Prozess bei DAHTA@DIMDI Es gibt eine erhebliche Anzahl an zu bewertenden Verfahren und Technologien und eine daraus resultierende Vielfältigkeit gesundheitspolitischer Fragestellungen. Dies macht es notwendig, die Bewertung nach einem strukturierten und standardisierten Prozess durchzuführen. Der HTA-Prozess bei DAHTA@DIMDI setzt diese Forderung um: Standardarbeitsanweisungen (Standard Operating Procedures, SOP), kontinuierlich dem Stand des Wissens angepasst, legen jeden Schritt des Bearbeitungsvorgangs fest. Damit sind Nachprüfbarkeit, Transparenz und die Sicherung einer hohen Qualität garantiert. Der Status als Behörde im Geschäftsbereich des BMGS sichert zudem größtmögliche Objektivität.
Der HTA-Prozess ist ein kontinuierliches Verfahren und setzt sich aus einer Reihe von einzelnen Schritten zusammen. Die Öffentlichkeit nimmt oft nur Teilberiche dieses Prozesses - die HTA-Berichte - wahr. Mit Abschluss eines HTA-Berichts ist der Prozess jedoch nicht beendet, vielmehr setzt eine Beobachtung ein, an deren Ende ein Bericht eventuell aktualisiert wird.
Abb.: Der HTA-Prozess bei DAHTA@DIMDI[Quelle: http://www.dimdi.de/static/de/hta/methoden/prozess/index.htm. -- Zugriff am 2005-12-30]
"Wie grenzen sich HTA und EbM voneinander ab?
Abb.: HTA und EbMEbM= evidence based medicine, EbHC = evidence based health care, HTA = health technology assessment
Es wird deutlich, dass die beiden Konzepte eng miteinander verknüpft sind, auch wenn die Zielsetzung eine andere ist. Die Methoden der Wissensbewertung von EbM finden sich im HTA-Konzept wieder."
[Quelle: http://www.dimdi.de/static/de/hta/methoden/prozess/ebm.htm. -- Zugriff am 2005-12-30]

Abb.: Dr. med. Susanne Blessing, geb. 1957, Fachärztin für Allgemeinmedizin
Für jeden Arzt sollten folgende Punkte selbstverständlich sein:
Doch könnte man über die Überbewertung dieses Wortmonsters "Evidenzbasierte Medizin" lächeln, wenn nicht die Gesundheitspolitik glücklich wäre, in evidenzbasierter Kochbuchmedizin ein Mittel zur Dämpfung der Kostenspirale im Gesundheitswesen gefunden zu haben. Vorgeschriebene Behandlungspläne machen die Kosten doch viel vorausschaubarer und auch planbarer (man muss ja nur die Behandlungspläne ändern). Und hier wird das Ganze für eine Hausärztin ziemlich unerfreulich und frustrierend:
DAHTA@DIMDI. -- http://www.dimdi.de/static/de/hta/index.htm. -- Zugriff am 2005-12-30
Rüther, Alric <1962 - > ; Dauben, Hans-Peter: Health Technology Assessment. -- In: Gesundheitsökonomie, Qualitätsmanagement und evidence based medicine : eine systematische Einführung ; mit 99 Tabellen / hrsg. von Karl W. Lauterbach ; Matthias Schrappe. -- 2., überarb. und erw. Aufl. -- Stuttgart : Schattauer, 2004. -- XVI, 573 S. : Ill., graph. Darst. ; 25 cm -- ISBN 3-7945-2287-7. -- S. 127 - 135. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Zu 3.: Qualitätsmanagement