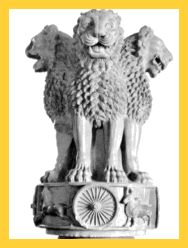
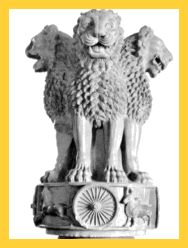
(mailto: payer@hdm-stuttgartḍe)
Viele Anregungen stammen von: Sharmila Bansal-Tönz, Jakob Egli, Claudia Guggenbühl, Angela Hohenberger, Kirsten Holzapfel, Helen Kleiner, Nandadulal Nandi, Peter Schreiner, Rita Schubnell, Markus Schüpbach, Christiane Schwarm, Larissa Sutter, Caroline Widmer, Edoardo Zentner, für dieses Kapitel besonders auch von Sabine Schwind
Zitierweise / cite as:
Payer, Alois <1944-- >: Materialien zu einigen Lehrreden des Dīghanikāya. -- D II, 9: Mahāsatipatthānasutta. -- 2. Gefühlsbetrachtung und Bewusstseinsbetrachtung. -- Fassung vom 2007-01-12. -- URL: http://www.payer.de/dighanikaya/digha209a.htm
Erstmals publiziert: 2006-10-30
Überarbeitungen: 2007-01-12 [Ergänzungen]; 2007-01-10 [Ergänzungen]; 2007-01-03 [Ergänzungen]; 2006-12-17 [Ergänzungen]; 2006-12-11 [Ergänzungen]; 2006-12-08 [Ergänzungen]; 2006-12-04 [Ergänzungen]; 2006-12-03 [Ergänzungen]; 2006-12-01 [Ergänzungen und Änderungen]
Anlass: Lehrveranstaltungen SS 2003; WS 2006/07
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
Copyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Verfassers.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Buddhismus von Tüpfli's Global Village Library
| Mönche, wie weilt ein Mönch in den Gefühlen, die Gefühle betrachtend? | Kathañ ca bhikkhave bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati. |
Da nimmt ein Mönch klarbewusst wahr,
|
Idha bhikkhave bhikkhu
|
| So weilt er von innen (nicht-objektivierend) in den Gefühlen, die Gefühle betrachtend, oder von außen (objektivierend) oder von innen und außen (nicht-objektivierend und objektivierend). Oder er weilt in den Gefühlen die Gesetzmäßigkeit des Entstehens betrachten, die Gesetzmäßigkeit des Vergehens betrachtend, die Gesetzmäßigkeit des Entstehens und Vergehens betrachten. Oder seine Achtsamkeit ist darauf gerichtet, dass es Gefühl ist. All dies nur soweit als es der erlösenden Erkenntnis und der Achtsamkeit dient. Er weilt unabhängig und greift nach nichts in der Welt. | Iti ajjhattaṃ vā vedanāsu vedanānupassī viharati bahiddhā vā vedanāsu vedanānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā vedanāsu vedanānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā vedanāsu viharati vayadhammānupassī vā vedanāsu viharati samudayavayadhammānupassī vā vedanāsu viharati. Atthi vedanā ti vā pan' assa sati pacuppaṭṭhitā hoti yāvad eva ñāṇamattāya paṭisasatimattāya anissito ca viharati na ca kiñci loke upādiyati. Evam pi kho bhikkhave bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati. |
(24) Gefühlsbetrachtung: für den Zweck Heilsweg wird Gefühl zweidimensional betrachtet:
- Dimension Lust-Unlust: angenehm - neutral - unangenehm
- Dimension Sinnenbezug: sinnlich - nicht-sinnlich

Abb.: "wenn sie ein angenehmes Gefühl empfindet"
[Bildvorlage: brooklyn. -- http://www.flickr.com/photos/brooke/57694571/in/set-72157594334765544/. -- Zugriff am 2006-12-08. --
Creative Commons Lizenz (Namensnennung)]

Abb.: "wenn sie ein unangenehmes Gefühl empfindet"
[Bildvorlage: brooklyn. -- http://www.flickr.com/photos/brooke/57694572/. -- Zugriff am 2006-12-08. --
Creative Commons Lizenz (Namensnennung)]
Abb.: "wenn sie ein neutrales Gefühl empfindet"[Bildvorlage: brooklyn. -- http://www.flickr.com/photos/brooke/78685188/. -- Zugriff am 2006-12-08. --
Creative Commons Lizenz (Namensnennung)]
Nach der Körperbetrachtung kommt die Gefühlsbetrachtung, weil wir unsere Gefühle in die Objekte projizieren, wodurch uns diese dann als begehrenswert oder abstoßend erscheinen.
"Das Gebiet der Gefühle oder Emotionen ist unübersehbar und theoretisch-psychologisch noch vollkommen unbewältigt. Gefühle, so scheint es, durchwalten unsere gesamte Existenz. Beginnend mit dem ersten Unlustgeschrei des neugeborenen, das sich plötzlich in einer Welt von reizen befindet, die auf das hilflose Wesen einstürmen und es zu überwältigen scheinen, bis zu dem Lustgelächter des ein Vergnügen Genießenden; von dem berauschenden Glücksgefühl der Liebe bis zu dem verzehrend bitteren Gefühl eines Hasses; von Gefühlen tiefer Befriedigung über ein gelungenes Werk oder eine gute Tat bis zu Gefühlen der Schuld und der Selbstanklage über eigenes Misslingen oder eine andere Menschen schädigende Handlung; von der Angst des 'Ins-Dasein-geworfen-Seins' (Heidegger) bis zum ekstatischen oder religiös hingegebenen Gefühl der Erhebung durch die Größe und Tiefe des Daseins -- vom einen bis zum anderen Ende dieser Skala von Gefühlen scheint es keine Abgrenzung und keine Unterbrechung in dem Strom unserer Emotionen zu geben. Während es nun nicht fruchtbar erscheint, sich mit dem Versuch einer Einteilung der Emotionen zu befassen, ist es außerordentlich wichtig, sich die fundamentale Rolle klar zu machen, die sie in ihrer Einwirkung auf unsere Antriebe spielen. Strebungen und Gefühle sind in eigenartiger Weise ständig miteinander verknüpft. Wie der feinsinnige Psychologe Philipp Lersch sagt, sind 'die Triebe und Strebungen umkleidet von Gefühlsregungen, die Gefühlsregungen sind durchwirkt von Trieben und Strebungen'."
[Bühler, Charlotte <1893 - 1974 >: Psychologie im Leben unserer Zeit. -- Sonderausgabe. -- München [u.a.] : Droemer Knaur, [1968]. -- S. 103]
Die Bedeutung der Gefühle für die Zuwendung zur Welt und die Bindung (das Anhaften) wird sehr klar, wenn man die Differenzierung der Gefühle betrachtet, die wir als Säugling durchlaufen:
"Nach Sroufe (1979) lassen sich die meisten Emotionen als Differenzierungen aus drei Emotions-Vorläufern beschreiben, die bereits im Neugeborenen zu beobachten sind:
- Vergnügen / Freude
- Ängstlichkeit / Furcht und
- Wut / Ärger.
Seine acht Stufen der Entwicklung charakterisieren Arten der sozialen Zuwendung zur Umwelt und sind durch die Fortschritte in der kognitiven und sozialkognitiven Entwicklung, wie sie Piaget beschrieben hat, mitbedingt.
- Periode der absoluten Reizschranke (1. Monat)
- Zuwendung zur Umwelt (2. - 3. Monat), Differenzierung in Neugier, Interesse und Freude / Lächeln
- Vergnügen an gelungener Assimilation (3. - 5. Monat) mit Differenzierung von Freude / volles Lachen und Wut / Enttäuschung
- aktive Teilnahme am sozialen Geschehen (6. - 9. Monat) mit Differenzierung von Vergnügen und Ärger
- Phase der sozial emotionalen Bindung (10. - 12. Monat) mit Differenzierung von Fremdenfurcht und Bindung
- Phase des Übens und Explorierens (13. - 18. Monat) mit Differenzierung von Begeisterung, Vorsicht / Ängstlichkeit und Ärger
- Bildung des Selbstkonzeptes (19. - 36. Monat) mit Differenzierung von positivem Selbstwert, Scham, Trotz und Bockigkeit bis hin zu absichtlichem Wehtun, und
- Phase des Spiels und der Phantasie (ab 36 Monaten) mit Differenzierung von Stolz und Liebe sowie Schuldgefühlen."
[Entwicklungspsychologie : ein Lehrbuch / Rolf Oerter ... (Hrsg.). -- 3., vollständig überarb. und erw. Aufl. -- Weinheim : PsycholgieVerlagsUnion, ©1995. -- ISBN 3-621-27244-5. -- S.233f.]
Gefühle treten zunächst "überwältigend" auf, d.h. sie entstehen, ohne dass der Wille und das Bewusstsein unmittelbar Einfluss nehmen könnte. Diese Spontaneität entspricht der Funktion der Gefühle als schnelle Handlungsorientierung in kritischen Situationen (Flucht, Misstrauen, Vertrauen, schnell Zugreifen etc.). Achtsamkeit führt diese überwältigenden Gefühle in den Bereich des Klarbewusstseins über und nimmt ihnen damit auch etwas von ihrer überwältigenden (vergewaltigenden) Kraft.
Zu einer modernen Sicht der Gefühle siehe die Bücher des Neurowissenschaftlers António Rosa Damásio (geb. 1944), z.B. den Bestseller:
Abb.: EinbandtitelDamasio, Antonio R. <1944 - >: Descartes' Irrtum : Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. -- [Berlin] : List, 2004. -- 384 S. : Ill. ; 19 cm. -- (List-Taschenbuch ; 60443). -- Originaltitel: Descartes' error (1994). -- ISBN 3-548-60443-9. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Eine hervorragende Einführung in die verschiedensten Aspekte der Gefühlsforschung ist:
Abb.: EinbandtitelOatley, Keith ; Keltner, Dacher ; Jenkins, Jennifer M.: Understanding emotions. -- 2nd ed. -- Malden, MA [u.a.] : Blackwell Pub., 2006. -- XXVI, 508 S. : Ill. ; 26 cm. -- ISBN 1405131039. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
| Mönche, wie weilt ein Mönch im Bewusstsein, das Bewusstsein betrachtend? | Kathañ ca bhikkhave bhikkhu citte cittānupassī viharati. |
Da nimmt ein Mönch klarbewusst wahr,
|
Idha bhikkhave bhikkhu
|
| So weilt er von innen (nicht-objektivierend) im Bewusstsein, das Bewusstsein betrachtend, oder von außen (objektivierend) oder von innen und außen (nicht-objektivierend und objektivierend). Oder er weilt im Bewusstsein die Gesetzmäßigkeit des Entstehens betrachten, die Gesetzmäßigkeit des Vergehens betrachtend, die Gesetzmäßigkeit des Entstehens und Vergehens betrachten. Oder seine Achtsamkeit ist darauf gerichtet, dass es Bewusstsein ist. All dies nur soweit als es der erlösenden Erkenntnis und der Achtsamkeit dient. Er weilt unabhängig und greift nach nichts in der Welt. | Iti ajjhattaṃ vā citte cittānupassī viharati bahiddhā vā citte cittānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā citte cittānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati vayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati samudayavayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati. Atthi cittan ti vā pan' assa sati pacuppaṭṭhitā hoti yāvad eva ñāṇamattāya paṭisasatimattāya anissito ca viharati na ca kiñci loke upādiyati. Evam pi kho bhikkhave bhikkhu citte cittānupassī viharati. |
(25) Bewusstseinsbetrachtung
Wie der Psychologe Philipp Lersch sagt, sind 'die Triebe und Strebungen umkleidet von Gefühlsregungen, die Gefühlsregungen sind durchwirkt von Trieben und Strebungen'; deshalb ist es folgerichtig, dass nach den Gefühlen das Bewusstsein mit seinen Antrieben usw. in den Aufmerksamkeitskegel gehoben wird.
Das Bewusstsein wird unter folgenden Aspekten betrachtet:
- den grundlegenden Antrieben: Gier, Hass, Verblendung, Nicht-Gier, Nicht-Hass, Nicht-Verblendung
- der Durchschaubarkeit, d.h. wie weit man in der Bewusstseinsklarheit gekommen ist
- der Stellung auf dem Erlösungsweg: auf Hohes gerichtet bzw. nicht, unübertreffbar bzw. nicht, gesammelt bzw. nicht, erlöst bzw. nicht
(26) Gier, Hass, Verblendung
Gier, Hass, Verblendung, Nicht-Gier, Nicht-Hass, Nicht-Verblendung sind die Wurzeln von Karma, modern würden wir von Antrieben (Handlungsbereitschaften) sprechen. Diese Wurzeln, Antriebe sind Grundlage für differenzierte Gefühle, Einstellungen und Wollen, damit für Karma.
"Anfangs erlebt der Säugling das Anwachsen von Antrieben [Antrieb zur Nahrungsaufnahme, zum Trinken, zum Schlafen, zur Kontaktaufnahme, zur Erkundung] wahrscheinlich noch recht undifferenziert als Unlust, ihre 'Abnahme' dagegen als Lust. Schrittweise erwirbt er die Fähigkeit, die einzelnen 'Antriebsspannungen' selbstbeobachtend als Gefühle (Emotionen) unterscheiden zu können: Der zunehmende Trinkantrieb wird als Durst, der Schlafantrieb als Müdigkeit und die Kontaktbereitschaft als Kontaktwunsch erlebt. Führen wir uns deshalb immer vor Augen: Ein Säugling hat Gefühle und Kann Lust und Unlust, Geborgenheit und Angst so intensiv erleben wie wir -- auch wenn er uns noch nicht sagen kann, was er empfindet. ... Die Fähigkeit zur bewussten Steuerung der eigenen Antriebe und zum Aufschub einer Bedürfnisbefriedigung entwickelt sich nur sehr langsam und schwerpunktmäßig jenseits des Säuglingsalters." [Schritt um Schritt : die Entwicklung des Kindes bis ins 7. Lebensjahr / hrsg. von Hans-Dieter Schmidt ... -- 4., erw. und neugestaltete Aufl. -- Berlin : Volk und Gesundheit, 1989. -- ISBN 3-333-00244-2. -- S. 54]
"wenn das Bewusstsein verblendungsbehaftet ist -- wenn das Bewusstsein ohne Verblendung ist"
"Trotzdem sind wir immer geneigt, die Tatsache zu vergessen, dass eigentlich jeder einzelne Mensch die Welt verschieden sieht. »Wenn wir die individuellen Unterschiede im Wahrnehmen verstehen«, sagt Gardner Murphy in seinem fundamentalen Werk über die 'Persönlichkeit', »so werden wir im Verständnis der Unterschiede des resultierenden Verhaltens weit gelangen.« Immer wieder machen die Menschen den Fehler, so fährt er fort, dass sie annehmen, die Welt werde von allen in gleicher Weise aufgenommen. tatsächlich lebt aber jeder in dem, was Lawrence K. Frank die »private Welt« des Individuums genannt hat -- jeder in seiner eigenen Welt." [Bühler, Charlotte <1893 - 1974 >: Psychologie im Leben unserer Zeit. -- Sonderausgabe. -- München [u.a.] : Droemer Knaur, [1968]. -- S. 104]
"Die allgemein menschliche Tendenz, Ereignisse, die einen betreffen, vor allem unangenehme, darauf zurückzuführen, dass andere sie beabsichtigt oder verursacht hätten, hat, wie Fritz Heider hervorhebt, oft zur Folge, dass man sonstige Faktoren -- zumeist die wirklich verantwortlichen -- falsch einschätzt, obwohl man sie, wäre man unvoreingenommen, durchaus wahrnehmen könnte. So wird auch die Schuld an verwerflichen Handlungen oder Verbrechen leicht dem 'Unsympathischen' zugeschrieben. Oskar Levant erzählt eine amüsante Anekdote über Toscanini. Ständig kritisierte der Meister einen bestimmten Geiger, weil er ihn wegen seines fleckigen Gesichts nicht leiden konnte. Einmal, bei einem Konzert des Orchesters in Hartford machte irgendein Geiger einen falschen Einsatz. Toscanini war wütend und, machte sofort sein 'schwarzes Schaf' für den Fehler verantwortlich. Tatsächlich aber war dieser Musiker, wie sich später herausstellte, bei dieser Gelegenheit gar nicht anwesend, da er krank in New York zurückgeblieben war."
[Bühler, Charlotte <1893 - 1974 >: Psychologie im Leben unserer Zeit. -- Sonderausgabe. -- München [u.a.] : Droemer Knaur, [1968]. -- S. 105]

Abb.: Gier, Hass und Verblendung: Hieronymus Bosch <1450 - 1516>:
Heuwagen, Triptychon, Mitteltafel: Der Heuwagen. -- um 1500
„De wereld is een hooiberg – elk plikt ervan, wat hij kan krijgen“
= „Die Welt ist ein Heuhaufen, ein jeder pflückt davon, soviel er kann“
"Im Mittelpunkt der Szene steht ein großer Heuwagen, der von dämonischen Gestalten, halb Mensch, halb Tier, gezogen wird. Ein flämisches Sprichwort: „De wereld is een hooiberg – elk plikt ervan, wat hij kan krijgen“ („Die Welt ist ein Heuhaufen, ein jeder pflückt davon, soviel er kann“) ist zwar erst seit 1820 schriftlich überliefert. Aber es gibt keinen Zweifel: Bosch hat dieses Sprichwort gekannt. Neben dem Gefährt laufen Menschen mit und versuchen, mit Händen und langen Forken Heu herunterzureißen. Sie streiten darum, einige geraten dabei unter die Räder. Inmitten der Szene wird einem am Boden liegenden Opfer die Kehle durchgeschnitten, ein anderer liegt bereits tot am Boden, seine Forke unbeachtet zu seinen Füßen. Als Konkurrenten für egoistisches Abgreifen sind diese beiden bereits ausgeschieden. In der rechten Ecke ist ein feister Geistlicher zu sehen. Er trinkt aus einem Becher, es scheint fast, als stoße er auf die Szene an. Und er schaut ungerührt zu, wie Nonnen den vor ihm stehenden Sack immer weiter mit Heu füllen – die Kirche hat sich ihren Löwenanteil längst gesichert. In unmittelbarer Nähe des Geistlichen spielt ein Narr Dudelsack – Symbol für Sexuell-Obszönes, ein Quacksalber hat gleich daneben seinen Stand aufgebaut, der markiert ist mit einem Fähnchen, auf dem ein durchstoßenes Herz abgebildet ist. Über dem Wagen schaut Jesus herab, er ist im Verhältnis zu dem Heuhaufen geradezu unscheinbar und wie er seine Wundmale präsentiert, macht er einen hilflosen Eindruck. Nicht eindeutig ist die Szene, die sich auf dem Heuwagen abspielt: Vor einem Busch, in welchem ein Liebespaar turtelt, musizieren Leute, ein Teufel spielt mit einer Flöte auf, der Engel schaut zu Jesus hoch. Diese Abbildung scheint etwas Unschuldiges zu haben, gleichwohl: Aus dem Busch ragt ein Stock hervor, an welchem ein Krug baumelt und ein hässlicher Alter späht um die Ecke. Dem Heuwagen folgt ein großer Tross, der Papst ist ebenso dabei wie der Kaiser und einige Adelige. Sie scheinen dem Gefährt bedenkenlos und wie selbstverständlich zu folgen. Die Richtung, die die dämonischen Zugtiere eingeschlagen haben, ist unmissverständlich: Es geht unbeirrt und ohne Einhalt nach rechts und direkt abwärts: In die Hölle."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Boschs_Triptychen. -- Zugriff am 2006-12-08]
(27) undurchschaubar -- durchschaubar: verkrampft - unverkrampft
Die Durchschaubarkeit ("Unverkrampftheit") des Bewusstseins ist u.a. auch ein Kennzeichen des Fortschrittes in der Achtsamkeit. Im Unterschied zu dieser Auslegung kommentiert die Papañcasūdanī:
Papañcasūdanī
- Saṅkhittaṃ = ein der Schlaffheit und Müdigkeit verfallenes Bewusstsein, ein solches Bewusstsein ist nämlich eingeschrumpft
- Vikkhittaṃ = ein von Aufgeregtheit begleitetes Bewusstsein, ein solches ist nämlich expansiv.
- Saṅkhittan ti thīnamiddhānupatitaṃ, etam hi saṅkucitacittaṃ nāma.
- Vikkhittan ti uddhaccasahagataṃ, etañ hi pasavacittaṃ nāma.
Papañcasūdanī, Th 7, 296
(27a) wenn das Bewusstsein auf Hohes gerichtet ist ... nicht auf Hohes gerichtet ... übertreffbar ... unübertrefflich ... gesammelt ... nicht gesammelt ... erlöst ... nicht erlöst ist: bei diesen Feststellungen geht es darum, dass der Achtsame lernt, sich keine Illusionen über seinen Heilszustand zu machen, d.h. sich bewusst ist, dass er die Erlösung, bzw. notwendige Teilmerkmale der Erlösung noch nicht vorhanden sind (bzw. vorhanden sind):
Zu Teil 3: Betrachtung der Gesetzmäßigkeiten und Schluss