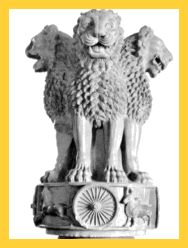
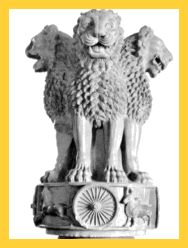
(mailto: payer@hdm-stuttgartḍe)
Viele Anregungen stammen von: Jakob Egli, Claudia Guggenbühl, Angela Hohenberger, Kirsten Holzapfel, Helen Kleiner, Nandadulal Nandi, Peter Schreiner, Rita Schubnell, Markus Schüpbach, Christiane Schwarm, Larissa Sutter, Caroline Widmer, Edoardo Zentner, für dieses Kapitel besonders auch von Sabine Schwind
Zitierweise / cite as:
Payer, Alois <1944-- >: Materialien zu einigen Lehrreden des Dīghanikāya. -- D II, 9: Mahāsatipatthānasutta. --3. Betrachtung der Gesetzmäßigkeiten und Schluss. -- Fassung vom 2007-01-17. -- URL: http://www.payer.de/dighanikaya/digha209b.htm
Erstmals publiziert: 2006-10-30
Überarbeitungen: 2007-01-17 [Ergänzungen]; 2006-12-17 [Ergänzungen]; 2006-12-15 [Ergänzungen]; 2006-12-10 [Ergänzungen]; 2006-12-04 [Ergänzungen]; 2006-12-03 [Ergänzungen]; 2006-12-01 [Ergänzungen und Änderungen]
Anlass: Lehrveranstaltungen SS 2003; WS 2006/07
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
Copyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Verfassers.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Buddhismus von Tüpfli's Global Village Library
| Mönche, wie weilt ein Mönch in den Gesetzmäßigkeiten, die Gesetzmäßigkeiten betrachtend? | Kathañ ca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati |
(28) Betrachtung der Gesetzmäßigkeiten
Auch bei den bisher aufgezählten Wegen der Aufrichtung von Achtsamkeit spielte die Aufmerksamkeit auf die Gesetzmäßigkeiten des Entstehens und Vergehens eine wichtige Rolle. Bei der vierten Komponente der Aufrichtung der Achtsamkeit treten die Gesetzmäßigkeiten, die für die Erlösung wesentlich sind ins Zentrum der Aufmerksamkeit:
- Faktoren, die gesetzmäßig Hindernisse auf dem Weg zur Erlösung sind: Betrachtung der fünf Hindernisse
- Die Faktoren, die die leidvolle, bedingt entstandene und entstehende Existenz ausmachen: Betrachtung der fünf Konstituentien / Koordinaten / Funktionalen Systeme bedingt entstehender Wirklichkeit
- Faktoren, die unsere Fesselung an die Welt, ans Leiden bedingen: Betrachtung der sechs inneren und äußeren Grundlagen des Bewusstseins
- Faktoren, die Erlösung ermöglichen: Betrachtung der sieben Glieder der erlösenden Erkenntnis
- Die grundlegende Erkenntnis der Tatsache des Leidens, die Diagnose seiner Ursache, die Feststellung des leidfreien Zustandes und die Therapie: Betrachtung der vier edlen Wahrheiten
| Mönche, da weilt ein ein Mönch in den Gesetzmäßigkeiten, die Gesetzmäßigkeiten betrachtend bei den fünf Hindernissen: | Idha bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu
nīvaraṇesu. Kathañ ca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu. |
1. Da erkennt ein Mönch klarbewusst,
|
1. Idha bhikkhave bhikkhu
|
2.
|
2.
|
| 3.
|
3.
|
| 4.
|
4.
|
5.
|
5.
|
| So weilt er von innen (nicht-objektivierend) in den Gesetzmäßigkeiten, die Gesetzmäßigkeiten betrachtend, oder von außen (objektivierend) oder von innen und außen (nicht-objektivierend und objektivierend). Oder er weilt in den Gesetzmäßigkeiten die Gesetzmäßigkeit des Entstehens betrachten, die Gesetzmäßigkeit des Vergehens betrachtend, die Gesetzmäßigkeit des Entstehens und Vergehens betrachten. Oder seine Achtsamkeit ist darauf gerichtet, dass es Gesetzmäßigkeiten sind. All dies nur soweit als es der erlösenden Erkenntnis und der Achtsamkeit dient. Er weilt unabhängig und greift nach nichts in der Welt. | Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati vayadhammānupassī vā dhammesu viharati. Samudayavayadhamānupassi vā dhammesu viharati. Atthi dhammā ti vā pan' assa sati pacuppaṭṭhitā hoti yāvad eva ñāṇamattāya paṭisasatimattāya anissito ca viharati na ca kiñci loke upādiyati. Evam pi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu. |
(29) Die fünf Hindernisse
Die fünf Hindernisse sind Hindernisse für die Sammlung (samādhi) und die objektive Erkenntnis der Wahrheit. Ausführlich darüber z.B. der Nīvaraṇappahānavagga des Aṅguttaranikāya:
Aṅguttaranikāya I: Nīvaraṇappahānavagga 1.1. Mönche, ich kenne keinen anderen einzelnen Faktor, wodurch Verlangen nach den Objekten der fünf Sinnesorgane so sehr entsteht bzw. wächst und sich ausbreitet, als die Vorstellung von Schönem, wenn man darüber unbedacht nachdenkt. 1.1. Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yena anupanno vā kāmacchando uppajjati upanno vā kāmacchando bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yath' idaṃ bhikkhave subhanimittaṃ. Subhanimittaṃ bhikkhave ayoniso manasi karoto anupanno ceva kāmacchando uppajjati upanno ca kāmacchando bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī ti. 1.2. Mönche, ich kenne keinen anderen einzelnen Faktor, wodurch Übelwollen so sehr entsteht bzw. wächst und sich ausbreitet, als die Vorstellung von Abstoßendem, wenn man darüber unbedacht nachdenkt. 1.2. Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yena anupanno vā vyāpādo uppajjati upanno vā vyāpādo bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yath' idaṃ bhikkhave paṭighanimittaṃ. Paṭighanimittaṃ hikkhave ayoniso manasi karoto anupanno ceva vyāpādo uppajjati upanno ca vyāpādo bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī ti. 1.3. Mönche, ich kenne keinen anderen einzelnen Faktor, wodurch Schlaffheit und Müdigkeit so sehr entsteht bzw. wächst und sich ausbreitet, als Unlust, Trägheit, faules Recken der Glieder, Benommenheit nach dem Essen, geistige Zähigkeit. 1.3. Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yena anupannaṃ vā thīnamiddhaṃ uppajjati upannaṃ vā thīnamiddhaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yath' idaṃ bhikkhave arati tandi vijambhitā bhattasammado cetaso ca līnattaṃ. Līnacittassa bhikkhave anupannaṃ ceva thīnamiddhaṃ upajjati upannaṃ ca thīnamiddhaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī ti. 1.4. Mönche, ich kenne keinen anderen einzelnen Faktor, wodurch Aufgeregtheit und Gewissensunruhe so sehr entsteht bzw. wächst und sich ausbreitet, als geistige Unabgeklärtheit. 1.4. Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yena anupannaṃ vā udhaccakukkuccaṃ upajjati upannaṃ vā udhaccakukkuccaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yath' idaṃ bhikkhave cetaso avūpasamo. Avūpasantacitassa bhikkhave anupannaṃ ceva uddhaccakukkuccaṃ uppajjati upannaṃ ca uddhaccakukkuccaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī ti. 1.5. Mönche, ich kenne keinen anderen einzelnen Faktor, wodurch Zweifel so sehr entsteht bzw. wächst und sich ausbreitet, als unbedachtes Nachdenken. 1.5. Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yena anupannā vā vicikicchā uppajjati uppannā vā vicikicchā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yath' idaṃ bhikkhave ayoniso manasikāro. Ayoniso bhikkhave manasi karoto anuppannā ceva vicikicchā uppajjati uppannā ca vicikicchā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī ti. 2.1. Mönche, ich kenne keinen anderen, besseren einzelnen Faktor, wodurch Verlangen nach den Objekten der fünf Sinnesorgane nicht entsteht bzw. verschwindet, als die Vorstellung von Unschönem, wenn man darüber bedacht nachdenkt. 2.1. Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yena anupanno vā kāmacchando n' uppajjati upanno vā kāmacchando pahīyati yath' idaṃ bhikkhave asubhanimmittaṃ. Asubhanimittaṃ bhikkhave yoniso manasi karoto anupanno ceva kāmacchando n' uppajjati upanno ca kāmacchando pahīyatī ti. 2.2. Mönche, ich kenne keinen anderen, besseren einzelnen Faktor, wodurch Übelwollen nicht entsteht bzw. verschwindet, als Güte, die Befreiung des Herzens, wenn man darüber bedacht nachdenkt. 2.2. Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yena anupanno vā vyāpādo n' uppajjati upanno vā vyāpādo pahīyati yath' idaṃ bhikkhave mettā cetovimutti. Mettaṃ bhikkhave cetovimuttiṃ yoniso manasi karoto anupanno ceva vyāpādo n' uppajjati upanno ca vyāpādo pahīyatī ti. 2.3. Mönche, ich kenne keinen anderen, besseren einzelnen Faktor, wodurch Schlaffheit und Müdigkeit nicht entsteht bzw. verschwindet, als grundsätzliche Initiative, Aufbruchsstimmung, Unternehmungsgeist, Energie. 2.3. Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yena anupannaṃ vā thīnamiddhaṃ n' uppajjati upannaṃ vā thīnamiddhaṃ pahīyati yath' idaṃ bhikkhave ārambhadhātu nikkammadhātu parakkamadhātu. Āraddhaviriyassa bhikkhave anupannaṃ ceva thīnamiddhaṃ n' uppajjati uppannaṃ ca thīnamiddhaṃ pahīyatī ti. 2.4. Mönche, ich kenne keinen anderen, besseren einzelnen Faktor, wodurch Aufgeregtheit und Gewissensunruhe nicht entsteht bzw. verschwindet, als geistige Abgeklärtheit. 2.4. Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yena anupannaṃ vā udhaccakukkuccaṃ n' upajjati upannaṃ vā udhaccakukkuccaṃ pahīyati yath' idaṃ bhikkhave cetaso vūpasamo. Vūpasantacitassa bhikkhave anupannaṃ ceva uddhaccakukkuccaṃ n' uppajjati upannaṃ ca uddhaccakukkuccaṃpahīyatī ti. 2.5. Mönche, ich kenne keinen anderen, besseren einzelnen Faktor, wodurch Zweifel nicht entsteht bzw. verschwindet, als bedachtes Nachdenken. 2.5. Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yena anupannā vā vicikicchā n' uppajjati uppannā vā vicikicchā pahīyati yath' idaṃ bhikkhave yoniso manasikāro. Yoniso bhikkhave manasi karoto anuppannā ceva vicikicchā n' uppajjati uppannā ca vicikicchā pahīyatī ti. Aṅguttaranikāya I, 3-5; Nal I, 4-6; Th 20, 2-5 [12 - 21]
Vgl. die sieben Hauptlaster/Wurzelsünden im Christentum:
- Superbia: Hochmut (Übermut, Hoffart, Eitelkeit, Stolz)
- Avaritia: Geiz (Habgier, Habsucht)
- Gula: Völlerei (Gefräßigkeit, Unmäßigkeit, Maßlosigkeit)
- Ira: Zorn (Wut, Vergeltung, Rachsucht)
- Luxuria: Wollust (Unkeuschheit)
- Invidia: Neid (Missgunst, Eifersucht)
- Acedia: Trägheit des Herzens / des Geistes (Überdruss)
Abb.: Hieronymus Bosch <1450 - 1516>: Tisch mit Szenen zu den sieben Todsünden und den letzten vier Dingen (Totenbett, Letztes Gericht, Himmel und Hölle), 1475–1480
"Das Hauptbild, die Todsünden, bildet den größeren Mittelteil des Tisches. Um dieses Rundbild (Tonde) herum sind in den Ecken des Tischs vier weitere Tonden angeordnet, die „Die vier letzten Dinge“, nämlich das „Sterben“, das „Jüngste Gericht“, den „Himmel“ und die „Hölle“ abbilden. Sie sind in ihrer Darstellung eher starr und konservativ, es ist auch nicht sicher, ob Hieronymus Bosch diese Bilder angefertigt hat. „Die Sieben Todsünden“ ranken sich um „Das Auge Gottes“, in dessen Pupille Jesus Christus zu sehen ist, der seine Wundmale zeigt. Untertitelt ist diese Abbildung mit dem lateinischen Text: „Cave cave deus videt“ („hüte dich, Gott sieht“). Den einzelnen Darstellungen der Todsünden hat Bosch eine Richtung zugewiesen: Der kompositorische Schwerpunkt der Bilder neigt sich – durch eine angedeutete Bewegung, durch Blicke der Figuren – nach rechts. Ein Betrachter, der sich von den Abbildungen leiten lässt, würde daher automatisch gegen den Uhrzeigersinn um den Tisch herumlaufen.
Die Bilder sind mit den lateinischen Begriffen der Todsünden untertitelt: Beginnend der am Fuße der Jesusdarstellung sind dies „ira“ (Zorn), „superbia“ (Hochmut), „luxuria“ (Wollust), „acedia“ (das einzige griechische Wort: Gleichgültigkeit, hier als Trägheit verstanden), „gula“ (wörtlich: Kehle, gemeint: Völlerei), „avaritia“ (Habgier) und „invidia“ (Neid). Im Gegensatz zu den Figuren in den Tonden „Die vier letzten Dinge“ sind die dargestellten Personen der „Sieben Todsünden“ bis zur Fratze verzerrt.
- Die Abbildung des „Zorns“ zeigt eine Schlägerei vor einem Wirtshaus, bei der auch das Mobiliar nicht verschont bleibt. Eine Frau versucht, zu intervenieren, vor den Männern sind „Knochenschuhe“ ausgebreitet.
- “Hochmut“ (im Mittelalter oft als „Hoffart“ bezeichnet) stellt sich dar als eine Frau, die keinen Blick für ihre Umgebung und schon gar nicht für den Betrachter übrig hat, wendet sie ihm doch den Rücken zu, und starrt gebannt in einen Spiegel, den ihr ein teuflisches Wesen vorhält.
- Die Abbildung der Todsünde “Wollust“ präsentiert ein Zeltgelage. Während Männer und Frauen sich handelseinig werden, verdrischt ein Mönch den entblößten Hintern eines Narren mit einem Kochlöffel. Die Harfe, Symbol für ein himmlisches Instrument, ist achtlos beiseite geworfen.
- Mit „Trägheit“ ist die des Geistes gemeint, Bosch setzt sie in seinem Bild als Gleichgültigkeit gegenüber dem Glauben und Gott um. Ein Geistlicher hat es sich in seinem Lehnstuhl bequem gemacht, die Bibel liegt geschlossen neben ihm.
- In Zeiten, als Hunger noch eine reale Gefahr nach jedem Winter war, galt die Völlerei als besonders verwerflich, da zukunftsgefährdend. Die Szene beherrscht ein widerwärtiger Fettwanst, der von einem ebenso fetten und hässlichen Kind bedrängt wird, damit er ihm von seinem reichhaltigen Mahl abgebe.
- Das Bild über die „Habgier“ scheint sich in zwei Szenen aufzulösen: Ersichtlich handelt es sich um eine Gerichtsszene. Während ein Mann seinen Geldbeutel umklammert, lässt sich der Richter von dem hinter ihm Stehenden bestechen, nämlich Geld zustecken. Er nimmt diese unrechte Leistung bedenkenlos an.
- Die letzte Abbildung, der „Neid“ ist von missgünstigen Blicken getragen. Nicht einmal die Tiere sind von dieser Todsünde verschont. Ein Hund, dem ohnehin schon zwei Knochen vorliegen, giert nach einem dritten, ein weiterer Hund neidet seinem Artgenossen diese Beute."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bilder_von_Hieronymus_Bosch#Die_Sieben_Tods.C3.BCnden. -- Zugriff am 2006-12-10]
| Mönche, da weilt ein ein Mönch in den Gesetzmäßigkeiten, die Gesetzmäßigkeiten betrachtend bei den fünf Gruppen von Konstituentien bedingt entstandener Wirklichkeit: | Puna ca paraṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
pañcasūpādānakkhandhesu. Kathañ ca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasūpādānakkhandhesu. |
Da erkennt ein Mönch:
|
Idha bhikkhave bhikkhu
|
| So weilt er von innen (nicht-objektivierend) in den Gesetzmäßigkeiten, die Gesetzmäßigkeiten betrachtend, oder von außen (objektivierend) oder von innen und außen (nicht-objektivierend und objektivierend). Oder er weilt in den Gesetzmäßigkeiten die Gesetzmäßigkeit des Entstehens betrachten, die Gesetzmäßigkeit des Vergehens betrachtend, die Gesetzmäßigkeit des Entstehens und Vergehens betrachten. Oder seine Achtsamkeit ist darauf gerichtet, dass es Gesetzmäßigkeiten sind. All dies nur soweit als es der erlösenden Erkenntnis und der Achtsamkeit dient. Er weilt unabhängig und greift nach nichts in der Welt. | Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati vayadhammānupassī vā dhammesu viharati. Samudayavayadhamānupassi vā dhammesu viharati. Atthi dhammā ti vā pan' assa sati pacuppaṭṭhitā hoti yāvad eva ñāṇamattāya paṭisasatimattāya anissito ca viharati na ca kiñci loke upādiyati. Evam pi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasūpādānakkhandhesu. |
(30) Betrachtung der fünf "funktionalen Systeme" entstehender Wirklichkeit
Der deutsche Mönch Nyānatiloka (Anton Walther Florus Gueth) (1878-1957) schreibt treffend zu den fünf Gruppen:
"Khandha, 'Gruppen' oder 'Daseinsgruppen', nennt man die 5 Gruppen, in die der Buddha die dem oberflächlichen Beobachter eine Persönlichkeit vortäuschenden gesamten körperlichen und geistigen Daseinserscheinungen eingeordnet hat ... Für alle Wesen, mit Ausnahme des Heiligen (arahat), sind diese fünf Gruppen 'Gruppen des Anhaftens' (upādāna-kkhandha), und zwar in dem Sinne, dass sie Objekte des Anhaftens bilden. ...
Unser sogenanntes Individuelles Dasein ist in Wirklichkeit nichts weiter als ein bloßer Prozess dieser körperlichen und geistigen Phänomene, ein Prozess, der seit undenkbaren Zeiten schon vor unserer Geburt im Gange war und der auch nach dem Tode sich noch für undenkbar lange Zeitperioden fortsetzen wird. Diese 5 Daseinsgruppen aber bilden, weder einzeln noch zusammengenommen, irgend eine in sich abgeschlossene wirkliche Ich-Einheit oder Persönlichkeit, und auch außerhalb derselben existiert nichts, was man als eine für sich unabhängig bestehende Ichheit bezeichnen könnte, so dass eben der Glaube an eine im höchsten Sinne wirkliche Ichheit, Persönlichkeit usw. eine bloße Illusion ist.
'Gleichwie bei Anhäufung der Teile
Man da von einem Wagen spricht,
Braucht man, sobald die Gruppen da sind,
Den populären Namen Mensch.'yathā hi aṅgasambhārā
hoti saddo ratho iti
evaṃ khandhesu santesu
hoti satto ti sammati[Vajirāsutta, Saṃyuttanikāya, Th 15, 198 [554]]
Hier sei besonders betont, dass auch die sog. 5 Daseinsgruppen als solche, genau genommen, lediglich eine abstrakte Klassifikation darstellen und dass, von der vierten Gruppe des Geistformationen [saṅkhārā] abgesehen, die Gruppen als solche überhaupt keine Wirklichkeit haben und jedesmal nur einzelne Repräsentanten dieser Gruppen mit ein- und demselben Bewusstseinszustande verbunden vorkommen können. Z.B. kann mit ein- und demselben Bewusstseinszustande jedesmal nur eine einzige Art von Gefühl, etwa Freude- oder Trauergefühl verbunden sein, niemals aber zwei oder gar eine Gruppe von Gefühlen. ...
Verkehrt ist es auch, dass man die Gruppen im Allgemeinen als zu kompakt, ja oft geradezu als mehr oder weniger dauernde Entitäten auffasst, wohingegen sie doch als Gruppen überhaupt keine Wirklichkeit besitzen und auch selbst ihre Repräsentanten nur ein momentanes, schnell dahinschwindendes Dasein haben. Gefühl, Wahrnehmung und Geistformationen [saṅkhārā] nämlich bilden genau genommen bloß verschiedene Aspekte oder Gesichtspunkte jener unaufhörlich aufeinanderfolgenden einzelnen Bewusstseinselemente, die mit ungeheurerer, unmessbarer Geschwindigkeit alle Augenblicke aufblitzen und dann unmittelbar darauf für immer verschwinden."
[Nyanatiloka <Thera> <1878 - 1957>: Buddhistisches Wörterbuch : kurzgefasstes Handbuch der buddhistischen Lehren und Begriffe in alphabetischer Anordnung. -- 5. Aufl., (Unveränd. Nachdr. der 2., rev. Aufl.). -- Stammbach : Beyerlein und Steinschulte, 1999. -- 277 S. ; 18 cm. -- Originaltitel: Buddhist dictionary. -- ISBN: 3-931095-09-6. -- S. 106 - 108. -- Hier können Sie dieses Werk bestellen: http://www.buddhareden.de/fr-bestellung.htm ]
Beschreibung der fünf Gruppen der Konstituentien bedingt entstehender Wirklichkeit:
Upādānaparivattasutta Mönche, dies sind die fünf Gruppen der Konstituentien bedingt entstehender Wirklichkeit:
- die Gruppe des Materiellen
- die Gruppe der Gefühle
- die Gruppe der Wahrnehmungen
- die Gruppe der übrigen Begleitzustände des Bewusstseins (besonders des Wollens)
- die Gruppe der Bewusstseinszustände
Pañc' ime bhikkhave upādānakkhandhā. Katame pañca.
- rūpupādānakkhandho
- vedanupādānakkhandho
- saññupādānakkhandho
- saṅkhārupādānakkhandho
- viññānupādānakkhandho
...
Was ist Materielles? Die vier Elemente und von diesen Elementen abhängige Materielle.
- Materielles (Körperliches) entsteht aufgrund des Entstehens von Nahrung
- Materielles vergeht aufgrund des Vergehens von Nahrung
- zum Vergehen des Materiellen führt der edle achtfache Pfad ...
Katamaṃ ca bhikkhave rūpaṃ. Cattaro ca mahābhūtā catunnaṃ ca mahābhūtānaṃ upādāya rūpaṃ idaṃ vuccati bhikkhave rūpaṃ.
- Āhārasamudayā rūpasamudayo
- āhāranirodhā rūpanirodho
- ayaṃ eva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo rūpanirodhagāminī paṭipadā ...
Was ist Gefühl? Die folgenden sechs Gruppen von Gefühlen:
- aus Sehkontakt entstehendes Gefühl
- aus Hörkontakt entstehendes Gefühl
- aus Riechkontakt entstehendes Gefühl
- aus Geschmackskontakt entstehendes Gefühl
- aus somatischem Kontakt entstehendes Gefühl
- aus geistigem Kontakt entstehendes Gefühl
- Gefühl entsteht aufgrund des Entstehens von Sinneskontakt
- Gefühl vergeht aufgrund des Vergehens von Sinneskontakt
- zum Vergehen des Gefühls führt der edle achtfache Pfad ...
Katamā ca bhikkhave vedanā. Chay ime bhikkhave vedanākāyā:
- cakkhusamphassajā vedanā
- sotasamphassajā vedanā
- ghānasamphassajā vedanā
- jivhāsamphassajā vedanā
- kāyasamphassajā vedanā
- manosamphassajā vedanā
Ayaṃ vuccati bhikkhave vedanā.
- Phassasamudayā vedanāsamudayo
- phassanirodhā vedanānirodho
- ayaṃ eva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo vedanānirodhagāminī paṭipadā ...
Was ist Wahrnehmung? Die folgenden sechs Gruppen von Wahrnehmung:
- Farb- und Gestaltwahrnehmung
- Tonwahrnehmung
- Geruchswahrnehmung
- Geschmackswahrnehmung
- somatische Wahrnehmung
- Wahrnehmung geistiger Objekte
- Wahrnehmung entsteht aufgrund des Entstehens von Sinneskontakt
- Wahrnehmung vergeht aufgrund des Vergehens von Sinneskontakt
- zum Vergehen der Wahrnehmung führt der edle achtfache Pfad ...
Katamā ca bhikkhave saññā. Chay ime bhikkhave saññākāyā:
- rūpasaññā
- saddasaññā
- gandhasaññā
- rasasaññā
- phoṭṭhabbasaññā
- dhammasaññā
Ayaṃ vuccati bhikkhave saññā.
- Phassasamudayā saññāsamudayo
- phassanirodhā saññānirodho
- ayaṃ eva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saññānirodhagāminī paṭipadā ...
Was sind die übrigen Begleitzustände des Bewusstseins? Die folgenden sechs Gruppen von Wollen:
- Wollen von Farbe und Gestalt
- Wollen von Ton
- Wollen von Geruch
- Wollen von Geschmack
- Wollen von somatischen Empfindungsobjekten
- Wollen von geistigen Objekten
- Wollen entsteht aufgrund des Entstehens von Sinneskontakt
- Wollen vergeht aufgrund des Vergehens von Sinneskontakt
- zum Vergehen des Wollens führt der edle achtfache Pfad ...
Katame ca bhikkhave saṅkhārā. Chay ime bhikkhave cetanākāyā:
- rūpasañcetanā
- saddasañcetanā
- gandhasañcetanā
- rasasañcetanā
- phoṭṭhabbasañcetanā
- dhammasañcetanā
Ime vuccanti bhikkhave saṅkhārā.
- Phassasamudayā saṅkhārasamudayo
- phassanirodhā saṅkhāranirodho
- ayaṃ eva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saṅkhāranirodhagāminī paṭipadā ...
Was ist Bewusstsein? Die folgenden sechs Gruppen von Bewusstsein:
- Sehbewusstsein
- Hörbewusstsein
- Riechbewusstsein
- Geschmacksbewusstsein
- somatisches Bewusstsein
- geistiges Bewusstsein
- Bewusstsein entsteht aufgrund des Entstehens der gestalteten Ganzheit von Körperlichem und Geistigem
- Bewusstsein vergeht aufgrund des Vergehens der gestalteten Ganzheit von Körperlichem und Geistigem
- zum Vergehen des Bewusstseins führt der edle achtfache Pfad ...
Katamaṃ ca bhikkhave viññānaṃ. Chay ime bhikkhave viññānakāyā:
- cakkhuviññānaṃ
- sotaviññānaṃ
- ghānaviññānaṃ
- jivhāviññānaṃ
- kāyaviññānaṃ
- manoviññānaṃ
Idaṃ vuccati bhikkhave viññānaṃ.
- Nāmarūpasamudayā viññānasamudayo
- nāmarūpanirodhā viññānanirodho
- ayaṃ eva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo viññānanirodhagāminī paṭipadā ...
Upādānaparivattasutta, Saṃyuttanikāya 3, 59 -61; Nal 2, 288 - 291; Th 17, 72 - 75 [112 - 117]
Die fünf khandha: die fünf "funktionalen Systemen" (Klein-Schwind), Funktionsbereichen (Pöppel), unsere fünf heilsrelevanten Koordinaten, die fünf Gruppen der Konstituentien bedingt entstehender Wirklichkeit. Pöppel unterscheidet - ohne Kenntnis der Khandhas! - folgende Funktionsbereiche:
- Wahrnehmung: Informationsaufnahme
- Lernen und Gedächtnis: Informationsverarbeitung
- Gefühle: Informationsbewertung. Grundgefühle.
- Freude
- Überraschung
- Furcht
- Ärger
- Ekel
- Trauer
- Absichten: Informationsumsetzung
- logistische Funktion (z.B. Aufmerksamkeitslenkung)
Siehe:
Klein-Schwind, Sabine Gudrun: Zur Konzeption von Individualität im Theravāda-Buddhismus im Vergleich mit ausgewählten naturwissenschaftlichen Ansätzen. -- 2. Teil II: Beziehungsideen I: Individualität im Theravāda. -- 2. Kapitel 2: Die Persönlichkeitsmodelle des Theravāda. -- URL: http://www.payer.de/schwind/schwind22.htm
Pöppel, Ernst <1940 - >: Der Rahmen : ein Blick des Gehirns auf unser Ich. -- München ; Wien : Hanser, 2006. -- 548 S. : Ill., graph. Darst. ; 22 cm. -- ISBN 978-3-446-20779-0. -- S. 117ff. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Man kann sich die Khandhas als Werte eines Fünfervektors, also als Koordinaten in einem fünfdimensionalen Raum, vorstellen, die einen gegenwärtigen Zustand der "Materiell-Mentalen-Einheit" insoweit beschreiben, als es heilsrelevant ist:
Zustand (t) := (rūpat, vedanāt, saññāt, saṅkhārāt, viññānat) (t = der jeweilige Zeitpunkt)
| Mönche, da weilt ein ein Mönch in den Gesetzmäßigkeiten, die Gesetzmäßigkeiten betrachtend bei den sechs inneren und äußeren Grundlagen des Bewusstseins: | Puna ca paraṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati chasu
ajjhattikabāhiresu āyatanesu. Kathañ ca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. |
| Da erkennt ein Mönch
|
Idha bhikkhave bhikkhu
|
2.
|
2.
|
3.
|
3.
|
4.
|
4.
|
5.
|
5.
|
6.
|
6.
|
| So weilt er von innen (nicht-objektivierend) in den Gesetzmäßigkeiten, die Gesetzmäßigkeiten betrachtend, oder von außen (objektivierend) oder von innen und außen (nicht-objektivierend und objektivierend). Oder er weilt in den Gesetzmäßigkeiten die Gesetzmäßigkeit des Entstehens betrachten, die Gesetzmäßigkeit des Vergehens betrachtend, die Gesetzmäßigkeit des Entstehens und Vergehens betrachten. Oder seine Achtsamkeit ist darauf gerichtet, dass es Gesetzmäßigkeiten sind. All dies nur soweit als es der erlösenden Erkenntnis und der Achtsamkeit dient. Er weilt unabhängig und greift nach nichts in der Welt. | Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati vayadhammānupassī vā dhammesu viharati. Samudayavayadhamānupassi vā dhammesu viharati. Atthi dhammā ti vā pan' assa sati pacuppaṭṭhitā hoti yāvad eva ñāṇamattāya paṭisasatimattāya anissito ca viharati na ca kiñci loke upādiyati. Evam pi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. |
(31) Betrachtung der sechs inneren und äußeren Grundlagen des Bewusstseins
Abb.: Bewusstseinvorstellung aus dem europäischen 17. Jahrhundert / von Robert Fudd (1574 – 1651)
[Bildquelle: Wikipedia]Die Grundlagen und Bedingungen für Bewusstsein sind Reiz und entsprechendes Organ. Dadurch werden wir gefesselt, wie wir es in extremen Situationen auch in der Sprache ausdrücken, z.B. "Ich bin gefesselt vom Endspiel der Fußballweltmeisterschaft".
Neben den fünf äußeren Sinnen, die hier neben dem inneren Sinn genannt werden, kennt die moderne Physiologie kennt für den Menschen noch vier weitere Sinne
- die Thermozeption (Temperatursinn),
- Nozizeption (Schmerzempfindung),
- den Gleichgewichtssinn und
- die Propriozeption (Eigenwahrnehmung des Körpers)
Die zugrundeliegende Erkenntnistheorie ist naiv realistisch: die Sinnesobjekte werden "vorgefunden" und nicht, wie es der Realität entspricht, aufgrund von Material konstruiert. Davon, dass die Außenwelt nicht aus Farben, Tönen, Gerüchen usw. besteht, sondern aus elektromagnetischen Wellen, Schallwellen, Molekülen usw. wusste man zur Zeit der Entstehung unserer Texte noch nichts. Auch im Bereich einer phänomenologischen Psychologie war man im Bereich der Sinnespsychologie nicht sehr aufmerksam (achtsam!) gewesen, sonst hätte man die Erkenntnisse z.B. der Gestaltpsychologie vorweg nehmen können.
So muss dieser ganze Teil für eine zeitgemäße Praxis im Sinne einer modernen Wahrnehmungspsychologie uns - physiologie und einer dem entsprechenden konstruktivistischen Erkenntnislehre umgearbeitet werden, soweit es dem Weg zur erlösenden Einsicht dient!
"Ein Kaminfeuer übermittelt über die Medien Strahlung, Schall und chemische Stoffe (allesamt (physikalische Größen), für die wir Sinnesorgane besitzen, Eigenschaften; das Kaminfeuer ist also ein distaler Reiz. Da die ausgesandten Signale Rezeptoren, z.B. in der Netzhaut des Auges, zur Reaktion reizen, handelt es sich hierbei um die Reize Licht, Wärme, Geräusche und Gerüche. Die Gesamtheit dessen, was wir vom Kaminfeuer wahrnehmen, bildet den proximalen Reiz, der von unseren Sinnesnerven als Perzept wie "gelb bis rote Farben, flackernde Bewegung, mittlere Temperatur, Knistern, geruchswirksame Aromen x, y und z" an die sensorischen Zentren weitergeleitet wird. Obwohl die Umrisse des Kamins auf der Netzhaut gekrümmt sind, wird er veridikal als rechteckig wahrgenommen. Zum Abschluss wird das Perzept durch die Kognition mit den Erinnerungen "Feuer" und "Kamin" verbunden, zum "Feuer im Kamin" kombiniert, als "Kaminfeuer" erkannt, mit "November 1968" und "Lisa" assoziiert und als "sehr angenehm" beurteilt und bildet damit die Grundlage für unsere Reaktion: Wir schnurren behaglich und entkorken genüsslich den Bordeaux." [Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung. -- Zugriff am 2006-12-17]
Das Forschungsgebiet, das zu unserem Problembereich die rasantesten Fortschritte macht, ist die Kognitive Neurowissenschaft (Cognitive Neuroscience). Ein gutes, verständliches, reich illustriertes Lehrbuch ist:
Rosenzweig, Mark R. ; Breedlove, S. Marc ; Watson, Neil V. (Neil Verne) <1962 - >: Biological psychology : an introduction to behavioral and cognitive neuroscience. -- 4. ed. -- Sunderland, Mass. : Sinauer, ©2005. 622 S. : Ill. ; 29 cm. + 1 CD-ROM. -- ISBN 0878937544. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Abb.: Die fünf Sinne. -- Liebigs Sammelbilder, 1897
Abb.: Die fünf Sinne
Abb.: Sehen
Abb.: Hören
Abb.: Riechen
Abb.: Schmecken
Abb.: BerührenAlle sechs Abb.: Liebigs Sammelbilder, 1889
Abb.: Geistwahrnehmung. -- Liebigs Sammelbilder, 1901
(32) Fessel
Die übliche Aufzählung der Fesseln ist:
Saṃyojanasutta Niedere Fesseln:
- 1. Falscher Glaube an ein Ich
- 2. Zweifel
- 3. Hängen an Sittlichkeit und religiösen Gelübden
- 4. Gier nach Objekten der Sinnenwelt
- 5. Übelwollen
oram-bhāgiya saṃyojana n.:
- 1. sakkāya-diṭṭhi f.
- 2. vicikicchā f.
- 3. sīla-bbata-parāmasa m.
- 4. kāma-chanda m.
- 5. vyāpāda m.
Höhere Fesseln:
- 6. Gier nach der feinstofflichen Welt der Formen
- 7. Gier nach der unstofflichen Welt
- 8. Abhängigkeit vom sozialen Feld
- 9. Aufgeregtheit
- 10. Nichtwissen
uddham-bhāgiya saṃyojana n.:
- 6. rūpa-rāga m.
- 7. a-rūpa-rāga m.
- 8. māna m.
- 9. uddhacca n.
- 10. avijjā f.
Saṃyojanasutta : Aṅguttaranikāya V, 17; Nal IV, 111, 21 - 112, 3; Th 24, 18 - 19
Eine andere Aufzählung von Fesseln ist:
Vibhaṅga
- Gier nach Objekten der Sinnenwelt
- Abneigung
- Abhängigkeit vom sozialen Feld
- falsche Ansichten
- Zweifel
- Hängen an Sittlichkeit und religiösen Gelübden
- Gier nach Werden
- Neid
- Geiz
- Nichtwissen
- kāma-rāga m.
- paṭigha m.
- māna m.
- diṭṭhi f.
- vicikicchā f.
- sīla-bbata-parāmasa m.
- bhava-rāga m.
- issā f.
- macchariya n.
- avijjā f.
Vibhaṅga ; Th 35, 528
| Mönche, da weilt ein ein Mönch in den Gesetzmäßigkeiten, die Gesetzmäßigkeiten betrachtend bei den sieben Glieder der erlösenden Erkenntnis: | Puna ca paraṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati sattasu
bhojjhaṅgesu. Kathañ ca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bhojjhaṅgesu. |
1. Da erkennt der Mönch.
|
1.
|
| 2.
|
2.
|
| 3.
|
3.
|
| 4.
|
4.
|
| 5.
|
5.
|
| 6.
|
6.
|
| 7.
|
7.
|
| So weilt er von innen (nicht-objektivierend) in den Gesetzmäßigkeiten, die Gesetzmäßigkeiten betrachtend, oder von außen (objektivierend) oder von innen und außen (nicht-objektivierend und objektivierend). Oder er weilt in den Gesetzmäßigkeiten die Gesetzmäßigkeit des Entstehens betrachten, die Gesetzmäßigkeit des Vergehens betrachtend, die Gesetzmäßigkeit des Entstehens und Vergehens betrachten. Oder seine Achtsamkeit ist darauf gerichtet, dass es Gesetzmäßigkeiten sind. All dies nur soweit als es der erlösenden Erkenntnis und der Achtsamkeit dient. Er weilt unabhängig und greift nach nichts in der Welt. | Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati vayadhammānupassī vā dhammesu viharati. Samudayavayadhamānupassi vā dhammesu viharati. Atthi dhammā ti vā pan' assa sati pacuppaṭṭhitā hoti yāvad eva ñāṇamattāya paṭisasatimattāya anissito ca viharati na ca kiñci loke upādiyati. Evam pi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bhojjhaṅgesu. |
(33) Betrachtung der sieben Glieder der erlösenden Erkenntnis
Diese sieben Glieder sind förderliche Bedingungen auf dem Erlösungsweg. Ihre Aufeinanderfolge ist psychologisch einsichtig.
Weiteres bei:
Nāgārjuna: Le Traité de la grande vertu de sagesse de Nāgārjuna (Mahaprajñāpāranitāśāstra) / [Hrsg. u. Übers.:] Etienne Lamotte [1903 - 1983]. -- Tome III. -- Louvain, 1970. -- (Publ. de l'Institute orientaliste de Louvain ; 2). -- S. 1128f., 1180f., 1200-1203.
| Mönche, da weilt ein ein Mönch in den Gesetzmäßigkeiten, die Gesetzmäßigkeiten betrachtend bei den vier edlen Wahrheiten: | Puna ca paraṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati catusu
ariya saccesu. Kathañ ca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati catusu ariya saccesu. |
Da erkennt der Mönch wirklichkeitsgemäß
|
Idha bhikkhave bhikkhu
|
| So weilt er von innen (nicht-objektivierend) in den Gesetzmäßigkeiten, die Gesetzmäßigkeiten betrachtend, oder von außen (objektivierend) oder von innen und außen (nicht-objektivierend und objektivierend). Oder er weilt in den Gesetzmäßigkeiten die Gesetzmäßigkeit des Entstehens betrachten, die Gesetzmäßigkeit des Vergehens betrachtend, die Gesetzmäßigkeit des Entstehens und Vergehens betrachten. Oder seine Achtsamkeit ist darauf gerichtet, dass es Gesetzmäßigkeiten sind. All dies nur soweit als es der erlösenden Erkenntnis und der Achtsamkeit dient. Er weilt unabhängig und greift nach nichts in der Welt. | Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati vayadhammānupassī vā dhammesu viharati. Samudayavayadhamānupassi vā dhammesu viharati. Atthi dhammā ti vā pan' assa sati pacuppaṭṭhitā hoti yāvad eva ñāṇamattāya paṭisasatimattāya anissito ca viharati na ca kiñci loke upādiyati. Evam pi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati catusu ariya saccesu. |
(34) Betrachtung der vier edlen Wahrheiten
Die formulierten vier edlen Wahrheiten sind ein Leitfaden, durch Beobachtung der Wirklichkeit selbst ihre Richtigkeit existentiell zu erfassen. Dabei geht man wie ein Arzt vor:
- Die grundlegende Erkenntnis der Tatsache des Leidens
- die Diagnose seiner Ursache
- die Feststellung des leidfreien Zustandes
- die Therapie
Bis hierher stimmen das Satipaṭṭhānasutta des Majjhimanikāya und das Mahāsatipaṭṭhānasutta des Dīghanikāya wortwörtlich überein. Das Mahāsatipaṭṭhānasutta schiebt bei den vier edlen Wahrheiten einen kommentierenden Text zu den vier edlen Wahrheiten ein:
Was, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Leiden:
|
Katamaṃ ca bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ.
|
|
| Was bedeutet Geburt? Es ist die Geburt dieser Wesen in der jeweiligen Gattung, das Geborenwerden, Niederkunft, Wiedergeburt, Entstehen der Konstituentien, Erlangen der Bewusstseinsgrundlagen.
|
Katamā ca bhikkhave jāti. Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jāti sañjāti okkanti abhinibbati khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccati bhikkhave jāti. |
|
|
|
||
| Was bedeutet Altern? Es ist das Altern dieser Wesen in der jeweiligen Gattung, die Alterung, der Verfall, das Ergrauen. das Verschrumpeln der Haut, die Erschöpfung der Lebensenergie, das Welken der Sinne. |
Katamā ca bhikkhave jarā. Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati bhikkhave jarā. |
|
Abb.: Altern ist leidvoll: Wirkungen des Knochenschwundes (Osteoporose) bei der Frau |
||
|
Abb.: Krankheit ist leidvoll: typisches Gesicht eines Cholerakranken |
||
| Was bedeutet Sterben? Das Verschwinden dieser Wesen aus der jeweiligen Gattung, das Entschwinden, das Hinscheiden, das Ablegen des Körpers, das Ende der Lebenskraft. |
Katamaṃ ca bhikkhave maraṇaṃ. Yaṃ tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ kālakiriyā khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa nikkhepo jīvitindriyass' upacchedo idaṃ vuccati bhikkhave maraṇaṃ |
|
|
|
||
| Was bedeutet Kummer? Es ist der Kummer, wenn jemanden irgendein Ungemach trifft, irgendein Leid berührt, die Bekümmernis, der innere Kummer, die innere Bekümmerung |
Katamo ca bhikkhave soko. Yo kho bhikkhave aññataraññatarena vyasanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa soko socanā socitattaṃ antosoko antoparisoko ayaṃ vuccati bhikkhave soko. |
|
Abb.: Der Gesichtsausdruck bei Kummer und Schmerz ist ein kulturelles Universale |
||
| Was bedeutet Klagen? Es ist das Klagen, wenn jemanden irgendein Ungemach trifft, irgendein Leid berührt, die Klagerei, die Wehjammerei |
Katamo ca bhikhhave paridevo. Yo kho bhikkhave aññataraññatarena vyasanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammene phuṭṭhassa ādevo paridevo ādevanā paridevanā ādevitattaṃ paridevitattaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave paridevo. |
|
|
|
||
| Was bedeutet Schmerz? Schmerz nennt man das körperliche Leid, das körperliche Unangenehme, dass durch den somatischen Sinneskontakt entstandene Leid, die unangenehme Empfindung |
Katamaṃ ca bhikkhave dukkhaṃ. Yaṃ kho bhikkhave kāyikaṃ dukkhaṃ kāyikaṃ asātaṃ kāyasamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ idaṃ vuccati bhikkhave dukkhaṃ. |
|
|
|
||
| Was bedeutet Betrübtheit? Betrübtheit nennt man das geistige Leid, das geistig Unangenehme, dass durch den geistigen Sinneskontakt entstandene Leid, die unangenehme Empfindung |
Katamaṃ ca bhikkhave domanassaṃ. Yaṃ kho bhikkhave cetasikaṃ dukkhaṃ cetasikaṃ asātaṃ manosamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ idaṃ vuccati bhikkhave domanassaṃ |
|
|
|
||
| Was bedeutet Beunruhigung? Es ist die Beunruhigung, wenn jemanden irgendein Ungemach trifft, irgendein Leid berührt, das Beunruhigtsein |
Katamo ca bhikkhave upāyāso. Yo kho bhikkhave aññataraññatarena vyasanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammene phuṭṭhassa āyāso upāyāso āyāsitattaṃ upāyāsitattaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave upāyāso. |
|
|
|
||
| Was bedeutet mit Unlieben vereint sein, ist leidvoll? Es bedeutet die Verbindung mit unerwünschten, unlieben, unangenehmen Farben und Gestalten, Tönen, Geschmäcken, somatischen Objekten, geistigen Objekten, oder mit nutzlosen Wünschen und Genüssen, unheilsamen Wünschen und Genüssen, Unwohl erzeugenden Wünschen und Genüssen, für den Wohlstand schädlichen Wünschen und Genüssen, das Zusammenkommen, Zusammentreffen, Vermischtwerden. |
Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho. Idha yassa te honti aniṭṭhā akantā amanāpā rūpā saddā rasā phoṭṭhabbā dhammā ye vā pan' assa te honti anatthakāmā ahitakāmā aphāsukakāmā ayogakkhemakhāmā yā tehi saddhiṃ saṅgati samāgamo samodhānaṃ missībhāvo ayaṃ vuccati bhikkkhave appiyehi sampayogo dukkho. |
|
|
Und aufgeschreckt aus halbem Schlummer Wilhelm Busch <1832 - 1908>:
Die Fliege. -- 1861 |
||
| Was ist das Leid, das im Getrenntsein von Liebem besteht? Es bedeutet die Nichtverbindung mit erwünschten,lieben, angenehmen Farben und Gestalten, Tönen, Geschmäcken, somatischen Objekten, geistigen Objekten, oder mit nützlichen Wünschen und Genüssen, heilsamen Wünschen und Genüssen, Wohl erzeugenden Wünschen und Genüssen, Wohlstand schaffenden Wünschen und Genüssen, mit Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Freund, Gefährten, Verwandtem, das Nichtzusammenkommen, Nichtzusammentreffen, Nichtvermischtwerden, |
Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. Idha yassa te honti iṭṭhā kantā manāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā ye vā pan' assa te honti atthakāmā hitakāmā phāsukakāmā yogakkhemakāmā mātā vā pitā vā bhātā vā bhaginī vā mittā vā amaccā vā ñātisālohitā vā yā tehi saddhiṃ asaṅgati asamāgamo asamodhānaṃ amsissībhāvo ayaṃ vuccati bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. |
|
|
|
||
Was bedeutet wenn man etwas, das man sich wünscht, nicht erlangt, ist
das leidvoll?
Dies alles kann man aber nicht durch einen Wunsch erreichen. Dies bedeutet wenn man etwas, das man sich wünscht, nicht erlangt, ist das leidvoll. |
Katamaṃ ca bhikkhave yam p' ichhaṃ na labhati taṃ pi dukkhaṃ.
|
|
|
|
||
| Was bedeutet kurz gesagt: die fünf
Grabsch-Konstituentien /
Koordinaten
bedingt entstandenen Daseins sind leidvoll? Nämlich:
|
Katame ca bhikkhave saṃkhittena pañcupādāna-kkhandhā
dukkhā. Seyyathidaṃ rūpūpādānakkhandho vedanupādānakkhandho saññupādānakkhandho saṅkhārupādānakkhandho viññāṇupādānakkhandho ime vuccanti bhikkhave saṃkhittena pañcupādāna-kkhandhā dukkhā. |
|
|
|
||
| Dies, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Leiden. | Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ | |
Mahāsatipaṭṭhānasutta, Dīghanikāya 2, 305 - 307; Nal 2, 227 - 230
| Was, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Entstehung des Leidens: es ist die Gier, die das Entstehen von Leiden bewirkt; die Gier, die Wiederentstehen bedingt, die von Freude und Leidenschaft begleitet ist, die hier und dort ihre Freude findet; die Gier nach Sinnenlust, die Gier nach Werden, die Gier nach Vergehen. | Katamaṃ ca, bhikkhave, dukkha-samudayaṃ ariya-saccaṃ: yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā nandi-rāga-sahagatā tatratarābhinandinī, seyyathīdaṃ kāma-taṇhā, bhava-taṇhā, vibhava-taṇhā. |
| Worauf aber, Mönche, entsteht diese Gier, worauf richtet sie sich? Auf das, was in dieser Welt lieb und angenehm erscheint, entsteht diese Gier und richtet sich darauf. |
Sā kho pan' esā bhikkhave taṇhā kattha uppajjamānā uppajjati kattha
nivisamānā nivisati. Yaṃ loke piyrūpaṃ sātarūpaṃ etth' esā taṇhā uppajjamānā uppajjati ethha nivisamānā nivisati. |
| Was erscheint in dieser Welt als lieb und angenehm? | Kiñ ca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ. |
| 1. [Sinnesorgane]
|
1.
|
| 2. [Objekte der Sinnesorgane]
|
2.
|
| 3. [Bewusstsein in den Sinnesorganen]
|
3.
|
4. [Zusammentreffen von Sinnesorganen mit ihren Objekten]
|
4.
|
5. [Gefühle]
|
5.
|
6. [Wahrnehmungen]
|
6.
|
7. [Wollen]
|
7.
|
| 8. [Gier]
|
8.
|
9. [Denken an]
|
9.
|
10. [In Gedanken verweilen bei]
|
10.
|
| All dies erscheint in dieser Welt lieb und angenehm, auf all dies entsteht diese Gier und richtet sich darauf. | |
| Dies ist die edle Wahrheit von der Entstehung des Leidens. | Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ. |
Mahāsatipaṭṭhānasutta, Dīghanikāya 2, 308 - 310; Nal 2, 230 - 231
| Was, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Beendigung des Leidens: es ist die Beendigung eben dieser Gier durch völlige Leidenschaftslosigkeit, das Aufgeben, Sich-Entäußern, Sich-Loslösen, Sich-Befreien, Unabhängigwerden von dieser Gier. | Katamaṃ ca, bhikkhave, dukkha-nirodhaṃ ariya-saccaṃ: yo tassā yeva taṇhāya asesa-virāga-nirodho, cāgo, paṭinissaggo, mutti, anālayo. |
| Was aber verlässt diese Gier inbezug auf was hört sie auf? Was in dieser Welt lieb und angenehm erscheint, das verlässt diese Gier inbezug auf das hört sie auf. |
Sā kho pan' esā taṇhā kattha pahīyamānā pahīyati kattha
nirujjhamānā nirujjhati. Yaṃ loke piyrūpaṃ sātarūpaṃ etth' esā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati. |
| Was erscheint in dieser Welt als lieb und angenehm? [Antwort wie oben bei der Wahrheit von der Entstehung des Leidens] |
Kiñ ca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ.
... [Analog zur Wahrheit von der Entstehung des Leidens]
|
| Dies ist die edle Wahrheit von der Beendigung des Leidens. | Idaṃ bhikkhave dukkha-nirodhaṃ ariya-saccaṃ. |
Mahāsatipaṭṭhānasutta, Dīghanikāya 2, 310 - 311; Nal 2, 231 -232
Was, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom zur Beendigung des Leidens
führenden Weg: es ist der edle achtgliedrige Pfad, nämlich
|
Katamaṃ ca, bhikkhave, dukkha-nirodha-gāminī paṭipadā ariya-saccaṃ:
ayam eva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathīdaṃ
|
| 1. Was bedeutet rechte Ansicht? Rechte Ansicht ist
|
1. Katamā ca bhikkhave sammādiṭṭhi. Yaṃ kho bhikkhave
ayaṃ vuccati bhikhave sammādiṭṭhi. |
2. Was bedeutet rechte Gesinnung?
|
2. Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkhappo.
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsaṅkhappo. |
3. Was bedeutet rechte Rede?
|
3. Katamā ca bhikkhave sammāvācā.
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvācā |
4. Was bedeutet rechtes Handeln?
|
4. Katamo ca bhikkhave sammākammanto.
ayaṃ vuccati bhikkhave sammākammanto. |
5. Was bedeutet rechter Lebensunterhalt?
|
5. Katamo ca bhikkhave sammāājīvo. Idha bhikkhave ariyasāvako micchājīvaṃ pahāya sammāājīvena jīvitaṃ kappeti ayaṃ vuccati bhikkhave sammāājīvo |
| 6. Was bedeutet rechte Anstrengung? Da bemüht sich ein Mönch
|
6. Katamo ca bhikkhave sammāvāyāmo. Idha bhikkhave bhikkhu
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvāyāmo. |
7. Was bedeutet rechte Achtsamkeit?
|
7. Katamā ca bhikkhave sammāsati. Idha bhikkhave bhikkhu
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsati. |
8. Was bedeutet rechte Sammlung?
|
8. Katamā ca bhikkhave sammāsamādhi. Idha bhikkhave bhikkhu
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsamādhi |
| Dies ist die edle Wahrheit vom Weg, der zur Beendigung des Leidens führt. | Idaṃ vuccati bhikkhave dukkha-nirodha-gāminī paṭipadā ariya-saccaṃ. |
Mahāsatipaṭṭhānasutta, Dīghanikāya 2, 311 - 313; Nal 2, 233 - 234
Mönche, wer diese vier Aufrichtungen der Achtsamkeit derart sieben Jahre
lang entfaltet, der kann eine der folgenden zwei Früchte erwarten:
Es braucht nicht einmal sieben Jahre, auch nach sechs, fünf, vier, drei, zwei, einem Jahr Entfaltung der Aufrichtung der Achtsamkeit kann er eine der beiden genannten Früchte erwarten. Ja dies kann er schon, wenn er die Aufrichtung der Achtsamkeit sieben Monate, sechs, fünf, vier, drei, zwei Monate, einen Monat, einen halben Monat, ja nur sieben Tage lang entfaltet. |
Yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya satta
vassāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave satta vassāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya cha vassāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave cha vassāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya pañca vassāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave pañca vassāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya cattāri vassāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave cattāri vassāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya tīṇi vassāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave tīṇi vassāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya dve vassāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave dve vassāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya ekaṃ vassaṃ tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhatu bhikkhave ekaṃ vassaṃ i yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya satta māsāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave satta masāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya cha masāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave cha masāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya pañca masāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave pañca masāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya cattāri māsāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave cattāri masāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya tīṇi māsāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave tīṇi masāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya dve māsāni tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhantu bhikkhave dve masāni yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya māsaṃ tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhatu bhikkhave māsaṃ yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya aḍḍhamāsaṃ tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
Tiṭṭhatu bhikkhave aḍḍhamāsaṃ yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evam bhāveyya sattāhaṃ tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pātikaṅkhaṃ
|
| Dies ist der einzige und einlinige Weg zur Reinheit der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Untergang von Leid und Unzufriedenheit, zur Gewinnung der rechten Methode, zur Verwirklichung des Nibbāna, nämlich die vier Aufrichtungen von Achtsamkeit, nämlich die vier Aufrichtungen der Achtsamkeit. Was ich gesagt habe, habe ich in Bezug darauf gesagt. | Ekayano ayaṃ bhikkhave maggo sattānaṃ visuddhiyā sokapariddavānaṃ samatikkamāya dukkhadomanassānaṃ atthagamāya ñāyassa adhigamāya nibbānassa sacchikiriyāya yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānā ti iti yan taṃ vuttaṃ idam etaṃ paṭicca vuttan ti |
| So sprach der Buddha. Die Mönche freuten sich zufrieden über diese Worte des Buddha. | Idaṃ avoca Bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandun ti. |
Weiteres bei:
Nāgārjuna: La traité de la grande vertu de sagesse (Mahāprajñāpāramitā´sāstra) / [trad. par] Étienne Lamotte. -- Tome III. -- p. 1311-1328.
Sehr empfehlenswerte Übersetzung des Satipaṭṭhānasutta samt des Kommentars sowie
Auszügen aus den Subkommentaren:
Satipatthāna : Der Heilsweg buddhistischer Geistesschulung : Die Lehrrede von der Vergegenwärtigung des Achtsamkeit (Satipaṭṭhāna-Sutta) / Text und Kommentar übersetzt, eingeleitet und erläutert von Nyānaponika. -- Konstanz : Christiani, 1950.