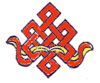
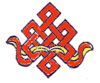
Wir sind miteinander verknüpft
mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Entwicklungsländerstudien / hrsg. von Margarete Payer. -- Teil I: Grundgegebenheiten. -- Kapitel 18: Lebenserwerbs- und Wirtschaftsformen. -- 3. Teil: Hirten, Handwerker, Händler, Dienstleistungsberufe, Sklaven und Zwangsarbeiter, Rentiers / von Carola Knecht. -- Fassung vom 2001-02-22. -- URL: http://www.payer.de/entwicklung/entw183.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2000-01-14
Überarbeitungen: 2018-10-06 [grundlegend überarbeitet von Alois Payer] ; 2001-02-22 [Update]
Anlass: Lehrveranstaltung "Einführung in Entwicklungsländerstudien", HBI Stuttgart, 1998/99
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Bestandteil der Abteilung Entwicklungsländer von Tüpfli's Global Village Library.
Skript, das von den Teilnehmern am Wahlpflichtfach "Entwicklungsländerstudien" an der HBI Stuttgart erarbeitet wird.
11.1. Grundbesitzer
11.2. Geldverleiher
12. Zum Beispiel: Nordindien
Zu Rinderhirten siehe auch:
Entwicklungsländerstudien / hrsg. von Margarete Payer. -- Teil I: Grundgegebenheiten. -- Kapitel 8: Tierische Produktion. -- 1. Rinder / verfasst von Sabine Madel. -- URL: http://www.payer.de/entwicklung/entw081.htm
John H. Bodley fasst die Subsistenzwirtschaft ostafrikanischer Hirtenvölker vereinfachend so zusammen:
"To design a reliable food system based on domestic animals, a subsistence herder must solve several problems:
which animals to use,
what food products to produce,
how many animals to herd,
what age and sex categories to maintain in the herds,
when to slaughter,
when to time breeding,
how to feed and water the herd, and
how to protect the herd from disease and predators.
Whereas hunters let nature take care of most of these matters, herders must constantly attend to the needs of their animals.
Abb.: Hirten mit Zebu-Herde, Uganda, 1994 (Quelle: FAO)
Abb.: Dromedare werden gemolken, die Milch wird dann pasteurisiert bzw. zu Käse verarbeitet, Mauretanien, 1995 (Quelle: FAO)
Most East African pastoralists are considered, and consider themselves, to be cattle peoples because of the dominant cultural role that cattle are assigned, but they actually depend on several functionally distinct domesticates, including cattle, camels, sheep, and goats. Cattle play major social, ritual, and subsistence roles while providing important material products. Camels become increasingly important as rainfall declines or pastures become overgrazed. The Small stock (sheep and goats) may provide more of a household's meat requirements than cattle and can be a significant source of milk. Small stock also are useful to speed recovery alter a serious drought because they reproduce more quickly than cattle. Reliance on animal domesticates makes for a situation that is the reverse of the protein limitation situation in Amazonia. East African pastoralists have an abundance of protein but have some difficulty producing adequate carbohydrates and calories except where they can grow grain or obtain it by barter with neighboring farmers.
Abb.: Ziegenherde kehrt von Sommerweide heim, Afghanistan, 1994 (Quelle: FAO)
Abb.: Schafherde, Togo, 1997 (Quelle: FAO)
Complementarity between domesticates is a striking aspect of pastoral systems. Maintaining mixed herds of large and small grazers and browsers makes for more efficient utilization of available forage and, in a simple way, duplicates the complexity of the natural savanna ecosystem. As grazers, cattle and sheep feed primarily on grasses and herbaceous vegetation; as browsers, goats and camels rely on woody shrubs and trees. Utilization of diverse domesticates also helps level out seasonal fluctuation in food production: Camels offen produce milk year-round, cows produce only during the wet season, and sheep and goats produce most milk during the dry season.
Abb.: Maasai entnimmt einer Kuh am Nacken Blut, Kenia, 1984 (©Corbis)
The diverse animal products that pastoralists consume also have the advantage of complementarity, and they maximize sustainable subsistence yield. Rather than emphasizing meat production, which obviously represents a onetime use of an animal, herders are concerned primarily with milk production. Milk maximizes biological efficiency because the calories in milk can be produced four times more efficiently in terms of energy costs than the calories in meat. Blood and milk can be produced without harm to the animal, and they complement each other in that blood is a major source of iron and can be drawn from animals that are not producing milk. This is especially important for cows when their milk production drops during the dry season. Cattle are not as efficient as goats at meat production, so cattle are rarely slaughtered except ritually, although they will be eaten when they die naturally.
Traditional herding is a labor-intensive activity. Individual herds may be subdivided to better reflect the abilities and requirements of different types of animals. Herds are moved seasonally to take advantage of the best pasture, and in some areas, a regular altitudinal transhumance (moving herds for optimum grazing) may be practiced. Pastoralists manage their herds to maximize the number of female animals to keep milk yields and growth potential high. Given the natural mortality rates of cattle and their reproductive biology, a herd is unlikely to contain more than about 30 percent fertile cows, and only half of these will be producing milk.
The actual number of animals needed to satisfy household nutritional requirements can be theoretically estimated, based on calculations of the annual production of a standard herd; however, there are many variables, and published estimates range from thirty to ninety or more head of cattle per household. Different researchers may use different estimates of household size and daily per capita minimum caloric requirements. The widely accepted figure of 2300 minimum daily kilocalories (kcal) is probably too high because it is based on Euro-American Standards. East African cattle herders are smaller people and should have correspondingly lower energy needs. Furthermore, use of the high-calorie figure inflates minimum herd requirements. Although the production of milk per animal under pastoral nomadism is lower than on European dairy farms, pastoral milk is more concentrated, and its nutritional value is 30 percent higher than that of European milk. Given the archaeological record of pastoralism in East Africa and the incredible resilience of the system under the impact of colonial invasion and recent forces for change, traditional herders seem to be operating quite rationally. Their herding strategies contribute to the long-range survival of their families in a very difficult environment."
[Bodley, John H.: Cultural anthropology : tribes, states, and the global system. -- 3. ed. -- Mountain View, CA : Mayfield, ©2000. -- ISBN 0767411943. -- S. 97 - 100. ]
|
Abb.: Schreiner, Zimbabwe (Quelle: ILO) |
Abb.: Herstellung von Armbändern, Indien (Quelle: ILO) |
|
Abb.: Töpferei, Amman, Jordanien (Quelle: ILO) |
Abb.: Drucker, Ranaketugama, Sri Lanka, 1993 (Quelle: FAO) |
Als Beispiel traditioneller Handwerker seien die Schmuckhersteller Nordafrikas genannt:
"Den Schmuckherstellern in den Maghreb-Ländern und in der Sahara ist nur eines gemeinsam. Ihr Handwerk wird in der Familie vererbt. Werdegang, Spezialisierungsgrad, Ansehen und Wohlstand der Handwerker unterscheiden sich.
Abb.: Juwelier-Geschäft, Marokko (©Corbis)
Abb.: Berber-Schmuck, Marokko (©Corbis)
K. Boujibar beschreibt sehr anschaulich die Lehrjahre eines marokkanischen Silberschmieds. Er durchwandert die Produktionsstätten der Region Sous, er lernt in Tiznit das Emaillieren, in Taguemout die Niello-Technik und lässt sich schließlich in Essaouira nieder. Der Schmuckhersteller scheint in Marokko in aller Regel seine Erzeugnisse auch selbst zu verkaufen. Werkstätten und Verkaufsräume haben ihre Standorte immer in den Suqs (Bazaren) des alten Stadtkerns (der Medina). In Marokko scheint das Handwerk des Waffen- und des Silberschmieds oft von einer Person ausgeübt zu werden.
Der gesamte Schmuckbedarf der Großen Kabylei wird in fünf 700-3000 Einwohnern zählenden Dörfern der Benni Yenni hergestellt. Nach Meinung von H. Camps-Fabrer hat sich hier ein Zentrum der Silberschmiede, aber auch der Waffenschmiede gebildet, weil die Böden zu karg waren, um die dichte, ständig wachsende Bevölkerung zu ernähren. Um 1900 soll es in diesem Gebiet 120 - 130 Werkstätten gegeben haben. Ende der 60er Jahre waren noch 28 Werkstätten übrig. Die Silberschmiede vermarkteten ihre Erzeugnisse nicht selbst, sondern gaben sie an Schmuckhändler ab.
In jüngster Zeit wurden mit Unterstützung der Regierung Verkaufsgenossenschaften gebildet. Eine jetzt starke Exportorientierung der Produktion führte zu einem Wandel der Strukturen der Handwerksbetriebe und mit Rücksicht auf die Nachfrage zur Änderung der Schmuckformen. Welch handwerklich hohes Niveau die Produktion aber auch heute noch hat, zeigt z. B. ein moderner Armreif.
Schwer zu beurteilen ist die Bedeutung des Anteils jüdischer Handwerker an der Schmuckherstellung in den Maghreb-Ländern. In Tunesien sollen nach jüngsten Untersuchungen 60% der geprüften Juweliere Juden gewesen sein. Auch für Marokko wird eine große Anzahl jüdischer Silberschmiede angenommen. Die Silberschmiede der Benni Yenni sollen alle Nachkommen islamisierter Juden sein. Es wäre interessant, der Frage nachzugehen, wie sich die Auswanderung der meisten jüdischen Handwerker in der Zeit nach 1967 auf die zukünftige Entwicklung dieses traditionsreichen Handwerks auswirkt.
Das Ansehen der Schmuckhersteller in Marokko scheint sich in nichts von dem anderer tüchtiger Handwerker zu unterscheiden. Aus der Großen Kabylei wird ausdrücklich berichtet, die Silberschmiede seien dort sehr respektiert.
Die Werkstatteinrichtung der Silberschmiede im Maghreb scheint heute, dem uns zugänglichen Bildmaterial nach zu urteilen, weitgehend jener der europäischen Werkstätten zu gleichen. Von einer bekannten Stuttgarter Werkzeug-Großhandlung erfuhren wir, dass sie in beachtlichem Umfang Juwelier-Werkzeuge nach Nordafrika exportiert.Ein völlig anderes Bild bietet sich uns bei den Handwerkern der Mauren und Tuareg. Wie oben schon erläutert, sind diese Gesellschaften kastenähnlich geschichtet.
In Mauretanien bilden Handwerker, Griots, Fischer und Jäger zusammen die Gruppe der Verachteten. Die Bezeichnung »Handwerker« wurde bewusst gewählt, die Angehörigen dieses Berufsstands sind nämlich die Handwerker überhaupt. Sie übernehmen Grob- und Silberschmiedearbeit, schnitzen Möbelstücke, Holzgefäße, Zeltstangen etc. und fertigen aus Leder Taschen und Zaumzeug. Ihre Frauen beherrschen die Techniken des Webens, Färbens, Flechtens und der Schneiderei.
Die Gründe für die Verachtung der Handwerker sind sicher vielschichtig. Bauern und vor allem Viehzüchter verachten sie, weil sie weder Land noch Herden besitzen und weil sie in ihrer Ernährung total von ihnen abhängig sind. Die Verachtung ist gemischt mit Furcht, weil die Handwerker den gefährlichen Werkstoff Eisen bearbeiten. Die Angst vor dem Eisen ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass dieser Werkstoff bei den Nomaden der Sahara erst seit rund 100 Jahren in Gebrauch ist und als Material zur Herstellung gefährlicher Waffen zu einer grundlegenden Veränderung ihrer Lebensumstände geführt hat. Sicher richtet sich die Verachtung der Bauern und Nomaden aber auch gegen Männer, die Waffen herstellen, ohne sie je selbst zu gebrauchen. Die häufig betonte Abscheu vor der schmutzigen Arbeit des Schmiedes dürfte daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein. Die bisher genannten Gründe führen zur Erblichkeit des Handwerks und dazu, dass Schmiede nur unter sich heiraten können, was dann als weiteres Moment zu ihrer Isolierung beiträgt. Ihre bescheidene Bezahlung entspricht ihrem geringen Ansehen.
Abb.: Tuareg-Mann mit seinen Schätzen, Asni, Marokko (©Corbis)
Auch die »Schmiede« der Tuareg üben alle bei den maurischen Handwerkern erwähnten Tätigkeiten aus. Ihre soziale Situation scheint aber etwas günstiger zu sein. Z. B. berichtet L. Zöhrer: »Die soziale Stellung der Schmiede bei den Imohag-Stämmen (Tuareg-Stämmen, d. Verf.) ist recht eigenartig; sie gehören weder dem Stande der Edlen noch dem der Vasallen an, doch gehören sie zu einem Imohag-Stamm als solchem, ohne dabei einen eigenen Stamm oder eine 'Kaste' zu bilden. Fast könnte man sagen, die Schmiede gehören samt ihrer Familie zur 'Klientel' dieser oder jener Edlen-Sippe. Dabei genießen die Schmiede eine sehr weitgehende Freizügigkeit in ihrer Lebensgestaltung, womit nach ihrer Auffassung auch nicht im Widerspruch steht, dass sie ihren Imohag-Herrn oft nolens-volens auf seinen meist recht langen Zügen begleiten, ja sie sind sogar auf die Imohag-Familie oder den Stamm, dem sie angegliedert sind, stolz et vice versa. «
Neuere Autoren wollen von einer Diskriminierung der Schmiede nichts mehr bemerkt haben. Tatsache ist jedenfalls, dass auch Tuareg-Schmiede nur untereinander heiraten und dass das Gehöft oder Zelt der Schmiedefamilie sich immer ein paar Hundert Meter außerhalb des Dorfes oder Lagers der Gruppe befindet. Bemerkenswert ist, dass Schmiede die Schriftzeichen des Tifinag beherrschen, eine Kunst, auf die sich sonst nur die Tuareg-Frauen verstehen. Sie versehen Ohrringe, Armreife und Amulettbehälter häufig mit ihrer Werkstattsignatur -- was immerhin auf einen gewissen Stolz schließen lässt oder einer Widmung. Die südlichen Tuareg-Gruppen lassen ihren Schmuck häufig auch von Haussa-Schmieden arbeiten.
Abb.: Mauretanischer Handwerker (Photo: D. Jacques-Meunié)
Das für Schmiedearbeiten erforderliche Inventar der mauretanischen und Tuareg-Handwerker ist wenig umfangreich, aber außerordentlich zweckmäßig. ... einen Blasebalg aus zwei Ziegenbälgen ... einen Drillbohrer (Dreule), einen Ziselierhammer, einen Reißzirkel, eine handgeschmiedete Feile und einen ebenfalls geschmiedeten, aber wiederum zur Neutralisierung des Eisens mit einer Inschrift versehenen Amboss. Zur Einrichtung gehören ferner eine Blechschere, Zangen, Punzen und Stichel. Punzen sind Metallstäbchen mit geformten Enden. .. eine Perlpunze ... eine S-Punze ... eine Schrotpunze.... ein Stichel ..."
[[Kalter, Johannes <1945 - >:] Schmuck aus Nordafrika. -- Stuttgart : Linden-Museum, ©1976. -- S. 54 - 62]
*
Abb.: Händler auf Großmarkt in Lahore, Pakistan, 1995 (Quelle: FAO)
Als Beispiel für Händler sei der Transsaharahandel genannt:
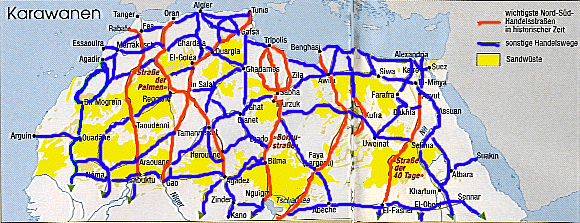
Abb.: Handelswege durch die Sahara
[Vorlage der Abb.: Sahara. -- Hamburg : Gruner + Jahr, ©1992. -- (Geo Special ; 6/92). -- ISBN 3570010899. -- S. 164f. ]
"Erreichte eine Karawane ihren Zielort, so wurden zunächst vor Zeugen die Waren geprüft, anhand von Begleitschreiben und den Warenbündeln beigelegten Inhaltslisten, oft noch vor der Stadt. Verluste gingen zu Lasten der Transporteure. Da unterwegs von den Waren die Wegezölle entnommen wurden, packten die Händler, wie Brulard berichtet, die dafür vorgesehenen Waren außen auf die Bündel, damit sie nicht geöffnet werden mussten. Die geprüften Waren gingen dann in die Depots der Händler, oft Repräsentanten der Auftraggeber, oder über Mittelsmänner in die Hände der Diula (einheimische Händler). Diese stellten die Verbindung zwischen den Fernhändlern und den einheimischen Produzenten her, kontrollierten die Transaktionen und verhinderten direkte Kontakte der Fremden zu den Produzenten. So wurde die Kontrolle des Marktes gewährleistet, der Wirkungsbereich der Fremden limitiert. Die Herkunft des sudanischen Goldes wurde auf diese Weise so gut verschleiert, dass es erst im 19. Jahrhundert zu genaueren Hinweisen kam, und selbst heute noch nicht völlig klar ist, wo nun wirklich die entscheidenden Goldvorkommen lagen. Darüber hinaus wussten die Goldwäscher selbst ihr Geheimnis durch die Praktik des stummen Handels erfolgreich zu schützen. Von einem Versuch, gewaltsam das Geheimnis der Goldherkunft zu erpressen, berichtet Yaqut. Kaufleute fingen einen der Schwarzen, der sich jedoch töten ließ, ohne etwas zu verraten. Daraufhin wurden die Goldlieferungen für drei Jahre eingestellt, bis der Mangel an Salz die Goldwäscher schließlich zwang, den Handel wieder aufzunehmen.
Abb.: Kamelkarawane in Sahara, Mauretanien (©Corbis)
Abb.: Straße durch Sahara, Algerien (©Corbis)
Ursprünglich bezeichnete Diula die Händler der Mande, dem Reichsvolk von Mali (Mande-nka, Mali-nke, das heißt Mande- beziehungsweise Mali-Leute). Inzwischen umfasst dieser Begriff eine Vielzahl von Händlergruppen, die sich aus Angehörigen verschiedener Völker zusammensetzen. Typische Diula sind zum Beispiel die Sarakollé (Marka), Wolof, Kooroko (Bambara-Fulbe-Mischvolk). Auch heute noch beherrschen die Diula weite Anteile des Handels, ständig reisende Agenten, ein Netz von Informanten sowie die kostensparende Mithilfe aller Familienmitglieder sichern zusammen mit Erfahrung und Flexibilität die Effizienz ihres Handelssystems. A. Cohen schildert am Beispiel der vergleichbaren Organisation der Kola-Händler des Haussalandes, der mai-gida (Hausherren, das heißt Händler und Wohnungsgeber für Kunden), deren fast uneinnehmbare Monopolstellung, die bis zur Kartellbildung geht. Volk und Städte hatten praktisch nur wenig miteinander gemeinsam. Aus den Zonen agrarisch-animistischer, im Verwandtschaftsverband lebender Stämme erhoben sich städtisch-islamisch geprägte Zentren, deren Einkünfte und Ideologie vom Fernhandel und den Kontakten mit den Weißen des Nordens bestimmt war. Es entstanden, wie Maquet sagt, «Sociétes à deux niveaus». Ein Vorgang, der sich heute wiederholt, denn wieder sind die Städte Träger und Zentren westlich-industrieller Neuerungen, mit geringer Relevanz für das «Volk».
Die geschilderten komplementären sozioökonomischen Bereiche, der Fernhandel mit seinen städtischen Organisationszentren und der agrarische, dezentralisierte Bereich der Bauern und Hirten spiegeln sich in den unterschiedlichen Markttypen des Sahel prägnant wieder. Der Fernhandel -- von Landesfremden durchgeführt -- benötigt stabile Zwischenstationen, Depots, Ruheplätze und Informationszentren sowie Kontakte zu einem Abnehmer- und Verteilersystem, an das er seine Waren weitergibt und das ihm -- in gewissen Grenzen -- Gewinn und Warenabnahme sichert. Diese Bedingungen erfüllen die Händler der Städte und stadtähnlichen Zentren, wo sie sesshaft und fixiert -- jedenfalls für bestimmte Zeiträume -- einerseits den ankommenden Fernhändlern jederzeit verfügbar sind und andererseits selbst Gelegenheit haben, durch ihre Agenten die Marktlage zu erkunden. Ihren architektonischen Ausdruck finden diese Gegebenheiten in den die Märkte der Karawanenzentren umrahmenden Häuserzeilen der Händlerbutiken, den Konglomeraten der Händlerviertel. Assoziiert sind meist, mehr oder weniger belebte ständige Märkte, da im Gefolge der Großhandelstransaktionen auch der Detailhandel floriert. Die Karawanenleute statten sich neu aus, verkaufen auch Waren außerhalb des Großhandels, und schließlich bedingt jede größere, ständige Siedlung durch die konstante Nachfrage ein mehr oder weniger gleichmäßiges Warenähgebot. In Städten ist auf dem Markt immer «etwas los», die entscheidende wirtschaftliche Bedeutung aber liegt bei den Großhändlergruppen, von denen die Reichsten kaum je auf dem Markt erscheinen, schon um der offiziellen Kontrolle und den Beobachtungen der Konkurrenten zu entgehen. In Gao erlebte ich einmal den «Patron» einer großen Butike, Depot für den Transport Adrar - Gao. Im Laden war nur ein Gehilfe, der Patron war, wie so oft, «nicht da». Es ging um zwei schöne, große Tuaregledersäcke, die ich in einer Ladenecke entdeckt hatte. Der Gehilfe nahm uns mit in die Wohnung. Nach der Bewirtung mit Tee auf der Dachterrasse, im Kreise der Familie, begann der « Patron», würdevoll in kostbaren Gewändern auf einem Teppich liegend, uns derart überhöhte Preise abzuverlangen, dass kein Handel zustande kam. Er ließ uns deutlich spüren, dass es ihm völlig gleich sei, ob wir kauften, und er meinte zu Recht, er hätte Zeit zu, warten, und irgendwann bekäme er diesen Preis.
Einige Charakteristika der Fernhändler, beziehungsweise der sesshaften städtischen Händler wurden hier schon deutlich. Sie handeln auf der Basis ausreichender Kapitalreserven, gesichert durch Sparsamkeit und geschicktes Ausnutzen der Marktsituation, vor allem aber durch die Absicherung innerhalb des von ihnen beherrschten Systems. Ihre Waren sind unverderblich, oder zumindest lange haltbar, sie können gehortet und entsprechend der Marktlage verkauft werden. Hier drückt kein nahender Abend den Preis, hier drängt keine Sorge um die Herden, der Händler ist in seiner vertrauten Umgebung und nicht wie der Nomade oder Bauer auf dem Wochenmarkt gezwungen, sich kurzfristig auf eine Situation einzustellen, adäquat zu reagieren, wieder weiter oder nach Hause zu gehen. Dagegen zeigen die Händler die Überlegenheit ihrer Position schon in ihrem Verhalten, geben sich desinteressiert, und selbst die Reichsten pokern mit unermüdlicher, keiner Eile unterworfenen Hartnäckigkeit um die geringste Gewinnspanne. Meist relativ einfach gekleidet, sind sie schwer nach ihrem Reichtum abzuschätzen. Typische Waren des Fernhandels sind heute neben europäischen Importwaren -- vom Transistorradio bis zum Emailgeschirr, Butangas-Dosen und Autozubehör usw. -- die Basisprodukte an Lebensmitteln, wie Reis, Hirse, Mais, Weizen, -- auch aus Spendenlieferungen. (Während der Dürre wurde überall im Niger von einem algerischen Getreide-Konvoi erzählt, der leergekauft war, bis er endlich im Niger ankam.) Weitere Fernhandelsgüter sind
Kolanüsse, die ein eigenes Marktsystem in Gang halten, Zucker, Salz, Datteln, Nudeln, Kleider- und Turbanstoffe sudanischer, nordafrikanischer und europäischer Herkunft. So nennt Brulard eine Stoffsorte kanbridj (nach Cambridge), englische Stoffe waren Standardartikel im Sudan neben den einheimischen Webstreifen gabaga oder turkudi, die Werteinheit, Zahlungsmittel und traditionelles Geschenk, obligatorischer Bestandteil des Brautpreises (zum Beispiel bei den Fali) waren. Der Import europäischer Eisenwaren, Waffen und Klingen hat ebenfalls eine alte Tradition. Barth notierte die häufigen Klingen aus Solingen (wie vielleicht oft zu sehr betont wird, denn der größte Teil kam aus Spanien, und auch die afrikanischen Schmiede waren nicht untätig). In Timbuktu vermisste er die in Agadez und Kano verbreiteten importierten «steirischen Rasiermesser». Neben dem Handel, das heißt dem Verkauf, verdienen die Großhändler auch am Geldverleih. (Barth zum Beispiel musste einem Händler in Kano 100 Prozent Zinsen zahlen, ein Satz, der heute auch in Mauretanien noch üblich ist, was einer meiner mauretanischen Bekannten mit dem Satz «Alle Händler, sind Schufte, sonst sind sie keine Händler», ein Händler dagegen mit der Erklärung « Man macht Handel, um zu gewinnen nicht um zu verlieren» kommentierte.) So sehen wir also in den unscheinbaren Butiken, angefüllt mit, verstaubten, angenagten Warenstapeln, verschnürten Bündeln und Warensortiments auf schiefen Regalen, bewacht von meist Tee trinkenden Händlergrüppchen die eigentlichen Organisations- und Verteilerzentren. Fernhandel heißt in der Regel Großhandel, deshalb ist das Handelsgeschehen von Depot zu Depot weniger spektakulär und nicht so unmittelbar auf die Einzelkunden bezogen wie das lebhafte Marktgeschehen der Wochenmärkte. Kraftfahrzeuge haben heute die Lastkarawanen des Fernhandels größtenteils ersetzt, doch die Strukturen des Transport- und Verteilersystems, ausschließliche Domäne der Männer, haben sich nur geringfügig entsprechend der schnelleren Kommunikationssysteme verändert. Auch heute noch erhält der Chef einer Händlerfamilie diula-ba von seinem Informanten ja-tigi per Telefon oder Telegramm Nachricht über eine günstige Einkaufsmöglichkeit, und schickt dann seinen Handelsagenten und Einkäufer diula-den aus, um die Ware zu erwerben.
Abb.: Am Transsahara-Highway, Algerien, 1995 (©Corbis)
Abb.: Timbuktu, Mali (©Corbis)
Wächter, Nutznießer und Durchführende der Karawanen waren die Nomaden, sich mit ihnen zu arrangieren, Schutz vor ihren Überfällen zu finden, war Voraussetzung des Handels. Die Unsicherheit der Karawanenwege wurde allerdings in vielen Darstellungen sehr übertrieben, das Erheben von Wegezöllen, in sämtlichen sesshaften Ethnien verbrieftes Recht der Herrschenden, wurde bei den Nomaden der Wüste a priori als Unrecht betrachtet. «Und diese Wüste hat viele Teufel», schrieb schon Ibn Battuta. Nach den Arabern hatten auch die französischen Kolonialherren ein naheliegendes Interesse daran, die Anarchie der Sahara herauszustellen, um ihr Vordringen als Ordnungsmacht zu legitimieren, die «Pacification» voranzutreiben. Zwar erreichten sie viele Gebiete in dem Zustand des Verfalls und wechselseitiger Kämpfe der Einheimischen, doch darüber hinaus wurde bewusst davon abgelenkt, dass die Wegeunsicherheit und das Chaos in manchen Regionen oft die Folge der Eroberungskriege war. Auch war der Zustand kontinuierlicher Kleinkriege nicht auf die Nomaden beschränkt. ... Die den Nomaden zu entrichtenden Abgaben waren genau festgelegt, entsprachen der Zahl und dem Wert der Waren, sie verpflichteten die Nomaden zum Geleitschutz innerhalb ihres Gebietes. Die Wege unterstanden der Kontrolle bestimmter Stammesgruppen, so wurde zum Beispiel die Route Ghadames-Agadez über Ghat im Norden von Ajjer T'uareg, im Mittelteil von den Isakkamaren und bei Erreichen des Air von den Kel Owi und dem Sultan von Agadez bewacht. Die Waren von Kano, so konstatierte Barth, erreichten Timbuktu nicht etwa auf dem direkten Weg über Sokoto, Gao, entlang des Niger (etwa 1500 Kilometer Luftlinie), sondern der größeren Sicherheit wegen über die Sahara, von Kano zogen die Karawanen über Agadez nach Ghat, über das Tidikelt nach Timbuktu (3700Kilometer Luftlinie). Die Ghadameskaufleute verfügten, nach Duveyrier, über «solide Allianzen mit den Tuareg». Kranke Nomaden wurden in Ghadames gepflegt und bewirtet, überall, auf den Routen fanden sich Warendepots, die von allen respektiert wurden, auch wenn sie ein Jahr dort lagerten. Um die Kamele zu schonen, wurde zum Beispiel der halbe Proviant nach der ersten Hälfte der Strecke abgelegt, wo er bis zur Karawanenrückkehr blieb. Auch die Lasten verendeter Kamele wurden deponiert, um später nachgeholt zu werden. Er schreibt: «... die Einkünfte des saharischen Handels sind enorm und die Risiken beinahe gleich Null, wenn der Händler sich den im Lande respektierten Sitten unterwirft.»"
[Ritter, Hans <1944 - >: Salzkarawanen in der Sahara. -- Zürich : Atlantis, ©1980. -- S. 146 - 157]
Aus der unüberschaubaren Fülle von Dienstleistungsberufen können nur einige Beispiele genannt werden:
Knechte und Mägde
Dienstboten
"Frauen in der »Negerhütte«
In der Schweiz und anderen hochentwickelten Industrieländern können sich nur wenige den Luxus einer Hausangestellten leisten -- im Drittweltland Brasilien dagegen gehört die Empregada in jedem normalen Haushalt der Mittelschicht einfach dazu, ganz gleich, ob er aus vier Personen oder nur aus einer besteht. Gut Betuchte halten sich zehn und mehr Hausbedienstete, unter ihnen Köchin, Kindermädchen, Putzfrau und Serviererin. Aber auch für den ökologisch-progressiv eingestellten Schullehrer oder den kommunistischen Abgeordneten in Rio, São Paulo oder Salvador de Bahia gilt Hausarbeit als dreckig, unfein, unwürdig. Ganz wie zur Sklavenzeit überlässt man diese deshalb der lächerlich niedrig bezahlten schwarzen Empregada.
Zu Hause rund um die Uhr bedient zu werden, so erklären Intellektuelle unumwunden, gehöre zu den Werten brasilianischer Kultur. Die Architekten projektieren nach wie vor Wohnblocks mit winzigen Hausdienerinnen-Alkoven ohne Fenster oder Luken nach außen. Für mehr als Bett und Stuhl reicht der Platz meist nicht; die Tür führt gewöhnlich direkt in die Küche, zum Spülstein. Keineswegs selten werden diese Verschläge noch wie damals Senzala (Negerhütte) genannt -- in scherzhaftem Tone, versteht sich.
Drei Millionen Brasilianerinnen, nach anderen Erhebungen sogar ein Drittel aller weiblichen Beschäftigten, sind Dienstmädchen. Hinzu kommen Hunderttausende von Minderjährigen und sogar Kinder unter zehn Jahren, die in städtischen Haushalten der unterentwickelten Nordostregion völlig ohne Bezahlung schuften. Vor allem »Mittelschichtler« machen sich dort den Umstand zunutze, dass bitterarme Eltern in den Dürregebieten des Hinterlandes nicht wissen, wie sie ihre meist aus sieben, neun oder gar zwölf Kindern bestehende Nachkommenschaft satt bekommen sollen, und deshalb geradezu froh sind, wenn eines in der Stadt Kost und Bett hat.
Der relativ hoch entwickelte Süden Brasiliens bildet dagegen traditionell die Ausnahme von der Regel: Die hier siedelnden mitteleuropäischen Einwanderer, meist Deutsche, Schweizer und Italiener, lehnten im vergangenen Jahrhundert überwiegend aus ethischen Gründen die Beschäftigung von Sklaven ab. Heute trifft man in den Haushalten der Nachfahren auffällig selten eine Empregada; mit der Hausarbeit wird man dort auf sehr ähnliche Weise fertig wie in der Schweiz oder in Deutschland.
Die Schöpfer der seit 1988 in Kraft befindlichen neuen Verfassung Brasiliens hielten zwar Verbesserungen des rechtlich-sozialen Status der Empregadas für unumgänglich, eine Gleichstellung mit den übrigen Beschäftigten blieb jedoch bezeichnenderweise aus. Hausangestellte -- sie werden ohne weiteres auch noch morgens um zwei Uhr zum Kaffeemachen aus dem Bett geholt -- haben im Unterschied zu den anderen Berufsgruppen weiterhin kein Anrecht auf geregelte Arbeitszeit, auf Familienzuschläge, auf eine Unfallversicherung oder auf ein bescheidenes Entlassungsgeld. Auch in Brasilien stehen den Arbeitnehmern inzwischen zumindest auf dem Papier 30 Ferientage zu, Samstag und Sonntag sind frei. Nicht so für die fast durchweg dunkelhäutigen Empregadas -- denen billigten die Senatoren und Abgeordneten des Nationalkongresses nur 20 Ferientage und den freien Sonntag zu. Das Gehalt eines Abgeordneten im Parlament reicht derzeit theoretisch aus, um monatlich rund 115 Empregadas zu bezahlen, das entspricht dem offiziellen Mindestsalär von umgerechnet knapp 100 Mark.
Die Kühnheiten der Verfassungsväter zugunsten der Hausangestellten lösten zunächst vor allem in der Mittelschicht Brasiliens einen Sturm der Entrüstung aus. Inzwischen weiß man, dass sich kaum jemand an die neuen Bestimmungen hält und immer noch zu niedrige Löhne bezahlt werden. Dunkelhäutige Frauen haben auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen, und die Empregadas müssen ihre Entlassung gewärtigen, falls sie auf ihre neuen Rechte pochen. Dennoch zeichnet sich eine leichte Besserung ab: In einigen Großstädten, darunter in Rio de Janeiro und Belo Horizonte, bildeten sich Hausangestellten-Gewerkschaften, deren Anwälte erste Prozesse vor Arbeitsgerichten anstrengten -- und sogar gewannen.
In den »besseren« Häusern Mitteleuropas gab es früher den Dienstboteneingang. Auch in Brasilien mag man bis heute noch nicht überall mit einer Empregada im selben Lift fahren. Sie ist daher gehalten, die Treppe oder den Warenlift zu benutzen. In einem Wohnblock in Rio wurde der einzige Lift apartheidmäßig in der Mitte durch eine Zwischenwand geteilt.
Schweizer oder Deutsche, die im Auftrag von Unternehmen beziehungsweise Institutionen zeitweise in den beiden Wirtschaftszentren São Paulo und Rio de Janeiro tätig sind, haben sehr oft größte Schwierigkeiten, sich den Andersartigkeiten und Gepflogenheiten des Gastlandes anzupassen. Die Anstellung, einer Empregada, die die Schuhe putzt, aufwäscht, einkauft und die Drinks auf die Terrasse bringt, gehört gewöhnlich nicht zu den nur schwer zu erlernenden Sitten."
[ Hart, Klaus: Frauen in der »Negerhütte«. -- In: Neue Zürcher Zeitung. -- ©1990-06-09. -- Wieder abgedruckt in: Zum Beispiel Dienstmädchen / Redaktion: Ekkehard Launer ... -- Göttingen : Lamuv, ©1995. -- (Lamuv Taschenbuch ; 183). -- S. 51 - 54. -- ISBN 3889774296. ]
religiöse Funktionäre, Schamanen, Magier, Heilige
|
Abb.: Schamane, Papua Neuguinea (©Corbis) |
Abb.: Der anglikanische Erzischof Desmond Mpilo Tutu (geb. 1930), Friedensnobelpreisträger (1984), (zusammen mit Nelson Mandela) Südafrika, 1990 (©Corbis) |
|
Abb.: Der 14. Dalai Lama Bstan-'dzin-rgya-mtsho (geb. 1935), Friedensnobelpreisträger (1989), Dharmasala, Indien, 1989 (©Corbis) |
Abb.: Sadhu (selbsternannter Hindu-Heiliger), Kathmandu, Nepal (©Corbis) |
Da religiöse Institutionen neben den Gebühren und Abgaben der Gläubigen oft Stiftungen, Pfründen, große Schenkungen erhalten, werden sie oft zu Großgrundbesitzern, Eigentümern von Kapitel usw. und damit wichtigen Wirtschaftseinheiten:
Abb.: Vaishnava-Hinduismus: Tirupati, Indien: Venkateshwar-Tempel, der reichste Tempel Indiens |
Abb.: Katholizismus: Inneres der Klosterkirche des Benediktinerklosters Monasteiro de São Bento do Rio de Janeiro, Brasilien: ein echter Kontrast zur Armut vieler Brasilianer |
|
Abb.: Tibetischer Buddhismus: Kloster Thikse, Ladakh, Indien, 1993 (©Corbis) |
Abb.: Theravādabuddhismus: Dalada Maligava --Tempel des hl. Buddhazahns, Kandy, Sri Lanka, einer der größten Großgrundbesitzer Sri Lankas |
Heilkundige
kommerzielle Sexarbeiter (Prostituierte)
Berufsbettler
Militärpersonen

Abb.: "Lustig ist das Soldatenleben": MPLA-Soldaten verprügeln einen UNITA-Verdächtigen, Angola, 1993 (©Corbis)
|
Abb.: J. F. Kennedy mit Major General Joseph Mobutu
(©Corbis) |
Abb.: Fidel Castro mit zwei Guerillas während des
Kampfes gegen das Batista-Regime, Kuba (©Corbis) |
|
Abb.: Yasir Arafat bei einer Rede im Libanon
(©Corbis) |
Abb.: Präsident Suharto, Indonesien (©Corbis) |
|
Abb.: Präsident Franco speist zusammen mit Kronprinz Juan Carlos und Präsident Stroessner, Madrid, Spanien, 1973 (©Corbis) |
Abb.: General Idi Amin, 1975 (©Corbis) |
Regierungsbeamte und andere Schreibtischberufe
|
Abb.: Arbeitsamt, Harare, Zimbabwe (Quelle: ILO) |
Abb.: Stadtverwaltung, Côte d'Ivoire (Quelle: ILO) |
usw. usw.
Sklaverei und Zwangsarbeit gehören nicht der Vergangenheit an, wie der folgende Artikel von 1995 zeigt:
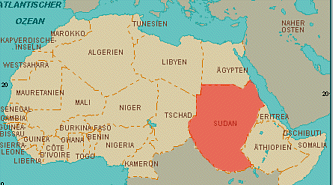
Abb.: Lage des Sudan (©Mindscape)
"Sudan: Wiederbelebung der Sklaverei Alang Ajaks schlimmste Alpträume wurden wahr, als sie gerade von ihren toten Eltern träumte. Ihr schien, ein Eindringling hätte sie an der Kehle gepackt und drückte ein heißes Eisen in ihr Fleisch.
Als sie die Augen öffnete, stellte die zehn Jahre alte Alang entsetzt fest, dass es kein Traum war sie war ein weiteres Opfer der Brandzeichnung von Sklaven, ein Phänomen, eingeführt durch einige sudanesische Araber, die die Sklaverei nach über 100 Jahren wiederbelebt haben. Der Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden eröffnet ihnen vielfältige Möglichkeiten für Beute in Form von Menschen. Die meisten sind Christen oder Animisten aus dem Süden, die gezwungen werden, arabische Namen anzunehmen und zum Islam überzutreten.
Jenseits des Flusses, wo sie gefangen gehalten wurde, liegt 125 Meilen nördlich von Khartoum die Stadt Shendi, im 19. Jahrhundert Sudans Zentrum des Sklavenhandels. Der ägyptische Markt für den Sklaven-Export besteht zwar nicht mehr. Doch Vertriebene aus dem Süden behaupten, dass Shendi immer noch als Zwischenstation auf dem Weg nach Port Sudan dient, von wo aus die Jungen und Mädchen in die Golfstaaten verschifft werden. Sklaven, bestimmt für Libyen, Tschad und Mauretanien, werden westwärts verfrachtet nach Mellit in der Provinz Nord-Dafur.
Alangs Schicksal hätte es sein können, als Dienerin bei einer der reicheren Familien am Golf zu landen. Doch sie blieb im Sudan. Der sudanesische Händler, der sie als Sechsjährige im Süden erstanden hatte, schenkte sie seinem Sohn Abdel Rahmau und seiner Schwiegertochter Zeinab.
Es war Zeinab, die beschloss, Alang zu brandmarken, »für den Fall, dass du unter den anderen schwarzen Huren verlorengehst«. Während sie die Narbe über ihrem Knie zeigt, sagt Alang, heute vierzehn, über ihre frühere Herrin: »Zeinab war sehr schlecht. Ich musste von früh bis spät arbeiten. Wenn sie mich erwischte, wie ich nach meiner Mutter weinte, nahm sie ein Küchenmesser und schrie:'Sei still, oder ich schneide dir die Kehle durch.' Nachdem sie mir wie einem Tier das Brandzeichen beigebracht hatte, schaffte ich es, in ein Hospital in Shendi zu gelangen.«
Zwei Jahre später, als sie gerade Zeinabs Ziegen fütterte, kam ein Fremder. »Er fragte mich nach den Namen meiner Eltern. Er fragte mich auch, wie ich heiße, und ich nannte den Namen, den sie mir in Shendi gegeben hatten -- Toma Abdel Rahman Sadig.
Ich konnte mich nicht an den Namen meiner Mutter erinnern, aber als ich an sie dachte, antwortete ich automatisch 'Ajak'. Der Fremde sagte daraufhin: 'Ich bin dein Bruder Ajong.' Am nächsten Morgen kam er wieder, mit der Polizei, und brachte mich nach Shendi.«
Abdel Rahmau und seine Frau wurden verhaftet -- und wieder freigelassen, weil die Polizei behauptete, es gebe keine Beweise für ihre Beteiligung an Alangs Entführung.
Die Militärregierung von Sudan, angeklagt, über die allgegenwärtige Sklaverei hinwegzusehen, versucht mit aller Macht, unabhängige Untersuchungen zu verhindern. Reporter werden durch die Geheimpolizei schikaniert, und einheimischen Akademikern ergeht es nicht besser.
Professor Ushari Ahmad Mahmoud, Autor von »Menschenrechtsverletzungen im Sudan«, war zwei Jahre lang im Gefängnis, weil er das Wiederaufleben der Sklaverei aufdeckte. Die Regierung wollte ihn nur entlassen, wenn er den Text seiner Veröffentlichung abänderte.
»Normalerweise läuft es so ab, dass bewaffnete arabische Milizen in den Dörfern im Süden oder in den Nuba-Bergen einfallen«, sagt Mahmoud. »Gewöhnlich nennen sie das ghazzu -- einen Überfall. Sie brennen die Dörfer nieder, die Männer werden getötet, wenn es ihnen nicht gelingt zu entkommen, Frauen und Kinder werden zusammengetrieben.
Diese Überlebenden werden zusammengebunden und in den arabischen Norden geschafft. Dann werden sie unter den am Überfall Beteiligten aufgeteilt. Sie können verkauft werden, es gibt allerdings keine Auktionen wie früher. Die Frauen und Kinder müssen auf den Feldern arbeiten, als Viehhirten und Wasserträger, oder im Haushalt alles ohne Lohn.«
Frauen und Mädchen müssen auch als Konkubinen, khadam, dienen. Wem es gelingt, zu entkommen, kann nicht gezwungen werden, zurückzugehen, weil es dafür keine gesetzlichen Bestimmungen gibt. Aber es kann passieren, dass, wer gefangen wird, getötet wird. Um Fluchtversuche zu verhindern, werden Sklaven manchmal gebrandmarkt. Menschenrechtsaktivisten haben Beweise dafür, dass Armeeoffiziere persönlich am Handel mit Kindern beteiligt sind. Offiziere nehmen sich zwei oder drei Kinder als Kriegsbeute, die später als Geschenke bei besonderen Anlässen vergeben werden.Einer der bekanntesten Anwälte Sudans, der nicht genannt werden will, sagt, es gibt noch einen anderen Grund, warum die Regierung die Entführung von Kindern aus dem Süden nicht wahrhaben will. »Die Regierung hat die Idee, sie zu bekehren, damit sie im Süden im Namen des Islam kämpfen können.
Sie werden auch als lebende Blutbanken für Soldaten aus dem Norden benutzt. Sechs Meilen außerhalb von Khartoum im Lager Um El Gus leben Hunderte von Kindern. Bei jeder größeren Schlacht werden sie zum Blutspenden zusammengetrieben. Anschließend bekommen sie Saft als Belohnung.«
Die Jungen und Mädchen, die die Armee fängt, sind kostenlos. In anderen Teilen des Landes hat dagegen jeder Sklave einen festen Preis, berichtet ein Mitglied des jüngst gegründeten Komitees zum Auffinden entführter Kinder. Ein Jugendlicher bringt in Ed-Daein, Süd-Dafur, etwa 4 000 sudanesische Dinars (umgerechnet etwa 170 DM), in Garangshek, Süd-Kordofan, steigt der Preis auf 8 000 Dinar, in Gozwich, näher an der libyschen Grenze, sind es bereits 13 000 Dinar.
»Tausende sind vermutlich zu Sklaven gemacht worden«, sagt ein Sprecher von »amnesty international«. »Die Bedingungen dafür sind alle gegeben: ein Krieg, ein desorganisiertes Land, große Entfernungen, abgelegene Gebiete, in denen Menschen ohne Kontrolle durch die Regierung tun können, was sie wollen. Diese Umstände gipfeln in Entführung und Sklaverei.«"
[Bhatia, Shyam. -- In: The Observer. -- 1955-04-09. -- Übersetzt in: Zum Beispiel Sklaverei / Redaktion: Uwe Hoering. -- Göttingen : Lamuv, ©1995. -- (Lamuv Taschenbuch ; 184). -- S. 55 - 59. -- ISBN 388977430X. ]
Rentiers sind Personen, die vom Ertrag ihres Eigentums -- Boden, Immobilien, Produktionsstätten, Produktionsmittel, Aktien usw. -- leben. Wichtige Formen von Rentiers sind u.a.
Das Folgende ist eine Beschreibung des Verhältnisses zwischen Grundbesitzer und Pächter im traditionellen Ostasien:
"Landlord-tenant relations in East Asia Despite the superficially despotic central government, the landlord was primarily dependent upon the goodwill of the tenant if he was to get his rent. It is true that, should the tenant refuse to pay the rent, the landlord could ask for help from the magistrate, but such aid, in the short run at least, might prove to be very costly, as the landlord would be saddled with all court costs besides having to satisfy those greedy lower officials upon whose goodwill he had made himself dependent. Thus it was better for both parties, tenant and landlord, to keep the central government at a distance--especially military officials. The tenant, of course, normally paid the rent. For him not to do so and present no excuse would be tantamount to rejecting the landlord's right to the land. But the actual amount to be paid was open to negotiation. If drought, flood, too much rain at the wrong time of year, insect plagues, or other factors adversely affected the harvest, it was the landlord's obligation to remit as much of the rent as necessary for the tenant to live. The tenant was in a better position to know the actual growing conditions and the real condition of the harvest. If good kan-ch'ing existed, the landlord would not press overly for the rent, and the tenant would be fairly honest about paying it in good years.
The lack of security in rural areas meant that good relations between landlord and villager were necessary to protect the landlord against bandits. In an area in which the gentry were well respected, they were able to maintain an effective militia (mostly composed of villagers) for the defense of the village and their own property. But if the villagers hated the landlord, residents of the rural area where he lived might offer him no protection against bandits coming from a neighbouring area or might simply attack him themselves.
More symbolic contributions made by tenants to the landlord consisted of gifts of food and produce presented at festivals. During rites of passage (at birth, marriage, death, etc.) in the landlord's house, tenants as well as freeholders would contribute labour. The landlord would make monetary contributions to his neighbours when they needed help. Tenant children often worked as domestics in the "big house," and sometimes a landlord would take a tenant girl to be his "little wife" (second, subordinate spouse). The tenant was courteous to the landlord, calling him "master" or "elder."
In addition to forgiving rents at times of distress to the tenant who fulfilled his obligations, the landlord acted as an intermediary between the rural area and the functionaries of the central government. He had the poise, education, and background that made it possible for him to argue the case for an accused villager or attempt to have the tax rate adjusted or obtain a pai-lou ("memorial") in honour of a faithful widow or earnest local historian. It was also expected of landlords to obtain financing for bridges, schools, temples, and other semipublic buildings. With the aid of the village headman, the landlord organized the maintenance of public works by means of corvée labour (labour exacted in lieu of taxes). At the village level this was probably more like a series of days of cooperative community effort than unrewarded drudgery. This unofficial body of village headman and landlord was also responsible for morality in the community. They often helped to work out a compromise in a dispute or even acted as judges. During the Ch'ing dynasty they were responsible for bimonthly public readings of the emperor K'ang-hsi's "Sacred Edict" (Sheng yü):
Be filial and respect the social relationships, be frugal and diligent, esteem scholarship and eschew unorthodoxy, be law-abiding and pay your taxes.
Sometimes local children were taught along with the children of the "big house" by a tutor, or a school was established elsewhere for the neighbourhood, usually at the Classical (Confucian) temple. These illustrations indicate only some of the functions of the client-patron system of government.
The burdens of this system lay initially upon the tenant but tended to drain the resources of the landlord. It is difficult to imagine a landlord maintaining good kan-ch'ing and making a great deal of profit from his landholdings. But, by investing in urban-based enterprises, such as pawnshops, grain shops (in which a surplus could be sold at times of greatest demand), and small industries, the gentry could recoup its losses.
It was difficult to become wealthy through the ownership of land alone and thereby to acquire gentry status because of the rules of equal inheritance by all the male heirs. Wealth was often initially acquired in the cities or, if acquired in the countryside, frequently by such dubious means as banditry. Later this wealth was transferred to land both for economic security and for social prestige.
[East Asian people : landlord-tenant relations. -- In: Encyclopedia Britannica™ deluxe CD2000. -- Bristol : Britannica, © 1994-2000. -- 3 CD-ROM]
Muhammad Yunus schildert im Folgenden sehr anschaulich eines der Erlebnisse 1974 in Jobra, Chittagong, Bangladesh, die ihn dazu bewogen haben, die Kleinstkreditbankbewegung Grameen zu gründen [Webpräsenz: http://www.grameen-info.org/. -- Zugriff am 2001-02-22].

Abb.: Lage von Chittagong (©Mindscape)
"Jobra war in drei Wohngebiete aufgeteilt, eins für Moslems, eins für Hindus und eins für Buddhisten. Wenn wir einen Besuch im buddhistischen Wohnviertel machten, nahmen wir unseren Studenten Dipal Chandra Barua mit; er entstammte einer armen buddhistischen Familie aus Jobra und zeigte sich immer hilfsbereit. Eines Tages stießen Latifee und ich auf ein völlig verfallenes Haus, vor dem eine Frau gerade Bambusrohr zurechtschnitt, um daraus einen Hocker zu bauen. Wir mussten nicht erst unsere Phantasie bemühen, um uns vorzustellen, dass ihre Familie nur mit größter Mühe über die Runden kam.
»Ich möchte mich mit ihr unterhalten«, sagte ich.
Latifee führte mich zwischen den Hühnern durch den Gemüsegarten zu ihr.
»Ist da jemand?« fragte er mit freundlicher Stimme.
Die Frau saß unter dem Dach aus verfaultem Stroh vor der Treppe ihres Hauses und war ganz in ihre Arbeit vertieft. Sie hockte auf dem Boden, hielt den halbfertigen Hocker zwischen die Knie geklemmt und war damit beschäftigt, die einzelnen Stränge der Bambusfasern zu flechten. Als sie Latifees Stimme hörte, ließ sie sofort ihre Arbeit fallen und verschwand in ihr Haus.
Abb.: Bambusbearbeiterin (©Grameen)
»Sie brauchen keine Angst zu haben«, sagte Latifee. »Wir sind keine Fremden. Wir unterrichten beide an der Universität und sind also Nachbarn. Wir möchten Ihnen nur ein paar Fragen stellen.«
Vom herzlichen Ton Latifees beruhigt, antwortete sie leise: »Es ist niemand zu Hause.«
Damit meinte sie, dass sich kein Mann im Haus aufhielt. In Bangladesch sprechen Frauen in der Öffentlichkeit im allgemeinen nicht mit einem Mann, es sei denn mit einem nahen Verwandten.
Im Hof spielten und hüpften nackte Kinder. Nachbarn tauchten auf, sahen uns neugierig an und fragten sich, was wir hier zu suchen hatten.
Im moslemischen Wohngebiet des Dorfs mussten wir oft durch ein Bambusgitter hindurch mit einer Frau sprechen, wenn wir sie befragen wollten. Die moslemische Sitte des Purdah (wörtlich »Vorhang« oder »Schleier«), die verlangt, dass sich verheiratete Frauen praktisch von der Außenwelt isolieren, wurde in Chittagong strikt eingehalten. Aus diesem Grunde nahm ich manchmal Zuflucht zu einer weiblichen Vermittlerin, einer Studentin oder einer Schülerin aus dem Ort, wenn ich Informationen zu erhalten wünschte.
Da ich in Chittagong zur Welt gekommen bin und den regionalen Dialekt spreche, fiel es mir leichter als einem Fremden, das Vertrauen der Dorfbewohnerinnen zu gewinnen. Trotzdem war es schwierig. ...
Ich wollte einen nackten kleinen Jungen auf den Arm nehmen, aber er fing an zu weinen und lief schnell zu seiner Mutter.
»Wie viele Kinder haben Sie?« fragte Latifee sie.
»Drei.«
»Der hier ist sehr hübsch«, sagte ich.Nachdem sich die Mutter beruhigt hatte, erschien sie wieder auf Schwelle. Sie war kaum älter als 20. Dünn, dunkelhäutig, schwarzäugig und mit einem roten Sari bekleidet, ähnelte sie jeder aus dem Heer von Millionen Frauen, die von morgens bis abends arbeiteten und doch nicht aus ihrem Elend herausfanden.
»Wie heißen Sie?«
»Sufia Begum.«
»Wie alt sind Sie?«
»21.«Ich benutzte weder Stift noch Notizblock, denn das hätte sie verschrecken können. Die Notizen wurden von meinen Studenten gemacht, die anschließend noch einmal kamen.
»Gehört Ihnen dieser Bambus hier?« fragte ich.
»Ja.«
»Wie beschaffen Sie sich den?«
»Ich kaufe ihn.«
»Wieviel bezahlen Sie dafür?«
»Fünf Taka.« (Damals der Gegenwert von 22 Cent.)
»Haben Sie diese fünf Taka?«
»Nein, die leihe ich mir von den paikari.«
»Von den Zwischenhändlern? Was handeln Sie mit denen aus?«
»Am Ende des Tages muss ich ihnen meine Bambushocker verkaufen, um das Darlehen zurückzuzahlen. Was übrigbleibt, ist mein Gewinn.«
»Wieviel bringt Ihnen das ein?«
»Fünf Taka und 50 Paisa.«
»Sie machen also einen Gewinn von 50 Paisa.«Sie nickte. Dies entsprach genau zwei Cent.
»Könnten Sie sich das Geld denn nicht anderswo leihen und das Material selbst kaufen?«
»Schon, aber der Geldverleiher würde noch viel mehr von mir verlangen. Die Leute, die sich mit ihnen abgeben, werden nur noch ärmer.«
»Wieviel nimmt der Geldverleiher?«
»Das hängt davon ab. Manchmal verlangt er zehn Prozent pro Woche. Einer meiner Nachbarn muss sogar zehn Prozent pro Tag zahlen.«
»Und Sie verdienen nur 50 Paisa, wenn Sie diese schönen Bambushocker bauen?«
»Ja.«In allen Ländern der Dritten Welt sind Wucherzinsen üblich und so sehr zum Bestandteil des Alltags geworden, dass selbst der Geldverleiher nicht mehr bemerkt, wie ausbeuterisch solch ein Vertrag ist. In Bangladesch muss auf dem Land ein Maund [= ca. 40 kg] gedroschener, geschälter Reis, den man sich zu Beginn der Aussaat leiht, nach der Ernte mit zweieinhalb Maunds zurückgezahlt werden.
Wenn ein Feld als Sicherheit dient, so wird es dem Gläubiger zur Verfügung gestellt, der so lange als Besitzer gilt, bis die gesamte Schuld getilgt ist. In vielen Fällen belegen offizielle Dokumente die Rechte des Gläubigers. Um die Tilgung der Schuld zu erschweren, verweigert der Gläubiger eine ratenweise Abzahlung. Nach Ablauf einer gewissen Periode ist der Gläubiger berechtigt, das Feld zu einem zuvor festgesetzten »Preis« zu »kaufen«.
Zuweilen ist das Darlehen für eine Investition oder einen großen Anlass (Heirat einer Tochter, Schmiergeld, Anwaltskosten oder dergleichen) bestimmt, aber in den meisten Fällen wird es für dringende Fälle in Anspruch genommen (zum Kauf von Lebens- oder Arzneimitteln oder zur Bewältigung einer anderen Notsituation). Jedenfalls fällt es dem Kreditnehmer sehr schwer, seine Schulden zurückzuzahlen.
Häufig entkommt er dem Teufelskreis aus Verschuldung und Neuverschuldung zwecks Tilgung des alten Kredits nur durch den Tod.
Jede Gesellschaft hat ihre Wucherer. Solange die Armen von den Geldverleihern abhängen, kann kein Wirtschaftsprogramm den Enteignungsprozess aufhalten.
Sufia Begum setzte ihre Arbeit fort, denn sie hatte keine Zeit zu verlieren. Ich beobachtete, wie ihre kleinen Hände die Bambusfasern flochten. Endlos lange auf dem hart gewordenen Lehmboden hockend, verdiente sie sich ihren Lebensunterhalt. Ihre Finger waren schwielig, ihre Fingernägel schmutzig.
Wie konnten ihre Kinder den Teufelskreis der Armut durchbrechen, um einen besseren Lebensstandard zu erreichend Welche andere Zukunft als die des Elends stand diesen Kleinkindern bevor? Wie konnten sie zur Schule gehen, wenn ihre Mutter kaum das Existenzminimum verdiente -- von einer anständigen Unterkunft und Bekleidung ganz zu schweigen.
»Sie verdienen also an einem ganzen Arbeitstag nicht mehr als 50 Paisa?«
»Ja, an guten Tagen.«Sie verdiente demnach zwei Cent täglich. Diese Information erschütterte mich. In meinen Vorlesungen warf ich mit Beträgen in Höhe von Millionen Dollar um mich, und hier, vor meinen Augen, ging es bei der Frage nach Leben oder Tod um ein paar Pfennige. Irgend etwas stimmte hier nicht. Weshalb gaben die Kurse, die ich an der Universität abhielt, nicht die Wirklichkeit des Lebens wieder? Ich war wütend auf mich selbst und auf eine so hartherzige, unbarmherzige Welt.
Es gab nicht den geringsten Hoffnungsstreif am Horizont, nicht den Hauch einer Lösung.
Wenngleich Sufia Begum nicht lesen und schreiben konnte, so verfügte sie dennoch über nützliche Fertigkeiten. Die einfache Tatsache, lebendig zu sein und mir gegenüberzusitzen, zu atmen und Tag für Tag ruhig gegen die Not anzukämpfen, bewies zweifelsfrei, dass sie eine nützliche Fähigkeit besaß -- die Fähigkeit zu überleben.
Die Armut ist so alt wie die Welt. Sufia hatte keine Aussicht, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern. Warum nicht? Ich war nicht fähig, diese Frage zu beantworten. Von Kindheit an sind wir daran gewöhnt, in unserer Umgebung Arme zu sehen, und wir haben uns nie gefragt, weshalb sie arm sind. Im herrschenden Wirtschaftssystem war Sufias Einkommen dermaßen gering, dass sie nie auch nur das kleinste Geldstück zur Seite legen, es investieren und sich wirtschaftlich entfalten konnte.
Es wäre mir nie eingefallen, dass jemand in größter Not lebt, nur weil ihm fünf Taka fehlen. Das kam mir unmöglich, ja sogar lächerlich vor. Sollte ich diese geringfügige Summe, die Sufia benötigte, vielleicht aus meiner eigenen Tasche bezahlen? Das war so einfach, so leicht.
Weshalb haben meine Universität und meine Fakultät, weshalb haben alle Wirtschaftsfakultäten dieser Welt und die zahllosen intelligenten Wirtschaftsprofessoren bisher nicht versucht, diese Leute zu begreifen und denen zu Hilfe zu kommen, die es am meisten nötig haben?
Ich widerstand meinem Drang, Sufia das Geld zu geben, das sie brauchte. Sie wollte keine milde Gabe. Außerdem wäre das auch keine endgültige Lösung gewesen."
[Yunus, Muhammad <1840 - > , Jolis, Alan <1953 - >: Grameen - eine Bank für die Armen der Welt. -- Bergisch Gladbach : Lübbe, ©1998. -- ISBN 378570948X. -- Originaltitel: Vers un monde sans pauvreté (1997). -- S.19 - 24. ]
Das Folgende ist eine sehr anschauliche Beschreibung eines muslimischen (!) Wucherers in Malaysia in den 1950er bis 1970er Jahren:

Abb.: Lage des Bundesstaates Kedah, Malaysia (©Mindscape)
"There is little doubt that Haji Ayub became in his lifetime the largest owner of paddy land that the state of Kedah (and perhaps the whole country) had ever known. At the time of his death, he was reputed to have owned more than 600 relong (426 acres) of paddy fields in addition to his other holdings of rubber and orchard land. The magnitude of his feat must be viewed against an agrarian setting in which the median holding is less than three relong and a farmer who owns twenty relong is considered to be quite rich. Alarmed at the astonishing speed with which Kedah's rice Land was passing into the hands of Haji Ayub, the State Assembly at one point actually forbade him to acquire more. The stories that swirl around the career and exploits of Kedah's rice-land baron, however, touch less on his fabulous holdings per se than on his style of life and the manner in which he built his empire. What makes Haji Ayub such a conversational staple is his legendary cheapness. To judge from the popular accounts I was introduced to that afternoon, Kedah's richest landowner maintained, by choice, a style of life that was hardly distinguishable from Razak's. Like Razak, he lived in a broken-down house that had never been repaired or rebuilt. Rather than buy manufactured cigarettes, he continued till the end of his life to roll his own peasant cigarettes, using the cheapest tobacco and nipah wrappers he cut from his own plants. Like the poorest of the poor, Haji Ayub bought only a single sarong cloth a year and, if you passed him, you would have thought he was the village beggar. Surpassing even Razak, he was said to have eaten nothing but dried fish, except on feast days. Although he could have afforded a luxuriouse car, and a surfaced road passed near his house, he traveled by foot or on bicycle. ... It was in this fashion that Kedah's rice Baron issued forth to collect rents from scores of tenants who had not already come of their own accord. The Spirit of self-denial touched all aspects of his life save one: he had allowed himself three wives. ....
When it came to describing how Haji Ayub acquired all this land, the conversation was just as animated but not nearly so jovial. The whole process is perhaps best captured in the nickname by which he is widely known: Haji "Broom". Peasants prefer the English word in this case because, I suspect, its sound suggests a single, vigorous sweeping motion. Quite literally, Haji Broom swept up all the Land in his path. The forte of the word also connotes something akin to what is meant by saying that one has "cleaned up" at poker (that is, swept up all the chips on the table) or "cleaned out" one's opponents. The image is more powerful precisely because it is joined with "Haji," a term of respect for those who have made the pilgrimage to Mecca. ...
Haji Broom's name came up not long afterward when I was asking a few villagers gathered under Pak Yah's house about moneylending and credit practices before double-cropping. Nor was explaining to me the notorious padi kunca system of credit and began his account with, "This is the way Haji Broom would do it." It involved an advance of cash roughly six months before harvest, repayable by a fixed quantity (a kunca) of paddy at harvest time, which typically amounted to an effective annual rate of interest approaching 150 percent. For at least half a century, until 1960, it was the standard form of seasonal credit extended by shopkeepers, rice millers, moneylenders, and not a few wealthy landlords. Virtually all observers of rice farming cited it both as a major reason for persistent poverty in the paddy sector and as the cause of defaults that further concentrated land ownership.It was clean moreover, that in this area Haji Broom and padi kunca were nearly synonymous.
If the practice of padi kunca skirts perilously close to the strong Islamic injunction against interest, it appears that Haji Broom also became a moneylender pure and simple. Mat "halus" Said that Haji Broom regularly lent money, usually in M$100 amounts, for six months, requiring repayment of M$130 or M$140. "His sons, Haji Rasid and Haji Ani, do the same thing. It's sinful. They've been doing it for seven generations. They only care about this world." Part of this lending, they said, was secondhand. That is, Haji Broom would take money from large Chinese moneylenders at 40 percent interest and relend it to peasants at 80 percent interest, pocketing the difference. In the eyes of these villagers, the fact that he worked hand-in-glove with the Chinese creditors in town made for an even worse transgression than if he had operated alone. The Chinese practice of lending cash at interest, on the other hand, occasions virtually no commentary; it is expected. After all, it is their normal business practice and nothing in their religion forbids it. For a Malay -- a member of their own community, their own religion, and in this case a Haji -- to practice usury despite its explicit denunciation in the Koran is to call forth the most profound censure.
But the keystone of Haji Broom's fortune, the means by which most fand fell into his hands, was the practice of jual janji (literally, promised sale). Nor, Pak Yah, and Mat "halus" can each tick off easily the names of families in the area who lost land to Haji Broom in this fashion. The practice worked as follows: Haji Broom would lend a man a substantial sum in return for which the title to all or a part of the borrower's Land would be transferred to Haji Broom. The written contract of sale provided that if, by a specified date, the borrower repaid the initial sum (nearly always less than the market value of the land), he could recover his land. For the borrower, the loss of the land was, in principle at least, not irrevocable. In practice, of course, it often was, and most of the large landholdings in Kedah were acquired in this fashion. Haji Broom and a few others, Nor adds, devised a new wrinkle to the procedure. A few days before the final date, he would go into hiding so that a peasant who was lucky enough to have amassed the cash to redeem his cand could not find him. Once the date had passed, he would then immediately ask the court to award him the land of the defaulting borrower. By such stratagems, Haji Broom turned nearly all his jual janji loans into land sales. As if to dramatize the finality of a loan from Haji Broom, Pak Yah noted that a visitor to the land baron's house would have found him seated in front of a lange cupboard filled from top to bottom with land titles."
[Scott, James C.: Weapons of the weak : everyday forms of peasant resistance. -- New Haven [u.a.] : Yale University Press, ©1985. -- ISBN 0300036418. -- S. 14 - 17]
Der folgende Abschnitt schildert die Stellung der Grundbesitzer in einem nordindischen Dorf nach der Landreform 1952:
"Madhopur is a large, Rājpūt-owned village of 1,047 acres on the level Ganges-Gomti plain. It is located in Kerakat Tahsil in the southeastern Part of Jaunpur District, U.P. [Uttar Pradesh] Like most of the eastern districts of U.P., Jaunpur is densely populated, overwhelmingly agricultural, and relatively poor as compared with the western districts of U.P. In Madhopur village the agricultural lands are about equally divided between the production of rice and the production of other grains such as barley and millets, with sugar cane as a leading cash crop. The village is two miles from an all-weather road and bus route which connects it with the cities of Banaras and Azamgarh, twenty-five and thirty-eight miles distant, respectively. It is four miles from the nearest railway, which provides transportation to Jaunpur, the ancient district Center. Kerakat town, the subdivisional headquarters for Madhopur, having a population of about 5,000 persons, is four miles away. ...
Abb.: Lage von "Madhopur"
The Camārs of Madhopur are the most numerous of the twenty-three principal caste groups which are resident there. Among the 1,852 persons enumerated by the village accountant in his census of 1948, five castes were represented by more than 50 members each:
- Camārs (636),
- Rājpūt "Thākurs," or "Lords" (436),
- Noniyās (239),
- Ahīrs (116), and
- Lohārs (67).
Eleven other local caste groups had less than 20 members each.
The twenty-three local caste groups of Madhopur are distributed in one main settlement and in nine hamlets in a manner which approximately symbolizes their relative standings in Madhopur society. Twenty caste groups are represented in the main settlement together with one of its hamlets. The houses of the dominant Thākurs and other high castes tend to be located at the center, while others circle the peripheries. Two other hamlets are the residences mainly of Noniyās and Ahirs, independent tenants who have settled near their tillage. No Camārs are permitted to make their residences in any of these higher-caste settlements. Instead, their houses are found clustered in six outlying hamlets on all sides of the settlements of the other castes.
Camārs, like all other castes of Madhopur, have long been subordinate in all economic and political affairs to the Thākur landlords (zamindārs) of the village. These Thākurs, Rājpūts of the Raghubansī clan, have held predominant economic and political power in Madhopur since the conquest of the village and the region by their ancestors in the sixteenth century. All Thākurs of Madhopur today trace their descent to Ganesh Rai, who conquered a fourteen-square-mile area around Madhopur which is now known as Dobhi Taluka. The two sons, and later the twelve grandsons, of Ganesh Rai divided this area among themselves into shares (mahāls). These twelwc shares still constitute the largest landholding divisions of the taluka.The village which I have called Madhopur fell to the Lot of Madhoram, the eldest grandson of Ganesh Rai. Within the village, his share was again divided for management among his six sons and their heirs into sections which are known as pattīs or thoks. Each section of the village has its revenue headman (lambardār), who is charged with the duty of depositing the land tax of his section twice each year at the Kerakat Tahsil treasury. By 1934, the landlord holdings of Madhopur had been partitioned into twenty-eight smaller shares by ownership, although the original six pattīs continued as tax-collection units up until the implementation of the U.P. Zamindari Abolition Act on July 1, 1952. Until that time, every non-Thākur family cultivating land in Madhopur did so only as the tenant or through the tenant of a Thākur family or a Thākur lineage (also called a pattī).
Zamindari Abolition in 1952 did little to affect the economic and political dominance of the Thākurs either in Madhopur or in the immediate region, for it expropriated the landlords only from that part of their tenanted lands which had not previously been registered as being under their own personal cultivation. As long ago as 1906, half the lands of Chandwak Pargana, of which Madhopur is part, had been recorded as being under the landlords' own cultivation. In 1953, after landlord abolition, Thākur ex-landlords still owned and cultivated approximately 70 per cent of the lands of Madhopur. The few permanent tenants in the village were enabled to buy out their parts of the Thākurs' landlord holdings by payment, to the state government of ten times the annual rent, but the landlords who lost land thereby are to be compensated by the government. Some ex-landlords, moreover, continue to receive rent from their now protected tenants-at-will. Although the old legal bases of tenancy under landlords ceased to exist in 1952, most non-Thākur families continue to gain access to land only as lessees under Thākurs.
The relationships which were traditional between landlord and tenant tend still to survive in Madhopur. These relationships involve much more than strictly economic considerations. The lessee of a Thākur is called a prajā, literally a "subject," "dependent," or "child." While a man may farm the lands of several Thākurs, he has a primary and lasting socioeconomic tie with the Thākur on whose land he had originally built his house. The Thākur is considered to be responsible for the welfare of his tenants, and responsible for their care in need and ill health. Each tenant in turn owes allegiance and support to his Thākur. The landlord-tenant tie is dramatized at lifecycle ceremonials, when the tenant performs ceremonial services and is fed in return by his Thākur. At festivals, too, the tenant receives gifts of food from his Thākur. The tenant's tie with his Thākur is clear also in disputes: the tenants of Bach Thākur support him, even to the extent of doing violence to his adversary.
Much like the traditional relationship between a landlord and his tenant is the relationship between a Thākur and his agricultural laborers. Permanent "plowmen" (halvāhās), who do every sort of agricultural work, are the most subordinate of the kinds of agricultural laborers. In Madhopur these laborers are usually Camārs. Members of other caste groups in the village also do agricultural work, but, since the Camārs are the most numerous of the impoverished lower castes, an employer talking about his "laborers" is most likely to be referring to his Camārs.
Besides its tenants and laborers, every Thākur family, acting as Patron (jajmān), also has traditional workers (parjūniyas), who provide specialized goods and services. Among the traditional workers of each Thākur family are the
- Kahār (Water Carrier),
- Nāi (Barber),
- Brahman priest,
- Lohār (Carpenter-Blacksmith),
- Kohār (Potter),
- Camār (Leatherworker and Midwife),
- Bārī (Betel Leaf Distributor) and
- Dhobī (Washerman).
In return for their services, the traditional workers are given biannual payments in grain and are sometimes given the use of a piece of land. The patron-worker tie is a hereditary one: a patron cannot arbitrarily change a traditional worker, and no one other than the hereditary worker will perform the traditional work for a patron, under threat of outcasting. Similarly, a traditional worker cannot change a patron without the permission of the patron and of his own caste. Members of castes other than the Thākurs have their traditional worker families also, usually four:
- Barber,
- carpenter-Blacksmith,
- Potter, and
- Camār.
Members of low castes usually employ the same traditional worker families which are employed by their own respective Thākurs."
[Cohn, Bernard S.: The changing status of a depressed caste. -- In: Village India : studies in the little community / ed. by McKim Marriott ... -- Chicago [u.a.] : University of Chicago Press, ©1955. -- S. 53 - 56]
Zu Kapitel 18.4: Lebenserwerbs- und Wirtschaftsformen, 4. Teil: Industriegesellschaft, Wirtschaftssektoren