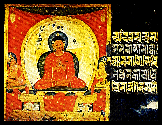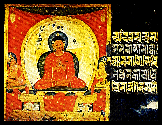Einführung in die Exegese von Sanskrittexten : Skript
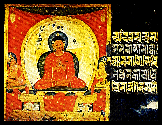
Kap. 7: Die eigentliche Exegese, Teil I: Übersicht über exegetische
Fragestellungen
von Alois Payer
mailto:payer@payer.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Alois <1944 - >: Einführung in die Exegese von Sanskrittexten :
Skript. -- Kap. 7: Die eigentliche Exegese, Teil I: Übersicht über exegetische
Fragestellungen. -- Fassung 2004-07-05. -- URL: http://www.payer.de/exegese/exeg07.htm.
-- [Stichwort].
Überarbeitungen: 2004-067-05 [revidiert] 1996-01-21
Anlass: Lehrveranstaltung Proseminar Indologie WS 1995/96
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung
in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen
Genehmigung des Verfassers.
0. ÜBERSICHT
- 1. Exegese als wissenschaftlich reflektierter
Verstehensvorgang
- 2. Fragestellungen der Exegese
- 2.1. Synchrones Verstehen (A)
- 2.2. Diachrones Verstehen (B)
- 2.3. Wirkungsgeschichtliches Verstehen (C)
- 3. Erkenntnisinteresse, Erkenntnisperspektive,
Beschränktheiten des Exegeten
Nachdem der Text mittels der Textkritik in seiner ursprünglichen Form konstituiert
ist, kann man unter Beiziehung der Primär- und Sekundärliteratur zur eigentlichen
Exegese schreiten. Die eigentliche Exegese bringt u. U. wieder neue Erkenntnisse bezüglich
der Textkonstitution.
Zum Ganzen ist auch das in Kapitel 2 Gesagte
heranzuziehen.
1. Exegese als wissenschaftlich reflektierter Verstehensvorgang
Exegese ist ein expliziter, wissenschaftlich reflektierter Verstehensvorgang.
Zum Verstehen s. Kapitel 2 .
Wissenschaftlich reflektiertes Verstehen von Texten (wissenschaftliche Exegese)
gehorcht deshalb denselben Regeln wie die meisten wissenschaftlichen Tätigkeiten:
- Formulierung von Lösungsvorschlägen,
- die man begründet
- und der Kritik aussetzt.
2. Fragestellungen der Exegese
Eine Exegese soll sich u. a. von folgenden Fragestellungen leiten lassen. Oft wird man
einige dieser Fragen nicht beantworten können, da die Quellenlage und/oder der
Forschungsstand nicht ausreicht. Doch sollte man sich immer klar Rechenschaft geben,
dass
und warum man gewisse Fragen nicht behandelt.
Als Ziel der Auslegung muss man unterscheiden zwischen:
- dem Herausarbeiten der Bedeutung des Textes zum Zeitpunkt, als der Text
verfasst wurde
- dem Herausarbeiten der Bedeutung, die ein Text bei der Übernahme in einen anderen Text
erhält, sei's als Zitat, sei's als sonstige nicht als solche vermerkte Übernahme
- dem Herausarbeiten der Bedeutung, die ein Text in verschiedenen Stadien vor Übernahme
in einen anderen Text hatte
- dem Herausarbeiten der Bedeutung, die der Text zu einem späteren Zeitpunkt hatte
(wichtig z.B. bei Rechtstexten, die auf neue Situationen angewandt werden
mussten; ebenso
religiöse Texte, die in ein religiös-philosophisches System übernommen wurden oder die
noch hunderte von Jahren nach ihrem Entstehen von Gläubigen unter geänderten
historischen
Bedingungen praktisch angewandt wurden <z.B. Gandhis applikatives Verstehen der
Bhagavadgîtâ>).
Das unter 2) Genannte ist ein Spezialfall von 4).
Das Verstehen eines Textes hat folgende Teilbereiche:
- A) Synchrones Verstehen (gleichzeitig): Verstehen der Aussage des
Textes, möglichst so, wie ihn ein ursprünglicher Adressat verstehen sollte bzw. konnte:
- Aa) aus der Textstelle selbst heraus: aufgrund der Formulierung des Textes
- Ab) aufgrund anderer Stellen des Gesamttextes, aus dem die Stelle stammt,
insbesondere aufgrund des Kontexts, der systematischen Stellung,
Parallelstellen usw.
- Ac) aufgrund anderer Texte, die dieselbe oder ähnliche Aussage, dieselben
Worte, Wendungen u. ä. enthalten wie der vorliegende Text.
- Ad) aufgrund anderer Informationen über Gegenstand und Situation der
Textstelle, z.B. aus der materiellen Kultur (z.B. Kultgegenstände, Kunst)
- Ae) aufgrund zeitlich und/oder geographisch vom Text entfernter analoger
Erscheinungen (z.B. gegenwärtige Bräuche; völkerkundliche "Parallelen")
- B) Diachrones Verstehen (Vorgeschichte): Verstehen eines Textes in dem Sinne,
dass man versteht, wie eine Vorstellung, Anweisung usw. des Textes historisch entstanden
ist und evtl. verändert wurde bis sie die Gestalt erhielt wie im vorliegenden Text. Dazu
dienen:
- Ba) andere Texte, die ein früheres Stadium der Vorstellung, Anweisung usw.
wiedergeben. (die Texte können, wenn sie aus einer in diesem Punkt konservativeren
Überlieferung stammen, u. U. jünger als der vorliegende Text sein).
- Bb) andere Quellen, z.B. aus der materiellen Kultur
- Bc) = Ae)
- C) Wirkungsgeschichtliches Verstehen (Nachgeschichte): Verstehen eines Textes,
indem man untersucht, was in ihm historisch "drinnen steckte", d.
h.. indem man
seine geschichtlichen Wirkungen untersucht. Dazu dienen analoge Quellen wie zu B).
2.1. Synchrones Verstehen (A)
Synchrones Verstehen (A) muss versuchen die sprachliche, sonstige kulturelle und
natürliche Welt des Verfassers/ Kompilators und ursprünglich intendierten Hörers,
soweit es für das Verständnis des Textes nötig ist, explizit oder implizit zu
rekonstruieren.
Explizit muss man dazu versuchen zu klären:
- A1) Datierung und Urheberschaft des Textes: Wann entstand der Text bzw. wann
wurde er in den vorlegenden Kontext übernommen? Wer ist sein Verfasser?
- A2) Zweck und Adressat des Textes: Welcher literarischen Gattung gehört der
Text an? Welchen Zweck hatte er? Was war sein Sitz im Leben? An welche Adressaten war er
gerichtet?
- A3) Historische Situation: In welcher historischen Situation entstand der Text?
("historische Situation" sowohl im Sinne der politischen Geschichte, der
Sozialgeschichte als auch der Geschichte des speziellen Lebensbereiches, dem der Text
besonders zuzuordnen ist <z.B. Religionsgeschichte, Kunstgeschichte, Geschichte der
betr. 'Wissenschaft', Realien>. Inwieweit spiegelt sich diese historische Situation im Text?
- A4) Stellung des Textstückes im Textganzen: Welche Stellung hat der Text im
Kontext? Warum steht er an dieser Stelle? Welche Stellung hat er im Textganzen als
erzählerischer, ästhetischer, systematischer usw. Ganzheit?
- A5) Abgrenzung des Textstückes als Einheit(en) innerhalb des Ganzen.
- A6) Aufbau und Gliederung des Textstückes.
- A7) Sprachliche Analyse des Textstückes: grammatische, lexikographische
Besonderheiten.
- A8) Metrische Analyse des Textstückes.
- A9) Analyse des Stils und der Darbietungsform des Textstückes: Darbietungsform
(z.B. Erzählung, Gespräch, Lied, Lehrsätze), Stilgattung, evtl. poetische Kunstmittel,
Erzähltechnik, Techniken der Vermittlung (z.B. Propagandatechniken,
Argumentationstechniken, Logik).
- A10) Analyse des Inhalts des Textstückes.
- A11) Vergleichende Analyse des Textstückes: Vergleich mit inhaltlich
ähnlichem in Texten gleicher und anderer Kategorie (z.B. eines Sûtras mit einer
Erzählung/Mythos). Stellung des Textes innerhalb der literarischen/sozialen Ganzheit, in
der er steht (z.B. innerhalb des Gesamtwerkes des betreffenden Dichters; innerhalb der
betreffenden
religiösen Richtung / philosophischen Schule). Bezug auf andere literarische Werke, Werke
der materiellen Kultur, historische Ereignisse. Gemeinsamkeit und Differenzierung
gegenüber anderen Werken dieser Ganzheit und gegenüber anderen Richtungen desselben
Gebietes. Evtl. übergreifender Vergleich (Vergleich mit anderen Religionen, Literaturen
usw., unabhängig davon, ob diese in historischer Verbindung mit dem vorliegenden Text
stehen oder nicht).
- A12) Wie stehen die einzelnen nach obigen Fragen erarbeiteten Elemente
zueinander in Beziehung? (z.B. Verhältnis von Sitz im Leben, Darbietungsform, Stil und
Metrum).
2.2. Diachrones Verstehen (B)
Diachrones Verstehen (B) muss untersuchen:
- B1) Den Werdegang des Textes selber. Dies ist besonders wichtig bei sog.
anonymer Literatur, d. h.. Literatur, die nicht auf einen einzigen Verfasser zurückgeht und
die im Laufe der Zeit verschiedenen Bearbeitungen unterlag.
- B2) Herkunft des Wortlautes des Textes (Quellen, Vorbilder,
Gattungseigenheiten): explizite oder verdeckte Zitate, Herkunft bestimmter Ausdrucksweisen,
Stil- und Darstellungsmittel usw. Aus B2) kann u. U. die Rekonstruktion verlorengegangener
Texte folgen.
- B3) Die Vorgeschichte des Inhalts, der Darbietungsform usw. des Textes: Wie
entstanden und entwickelten sich die Inhalte des Textes? Wie entstanden und entwickelten
sich best. Ausdrücke, Ausdrucksweisen, Stil- und Darstellungsmittel? usw. Wie erklären
sich aus dieser Vorgeschichte zunächst schwerverständliche Inhalte und Ausdrucksweisen
des vorliegenden Textes?
2.3. Wirkungsgeschichtliches Verstehen (C)
Wirkungsgeschichtliches Verstehen (C) fragt insbesondere:
- C1) Wie wurde der Text später verstanden/missverstanden?
- C2) Welche Wirkungen im Bereich Gesellschaft, Politik, Religion, Literatur,
Wissenschaft usw. hatte er?
- C3) Wie und warum wurde der Text tradiert?
In den folgenden zwei Kapiteln folgen nähere Erläuterungen zu einigen obiger
Fragestellungen.
3. Erkenntnisinteresse, Erkenntnisperspektive,
Beschränktheiten des Exegeten
Eine Exegese sollte auch das Erkenntnisinteresse des Exegeten thematisieren
(Relevanz der Fragestellung innerhalb der forschungsgeschichtlichen Situation u.
ä.).
Da es unmöglich ist, alle oben genannten Fragestellungen durchzuführen, muss
auch die Perspektive der Exegese ausdrücklich genannt werden.
Auch sprachliche und andere Beschränktheiten des Exegeten sollte man nennen
(wenn z.B. wichtige Quellen in bestimmten Fragen infolge Unkenntnis dieser
Sprachen nicht verwendet werden können, wenn dem Exegeten eine oder mehrere
einheimische Wissenschaften unverständlich sind, wenn aus Zeitgründen manche
Werke nicht herangezogen werden konnten).
Zu Kapitel 8: Die eigentliche
Exegese, Teil II: Zu einzelnen Fragestellungen synchronen Verstehens