Internationale Kommunikationskulturen


mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - >: Internationale Kommunikationskulturen. -- 7. Kulturelle Faktoren: Betriebskulturen und Entscheidungsfindung. -- 4. Teil IV: Beispiele. -- Fassung vom 2001-02-20. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur074.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2001-02-20
Überarbeitungen:
Anlass: Lehrveranstaltung, HBI Stuttgart, 2000/2001
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Länder und Kulturen von Tüpfli's Global Village Library

Abb.: Tabakfabrik, Thailand (©Corbis)

Abb.: Produktion von Alpine® Autoradios in Qingdoa Daesung Electronic Corp. Ltd., Xia Wang Bu Licang Qu Qingdao City, Shandong Province, China
[Bildquelle: http://www.nlcnet.org/report00/alpinedaesungdoc.htm. -- Zugriff am 2001-01-02. -- Dort nähere Informationen zu dieser Betriebskultur]
|
|
|
| Abb.: Nähsaal mit 2000 Arbeitern, Tae Kwang Vina Factory, Vietnam | Abb.: Fließbandfertigung für Nike®, Tae Kwang Vina Factory, Vietnam |
|
[Bildquelle: http://www.corpwatch.org/trac/nike/photos.html. -- Zugriff am 2001-01-02] |
|
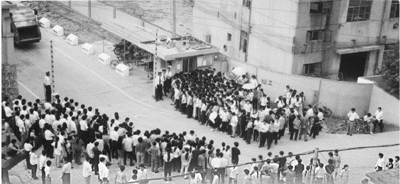
Abb.: Der Hintergrund solcher Betriebskulturen: Arbeitsmangel:
Arbeitssuchende vor Freetrend Factory, Shenzhen, Guangdong Province, China,
Produzent von New Balance© Schuhen
[Bildquelle: http://www.nlcnet.org/report00/newbal_china.htm. -- Zugriff am 2001-01-02. -- Dort ausführliche Informationen]
Weiterführende Ressourcen zu Billiglohnländern:
Entwicklungsländerstudien / hrsg. von Margarete Payer. -- Teil II: Kernprobleme. -- Kapitel 24: Arbeit und Beschäftigung / verfasst von Yvonne Hermann. -- URL: http://www.payer.de/entwicklung/entw24.htm. -- Zugriff am 2001-01-03
Entwicklungsländerstudien / hrsg. von Margarete Payer. -- Teil I: Grundgegebenheiten. -- Kapitel 18: Lebenserwerbs- und Wirtschaftsformen. -- 5. Teil: Kapitalismus und Sozialismus / von Carola Knecht. -- URL: http://www.payer.de/entwicklung/entw185.htm. -- Zugriff am 2001-01-03
Webportal: http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Labor/Sweatshops/. -- Zugriff am 2001-01-02
|
|
|
| Abb.: Lage von Petaling Jaya (©MS-Encarta) | |
Webportal für Petaling Jaya: http://dir.yahoo.com/Regional/Countries/Malaysia/States_and_Regions/Selangor/Cities/Petaling_Jaya/.
-- Zugriff am 2001-01-10
Webpräsenz von Motorola: http://www.motorola.com/General/index.html.
-- Zugriff am 2001-01-10
"In der Industriezone von Petaling Jaya außerhalb von Kuala Lumpur lieferte eine lange Schlange aus klapprigen blauen Bussen die Arbeiter für den 14-Uhr-Schichtwechsel des Motorola-Werkes ab. Das blaue Logo von Motorola war schon von der Schnellstraße aus sichtbar, zusammen mit einigen anderen mit bekannten Namen wie Canon, Sanyo, Panasonic und Minolta. Die Fabrik sah aus wie ein niedriges Bürogebäude, vor dem ein asphaltierter Parkplatz mit Palmen und riesigen Eiben lag. Die weiße Fassade war mit Dutzenden von roten Papierlaternen und vergoldeten Spruchbändern geschmückt, da gerade das chinesische Neujahr gefeiert wurde. Über dem Haupteingang forderte ein großes Schild die Arbeiter zur Teilnahme am Motorola ten kilometer run auf, dessen Gewinner am US-Marathon in Austin teilnehmen würden.
Die Arbeitnehmer gingen durch die Glastüren und dann einen langen, blankgescheuerten Korridor entlang bis zu den Umkleideräumen, an der Bibliothek, dem Fitnesscenter und dem Bankautomaten vorbei. Es waren ausschließlich Frauen, die meisten von ihnen noch jung und im Vergleich zu Amerikanerinnen klein und zierlich. Ihre Kleidung entsprach den Vorschriften des Islam - weite, knöchellange Kleider, Kopf und Schultern von den moslemischen Tundjung bedeckt, seidenen Schals in Blassblau, Orange und Braun. Einige von ihnen waren konservativer gekleidet und trugen die weit geschnittenen schwarzen Schleier, die ihre Gesichter wie samtbraune Herzen einrahmten und den Oberkörper vollständig verhüllten.
»Guten Tag, meine Damen.« Roger Bertelson, Leiter der Motorola-Niederlassung in Malaysia, führte mich gerade im Werk herum. Wir ragten wie Leuchttürme aus dem Meer der Frauen heraus. Sie gingen mit niedergeschlagenen Augen an uns vorbei und grüßten uns mit einem leichten Kopfnicken. Bertelson trug einen Bürstenhaarschnitt, besaß die heitere Direktheit, die für Amerikaner typisch ist, und sah aus wie eine größere Ausgabe von Ross Perot [Webpräsenz von Ross Perot: http://www.perot.org/. -- Zugriff am 2001-01-10]. Er erklärte mir gerade die Wandtafel, an der Fotos von Mitarbeiterinnen hingen, die erfolgreiche Verbesserungsvorschläge gemacht hatten.
»Wir mussten die Kultur ändern«, sagte Bertelson, »weil Frauen in Malaysia nicht dazu ermutigt werden, ihre Meinung zu sagen. Von einer guten Tochter wird erwartet, dass sie Kinder bekommt und für ihren Ehemann da ist. Daher müssen wir ihnen erst einmal beibringen, ihre Meinung zu sagen. Wir arbeiten mit positiver Bestätigung, wie in der Schule. Zuerst machen wir ihnen klar, dass wir ihnen zuhören werden. Und dann müssen sie sich unter ihren Kolleginnen durchsetzen.«
Auch der Bankautomat war zunächst ein kulturelles Hindernis. »Wir mussten das Schema durchbrechen«, erklärte Bertelson. »Die Frauen gingen nach Hause und sagten zu ihrem Vater: 'Ab heute werde ich meinen Lohn nicht mehr nach Hause mitbringen. Er wird auf das Konto überwiesen.'«
Die Frauen vor uns kamen an einigen Gemälden von Norman Rockwell vorbei -- warmherzige, nostalgische Szenen aus dem amerikanischen Alltagsleben [Vgl. Webpräsenz des Norman Rockwell Museum Vermont: http://www.normanrockwellvt.com/. -- Zugriff am 2001-01-10]. Neben jedem Bild hing ein Aphorismus auf englisch. »Hervorragende Leistungen werden nicht unbemerkt bleiben.« - »Begeisterung lässt einen Menschen mit allem fertig werden.« - »Was wir sagen, ist genauso wichtig wie der Ton, mit dem wir es sagen.« Ich konnte mir nur schwer vorstellen, welche Bedeutung Rockwells anheimelnde Schilderungen des amerikanischen Lebens in dieser Umgebung hatten.
Im Umkleideraum legten die Frauen Schuhe und Schleier ab und betraten dann einen zweiten Umkleideraum auf der anderen Seite des Korridors. Einige Minuten später kamen sie wieder heraus, eingehüllt in strahlendweiße Overalls, mit Mundschutz und Kopfhaube. Sie wirkten wie Besucher aus einer anderen Welt, viel keuscher noch als im strengsten islamischen Schleier. In der Luftdusche spülte ein Strom gereinigter Luft die letzten noch verbliebenen Staubkörnchen fort. Dann betraten sie den versiegelten Reinraum, wo lange Reihen komplizierter Maschinen und Monitore auf die nächste Schicht warteten.
Im Inneren des Reinraums begannen die Frauen in den Schutzanzügen mit ihrer Arbeit, der Produktion von Halbleiterchips, die viel Aufmerksamkeit erforderte. Sie arbeiteten im Submikrometerbereich, befestigten Leitungsdrähte auf Bauelementen, die viel zu klein waren, als dass man sie ohne Hilfe eines elektronischen Monitors hätte sehen können. »Eigentlich machen nicht sie es, sondern die Maschinen«, sagte Bertelson, der den Frauen durch ein Fenster in der Wand zusah. ...
Kulturelle Umgestaltung war bei Motorola reine Routine, die dreimal am Tag und sieben Tage die Woche zu sehen war, aber sie machte auch das enorme Ausmaß der Globalisierung deutlich -- ein gigantischer Sprung über Zeit und Raum hinweg, ein Austausch, der banal und revolutionär zugleich war, andeutungsweise imperialistisch und ausbeuterisch, aber im Grunde genommen auch befreiend. Langfristig gesehen wird das Eindringen moderner Technik in die Gesellschaft vielleicht eine ebenso große Bedeutung haben wie die Veränderungen in der Wirtschaft. Motorola und andere Halbleiterunternehmen, die sich in Malaysia niedergelassen haben, ist es gelungen, Spitzentechnologie mit schüchternen jungen Frauen aus den Kampong zu vereinen, kleinen Dörfern auf dem Land; wo es sonst ihr Schicksal gewesen wäre, dem Vater oder dem Ehemann bei der Reisernte oder der Herstellung von Palmöl zu helfen.
Beim Mittagessen in der Firmenkantine sprachen Bertelson und die anderen Manager über Technologie. »Die Unternehmenspolitik schreibt vor, dass wir die Produktivität jedes Jahr um l-3 Prozent verbessern müssen«, sagte er. »Zu jedem Arbeitsgang gibt es einen Plan, der bis zum Jahr 2000 eine Verbesserung um den Faktor zehn vorsieht, durch Automatisierung und Steigerung der Arbeitsleistung. Und das werden wir auch schaffen.« ...
Bertelsons Abteilungsleiter, die mit uns am Tisch saßen, legten die Vermutung nahe, Motorola sei das Ideal eines multikulturellen Unternehmens. Chinese, Malaie, Inder, schwarz, gelb, hellbraun, Christ, Buddhist, Moslem, Hindu. Die einzigen Weißen waren Bertelson und ein schottischer Ingenieur namens Dave Anderson, der aus Singapur kam. Longinus Bernard, ein Inder aus Johore, dessen Vater noch auf den Landgütern der Kolonialherren gearbeitet hatte, sprach über die Zeit im Jahr 1974, als Motorola gerade angefangen hatte. »Wir waren so klein, dass jeder jeden kannte«, erinnerte er sich. »Es war wirklich -- wie sagt man -- ein gutes Gefühl.«
Hassim Majid, Manager für Regierungsangelegenheiten, erklärte, wie die verschiedenen Bevölkerungsgruppen bei der Einstellung der Mitarbeiter berücksichtigt wurden. »Die Regierung hat uns geraten, eine aktive Rolle bei der Restrukturierung der kulturellen Zusammensetzung im Unternehmen zu spielen«, sagte er. »Sie sagten uns, wir sollten soundso viele Malaien wie mich einstellen, soundso viele Chinesen, soundso viele Inder, genau wie bei den Förderungsmaßnahmen zugunsten von Minderheiten, die in den Vereinigten Staaten eingeführt worden waren. Motorola hat diese Vorgaben erfüllt.«
In der Anlage in Kuala Lumpur, Motorolas größter Fabrik außerhalb der Vereinigten Staaten, arbeiteten 5000 Menschen, 80 Prozent Malaien und 3900 »Damen«, wie sie von den Managern genannt wurden. Das Unternehmen hatte vor, die Anlage -- aber nicht die Zahl der Mitarbeiter -- auf die doppelte Größe zu erweitern. Das Werk verkörperte eine schon damals voll ausgebildete Anomalie der globalen Wirtschaftsrevolution: Während konservative Ideologen in den Vereinigten Staaten noch heftige Attacken gegen eine drohende Multikultur führten, waren konservative amerikanische Unternehmen schon dabei, sie rund um die Welt umzusetzen. Im globalen Zusammenhang gesehen, schien die Fixierung der amerikanischen Politik auf Rasse und kulturelle Überlegenheit lächerlich, realitätsfremd und vielleicht auch gefährlich zu sein."
[Greider, William <1939 - >: Endstation Globalisierung : neue Wege in eine Welt ohne Grenzen. -- Ungekürzte Taschenbuchausgabe. -- München : Heyne, ©1998. -- (Heyne Business ; 22/1056). -- ISBN 3453155521. -- Originaltitel: One world, ready or not : the manic logic of global capitalism, ©1997. -- S. 143 - 147. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
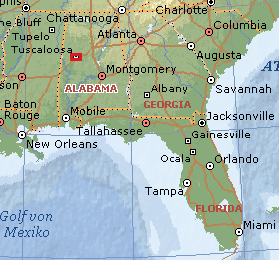
Abb.: Lage von Tuscaloosa (©MS-Encarta)
Webpräsenz von Tuscaloosa: http://www.ci.tuscaloosa.al.us/.
-- Zugriff am 2001-01-10
Webpräsenz von Mercedes-Benz, Tuscaloosa: http://www.mbusi.com/.
-- [Sehr besuchenswert!]. -- Zugriff am 2001-01-10
"Wenn Malaysier in der Lage waren, amerikanische Halbleiter herzustellen, konnten dann nicht Arbeitnehmer in Alabama einen deutschen Mercedes zusammenbauen? Die Frage war gar nicht so weit hergeholt, denn der US-Bundesstaat Alabama schnürte für Daimler-Benz ein dickes Subventionspaket zusammen, damit das Unternehmen ein kleines Mercedes-Werk in Tuscaloosa eröffnete. Die Regierung von Alabama sicherte Daimler-Benz Steuerbefreiungen in Höhe von 300 Millionen Dollar und stattliche Subventionen für eine Fabrik zu, in der lediglich 1500 Menschen beschäftigt werden sollten -- das heißt, 200000 Dollar pro Arbeitsplatz.

Abb.: Mercedes-Benz Tucaloosa [Bildquelle: http://www.mbusi.com/mbusi.htm.
-- Zugriff am 2001-01-10]
Alabama war ungeheuer stolz auf seine Errungenschaft, so stolz wie die Malaysier, als Motorola in ihr Land gekommen war. Aufgrund der hässlichen rassistischen Vergangenheit ihres Staates waren es die Einwohner von Alabama gewohnt, als rückständig verhöhnt und bei der Entwicklung neuer Industrien übergangen zu werden. Vielleicht würde es dem Namen Mercedes gelingen, für Ansehen und Modernität zu sorgen. Der Gouverneur gab bekannt, dass der Interstate Highway von Montgomery nach Birmingham in Mercedes-Benz-Autobahn umbenannt werde. Er schickte Truppen der Nationalgarde los, um vor Baubeginn das Werksgelände zu räumen. Auf der Anzeigetafel des Football-Stadions der Universität wurde ein Mercedes-Stern angebracht, aber das war selbst den Einwohnern Alabamas zuviel. Der Stern wurde wieder abmontiert.
Die Bedingungen, die Daimler mit Alabama ausgehandelt hatte, ließen Malaysias Steuervergünstigungen wie ein Trinkgeld aussehen. Zusätzlich zu 253 Millionen Dollar direkten Subventionen versprach der Staat, 2500 Exemplare des neu entwickelten Allradfahrzeugs zu kaufen, das 30000 Dollar kostete. Die Steuerzahler von Alabama würden 60 Millionen Dollar für Reise- und Hotelkosten zahlen, um ihre Mitbürger zum Training nach Deutschland zu schicken. Und angesichts der großzügigen Steuerbefreiung würden die Löhne der zukünftigen Mercedes-Arbeiter noch einige Jahre lang aus Steuermitteln finanziert werden."
"Zumindest im Fall von Alabama konnte der Staat von sich behaupten, dass auch er ein »Entwicklungsland« sei und wie Malaysia zu außergewöhnlichen Mitteln greifen müsse. Die großzügigen Subventionen waren jedoch nicht der einzige Grund dafür, warum sich multinationale Unternehmen an Orten wie Tuscaloosa, Spartanburg oder Smyrna niederließen. Im Südosten der Vereinigten Staaten war der Durchschnittslohn eines Arbeitnehmers in der Fertigungsindustrie etwa halb so hoch wie in Deutschland. Im neuen BMW-Werk in South Carolina fingen die Arbeiter mit zwölf Dollar pro Stunde an und konnten sich dann bis auf 16 Dollar hocharbeiten. Dazu gab es zehn Tage bezahlten Urlaub anstelle der 30 Tage für deutsche Arbeitnehmer.
Die Migration des Kapitals erlaubte es den Unternehmen nicht nur, eine neue, moderne Fabrik auf eine grüne Wiese zu setzen, sie ermöglichte es ihnen auch, »reinen Tisch« zu machen und mit den Arbeitnehmern auf der grünen Wiese von vorn anzufangen. »Die schlechten Angewohnheiten lassen wir hinter uns zurück«, sagte ein Ford-Manager zu mir, als er ein Autoteilewerk in Ungarn beschrieb, wo die neue Belegschaft im Gegensatz zu Detroit in fließenden Arbeitsgruppen organisiert war und keine Vorarbeiter hatte. Als japanische und deutsche Automobilhersteller ihre neuen Werke in den Vereinigten Staaten errichteten, suchten sie sich kleine Städte in ländlichen Gebieten aus, in der Regel in den Südstaaten, wo die Gewerkschaften nicht sehr stark vertreten waren.
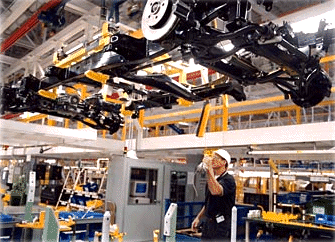
Abb.: Montagehalle bei Mercedes-Benz Tuscaloosa [Bildquelle: http://www.mbusi.com/mbusi.htm.
-- Zugriff am 2001-01-10]
Konnten Arbeiter aus Alabama einen Mercedes herstellen? Als ich in Stuttgart war, stellte ich Erich Klemm diese Frage. Er ist Betriebsratsvorsitzender im größten Montagewerk von Daimler in Sindelfingen. Auf dem Parkplatz vor der Fabrik standen nur Mercedes, weil jeder Arbeitnehmer einen fährt. Klemm lächelte etwas gequält und dachte kurz nach. »Wenn wir ihnen dabei helfen«, erwiderte er schließlich.
Klemm erklärte, dass die IG Metall [Webpräsenz: http://www.igmetall.de/. -- Zugriff am 2001-01-11] und der Betriebsrat des Unternehmens der Produktionsverlagerung nach Alabama zugestimmt hätten, weil die neuen Mehrzweckfahrzeuge, die dort hergestellt werden sollten, ohnehin in erster Linie für den amerikanischen Markt gedacht waren. Darüber hinaus versprach die deutsche Gewerkschaft, der amerikanischen Gewerkschaft United Auto Workers [Webpräsenz: http://www.uaw.org/. -- Zugriff am 2001-01-11] dabei zu helfen, die Angestellten in den neuen deutschen Werken in den Vereinigten Staaten gewerkschaftlich zu organisieren. Der Gewerkschaft war jedoch klar, dass sie auf erheblichen Widerstand stoßen würde, insbesondere in den Reihen der amerikanischen Arbeitnehmer, die froh waren, einen Arbeitsplatz bei Mercedes ergattert zu haben.
Deutschlands modernes System der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen in gewerkschaftsfeindlichen Staaten wie Alabama oder South Carolina einzuführen, würde eine ähnlich revolutionäre Einmischung in die einheimische Kultur bedeuten wie der Prozess, malaysische Frauen mit Bankautomaten vertraut zu machen. In Deutschland saßen die Vertreter der IG Metall im Aufsichtsrat von Mercedes-Benz und wurden über die Firmenstrategie informiert. In Sindelfingen berieten sich die Manager vor jeder wichtigen Entscheidung mit Klemm und dem von den Arbeitnehmern gewählten Betriebsrat.
War es überhaupt vorstellbar, dass Angestellte in einer Fabrik in Alabama eine Arbeitnehmervertretung wählten? Oder dass das Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet wurde, sich mit den Erwerbstätigen zu beraten? Waren die Vereinigten Staaten für eine solch radikale Neuerung bereit? Vermutlich nicht, räumte Klemm ein, aber die deutsche Gewerkschaft war fest entschlossen, die Rechte der amerikanischen Arbeitnehmer zu unterstützen, selbst wenn einige amerikanische Arbeitnehmer sich nicht gerade begeistert über diese Hilfe zeigten. Eine ungewöhnliche Situation - Deutsche boten sich an, den Amerikanern zu zeigen, wie sie mit ihrem neuen Chef aus Stuttgart umgehen sollten.
»Wir haben dem Unternehmen gesagt, wenn ihr in die Staaten geht, dann solltet ihr euch nicht wie hässliche Kapitalisten benehmen, sondern mehr Verantwortung an den Tag legen«, sagte Klemm. »Wir würden es auf keinen Fall hinnehmen, wenn Mercedes versuchen sollte, mit Hilfe der amerikanischen Gesetzgebung die Gewerkschaften oder eine Arbeitnehmervertretung zu bekämpfen. Wenn das Unternehmen Arbeiter feuert, weil diese sich gewerkschaftlich organisieren wollen, werden wir dagegen angehen.«"
[Greider, William <1939 - >: Endstation Globalisierung : neue Wege in eine Welt ohne Grenzen. -- Ungekürzte Taschenbuchausgabe. -- München : Heyne, ©1998. -- (Heyne Business ; 22/1056). -- ISBN 3453155521. -- Originaltitel: One world, ready or not : the manic logic of global capitalism, ©1997. -- S. 163f., 172 - 174. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]

Abb.: Lage von Jena (©MS-Encarta)
Obwohl die Betriebskulturen der DDR der Vergangenheit angehören, sind sie Bestandteil der Lebenserfahrung vieler Bürger der ehemaligen DDR. Insofern sind sie auch heute noch wichtig für die Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen aus der ehemaligen DDR.
"Der Wiederaufbau des Zeiss-Werkes begann nach der Demontage im April 1947 mit 5 048 Mitarbeitern. Schnell wuchs die Belegschaft. Die Deutsche Wirtschaftskommission (DWK) beschloss am 16. Juni 1948, die Carl-Zeiss-Stiftung zu erhalten, ihre Betriebe jedoch gegen den Widerstand der Belegschaft zu enteignen und in Volkseigentum zu überführen.
Planerfüllung und Motivation
Bereits im Mai 1948 beriet die Wirtschaftskonferenz des Parteivorstandes der SED die Ausarbeitung und Verwirklichung einer einheitlichen Wirtschaftsplanung durch Halbjahr- und Jahrpläne. Nach dem ersten Halbjahrplan für die zweite Hälfte des Jahres 1948 und dem Zweijahrplan für 1949 und 1950 verkündete die Regierung für die Zeitspanne von 1951 bis 1955 den ersten Fünfjahrplan.

Abb.: Der Bergmann Adolf Hennecke bei seiner Hochleistungsschicht im Oelsnitzer
Karl-Liebknecht-Schacht, 1948-10-13
Ein wichtiges Mittel, die Werktätigen zur Planerfüllung und -übererfüllung zu motivieren, wurde die Aktivistenbewegung. Ausgehend von der inszenierten Überbietung der Norm um 380 Prozent durch den Bergmann Adolf Hennecke [1905 - 1975] im Oktober 1948 wurde sie - ganz nach sowjetischem Vorbild -- zu einer großangelegten Kampagne, die zwei Ziele verfolgte: einerseits die Beschäftigten zu höheren Leistungen zu motivieren, andererseits sie durch Auszeichnungen -- Aktivistentitel, Ausweis, Medaillen -- enger an Betrieb und Staat zu binden. So zeichneten zum Beispiel die Zeiss-Werke 1949 bereits 126 Werktätige als Aktivisten aus.
Rund 12 000 Frauen und Männer arbeiteten zu Beginn des Jahres 1951 beim VEB [Volkseigenen Betrieb] Carl Zeiss Jena. Die Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL) und die Betriebsparteiorganisation (BPO) der SED formulierten im Aktivistenplan für den Zeiss-Betrieb hochgesteckte Ziele:
Aber es gab noch andere Wege, um die Belegschaft zu höherer Arbeitsproduktivität anzuspornen: Im April 1953 erließen Werksleitung, BGL [ Betriebsgewerkschaftsleitung] und die Betriebsparteiorganisation der SED einen gemeinsamen Aufruf zum innerbetrieblichen Wettbewerb für die Energie- und Materialeinsparung unter der Losung »Sparsamste Betriebsleitung des VEB Carl Zeiss Jena«. Die Betriebsgewerkschaftsleitung schloss zudem sogenannte Betriebskollektivverträge ab, die in erster Linie die Werktätigen zur Planerfüllung verpflichteten und in zweiter Linie der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der kulturellen Betreuung des Arbeiters dienten.
Ziel dieser und vieler weiterer in den Volkseigenen Betrieben unternommenen
Anstrengungen war, mittels innerbetrieblicher und staatlicher Auszeichnungen die
Leistungsbereitschaft des einzelnen Werktätigen, der Kollektive wie des
Gesamtbetriebes zu steigern, die Pläne zu erfüllen und die Belegschaft fester
in den jeweiligen Betrieb zu integrieren. Die Bindung an den Betrieb sollte
gleichzeitig die Akzeptanz des eigenen Staates fördern. Propaganda und
Agitation waren hierbei wichtige Hilfsmittel.
Doch 1953 regte sich innerhalb der Arbeiterschaft entschiedener Widerstand gegen
die Politik des Staates. Zeiss-Arbeiter informierten ihre Kollegen in den
Morgenstunden des 17. Juni über den in Berlin ausgebrochenen Streik und dessen
Forderungen, die Normerhöhungen zurückzunehmen und die Regierung zu stürzen.
Neben Solidaritätserklärungen mit den Streikenden verlangten die Werktätigen
zusätzlich die Wiederherstellung des alten Zeiss-Statutes und die Abschaffung
der Bezeichnung »VEB«. Die Arbeiter aller Zeiss-Betriebe streikten innerhalb kürzester
Zeit, andere Jenaer Betriebe schlossen sich an. Nach einer Großdemonstration
mit 15 000 Demonstranten, dem Sturm des SED-Parteigebäudes, der FDGB- und FDJ-Büros
sowie des Stadtgefängnisses besetzten sowjetische Truppen alle Zeiss-Betriebe.
Innerhalb weniger Stunden schlugen sie den Aufstand nieder. Die Forderungen
blieben unerfüllt.
Einrichtungen für Sozialwesen und Gesundheitsschutz
Die Jenaer Zeiss-Werke, die seit dem 19. Jahrhundert in der sozialen
Tradition ihrer Firmengründer Carl Zeiss [1816 - 1888] und Ernst Abbe [1840 -
1905] standen, waren vorbildlich in ihren »Einrichtungen für Sozialwesen und
Gesundheitsschutz«.
In der im Mai 1948 eingerichteten, ständig erweiterten Betriebspoliklinik
arbeiteten Mitte der fünfziger Jahre unter der Leitung eines Chefarztes 17 Ärzte
und zahlreiche Krankenschwestern, Zahntechniker, Masseure, Laboranten und
Verwaltungsangestellte. Werksangehörige und deren Familienmitglieder nahmen
dieses kostenfreie Angebot zunehmend an. Als besonders wichtige Aufgabe galt für
die Betriebspoliklinik die Gesundheitsvorsorge. Zudem überwachte sie täglich
die Werksküche und die Qualität des Werksessens.
Seit 1951 existierte auch eine eigene Apotheke der Betriebspoliklinik. Sie versorgte die Betriebsangehörigen sowie die Ferien- und Kinderheime, Ferienlager und das Kinderkrankenhaus der Carl-Zeiss-Stiftung, stand aber auch den Bewohnern Jenas und Umgebung zur Verfügung.
Betriebskindereinrichtungen bildeten einen weiteren Schwerpunkt der betriebseigenen Sozialleistungen. Im Jahr 1954 unterhielten die Zeiss-Werke drei Betriebskinderkrippen, einen Betriebskindergarten und zwei Betriebskinderhorte. Hierzu kamen eine Betriebskindertagesstätte und die zentrale Kinderküche. Ein Kinderkurhaus, ein Kindererholungsheim, ein Pionierlager und ein Betriebsferienlager ergänzten dieses Angebot.
Für weibliche und männliche Lehrlinge, deren Eltern außerhalb Jenas wohnten, standen Mädchen- und Jungenwohnheime zur Verfügung. Etwa ein Drittel des Monatsverdienstes zahlten sie hier für Unterkunft und Verpflegung; 1954 waren dies je nach Lehrjahr zwischen 24 und 30 DM monatlich.
Darüber hinaus bot das Werk seinen Werktätigen Erholung und Urlaub in verschiedenen Urlaubs- und Erholungsheimen. Subventioniert von Betrieb und Staat zahlten FDGB-Mitglieder für einen zweiwöchigen Aufenthalt 35 DM, alle übrigen Werksurlauber und Familienmitglieder 70 DM. Bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 350 DM ein sehr interessantes Angebot. Doch die vorhandenen Plätze reichten bei weitem nicht aus, lange Wartezeiten mussten in Kauf genommen werden.
Gerade diese Urlaubsangebote trugen aber - - gemeinsam mit all den anderen genannten betriebseigenen Sonderleistungen -- letztendlich dazu bei, dass viele Belegschaftsangehörige sich eng mit dem Betrieb verbunden fühlten, ihn gleichsam als ein »zweites Zuhause« empfinden konnten.
Bildungseinrichtungen
Um für den eigenen Fertigungs- und Industriebereich gut ausgebildete Arbeitskräfte zu haben, leisteten sich die Volkseigenen Betriebe Lehrwerkstätten und Betriebsberufsschulen.
Bis 1949 bildete der VEB Carl Zeiss Jena im Durchschnitt jährlich 400 Lehrlinge aus. Bis Juli 1954 stieg ihre Zahl auf 1800, davon die Hälfte Mädchen. Neben ihrer Arbeit und sportlichem Ausgleich sollten sie aber auch freiwillige Arbeitsstunden im Nationalen Aufbauwerk leisten. Für das Kulturangebot sorgte mit materieller und finanzieller Unterstützung des Werkes die Freie Deutsche Jugend.
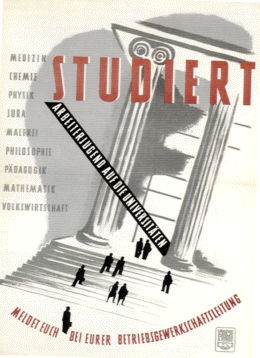
Abb.: "Arbeiterjugend auf die Universitäten", Plakat, DDR,
1950er-Jahre
Von 1949 bis 1953 delegierte das Werk mehr als 650 junge Arbeiter und Angestellte zum Studium an Arbeiter- und Bauernfakultäten, Fachschulen und Universitäten. Arbeiter- und Bauernfakultäten waren 1949 an allen Universitäten und einigen Hochschulen eingerichtet worden. Hervorgegangen aus sogenannten Vorstudienanstalten wurden hier »Arbeiter- und Bauernkinder« sowie Kinder der »werktätigen Intelligenz« zugelassen, die über eine abgeschlossene Grundschul- und Berufsausbildung verfügten und sich durch hervorragende Arbeitsleistungen in der Produktion auszeichneten. Ende 1953 studierten bereits 510 Werksangehörige.
Aus der Betriebsvolkshochschule entwickelte sich 1953 die Technische Betriebsschule. Sie bot jedem Werksangehörigen kostenfrei die Möglichkeit, durch technische Schulung seine berufliche Qualifikation zu verbessern und somit sein Einkommen zu erhöhen. Im ersten Quartal 1954 belegten bereits über 4600 Teilnehmer 230 Lehrgänge.
Zeiss erweiterte sein Bildungsangebot zudem durch eine eigene Fachschule für Augenoptik, eine technisch-wissenschaftliche Bibliothek, ein Technisches Kabinett und drei Betriebsbüchereien.
»Kulturelle Massenarbeit«
Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften und Zirkel, Volkskunstgruppen, Chöre, Orchester und Betriebssportgemeinschaften waren Ausdrucksformen der »Kulturellen Massenarbeit« in den Volkseigenen Betrieben. 1954 nutzten rund 70 Prozent der Zeiss-Gesamtbelegschaft das vielfältige Angebot -- einschließlich der Schüler der Technischen Betriebsschule und der Bibliotheksbenutzer. Ein Spitzenergebnis auch im Vergleich mit anderen DDR-Betrieben.
Doch zeigen diese Zahlen auch, dass ein nicht unbedeutender Teil der Belegschaft die Angebote des Werkes nicht annahm und seine Freizeit selbst organisierte. Zuweilen konnten nicht alle das betriebliche Angebot nutzen, da die Plätze beschränkt oder wie die Ferienaufenthalte in betriebseigenen Häusern teilweise an die Mitgliedschaft in einer Massenorganisation -- hier dem FDGB -- gebunden waren.
Das soziale und kulturelle Engagement von ... [den] Zeiss-Werken ... entsprang zu einem Teil der Sorge um das Wohl und die Arbeitsfähigkeit des einzelnen Werktätigen. Es darf aber nicht übersehen werden, dass die betriebseigenen sozialen Dienste, Fortbildungs- und Freizeiteinrichtungen wie auch die Auszeichnungen, Urkunden und Medaillen für besondere Verdienste und Leistungen am Arbeitsplatz immer auch einen anderen, nicht selten vorrangigen Zweck verfolgten: Über eine Akzeptanz der Betriebsform VEB sollte zugleich eine Akzeptanz des sozialistischen Staates herbeigeführt werden.
Für den einzelnen Werktätigen waren die betriebseigenen Leistungen aber unabhängig davon eine wichtige Hilfe bei der Bewältigung des täglichen Lebens -- insbesondere bei einem sich insgesamt nur langsam entwickelnden Lebensstandard und eingeschränkten Konsummöglichkeiten."
[Schlief-Ehrismann, Renate <1960 - >. -- In: Markt oder Plan : Wirtschaftsordnungen in Deutschland 1945 .- 1961 / Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hg.). -- Frankfurt a. M. [u.a.] : Campus, ©1997. -- ISBN 3-593-35655-4. -- S. 105 - 110]
Webpräsenz der Carl Zeiss:
http://www.zeiss.de/DE/home.nsf/intro. -- Zugriff am 2001-01-22

Abb.: Arbeiter prosten ihren Patrons zu, Vichy, 1940er-Jahre
[Bildquelle: Geschichte des privaten Lebens / Philippe Aries (hg.) .... -- Frankfurt a. M. : Fischer. -- Bd. 5. -- 1995. -- ISBN 3100336356. -- S. 49. -- Originaltitel: Histoire de la vie privée (1987). -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Der durch die Kirche propagierte Traditionalismus gilt immer noch für weite Teile der Bevölkerung; insbesondere die familiären Strukturen der mittelständischen Unternehmen, mit dem Bild des patron, konnte er prägen. Patronalismus ist auch in Großunternehmen anzutreffen, doch traditionell betrifft er das Wirkungsfeld der kleinen und mittelständischen Unternehmen und prägte hier die Unternehmenskultur langfristig. Obwohl der Staat eine internationale Aktivität intensiv fördert, lassen sich die kleinen und mittleren Unternehmen kaum zu diesem Schritt bewegen. Bedingt durch veraltete Betriebsstrukturen sowie mangelndes Interesse der Mittelständler, sich außerhalb des gewohnten Kundenkreises zu versuchen, steht man der internationalen Zusammenarbeit skeptisch bzw. aufgrund fehlender Erfahrung ängstlich gegenüber. Münch macht den traditionalistischen Geist des Katholizismus für die patronalistische Haltung der Klein- und Mittelunternehmer in Frankreich verantwortlich:
»Wenn die verehrte Kundschaft dem Betrieb treu bleibt, dann ist man schon zufrieden. Sicherheit geht allemal vor Risiko. Nichts verändern, was sich bewährt hat ist die Devise. Eine neue Ladeneinrichtung wird nicht als Investition betrachtet, um neue Kundschaft anzuziehen. Es wird mehr befürchtet, dass sie die alte Kundschaft verschreckt. Das wirtschaftliche Leben läuft in festen Beziehungen zu langjährigen Kunden und Lieferanten ab, nicht auf einem anonymen Markt. Treue gegenüber der Klientel und Rücksichtnahme auf den Kundenkreis der Kollegen, nicht harter Wettbewerb und Erfolgsstreben regieren hier.«
In Frankreich werden petites et moyennes entreprises PME genannt, bzw. Industrieunternehmen werden als petites et moyennes industries PMI bezeichnet. Das allgemein angewandte Kürzel PME für Klein- und Mittelbetriebe soll auch in dieser Untersuchung Verwendung finden. Eine allgemeingültige Definition von »mittelständischen Unternehmen« oder von »Mittelstand« existiert jedoch nicht. Der Begriff umfasst einen sehr heterogenen Bereich von Handwerk, Industrie, Handel bis zu Dienstleistungen, wobei -- abhängig vom Untersuchungsgegenstand -- unterschiedliche Abgrenzungen existieren. Eine Beschäftigtenzahl von 500 Personen gilt in Frankreich üblicherweise als Grenze zum Großunternehmen. In der Literatur wird oft die Eigentümerunternehmerschaft als qualitative Eigenschaft des Mittelstands beschrieben. Eigentum, Unternehmensführung, Verantwortung und Risikobereitschaft in der Person des Unternehmers charakterisieren hauptsächlich das mittelständische Unternehmen. Die Kapitalbereitstellung erfolgt dabei durch Einzelne oder wenige Teilhaber. In dieser Untersuchung gilt die quantitative Abgrenzung von bis zu 500 Beschäftigten in einem Unternehmen.
Der Unternehmer im französischen Familienbetrieb ist der patron, der »Schutzheilige«, ein Begriff aus vorindustrieller, feudal-kirchlicher Zeit. Mit der Entstehung von größeren Industriebetrieben um 1830 benutzte man verstärkt den Begriff patron bzw. patronat für die Inhaber kleiner und mittlerer Familienbetriebe. Seit den Massenstreikbewegungen von 1936 hat sich der Begriff patron zudem als gemeinsamer Kampfbegriff für die Arbeiterschaft gefestigt. Er trägt für alle deutlich erkennbar die Botschaft der patronalen Autorität in sich. Das patronat verspricht Fürsorge für die Arbeiter. Letztere verpflichten sich im Gegenzug zur Akzeptanz der von Gott vorgegebenen Hierarchie und schulden ihnen absoluten Gehorsam. Der Patron herrscht im mittelständischen Betrieb im Sinne der ständischen Ordnung. Er befiehlt, die Mitarbeiter müssen gehorchen und hegen auch keine Zweifel an seiner vorgegebenen Autorität. Tradition und persönliche Beziehungen bestimmen die Betriebsführung und weniger die tatsächlichen Marktchancen des Unternehmens. Ein in Frankreich arbeitender deutscher Manager meint auf die Frage nach der Existenz von hierarchischer Distanz im mittelständischen Unternehmen: "Wir haben an der Spitze einen Diktator, der sich PDG nennt, und unten drunter haben Sie lange nichts. "
Eine eigenständige Vertretung der Mitarbeiterinteressen ist mit dem Patron nicht vereinbar. Die Folgen sind radikale Tendenzen bei den Gewerkschaften, die sich anderweitig keine Mitsprache erhoffen können. In diesem Kontext besitzt für französische Manager in deutsch-französischen Kooperationen insbesondere die starke Stellung der deutschen Gewerkschaften große Bedeutung. Sie werden als Hindernis für den notwendigen Wandel und Fortschritt angesehen. Ein Mitbestimmungsgesetz für Arbeitnehmer, d.h. ein sogenanntes Systeme de cogestion, kennen sie in Frankreich nicht. Die Angleichung bzw. Harmonisierung von Sozialklauseln für deutsche und französische Mitarbeiter in einer binationalen Kooperation gestaltet sich daher äußerst schwierig und langwierig. Im Gegensatz zum an die feudale Ordnung angelehnten Patron definiert sich der deutsche »Unternehmer« durch seine wirtschaftliche Funktion sowie seine liberal-individualistische Persönlichkeit, losgelöst von Tradition und Religion. Er verkörpert den Geist der modernen industriellen Dynamik, geprägt in der Zeit der stürmischen Industrieproduktion ab 1870 und entfernt sich vom Bild des frühneuzeitlichen Feudalherrn. Bei sozial- und tarifpolitischen Auseinandersetzungen spricht man vom Arbeitgeber, ansonsten vom Unternehmer. In Frankreich vereinigt der Patron beide Sinndeutungen.
Im vom katholischen Traditionalismus geprägten Frankreich konnte sich kein unternehmerisches Bewusstsein in der Bevölkerung verankern. Die Entfaltungsmöglichkeiten des jungen Unternehmers, des »american dream« waren nicht erstrebenswert. Statt dessen galt der bescheidene, sicherheitsbewusste Handwerker oder Gewerbetreibende, der sich auf seine Stammkundschaft beschränkt, als Vorbild des katholischen Traditionalismus. Zur Relativierung dieser Aussage sei hinzugefügt, dass in Deutschland zwar überwiegend eine positive Haltung gegenüber dem Unternehmergeist existieren mag. Im Gegensatz zu den USA ist jedoch nicht das Bild des Self-made-man charakteristisch, sondern mehr das einer Beamtenmentalität. Der Durchschnittsbürger sucht Schutz in großen Organisationen und Verbänden. Risikobereitschaft und unternehmerische Initiativen gehen deshalb zumeist von Großunternehmen aus. Ein amerikanischer, ökonomischer Liberalismus besitzt im vom Bildungsliberalismus geprägten Deutschland keine tiefe Verwurzelung. Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Deutschland rasant nachgeholte Industrialisierung konnte sich nicht auf eine in der Gesellschaft vorhandene ökonomische Freiheit stützen, sondern musste staatlich vorangetrieben werden.
In den Jahren 1983/84 hat die sozialistische Regierung mit einem rigorosen
politischen Kurswechsel zu einer Öffnung der französischen Gesellschaft für
marktwirtschaftliche Problemstellungen beigetragen. Die Franzosen entdeckten
eine neue Seite des Ökonomischen und versuchten einen nationalen Konsens
hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung des Unternehmers zu finden. Das
schlechte Ansehen des freien Unternehmertums wird von der Regierung als Ursache
für die wirtschaftlichen Schwächen Frankreichs gesehen. Deshalb propagieren
die staatlichen Eliten eine Revision des bisherigen Bildes der wirtschaftlichen
Tätigkeit und fordern mehr unternehmerische Initiative der Gesellschaft. Die
französische Gesprächskultur integriert nun, dank der Vorbildrolle des
Staates, auch ökonomische Fragen als Gradmesser für die intellektuelle
Kompetenz der Individuen. Medien und Politik wollen mit einer Imagekampagne zu
einer Ökonomisierung der Mentalitäten bzw. zu einer Veränderung des
Unternehmerbildes beitragen, so dass beispielsweise im staatseigenen Radiosender
France Inter eine eigene wöchentliche Rubrik La route des
entrepreneurs eingeführt wird oder Tageszeitungen erstmalig eigene
Wirtschaftsbeilagen entwickeln. Unternehmer sind plötzlich hoffähig geworden.
Das berufliche Ideal des Elitebeamten scheint sich in Richtung des Unternehmers
zu wandeln. Bernard Tapie beispielsweise wurde nach dem Kauf des deutschen
Unternehmens Adidas in der französischen Bevölkerung hochgejubelt. Es gelang
ihm, protegiert von Francois Mitterand, sogar der Eintritt in die Politik. Doch
nach den Skandalen um seine Person und dem Konkurs seines Unternehmens eignet er
sich sicherlich nicht mehr für ein besseres Unternehmerbild in Frankreich. Die
Beamtenelite indessen hat keineswegs an Image eingebüßt und wird sich nach dem
Scheitern des »Leitbildes« Bernard Tapie auch in Zukunft als bedeutendstes
gesellschaftliches bzw. berufliches Ideal darstellen. Dem Begriff patron
hängt damit weiterhin mehr das Image eines autoritären, lediglich nach Geld
strebenden Unternehmers nach als das einer gesellschaftlichen Leitfigur des nouvel
entrepreneur.
Wenn Armand Bizaguet von einem allgemeinen gesellschaftlichen Misstrauen der
Franzosen gegenüber Kapital und Profit spricht, so denkt er dabei an das von
uns bereits betrachtete, langfristige geistige Erbe der mittelalterlichen
Kirche. Arbeit und Geld besitzen daher im vom Protestantismus geprägten
Deutschland eine von Frankreich gänzlich unterschiedliche Bedeutung, was sich
unter anderem an der hohen gesellschaftlichen Wertschätzung der ökonomischen Führung
zeigt. Indessen führt der traditionelle Einfluss der Kirche auf die französische
Gesellschaft dazu, dass bis in die Gegenwart hinein das Ansehen in Frankreich
nicht auf dem materiellen Besitz, sondern auf der sozialen Position beruht.
Diese Position ist von Gott vorgegeben. Der Versuch, aus der eigenen Stellung
der bestehenden Hierarchie auszubrechen, wird von der Umgebung misstrauisch
beobachtet. Kennzeichnend für die, unter anderem dem Katholizismus
entspringende Haltung zur Anhäufung von Kapital ist das geringe
unternehmerische Wagnis gegenüber dem massiven Drang der gesellschaftlichen
Elite in eine administrative Funktion: (...) la mentalité française, si peu
capitaliste, qui se manifeste par ce besoin de sécurité et de protection (...)
plutôt que par le goût d'entreprendre pour creér des richesses, ou encore par
cette propension de nos élites intellectuelles á s'orienter vers la fonction
public plutôt que vers l'entreprise."
[Fischer, Matthias: Interkulturelle Herausforderungen im Frankreichgeschäft : Kulturanalyse und interkulturelles Managemant. -- Wiesbaden : Gabler, ©1996. -- (Gabler Edition Wissenschaft). -- ISBN 3824463288. -- Zugleich: Erlangen-Nürnberg, Universität, Dissertation, 1995. -- S. 72 - 76 (dort Quellennachweise). -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
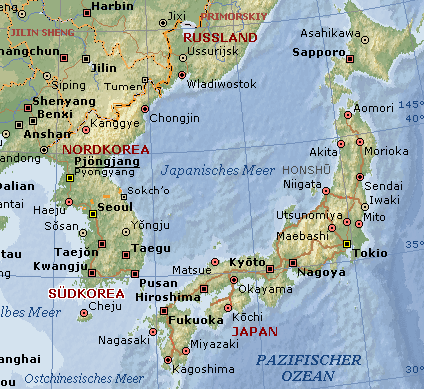
Abb.: Lage von Südkorea und Japan (©MS-Encarta)
| Korean Air's offizielle Firmenphilosophie seit 1969: "To become the world's leading airline and possess the highest standards of service and safety." |
"Die Fluggesellschaft Korean Air [Webpräsenz: http://www.koreanair.com/index.asp?langid=EN. -- Zugriff am 20001-01-04] ist in den letzten Jahren in Verruf geraten. Grund ist eine Serie von Unfällen und Beinahe-Katastrophen. In der Mehrzahl der Fälle waren Fehler der Besatzungen im Spiel. Zurzeit arbeitet das Unternehmen am Aufbau einer Sicherheitskultur und an der Rekrutierung besser qualifizierten Cockpit-Personals. ...
David Greenberg beschäftigte sich nach seiner Pensionierung als Flugbetriebsleiter bei der Delta Air Lines als Berater in Sachen Flugsicherheit. Im Auftrag von American Airlines untersuchte er den Landeunfall von Little Rock (Arkansas), bei dem eine MD-83 in starkem Regen über die Landebahn hinausgeschlittert war. Greenberg ist bei Korean auf Ursachenforschung gegangen und kommt zu anderen als den üblichen Schlussfolgerungen. Seiner Ansicht nach ist es nicht nur die koreanische Mentalität mit ihren streng festgelegten Hierarchien und Vorstellungen von Gesichtsverlust, die die Fluggesellschaft so sehr in Schwierigkeiten gebracht hat. Vielmehr spürt er den «starken Einfluss von Unternehmenskultur». Eingefahrene Strukturen und Verhaltensweisen zu ändern, sei in älteren Unternehmen wie Korean sehr viel schwerer als bei jüngeren.
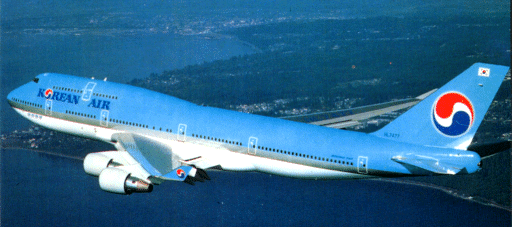
Abb.: Betrieb Jumbojet (Bildquelle: KAL)
Greenberg muss sich auch als Integrationskünstler beweisen. Die Hierarchie unter den Piloten soll nicht mehr wie in den schlechten alten Tagen auf politischer Basis entschieden werden, sondern auf Grund von Fähigkeiten. Nach wie vor sind auch alte Verbindungen ein Problem. Viele der Piloten kennen sich aus Militärzeiten und sind dann zur Airline gewechselt, oft finden sich die einst Untergebenen als Chefs im linken Sitz wieder, während ihre Vorgesetzten als Co- Piloten fliegen. In einer Kultur, in der Rangfolgen von extremer Bedeutung sind, ist das eine schwierige Situation und keine gute Ausgangslage für ein gutes Crew Resource Management (CRM). Greenberg will erreichen, dass in kritischen Flugsituationen nicht mehr Autorität zählt, sondern die Lage in guter Arbeitsaufteilung gemeistert wird. «Wir müssen den Piloten beibringen, dass sie sich im Cockpit anders verhalten müssen, als sie das in der U-Bahn von Seoul tun würden, wenn sie ihren Vorgesetzten treffen», sagt David Moore, der das Team von Flight Safety Boeing bei Korean Air leitet. Doch es ist schwierig, so findet Greenberg, eine neue Sicherheits- und Trainingskultur zu vermitteln, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Neben den (unternehmens)kulturellen Konflikten hält Greenberg vor allem die mangelnden Englischkenntnisse vieler Crews für einen entscheidenden Gesichtspunkt.
Die ausländischen Kapitäne zu integrieren, ist ein weiteres Problem, denn wenn diese schneller Karriere machen, erzeugt dies Neid. Greenberg sagt, im Cockpit selbst sei dies nie ein Thema, aber die koreanischen Piloten haben gestreikt, weil die Ausländer viel mehr verdienen als sie."
[Flottau, Jens: «Die letzte Hoffnung für Korean Air» : Totalumbau des Unternehmens nach Serie von Unfällen. -- In: Neue Zürcher Zeitung. -- Internationale Ausgabe. -- 2001-01-04. -- S. 42. -- Online: http://www.nzz.ch/2001/01/04/lf/page-article72SSV.html. -- Zugriff am 2001-01-04]
Andreas Wittel führte ethnographische Untersuchungen in einem südwestdeutschen Elektronikbetrieb, dem er das Pseudonym GT gibt. Als einen wichtigen Faktor der Betriebskultur ortet er die Kaffeekultur, die hier nach amerikanischem Muster gestaltet ist:
"Während in den meisten bundesdeutschen Unternehmen die Beschäftigten das Kaffeetrinken selbständig organisieren - also Kaffeemaschinen mitbringen, eine Kaffeekasse anlegen, Arbeiten wie den Kauf von Kaffeepulver, Milch und Zucker aufteilen -- sind hier Indizien einer »mitgebrachten« Belegschaftskultur nicht vorzufinden. Bei GT liegt die Inszenierung der Kaffeekultur nahezu ausschließlich in den Händen der Firma. Sie übernimmt quasi die Rolle eines Gastgebers. Statt der üblichen, von den Beschäftigten mitgebrachten Filtermaschinen für acht bis zehn Tassen gehören hier hochmoderne und riesige Kaffeemaschinen zum festen Inventar der Großraumbüros. Der Kaffee ist gratis -- Teil des Sozialleistungsbestands der Firma. Die Maschinen verlangen von den Mitarbeitern nur einen Knopfdruck und füllen dann die Tassen entweder mit Wasser (für Teetrinker) oder mit Kaffee automatisch auf. Das Unternehmen stellt selbst die Trinkgefäße zur Verfügung.
Schon das räumliche Setting zeigt die Bedeutsamkeit des Kaffeetrinkens. In jedem Großraum befindet sich mindestens eine Kaffeeecke. Im Beobachtungsbereich steht sie an einer Schnittstelle des Verkehrs: direkt an einer Wegkreuzung, unweit des Treppenhauses, in der Nähe des Kopierers und für alle gut zugänglich in der Mitte des am häufigsten frequentierten Gangs. Durch diese zentrale Positionierung verleiht die Firma dem Getränk eine eminente Bedeutung. Sie gibt zu verstehen, dass das Kaffeetrinken wie selbstverständlich zur Firma gehört, dass es nicht nur toleriert, sondern geradezu erwünscht ist. Die Mitarbeiter kennen die Funktion, die der Konzern diesen Ecken beimisst, nur allzu genau. Eine Sekretärin erklärt:
»Du sollst dich quasi mit den Leuten unterhalten. Das wird sogar gewünscht. Und dazu sind diese Ecken da, diese Bistro-Ecken. Das hat man mir eindeutig gesagt. Verständigung und Kommunikation und so soll gefördert werden.«"

Abb.: Kaffee-Kommunikationskultur (©ArtToday)
"Im Gegensatz zu den schriftlichen Äußerungen der Firma entwerfen die Beschäftigten ein differenzierteres -- und man kann wohl sagen: realistischeres -- Bild der Kaffeegespräche. Sie schreiben der Kaffeeecke zwei Funktionen zu: Sie dient demnach sowohl als Informationsbörse wie auch als Ort der kurzfristigen Entspannung. Nahezu alle befragten Mitarbeiter erwähnen beide Funktionen, allerdings führen viele dabei zunächst den Informations- und Kommunikationsaspekt an und kommen anschließend auf den Regenerations- und Pausencharakter der Kaffeeecke zu sprechen. Die Übergänge von eins nach zwei sind, wie das folgende Zitat einer Sekretärin zeigt, oftmals fließend und unmerklich:
»Der Informationsfluss ist am Kaffeepott sehr groß. Größer, als wenn man die ganze Zeit am Arbeitsplatz sitzt. Dort trifft man dann welche von anderen Bereichen und die erzählen dann, woran sie gerade arbeiten und wie es da so ist. Da erfährt man die meisten Dinge. Offiziell kommt das erst später. Die Gerüchteküche ist schneller. Organisationsänderungen oder so etwas, das sickert immer vorher durch. Und dann trifft man sich dort und dann geht das so automatisch. Das ist auch ganz witzig. Man lernt sich dort irgendwie besser kennen. Und es ist viel lockerer und es werden Witze gemacht. Bei mir hat sich das schon eingependelt, dass ich sage, jetzt könnte ich mal eine Pause gebrauchen. Und dann suche ich mir jemanden oder treffe dort jemanden. Ich finde das blöd, den ganzen Tag vor sich hinzuarbeiten. Da stumpft man ja total ab. Also die Kontakte zu den Kolleginnen und Kollegen sollten schon ein bisschen gepflegt sein. Wir lachen auch viel miteinander, muss ich sagen.«"
Im Zusammenhang mit der im Unternehmen praktizierten open-door-policy wird von fast allen Beschäftigten ein weiteres egalisierendes Moment der Kaffeekultur genannt: Da alle in einem Großraum sitzen, seien die Vorgesetzten leichter erreichbar. Man müsse oftmals nicht erst mühevoll um einen Termin bitten, sondern könne die Manager oft ganz informell am Kaffeepott treffen und sie dann ansprechen. Das Beispiel Kaffeepott, das für einen zwanglosen und weitgehend unhierarchischen Umgang mit Hierarchie steht, taucht in fast allen Interviews auf. Es wird benutzt, um einen der zentralen firmenkulturellen Werte zu illustrieren, den informellen Umgang, auch mit Managern. Ein besonders schönes Beispiel findet sich in der Betriebszeitung. In diesem Forum haben im Mai 1988 Schülerzeitungsredakteure ihre Ergebnisse eines zweitägigen Workshops über die Besonderheit der Firma im Vergleich zu anderen Unternehmen präsentiert. Zitat:
»Eberhard, kommen Sie mal mit auf'n Kaffee?«, spricht die Tippse zum Topmanager, denn man redet sich beim Vornamen an."
Der Name Eberhard steht hier nicht ganz zufällig. Es ist der Vorname des damaligen Vorsitzenden der GmbH. Allerdings zeigt sich auch hier, wie Anspruch und Wirklichkeit auseinanderfallen. Aus einem Interview mit einer Sekretärin:
»Das Management ist kaum greifbar. Entweder sind sie in Meetings oder außer Haus. Dass die sich mal an den Kaffeepott stellen, darauf kann man lange warten. Das kommt jedes Schaltjahr einmal vor.«
Frage: »Aber man ist doch immer ganz stolz, dass hier auch die Vorgesetzten an den Stehtischen zu finden sind.«
»Ja, das sollten sie auch, aber das sind sie eben nicht.«"
[Wittel, Andreas: Belegschaftskultur im Schatten der Firmenideologie : eine ethnographische Fallstudie. -- Berlin : Sigma, ©1997. -- ISBN 3894044322. -- S. 42f., 53, 57. -- Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 1996. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Mobbing gehört leider sehr oft zur Betriebskultur.
"Was ist Mobbing
Weil alle über Mobbing reden, wird der Begriff häufig verwässert. Ein Streit zwischen Kollegen, eine Schikane des Vorgesetzten oder die unverschämte Bemerkung eines Mitarbeiters wird gleich als Mobbing bezeichnet.
In einer häufig benutzten Beschreibung heißt es: "Mobbing ist
Diese Definition ist in der Gesellschaft gegen psychosozialen Stress und Mobbing (GpsM) e.V. zusammen mit Heinz Leymann entwickelt worden. "
[Quelle: http://www.dgb.de/themen/mobbing_01.htm. -- Zugriff am 2001-01-07]

Abb.: Beliebteste Mobbinghandlung: Hinter dem Rücken wird schlecht über jemanden gesprochen
(©ArtToday)
"Die zwanzig «beliebtesten» Mobbinghandlungen (entsprechend den Daten von Knorz & Zapf)
Frauen mobben häufig anders als Männer. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede im Mobbing-Verhalten spiegeln nicht allein psychische und erziehungsbedingte Differenzen wider, es liegt auch nahe, dass die ungleiche Verteilung von Positionen im Berufsleben vielen Männern andere Instrumente der Machtausübung ermöglicht, als sie Frauen offen stehen."
[Quelle:http://www.igmetall.de/buecher/onlinebroschueren/mobbing/mobbing.html. -- Zugriff am 2001-01-07]

Abb.: Sarariiman (©Corbis)
Als sarariiman (salaryman) (![]() )
bezeichnet man in Japan white-collar Manager der mittleren Ebenen.
)
bezeichnet man in Japan white-collar Manager der mittleren Ebenen.
Von den beiden Autoren des Buchs
Yashimura, Noburu ; Anderson. Philip: Inside the Kaisha : demystifying Japanese business behaviour. -- Boston, MA : Harvard Business School Press, ©1997. -- 257 S. -- ISBN 0875844154. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
war Noburu Yashimura bevor er dieses Buch schrieb 5 Jahre sarariiman bei der Sumitomo Bank [Webpräsenz: http://www.sumitomobank.co.jp/english/index.html. -- Zugriff am 2001-01-16].

Abb.: Sumitomo Bank
Yashimura will eine Innensicht von japanischer Betriebskultur in einem Großbetrieb (kaisha) geben. Die folgenden Ausführungen folgen diesem Buch (in Klammern: Seitenangaben).
Das Verhalten japanischer sarariimen hängt viel mehr von den Betriebskulturen und der Betriebsorganisation ab als von allgemein-japanischen kulturellen Normen. Das zeigt sich daran, wie sehr sich das Verhalten von japanischen Managern ändert, wenn sie zu Firmen mit westlichen Besitzern überwechseln (S. IX). Die vielen Versuche, japanische Betriebskulturen durch japanische Kultur im allgemeinen zu erklären (dabei verweist man auf Shinto, Zen, Kabuki, Samurai, Teezeremonie, Gartenkunst, Landwirtschaft usw. usw.), sind verfehlt (S. 5).
Obwohl es nach außen hin so aussehen mag, als ob die Topmanager die entscheidenden Führungspositionen innehaben, sind sie in Wirklichkeit wie ein mikoshi, der vom mittleren Management herumgetragen wird.
|
|
|
| Abb.: Mikoshi, von Shintopriestern getragen, Matsudaira Fest, Aichi-Präfektur, 1998 [Bildquelle: http://home.earthlink.net/~sarahslade/mikoshi.html. -- Zugriff am 2001-01-16] | Abb.: Papiermodell eines Mikoshi [Bildquelle: http://www.yamaha-motor.co.jp/ papercraft/seasons/mikoshi/mikoshi-e.html. -- Dort auch Bastelbogen. -- Zugriff am 2001-01-16] |
Mikoshi ist in der japanischen Shintoreligion ein tragbarer Holzschrein, in den man eine Gottheit platziert. Diesen Schrein trägt man durch die ganze Stadt. Mikoshi wird verehrt und ist einflussreich, aber er kann nirgendwohin selbst gehen. Er geht nur dorthin, wohin man ihn trägt. Ebenso verhält es sich mit japanischen Topmanagern: sie sehen wie Führer aus, können aber nur dorthin gehen, wo sie der Konsens der mittleren Manager haben will, sie müssen sagen, was die mittleren Manager wollen, und ihre Hauptfunktion ist, zu helfen, dass das mittlere Management seine Ziele erreicht (S. 9).
Die Entscheidung, dass ihr Sohn Beamter (erste Wahl) oder sarariiman (zweite Wahl) werden soll, müssen die Eltern schon sehr früh treffen. Große japanische Unternehmen (kaisha) stellen als sarariiman nur sehr gute Absolventen von Elitehochschulen an. Um die Aufnahmeprüfung an eine solche Hochschule zu schaffen, ist es wichtig, dass alle Schulen (oft schon ab Kindergarten) auf die Anforderungen dieser Aufnahmeprüfung vorbereiten. Dies setzt die Söhne ehrgeiziger Eltern unter dauernden Schulstress. Wichtiger als die individuelle schulische Leistung ist es aber, eine hochrangige Prestigeschule zu besuchen. Die individuellen Leistungen sind nach außen hin nicht sichtbar, wohl aber der Besuch einer Eliteschule.
"Über den wichtigsten Wendepunkt im Leben junger Japaner und Japanerinnen entscheidet die Aufnahmeprüfung zur Universität. Die Eltern wählen nach Begabung, Schulabschlusszeugnis und Geldbeutel eine Universität aus. Die Medien verbreiten jährlich eine Ranking-Liste, der die auf Niveau und Ruf beruhende Hierarchie der Universitäten zu entnehmen ist. Alle Eltern versuchen, die nach Maß der Gegebenheiten bestmögliche Universität auszusuchen.
Die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung nimmt oft ein volles Jahr in Anspruch. Wer schlau ist, bereitet sich auf mehrere Universitäten vor und wählt nach bestandenen Examina die jeweils beste. Wer sich auf eine Universität kapriziert und nicht mit einer »zweiten Wahl« begnügen will, kann im Falle des Scheiterns ein weiteres Jahr Vorbereitungsschulen besuchen und es dann erneut versuchen. Solche zwischen Schule und Studium in ein Loch gefallene junge Menschen nennt man, wie einst die herrenlos gewordenen Samurai, rônin.
Wer die Aufnahmeprüfung zur Universität geschafft hat, ist der Examenshölle entronnen und hat -- vorerst -- ausgesorgt. Die vier Studentenjahre kann man gemütlich angehen, ausgiebig Sport treiben, viel lesen und möglichst auch reisen. Wer das Aufnahmeexamen bestanden hat, hat den Abschluss so gut wie in der Tasche."
[Thomas, Gothild ; Thomas, Kristina: Reisegast in Japan. -- 2. Aufl. -- Dormagen : Iwanowski, ©1999. -- ISBN 3923975821. -- S. 189. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Firmen suchen sich Nachwuchskräfte unter den Hochschulabsolventen durch das Netzwerk von Ehemaligen (Alumni), die in der Firma beschäftigt sind. Normalerweise wird man aufgrund der Empfehlung durch Alumni angestellt. Ein Ehemaliger fungiert als Mentor (senpai) für den Anzustellenden und nach der Anstellung.
Zu Beginn der Lehrzeit muss der angehende sarariiman sein Aussehen und die Umgangsformen gemäß der Firmenkultur lernen. Der Benimmcode umfasst ca. 70 Seiten:
Durch die Einhaltung dieser Regeln wird man ein Insider, ein Mitglied der Organisation. Outsider sind solche, die diese Regeln nicht einhalten (müssen).
Bis zum dreißigsten Lebensjahr bzw. zur Hochzeit müssen Angestellte entweder in einem Zweierzimmer der Firma oder bei ihren Eltern schlafen. Meist teilt man das Zimmer mit seinem Mentor (senpai). Während dieser Zeit dürfen sie auch kein eigenes Auto besitzen. Während dieser Zeit steht der junge sarariiman rund um die Uhr, das ganze Jahr unter Aufsicht der Firma. Sie haben ihren Chefs blinden Gehorsam zu leisten.
Dadurch, dass ein angehender Manager 10 Jahre lang so behandelt wird, wird er völlig in die Kultur der sozialisiert, deren Bestandteil er voraussichtlich lebenslang bleiben wird.
Die Zuweisung auf eine Stelle erfolgt durch die Firma gemäß dem Bedarf, nicht nach Wünschen des Angestellten.
Yashimura und Anderson meinen, dass man das Verhalten japanischer sarariimen -- ohne allzu sehr zu vereinfachen oder zu generalisieren auf einige Grundprinzipien zurückführen kann (S. 32 - 55):
Aus diesen Prinzipien heraus versuchen Yashimura und Anderson im Rest des Buches, folgende Phänomene der japanischen Firmenkulturen zu erklären:
Für die sehr lesenswerten Ausführungen zu diesen Fragen und die vielen Beispiele dazu, muss auf das genannte Buch verwiesen werden.

Abb.: Kollegenumtrunk, Japan (© J. Tadashi Kitamura)
"Immer wieder stellen Ausländer die Frage: Zählt es zur Arbeit oder zur Freizeit, wenn nach Feierabend die gesamte Abteilung, Abteilungsleiter inklusive -- exklusive Frauen, versteht sich --, auf Firmenkosten in ihre Stammkneipe zieht?
Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Da diese Zusammenkünfte nach Dienstschluss stattfinden, werden sie nicht zur offiziellen Arbeitszeit gerechnet. Selbstbestimmte Freizeit sind sie ebenso wenig, denn so zwanglos, wie manch Außenstehender meint, geht es dabei nicht zu. Kein Tarif- und kein Einstellungsvertrag schreibt die Teilnahme am feuchtfröhlichen Beisammensein vor. Jedoch: wer sich entzieht, kann mit erheblichen Nachteilen rechnen.
Wie kommt es, dass der einzelne sich zum »Mitmachen« verpflichtet fühlt? Zunächst will jeder in die Gemeinschaft der Mitarbeiter aufgenommen werden und Chef und Kollegen in lockerer Atmosphäre kennenlernen. Auch wir erwarten in der Regel, dass »Neue« ihren Einstand oder altgediente Kollegen ihren Abschied feiern. Regelmäßig -- mehrmals die Woche bis tief in den Abend hinein! -- abzuhaltenden Zusammenkünften aber würden wir uns verweigern. Warum zum Teufel wehren Japaner sich dagegen nicht? Wird ein Japaner eingestellt, kann er lebenslange Beschäftigung in ein und derselben Firma erwarten, weshalb Stellenwechsel in Japan die Ausnahme ist. So wie die Anstellung auf Lebenszeit den Mitarbeiter an »sein« Unternehmen bindet, so verschafft sie der Firma unangezweifelte Verfügungsgewalt über ihre Belegschaft. Dies erinnert an den traditionellen Kontrakt zwischen den Samurai und ihren Dienstherren: Indem die Dienstherren ihren Kriegern Arbeit und Brot zusicherten, konnten sie unbedingte Treue ihrer Krieger erwarten.
Unternehmen fördern die abendlichen Trinkgelage, weil sie ihnen positive Auswirkungen auf das Betriebsklima zuschreiben. Sie wissen, dass im Rahmen der strengen Firmenhierarchie nicht jeder Abteilungsleiter allzeit die Motivation seines Teams aufrechterhalten kann und Spannungen sich nicht vermeiden lassen. Die Abende in einer Bar sollen Harmonie wiederherstellen helfen, gilt harmonisches Zusammenarbeiten doch als unabdingbare Voraussetzung für gute Leistung.
Deshalb legen Firmen wie Abteilungsleiter Wert auf diese »zwanglosen« Treffen, trägt das Unternehmen gern die Kosten und schließt niemand sich aus. Ein »Spielverderber« würde zwischen ihm und Kollegen bestehende Spannungen verschärfen, statt zum gemeinsamen Ziel, der Harmonie, sein Scherflein beizutragen. Also achten Abteilungsleiter sorgsam darauf, dass ihre Schäflein der Herde folgen -- nicht zuletzt, weil Verweigerung als Protest gegen ihre Autorität begriffen werden könnte.
Von den Teilnehmern wird mehr verlangt als bloße Anwesenheit: Jeder soll auf irgendeine Weise zur Unterhaltung der Gruppe beitragen. Heute bedient man sich oft einer Karaoke-Anlage und schmettert pflichtbewusst -- mal schmalzig, mal witzig - einen Song. Nach wie vor sind auch Beiträge wie Gedichte, Anekdoten, Fingerspiele, Schnellsprechverse o.ä. willkommen. Der Begriff kakushi-gei, »verborgene Kunst«, drückt Anerkennung für Teilnehmer solcher Runden aus, die ihr Publikum wie auch immer bestens unterhalten.
Alkohol fließt bei solchen Zusammenkünften in Strömen, da er bekanntlich -- abgesehen von jenen, die mit jedem Schluck zusehends verstummen -- die Zunge löst. Er erleichtert das Äußern von Kritik, die man angesichts der rigiden Rangordnung im Arbeitsalltag verschweigt. Auch das ist durchaus Absicht der Veranstaltung. Im mildernden Umstand der Trunkenheit erfahren Abteilungsleiter, die im Büro Zweifel an Führungsstil oder Einscheidungen nicht dulden dürfen, die -- hoffentlich -- ehrliche Einschätzung ihrer Mitarbeiter. Hier können sie nicht nur Unmut rechtzeitig erkennen, sondern auch kleinere Mängel zugeben, ohne ihre Autorität preiszugeben.
Es ist ungeschriebenes, absolut bindendes Gesetz, anderntags zu vergessen, was alkoholbenebelt im Rahmen des zwanglosen (bureikô) Beisammenseins gesagt wurde. Wer es missachtet, wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Abteilungsleiter wie Untergebene dürfen nie ernüchtert auf »im Suff« ausgetragene Konflikte anspielen, geschweige denn sie offen ansprechen. Ausländern ist es mitunter ein Anliegen, sich » am Morgen danach« für peinliche Szenen zu entschuldigen -- was in den Augen der Japaner ein böser Fauxpas ist.
Vermutlich ist die beschriebene Sitte der Grund, weshalb Betrunkene in Japan nicht Anstoß, sondern Mitleid erregen. Man nimmt sich ihrer hilfreich an. Leidgeprüfte Ehefrauen verfrachten trunkene Gatten auf den futon und versorgen sie nach Kräften, damit sie in wenigen Stunden wieder wie gewohnt zur Arbeit trotten können. Hat ein Zecher Mühe, sich auf den Beinen zu halten, tröstet man neckend: »Alkohol geht immer in die schwächsten Körperteile, bei anderen in den Kopf, bei dir in die Beine.«"
[Thomas, Gothild ; Thomas, Kristina: Reisegast in Japan. -- 2. Aufl. -- Dormagen : Iwanowski, ©1999. -- ISBN 3923975821. -- S. 243 - 245. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Kurz noch Farbe auf die Lippen und Puder übers Gesicht streichen, dann ist alles bereit. Umzuziehen braucht sich niemand, denn die meisten kommen sowieso in Anzug und Krawatte. Einmal im Monat zieht es die Mitarbeiter der Revisions- und Beratungsfirma Price Waterhouse Coopers [Webpräsenz: http://www.pwcglobal.com/ch/ger/main/home/index.html. -- Zugriff am 20001-01-17] in corpore ins Zürcher Szene-Lokal Adagio [Webpräsenz: http://www.boconsulting.ch/adagio.html. -- Zugriff am 2001-01-17] . Dort wird das Gemeinschaftsgefühl mit andern Mitteln entwickelt: statt wie früher auf dem Betriebsausflug ins Grüne oder beim Kegelabend neuerdings auf der Tanzfläche. Die Angestellten kommen direkt aus dem Büro, erhalten Drinks und Häppchen serviert und bewegen sich zur Musik, die ein betriebsinterner DJ bereits ab 19 Uhr auflegt. Was sich als spontane und unspektakuläre Freizeitbeschäftigung anhört, ist im sogenannten After-Work-Club institutionalisiert. Die Idee wurde von New York über England nach Deutschland exportiert und findet seit einiger Zeit auch in der Schweiz Anklang. Die Absicht ist es, einer vorwiegend jungen Zielgruppe das Non-Stop-Party-Erlebnis gleich nach der Arbeit zu bieten, weil die Arbeitszeiten der meisten Büroangestellten keine nächtlichen Partygänge erlauben.
Das Unternehmen hat einen solchen After-Work-Club vor dem Hintergrund der hohen Fluktuation von Mitarbeitern eingeführt. Laut eigenen Angaben betrug diese 1999 rund 22 Prozent. Angestellte zu halten und neue zu finden, stellt für die Firma denn auch eine große Aufgabe dar. «Der Arbeitsmarkt ist zurzeit extrem ausgetrocknet. Unsere Mitarbeiter werden in dieser Situation fast überschwemmt mit Angeboten», sagt Peter Weibel, Delegierter des Verwaltungsrats von Price Waterhouse Coopers Schweiz. Die Leistungen der großen Revisions- und Beratungsfirmen sind bezüglich Lohn und Entwicklungsmöglichkeiten ähnlich; die meisten zahlen ihren Mitarbeitern die Weiterbildung, etwa zum Steuerexperten oder zum Marketingplaner. Die Investition von 10 Prozent des Umsatzes in «Learning and Education» dürfte etwa der Branchennorm entsprechen. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, versucht Price Waterhouse Coopers mittels kulturellen Angebots die Mitarbeiter an die Firma zu binden und sich damit als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Weibel hat die Erfahrung gemacht, dass «sein» Unternehmen oft der erste Arbeitgeber für Hochschulabsolventen ist. Nach drei bis vier Jahren erfolgt eine Standortbestimmung, oft verbunden mit einem Stellenwechsel.
Die gute Resonanz der ersten Abende hat die betreffende Unternehmung veranlasst, auch einen Studentenklub zu gründen. Die Mitglieder nehmen an den Anlässen des After-Work-Clubs teil und haben dadurch die Möglichkeit, «ihren potenziellen neuen Arbeitgeber auf ungezwungene Art kennen zu lernen», wie es Weibel formuliert. Für die bestehenden Mitarbeiter endet der Feierabend gegen 22 Uhr, denn so lange ist das «Adagio» exklusiv gemietet. Während die Angestellten wieder an den nächsten Arbeitstag denken müssen, sind Tanzfläche und Bar von da an für die professionellen Partygänger offen."
[ven: Vom Büro auf die Tanzfläche : mit After-Work-Clubs die Firmenidentifikation steigern. -- Neue Zürcher Zeitung. -- Internationale Ausgabe. -- ©2001-01-17. -- S. 39. -- Online: http://www.nzz.ch/2001/01/17/ma/page-article74604.html]
Abb.: Zweimal Schweiz [Bildquelle: http://www.schweiz-in-sicht.ch/de/3_bev/3_fs.html.
-- Zugriff am 2001-01-23]
"Das Verhältnis des Mitarbeiters zur Arbeit und zum Unternehmen
Wir sagten schon, dass die Schweizer traditionell dazu neigen, viel zu
arbeiten und ihren Stolz darein setzen, gute Arbeit zu tun.
Arbeitsethos
In der Tat gibt es wohl nur wenige Länder, in denen eine Volksabstimmung über
eine Verkürzung der Arbeitszeit und eine Verlängerung des Urlaubsanspruchs zur
Ablehnung dieser Vorschläge führen würde, so wie das in der Schweiz geschehen
ist.
[1976 verwarfen die Schweizer Stimmbürger eine Volksinitiative zur gesetzlichen Einführung der 40-Stundenwoche mit 1,3 Mio. gegen 0,3 Mio. Stimmen; 1985 verwarfen sie eine Volksinitiative zur Verlängerung des Urlaubsanspruchs mit 0,9 Mio. gegen 0,5 Mio. Stimmen.]
Wenn man die Gründe für diesen Entscheid hinterfragt, so gibt es deren vor allem zwei. Einmal war man großenteils gar nicht gegen eine Verkürzung der Arbeitszeit und eine Verlängerung des Urlaubs, sondern nur gegen eine gesetzliche Verpflichtung dazu, und zwar aus der Überzeugung heraus, dass derlei nicht allgemein, sondern dezentral, je nach den Umständen zwischen den unmittelbar Betroffenen, geregelt werden sollte. Zum andern fürchteten viele Stimmbürger, dass die Schweizer Wirtschaft durch die vorgeschlagenen Maßnahmen konkurrenzunfähig werden könnte."
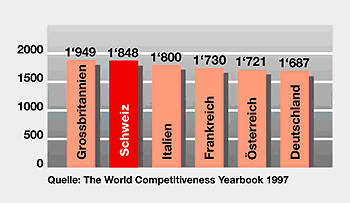
Abb.: Jahresarbeitszeit in Stunden im internationalen
Vergleich [Bildquelle: http://www.standortschweiz.ch/arguments/arguments.frame.de.html.
-- Zugriff am 2001-01-23]
Psychologischer Arbeitsvertrag
Das Verhältnis des Schweizers zu seiner Firma ist meist ein instrumentelles. "Das bedeutet, dass er sich ihr gegenüber nur in bestimmten Grenzen, nämlich insoweit, als es der Zweck verlangt, verpflichtet fühlt. Er fühlt sich verpflichtet, ordentliche Arbeit zu leisten und die allgemeinen Arbeitsbedingungen zu akzeptieren (und erwartet als Gegenleistung, dass er korrekt bezahlt und behandelt wird), aber er fühlt sich nicht mit der Firma verheiratet (ähnlich wie es ihm die gleichzeitige Zugehörigkeit zu einer Reihe von Vereinen, Assoziationen, Klubs, Cliquen usw. gestattet, keiner dieser Vereinigungen völlig anzugehören bzw. zu verfallen). Er trennt Arbeit und Freizeit zunehmend und hat auch seinen Freundeskreis größtenteils außerhalb der Firma. Geschäftsausflüge, gemeinsame Weihnachtsfeste und Jubiläen sind bei ihm meist wenig beliebt, es sei denn, sie werden nicht auf der Ebene des gesamten Unternehmens organisiert, sondern im kleinen Kreis der Werkstatt, des Büros oder der Abteilung, wo jeder jeden kennt.
Diese nüchterne Haltung, bei der man nie vergisst, dass man im Unternehmen in erster Linie arbeitet, geht aber nicht so weit, dass man sich mit ihm in einem grundsätzlichen Interessenkonflikt sieht (demnach das Unternehmen seine Mitarbeiter so weit wie möglich auszunützen trachtet, indem es möglichst viel Arbeit fordert und möglichst wenig Salär zahlt; und demnach umgekehrt der Mitarbeiter dasselbe versucht, indem er möglichst viel Salär für möglichst wenig Arbeit zu erreichen strebt). Vielmehr geht man von einer Interessenidentität aus, die darin besteht, möglichst viel möglichst günstig zu produzieren und zu verkaufen.
Der Klassenkampf ist in der Schweiz also nicht vorprogrammiert und findet auch tatsächlich nicht statt. Vielmehr arbeiten Kapital und Arbeit, Arbeitgeber und Arbeitnehmer wie wirkliche (Sozial-)Partner zusammen, um den allgemeinen Wohlstand zu mehren und international wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei akzeptieren Gewerkschaften wirtschaftliche Zwänge meist ohne großen Widerstand, und zwar selbst dann, wenn ihre Mitglieder dabei (zumindest kurzfristig) zu kurz zu kommen scheinen (etwa wenn sie auf soziale Leistungen verzichten, um die wirtschaftliche Schlagkraft des Unternehmens nicht zu gefährden). Auch ihre Lohnforderungen sind meist mehr als vernünftig (sie liegen im Durchschnitt durchwegs unter denen, die etwa in den Nachbarländern erhoben werden -- was allerdings paradoxerweise dazu geführt hat, dass die Löhne höher als dort sind). Gegenleistungen hierfür sind vor allem ein angenehmes Arbeitsklima (das allerdings oft paternalistische Züge trägt, und zwar vielleicht deshalb, weil oft noch Eigentum und Geschäftsleitung zusammenfallen und weil sich der Inhaber-Chef und seine Mitarbeiter auch außerhalb der Firma begegnen) und ein hoher Grad an Sicherheit des Arbeitsplatzes, letzteres obwohl die Arbeitgeber dazu gesetzlich in keiner Weise verpflichtet sind (im Gegenteil ist der Kündigungsschutz in der Schweiz so gering wie nirgends sonst in Europa). Fehler dürfen gemacht werden, solange sie nicht verschwiegen werden und solange sie sich nicht in der gleichen Form wiederholen. Im übrigen entlässt man Mitarbeiter nicht nur nicht, sondern verändert auch ihren Status nur sehr zögernd.
Grundlage für diesen Austausch von Arbeitsbereitschaft und Anpassungswillen
gegen Arbeitssicherheit und Fürsorge ist die allgemein akzeptierte Vorstellung
von einer pluralistischen Gesellschaft und von einer arbeitsteiligen
Unternehmung.
Pluralismus bedeutet in diesem Zusammenhang: The business of business is
business, und innerhalb des Unternehmens: jeder an seinem Platz, d. h. an
dem Platz, den er am besten auszufüllen vermag. Das Unternehmen hat keine
sozialen Verpflichtungen, die darüber hinaus gehen, seine wirtschaftliche
Aufgabe zu erledigen. Sein Platz in der Gesellschaft ist auf diesen
wirtschaftlichen Zweck begrenzt. Es ist Gesellschaft, nicht Gemeinschaft im
Sinne von Tönnies. Diese Gesellschaft setzt sich aus Mitgliedern (Mitarbeitern)
zusammen, die ihre spezifischen Leistungen so einbringen, dass dies für das
Unternehmen zum Erfolg führt und für sie selbst von Vorteil ist.
Dabei ist anerkannt, dass der Erfolg des Unternehmens sowohl vom Können jedes einzelnen Mitarbeiters abhängt als auch davon, dass sich deren Beiträge organisch ergänzen.

Abb.: 23 MW-Kaplanlaufrad für ein Laufkraftwerk [Bildquelle: http://www.schweiz-in-sicht.ch/de/3_bev/3_fs.html.
-- Zugriff am 2001-0123]
Was das Können angeht, möchten wir noch einmal die Wichtigkeit unterstreichen, die der Ausbildung beigemessen wird (wobei vor allem die Lehrlingsausbildung vorbildlich ist), und hinzufügen, dass man einerseits vor allem den Spezialisten vertraut (Generalisten haben kein Metier und sind verdächtig, jack of all grades and master of none zu sein) und zum anderen aber vor allem denjenigen Spezialisten, die sich ihr Wissen durch langjährige praktische Erfahrung erworben haben. In diesem Zusammenhang sei gesagt, dass Karrieren in der Schweiz meist relativ langsam gemacht werden. (Fast) niemand wird mit Vorschusslorbeeren bedacht. Vielmehr sollten alle von unten anfangen und sich bewähren, wobei «sich bewähren» nicht bedeutet, dass man Außergewöhnliches leistet, sondern dass man eine normale, solide Leistung erbringt. Im weiteren werden Mitarbeiter immer wieder getestet, bevor sie weiter aufrücken können. Der militärische Rang wird am Anfang einer Karriere als ein solcher (bestandener) Test gewertet. Später aber ist er, wenn man von einigen Banken und Versicherungen absieht, von weit geringerer Bedeutung, als gemeinhin angenommen wird: In vielen Kleinbetrieben bedeutet eine Offizierskarriere sogar einen Nachteil, da die Firma sich nicht leisten kann, eine Führungskraft immer wieder zu Übungen und Lehrgängen freizustellen.
Und was das Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte angeht, so handelt es sich mehr um ein geordnetes Nebeneinander als um ein echtes teamwork. Der Schweizer zieht es meist vor, allein zu arbeiten und bei seiner Arbeit in Ruhe gelassen zu werden. Er möchte sich auf seine Kollegen verlassen können und fühlt sich verpflichtet, selbst auch zuverlässig zu sein. Zuverlässigkeit und Loyalität sind also wichtig, nicht wirkliche Teamfähigkeit.
Konfliktvermeidung
Während der Schweizer also ohne große Begeisterung in Gruppen arbeitet und im Unternehmen keine enge Gemeinschaft sucht, ist er andererseits sehr darauf bedacht, keine Konflikte aufkommen zu lassen, die die Zusammenarbeit ernsthaft gefährden könnten. Es kommt ihm nicht auf wirkliche Harmonie an, aber darauf, dass es zu keinem Bruch kommt und das Nebeneinander nicht zum Gegeneinander führt. Er fühlt sich zur friedlichen Koexistenz verurteilt.
Entsprechend besteht innerhalb des Unternehmens ein relativ großer Konformitätsdruck. Der Individualist wird zwar akzeptiert. der Quertreiber aber nicht; und wer ständig Kritik übt, manövriert sich sofort ins Abseits. Dass «Stars», die mehr glänzen wollen als ihre Kollegen, unbeliebt sind. sagten wir schon. In den Beziehungen des Unternehmens zur Außenwelt ist das beste Beispiel der Konfliktvermeidung oder -bewältigung das seit über fünfzig Jahren in unzähligen Kollektivarbeitsverträgen zwischen Unternehmen und Gewerkschaften abgeschlossene Friedensabkommen, das bei aller Gegensätzlichkeit der Interessen und bei aller kritischen Distanz doch von beiden Parteien (wie im übrigen auch von der Bevölkerung insgesamt) gleichermaßen für den besten modus vivendi gehalten wird.
Interessenkonflikte und Meinungsverschiedenheiten bestehen natürlich
dennoch, wie anderswo auch. Aber sie werden kaum offen ausgetragen. Nach Möglichkeit
werden sie verdrängt. Es wird Kollegialität verlangt. Heikle Themen werden
ausgeklammert: sie werden zum Tabu. Auch die Tendenz zum understatement
erfüllt weitgehend die gleiche Funktion: Damit wird vermieden, dass man Neid
oder Kritik erweckt und damit Konfliktmaterial schafft. Vivons caches, vivons
heureux!
Wenn es dennoch nicht möglich ist, Konflikte völlig zu vermeiden oder zu verdrängen,
versucht man es, sie wenigstens zu begrenzen. Sie werden privatisiert, d. h. auf
der niedrigstmöglichen Ebene behandelt, wo möglichst wenige Personen betroffen
sind und wo sie entsprechend keine hohen Wellen schlagen. Ein anderes Verhalten
dieser Art ist das Aufteilen von größeren Problemen in kleine und ihre
Zuweisung an verschiedene Kommissionen und Arbeitsgruppen in der Hoffnung, dass
sie damit ihr Konfliktpotential verlieren (oder überhaupt ganz verschwinden).
Im übrigen begrenzt man z. B. den Wettbewerb sowohl intern (indem man versucht, allzu ehrgeizige Mitarbeiter zunächst überhaupt gar nicht einzustellen) als auch extern (die Schweiz ist eines der Länder mit den meisten Kartellen und Wettbewerbsabsprachen). Diese Praxis der stillen oder offenen Absprachen scheint das direkte Gegenteil von dem zu sein, was wir bei der Schweizer Neutralitätspolitik beobachten. Doch trügt der Schein, wenn man bedenkt, dass es die Neutralität erlaubt, Konflikten aus dem Weg zugehen und gute Beziehungen mit aller Welt zu unterhalten (selbst mit Ländern, deren politisches System man verurteilt).
Aber auch mit Konfliktbegrenzung ist es natürlich nicht immer getan. In diesen Fällen sucht man nach einem Kompromiss. Die Kompromissbereitschaft wird dadurch gefördert, dass man es vermeidet, dass sich dieselben Parteien immer wieder und ausschließlich als Widersacher gegenüberstehen. So gibt es keine Institutionalisierung der Gegensätze, sondern kommt es zu dauernd wechselnden Koalitionen.
Ergebnis all dieser Bemühungen, Konflikte zu vermeiden, klein zu halten und zu entschärfen, ist keine tiefempfundene Gemeinsamkeit. Vielmehr gibt es viel Nörgelei, viele latente Aggressivität und versteckte Ambitionen und Frustrationen hinter der herrschenden Fassade der freundlichen Beziehungen und der Rhetorik von der guten Atmosphäre. Dass diese Aggressivität nicht zum Ausbruch kommt, liegt vielleicht daran, dass es allen gesamthaft seit Jahrzehnten ständig besser geht und es deshalb im Interesse der überwiegenden Mehrzahl der Bevölkerung liegt, den Lauf der Dinge nicht zu stören.
Das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern
Das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern ist ein scheinbar widersprüchliches. Einerseits besteht kein Zweifel daran, wer der Chef ist, andererseits handeln die Untergebenen aber nicht wie bloße Befehlsempfänger.
Dieser Widerspruch erklärt sich zunächst dadurch, dass die Position des
Chefs nicht als Ausdruck persönlicher Macht, sondern als eine notwendige
Funktion verstanden wird. Sie ist das Ergebnis der Arbeitsteilung, nach der
jeder die Aufgabe erledigt, für die er am besten geeignet ist. Eine dieser
Aufgaben ist es, zu führen. Sie fällt denjenigen zu, die sich dafür
qualifizieren. Die anderen machen sie ihnen nicht streitig; denn sie wollen
nicht, was sie nicht (besser) können. Mitbestimmung ist nicht erwünscht, weil
es eben nicht um Macht geht, sondern um Effizienz, und weil viele Köche den
Brei verderben.
Es herrscht die Vorstellung (die auch in vielen Fällen den Tatsachen
entspricht), dass Führungsaufgaben nicht von irgendwelchen Auserwählten
erledigt werden, sondern von Managern, die keiner besonderen Klasse angehören
und nicht unbedingt besondere Schulen besucht haben; von Mitbürgern, die zwar
besondere Fähigkeiten haben, die sie aber nicht zu anderen Menschen macht
(vielmehr sind sie «Menschen wie du und ich», was oft insofern glaubwürdig
ist, als sie sich tatsächlich hochgearbeitet haben). Chef sein ist kein
Privileg und vermittelt auch nur wenige. Es ist eine Pflicht, eine
Dienstleistung (mit Betonung sowohl auf Dienst als auf Leistung). Der Chef darf
Entsprechend gestaltet sich der Entscheidungsprozess (wenigstens bei wichtigen Entscheidungen und auf Geschäftsführungsebene) folgendermaßen:
Solange ein Chef sich in etwa an diese fünf Regeln hält, wird ihm ohne weiteres Folge geleistet. Seine Macht wird a priori akzeptiert. Sie ist reell, weil sie für legitim gehalten wird (sie ist also meist Autorität im Sinne von Max Weber, selbst wo sie auf Tradition oder Charisma beruht). Missachtet der Chef diese Regeln aber gröblich, so disqualifiziert er sich als Vorgesetzter und verliert somit Respekt und Gefolgschaft. Es kommt zum passiven Widerstand (selten zur offenen Rebellion) oder dazu, dass man desertiert, d. h. die Firma verlässt.
Macht wird also akzeptiert, wenn und so lange wie sie eine nützliche Funktion erfüllt und maßvoll, ja zurückhaltend ausgeübt wird. Deshalb ist sie meist nicht starr definiert, aber immer begrenzt (die Grenzen ergeben sich aus den Umständen). Es besteht eine Art wechselseitige Bedingung zwischen dem Respekt des Mitarbeiters vor der Weisungsbefugnis des Vorgesetzten und dem Respekt des Vorgesetzten vor der persönlichen Integrität des Mitarbeiters und seiner Befugnis, im Bereich seiner Aufgaben frei zu handeln. Die Rechte beider Seiten sind an ihre verantwortungsvolle Ausübung gebunden, wobei für letzteres wahrscheinlich das Kündigungsrecht das beste Beispiel ist (es gibt in der Schweiz praktisch keinen Kündigungsschutz: der Arbeitgeber hat das Recht, Mitarbeitern, selbst ohne Nennung von Gründen, zu kündigen, solange er nur eine gewisse Frist einhält; dieses Recht wird nur sehr selten ausgeübt und noch seltener missbraucht, was sicher erklärt, dass es überhaupt in dieser Form noch existiert).
Ergebnis von all dem ist, dass die Chefs durchaus das Heft in der Hand haben, das Machtgefälle aber als relativ gering angesehen wird.
Das Verhältnis der Mitarbeiter untereinander
Wir sagten schon, dass der typische Schweizer nicht besonders gerne in Gruppen arbeitet, sondern die Arbeit in der Gruppe eher als notwendiges Übel empfindet. Dennoch identifiziert er sich im Unternehmen mit der Abteilung oder Filiale, die seine direkte Umgebung darstellt, viel mehr als mit dem Unternehmen als Ganzem. Nur handelt es sich dabei eben weniger um eine Gruppe, wo eng zusammengearbeitet wird, als um eine Gemeinschaft, die sich aus dem einfachen Zusammensein, der Nähe und dem daraus resultierenden unmittelbaren täglichen Kontakt ergibt. Diese Gemeinschaft, die soziale und nicht wirtschaftliche Funktionen hat, ist ihm wichtig. In ihr muss er sich wohl fühlen; hier muss der Ton stimmen, sonst bleibt er nicht lange. Wenn er sich aber wohl fühlt, dann verlässt er sie nur sehr ungern, was u. a. zur Folge hat, dass der interne Transfer oder job rotation (der oft schon dadurch problematisch ist, dass man sehr spezialisiert ist und das Tätigkeitsgebiet, für das man ausgebildet wurde, nicht verlassen will) nicht leicht fällt.
Diese Gemeinschaft, in der
diese Gemeinschaft ist zwangsläufig klein.
In der Tat arbeitet man nur ungern in großen Einheiten. Dem kommt zugute, dass große Einheiten auch nicht für besonders wirtschaftlich gelten und kaum existieren (Fabriken, wo Tausende von Arbeitern unter einem Dach arbeiten, stellen eine seltene Ausnahme dar). Small is beautiful!
Abgesehen von dieser Verbundenheit mit den «Nachbarn am Arbeitsplatz» und betriebseigenen Vereinen (zum Kegeln, Fußballspielen, Jassen und Wandern und dergleichen) gibt es kaum echte Gruppen. Formal schon: Kader, Angestellte und Arbeiter oder verschiedene Berufsgruppen. Doch haben diese eigentlich nur eine Funktion der Ausgrenzung und erzeugen keine lebendigen Beziehungen. Auch Gewerkschaften sind am Arbeitsplatz selten sehr aktiv und erzeugen kein echtes Zugehörigkeitsgefühl. Vielmehr gehört man einer Gewerkschaft (wenn überhaupt) etwa so an wie einem Automobilklub oder einer Versicherung.
Insgesamt lässt sich also sagen, dass der Betrieb, in dem er arbeitet, für den Schweizer selten den Mittelpunkt seines sozialen Lebens bildet. Er liebt es, am Arbeitsplatz zwar mit niemandem im Streit zu liegen und im Gegenteil kameradschaftliche Beziehungen mit seinen Kollegen zu pflegen, will sich aber ansonsten niemandem zu sehr verpflichtet fühlen. Er akzeptiert den meist nicht unerheblichen Anpassungsdruck, aber nur deshalb, weil er nicht wirklich unter die Haut geht und weil er sich auf die Arbeit beschränkt. Nach der Arbeit ist er oft ein ganz anderer, mit einem anderen Stil, mit anderen Interessen und Beziehungen."
[Bergmann, Alexander: Unternehmenskultur in der Schweiz. -- In: Handbuch der schweizerischen Volkskultur / hrsg. von Paul Hugger. -- Zürich : Offizin, ©1992. -- Bd. 3. -- ISBN 3907495365. -- S. 1133 - 1140. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Zu Kapitel 8: Bürokratie und Korruption