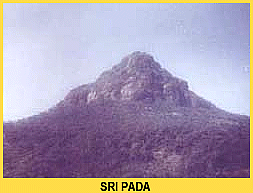
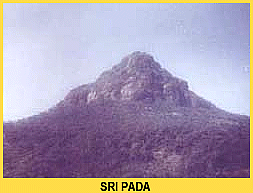
mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Mahanama <6. Jhdt n. Chr.>: Mahavamsa : die große Chronik Sri Lankas / übersetzt und erläutert von Alois Payer. -- 19. Kapitel 19: Ankunft des Bodhi-Baums. -- Fassung vom 2006-09-05. -- URL: http://www.payer.de/mahavamsa/chronik19.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2001-07-12
Überarbeitungen: 2006-09-05 [Ergänzungen]; 2006-05-29 [Ergänzungen]; 2006-05-21 [Ergänzungen]; 2006-04-21 [Umstellung auf Unicode!]; 2006-03-03 [Einfügung des Palitexts]
Anlass: Lehrveranstaltung, Universität Tübingen, Sommersemester 2001
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Übersetzers.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Buddhismus von Tüpfli's Global Village Library
Pālitext: http://www.tipitaka.org/tipitaka/e0703n/e0703n-frm.html.-- Zugriff am 2001-06-06
Falls Sie die diakritischen Zeichen nicht dargestellt bekommen, installieren Sie eine Schrift mit Diakritika wie z.B. Tahoma.
Die Zahlreichen Zitate aus Malalasekera, G. P. <1899 - 1973>: Dictionary of Pāli proper names. -- Nachdruck der Ausgabe 1938. -- London : Pali Text Society, 1974. -- 2 vol. -- 1163, 1370 S. -- ISBN 0860132692. sind ein Tribut an dieses großartige Werk. Das Gesamtwerk ist online zugänglich unter: http://www.palikanon.com/english/pali_names/dic_idx.html. -- Zugriff am 2006-05-08.
Ekūnavīsatima pariccheda
Bodhi āgamano
Alle Verse mit Ausnahme des Schlussverses sind im Versmaß vatta = siloka = Śloka abgefasst.
Das metrische Schema ist:
̽ ̽ ̽ ̽ ˘ˉˉˉ
̽ ̽ ̽ ̽ ˘ˉ˘ˉ
̽ ̽ ̽ ̽ ˘ˉˉˉ
̽ ̽ ̽ ̽ ˘ˉ˘ˉ
Ausführlich zu Vatta im Pāli siehe:
Warder, A. K. (Anthony Kennedy) <1924 - >: Pali metre : a contribution to the history of Indian literature. -- London : Luzac, 1967. -- XIII, 252 S. -- S. 172 - 201.
" It is doubtful if any other single incident in the long story of their race has seized upon the imagination of the Sinhalese with such tenacity as this of the planting of the aged tree. Like its pliant roots, which find sustenance on the face of the bare rock and cleave their way through the stoutest fabric, the influence of what it represents has penetrated into the innermost being of the people till the tree itself has become almost human." Pieris, Paulus Edward <1874 - 1959>: Ceylon and the Portugese : 1505 - 1658. -- Tellipalai, 1920. -- S. 3f.
[Zitiert in: Adikaram, E. W. < - 1986>: Early history of Buddhism in Ceylon or State of Buddhism in Ceylon as revealed by the Pāli commentaries of the 5th century A.D. -- Colombo : Gunasena, 1946. -- Zugleich: London, Univ., Dissertation. -- S. 55]
1. Mahābodhirakkhaṇatthaṃ
aṭṭhārasa
rathesabho;
devakulāni datvāna,
aṭṭhāmaccākulāni ca.
2. Aṭṭha brāhmaṇakulāni,
aṭṭha seṭṭhikulāni ca;
gopakānaṃ taracchānaṃ,
kuliṅgānaṃ kulāni ca.
3. Tatheva pesakārānaṃ,
kumbhakārānam eva
ca;
sabbesañ cāpi senīnaṃ,
nāgayakkhānameva ca.
1./2./3. Der Wagenstier [König] bestimmte zur Hut über den Mahābodhibaum 18 Personen aus königlichen Familien, 8 Personen aus Familien von königlichen Beratern, 8 Personen aus Brahmanenfamilien, 8 Personen aus Kaufmannsfamilien1, Personen von Familien der Rinderhirten, der Taraccha2 ("Hyänen") und der Kuliṅga3 ("Sperber"), von den Webern, den Töpfern, von allen Zünften, von Nāga4 [Kobragottheiten] und Yakkha4.
Kommentar:
1 Kaufmannsfamilien
In seinem auch heute noch sehr lesenswerten Buch schreibt Richard Fick über die Seṭṭhi:
"Der hauptsächlichste und vornehmste Repräsentant der gahapati-Klasse ist der seṭṭhi. Obwohl er uns, wenigstens nach den Jātaka, fast immer als am Hofe des Königs in dessen Diensten beschäftigt entgegentritt, haben wir ihn doch nicht bei den königlichen Beamten miterwähnt, weil er nicht eigentlich zu den rājabhogga, den Beamten des Königs, gehört, sondern ein gahapati ist: er scheint eine Art Doppelstellung, eine amtliche und eine private, eingenommen zu haben. Im Vinaya-Piṭaka trägt der seṭṭhi einen vorwiegend privaten Charakter; er erscheint uns hier durchweg als ein angesehener, mit einer besonderen Ehrenstellung unter seinen Berufsgenossen betrauter Kaufmann, so namentlich der viel-erwähnte freigebige Verehrer Buddha's, Anāthapiṇḍika. Doch ist zu beachten, dass im Cullavagga (VI. 4.1) von diesem gesagt wird, er sei der Schwager „des seṭṭhi von Rājagaha", ein Ausdruck, der an sich schon auf eine amtliche Stellung hindeutet; auch dass Anāthapiṇḍika glaubt, sein Schwager habe den König Bimbisāra zu einem Festmahl eingeladen, spricht für die Annahme einer solchen. Von demselben seṭṭhi von Rājagaha heisst es im Mahāvagga (VIII. 1. 16) ausdrücklich, dass er dem Könige sowohl wie den Kaufleuten viele Dienste leistete (bahūpakāro devassa c'eva negamassa ca). In den Jātaka steht der seṭṭhi, wie gesagt, meistens in naher Beziehung zum königlichen Hof. Bei der Verwaltung der Finanzen des Reichs, zur Besoldung des Heeres und der Beamten, bei kriegerischen Unternehmungen, öffentlichen Bauten u. s. w. brauchte der König offenbar den Rath und Beistand eines mit den Handelsverhältnissen des Landes genau vertrauten Geldmannes; andererseits musste auch der Kaufmannschaft daran liegen ihre Interessen am Hofe vertreten und bei der Gesetzgebung und Verwaltung berücksichtigt zu sehen. Beiden Zwecken diente der seṭṭhi, der amtliche „Vertreter der Kaufmannschaft" am königlichen Hofe. Als solcher begibt er sich in die öffentlich« Audienz beim Könige (rājupaṭṭhāna. I. 269, 349; III. 119, 299; IV. 63), wie an einer Stelle angegeben wird, dreimal am Tage (divasassa tayo vāre rājupaṭṭhānaṃ gacchati. III. 475); als solcher verabschiedet er sich vor einer Reise vom Könige (I. 452) und erbittet sich, wenn er sein Amt niederlegen, dem weltlichen Leben entsagen und heimatloser Asket werden will, die Erlaubnis des Königs (pabbajjaṃ me anujānāhi. II. 64). Wie sein soyialer Rang sich vererbte, so geht auch das Amt (seṭṭhitthāna) des Vaters in der Regel auf den Sohn über (I. 231, 248; III. 475). In einer seṭṭhi-Familie wiedergeboren gründet der Bodhisatta, als er herangewachsen ist, einen Hausstand und erlangt nach dem Tode seines Vaters die Stellung eines „Vertreters der Kaufmannschaft" (seṭṭhikule nibbattitvā vayappatto kuṭumbaṃ saṭhāpetvā pitu accayena seṭṭhitthānaṃ patvā. IV. 62).
Genaueres über die einzelnen mit diesem Amte verbundenen Pflichten und Funktionen können wir unserer Quelle nicht entnehmen. Möglich ist, dass der König sich seiner Person bediente, um die ihm nach den Gesetzbüchern zustehende Aufsicht über den Handel auszuüben, um durch ihn die Aufrechterhaltung der für die Handelsgesellschaften und Gilden geltenden Gesetze oder Gewohnheitsrechte zu kontrollieren. Vielleicht waren es daneben auch persönliche Dienste, Besorgung von Geldgeschäften, Verwaltung des königlichen Schatzes, die er von ihm verlangte; jedenfalls scheint er vermöge seines ungeheuren Reichtums dem Könige unentbehrlich gewesen zu sein, da wir ihn so beständig in seiner Umgebung antreffen. Aus dem täglichen Verkehr wird sich bisweilen ein freundschaftliches Verhältnis zwischen dem Könige und seinem seṭṭhi entwickelt haben, und ähnlich wie dies bei dem purohita der Fall war, mochte die Erblichkeit des Amtes in derselben seṭṭhi-Familie dazu beitragen diese eng an das Herrscherhaus zu fesseln. Im Aṭṭhāna Jātaka (III. 475) sind der Kronprinz und der Sohn des seṭṭhi von Benares Spielkameraden und werden im Hause eines und desselben Lehrers erzogen und unterrichtet. Auch nachdem der Prinz zur Regierung gelangt ist, weilt der Sohn des seṭṭhi in seiner Nāhe, und späterhin, nach dem Tode seines Vaters selbst seṭṭhi geworden, begibt er sieh dreimal täglich in den Palast des Königs und plaudert mit ihm bis in die Nacht. „Wo ist mein Freund?" ruft der König, als er eines Tages den seṭṭhi nicht erblickt.
In dieser offiziellen Stellung eines „Vertreters der Kaufmannschaft" erscheint der seṭṭhi indessen auch in den Jātaka nicht immer, sondern auch hier bisweilen als reiner Privatmann, als begüterter und einflussreicher Handelsherr. Ein in Benares wohnender seṭṭhi treibt Handel, indem er eine Karawane von 500 Wagen führt (1.270); in der Provinz (paccante. I. 451; IV. 169), auf dem Lande (janapadaseṭṭhi. IV. 37) ansässige seṭṭhi, bei denen doch eine amtliche Tätigkeit von vorne herein unwahrscheinlich ist, werden verschiedentlich erwähnt. Inwiefern sich diese von anderen Kaufleuten, beispielsweise von den später zu besprechenden Karawanenf[hrern (satthavāha) unterschieden, insbesondere ob sie ihnen gegenüber irgendwie eine aufsichtführende Stellung, etwa als „Gildeherren", einnahmen, geht aus den Jātaka nicht hervor; was wir aus unserer Quelle erfahren, beschrānkt sich auf allgemeine Beschreibungen ihres Reichtums und ihres Einflusses. Das Vermögen eines seṭṭhi wird ebenso wie bei den reichen Brahmanen regelmäßig auf 800 Millionen (asītikoṭivibhavo seṭṭhi. III. 128, 300, 444; V. 382) angegeben, eine Angabe, die allerdings für die Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse von wenig Wert ist, da bei dem geringen Verständnis, das die Inder für richtige oder auch nur annähernd der Wirklichkeit entsprechende Zahlen haben, irgend eine andere hohe Zahl genau dasselbe sagen würde, da wir außerdem nicht wissen, welche Münze wir zu dieser Ziffer zu ergänzen haben. Etwas genauer wird das Besitztum eines seṭṭhi präzisiert, wenn im Visayha Jātaka (III. 129) erzählt wird, dass Sakka, durch die Wohltätigkeit des seṭṭhi beunruhigt, seine ganze Habe vernichtet: Geld, Getreide, Öl, Honig, Zucker u. s. w., ja selbst seine Sklaven und Lohnarbeiter. Als zum Hausstand eines seṭṭhi gehörig werden an einer andern Stelle (III. 444) außer Weib und Kind noch die Dienerschaft (parijana) und die Hirten (vacchakapālakā) genannt. Der Kuhhirte (gopālaka I. 388) eines seṭṭhi treibt die Kühe seines Herrn, wenn das Korn dick zu werden anfangt, in den Wald, baut dort einen Stall für das Vieh und liefert von Zeit zu Zeit die Milch an den seṭṭhi ab. Nehmen wir hinzu, dass gelegentlich (siehe oben S. 77) von Reisfeldern eines seṭṭhi die Rede ist, so ergibt sieh daraus, dass wir uns den seṭṭhi nicht nur als Kaufherrn, sondern auch als Vieh züchtenden und Ackerbau treibenden Grundbesitzer vorzustellen haben.
In Folge der großen ihm zur Verfügung stehenden Geldmittel reichte sein Einfluss offenbar über den Wirkungskreis seines eigenen Geschäftes hinaus; wir finden zwar nicht ausdrücklich erwähnt, dass er Geld gegen Zinsen verleiht, dürfen aber doch wohl annehmen, dass er dem Gastwirt, der „von ihm lebt" (taṃ upanissāya eko vāruṇivānijo jivati. I. 252), die Mittel zum Betriebe seines Spirituosenhandels gewährt hat. Auch der Schneider, der bei einem seṭṭhi wohnt (seṭṭhiṃ nissāya vasantassa tunnakārassa. IV. 38), mag in einem ähnlichen Verhältnis zu seinem Hausherrn gestanden haben.
Der Wunsch Reichtum und Ansehen in der Familie zu erhalten wird bei den seṭṭhi-Familien die Neigung und Gewohnheit innerhalb der eigenen jāti zu heiraten verstärkt und zu häufigen Heiraten derselben untereinander geführt haben. Der im Nigrodha Jātaka vorkommende seṭṭhi von Rājagaha bringt seinem Sohn die Tochter eines auf dem Lande wohnenden seṭṭhi ins Haus (IV. 37). Dem Sklaven des seṭṭhi von Benares gelingt es, wie im Kaṭāhaka Jātaka erzählt wird, durch einen gefälschten Brief die Hand der Tochter eines seinem Herrn befreundeten, an der Grenze wohnenden seṭṭhi zu gewinnen. Der Brief, den der Sklave selbst geschrieben hat, und den er dem Geschäftsfreunde seines Herrn einhändigt, beginnt mit den Worten: „Der Überbringer dieses Schreibens ist mein Sohn N. N. Ich halte es für passend, dass sich unsere beiderseitigen Kinder miteinander verheiraten" (āvāhavivāhasambandho nāma mayhaṃ tayā tuyhañ ca mayā saddhiṃ patirūpo. 1. 452).
Hand in Hand mit diesem Wertlegen auf standesgemäße Heirat und tadellose Abkunft geht wie bei den khattiya und den stolzen Brahmanen auch bei den vornehmen seṭṭhi-Familien eine tiefe Verachtung der durch Beruf oder Rasse niedrigstehenden Volksschichten; namentlich macht sich dieser „Kastengeist" dem Stamm der Caṇḍāla, den Parias der damaligen indischen Gesellschaft, gegenüber geltend: Wir sahen (oben S. 29), welcher Schrecken die seṭṭhi-Tochter ergreift, als sie erfährt, dass sie einen Caṇḍāla erblickt hat, und wie ängstlich sie bemüht ist die üblen Wirkungen dieses Anblicks durch Auswaschen ihrer schönen Augen zu verhindern.
Reichtum und Vornehmheit der seṭṭhi-Familien brachten es von selber mit sich, dass die Söhne solcher Familien eine sorgfältige Erziehung genossen; ja es hat nach unserer Quelle den Anschein, dass sie, zum Teil wenigstens, die nach den Gesetzbüchern den drei oberen Kasten gemeinsame Pflicht des Vedastudiums auch wirklich erfüllten. Die beiden seṭṭhi-Söhne des Nigrodha Jātaka werden von dem seṭṭhi von Rājagaha zum Zwecke des Studiums nach Takkasilā zu einem Lehrer geschickt, dem sie 2000 als Honorar einhändigen (IV. 38); der bereits erwähnte, im Aṭṭhāna Jātaka vorkommende junge seṭṭhi wird mit dem Prinzen zusammen bei demselben Lehrer unterrichtet (III. 475). Zwar wird in beiden Fällen nur gesagt, dass die Jünglinge „die Wissenschaft erlernten" (sippaṃ uggaṇhiṃsu), doch halte ich es für wahrscheinlich, dass auch an diesen Stellen unter sippa das religiöse Studium zu verstehen ist, weil, wie (oben S. 40, 48 f.) ausgeführt wurde, unter den Jüngern Buddha's in hervorragendem Maße die Söhne reicher und vornehmer Familien vertreten sind, eine Tatsache, die meiner Ansicht nach hauptsächlich auf die Teilnahme dieser Kreise an den geistigen Bestrebungen jener Zeit zurückzuführen ist.
Wie diese seṭṭhi-Familien, deren Gesamtheit durch das allen gemeinsame Standesbewusstsein, durch den Brauch Heiraten nur innerhalb der eigenen jāti zu schließen und das Bestreben eine Vermischung mit den niederen Kasten zu vermeiden, ferner durch die Gemeinsamkeit eines erblichen Berufs ein der Kaste nicht unähnliches Aussehen erhält, so heben sich von der großen Masse des Volks andere soziale Gruppen ab, die sich uns durch das Hinzutreten eines neuen Faktors, der äußeren Organisation, als noch schärfer umgrenzte und geschlossenere Einheiten darstellen, nämlich die unsern mittelalterlichen Gilden vergleichbaren Genossenschaften der Kaufleute und Handwerker."[Quelle: Fick, Richard <1867 - 1944>: Die sociale Gliederung im nordöstlichen Indien zu Buddha's Zeit : mit besonderer Berücksichtigung der Kastenfrage vornehmlich auf Grund der Jtaka dargestellt. -- Kiel : Haeseler, 1897. -- S. 166 - 172.]
2 Taraccha ("Hyänen"): Clan, benannt nach Totemtier. In Asien kommt nur die Streifenhyäne (Hyaena hyaena) vor
"Taracchā The name of a clan in Ceylon. The name is totemistic.
This clan was among the tribes which accompanied the Bodhi-tree to Ceylon (Mhv.xix.2).
When Aggabodhi I, set up an image of Mahinda on the bank of the Mahindatata, the image was carried by the Taracchā. Cv.xlii.30; see Cv.Trs.i.29, n.2."
[Quelle: Malalasekera, G. P. <1899 - 1973>: Dictionary of Pāli proper names. -- Nachdruck der Ausgabe 1938. -- London : Pali Text Society, 1974. -- 2 vol. -- 1163, 1370 S. -- ISBN 0860132692. -- s. v.]
"Die Streifenhyäne (Hyaena hyaena) ist eine relativ kleine Hyäne, die als einzige Art ihrer Familie auch außerhalb Afrikas vorkommt, nämlich in Teilen Asiens. Merkmale
StreifenhyäneStreifenhyänen sind viel schlanker und kleiner als die verwandten Tüpfelhyänen. Sie haben eine Kopfrumpflänge von 110 cm, hinzu kommen 30 cm Schwanz. Ihr Gewicht beträgt etwa 40 kg, in Ausnahmefällen über 50 kg (Hälfte des Körpergewichts einer Tüpfelhyäne). Die lange Rückenmähne kann aufgerichtet werden und lässt die Hyäne dann viel größer erscheinen als sie eigentlich ist. Das Fell ist grau und von deutlichen schwarzen Querstreifen überzogen, die Kopf, Rumpf und Beine bedecken.
LebensraumDie Streifenhyäne lebt in der Nordhälfte Afrikas: nördlich der Sahara, entlang des Niltals, in der Sahelzone und im Norden Kenias. Außerdem kommt sie in Westasien (einschließlich Anatoliens, der Arabischen Halbinsel) und Indien vor. Ihr Lebensraum sind halbwüstenartige, trockene Regionen.
Verbreitung der StreifenhyäneLebensweise
In der Lebensweise unterscheidet sich die Streifenhyäne beträchtlich von der Tüpfelhyäne. Sie ist ein eher einzelgängerisches Tier, das sich nur ausnahmsweise zu kleinen Familienverbänden zusammenschließt. Sie kann außer einem leisen Knurren keine Laute von sich geben (kein "Lachen"). Sie hat kein ausgeprägtes Revierverhalten. Vor allem aber können Streifenhyänen nicht selbst große Tiere erjagen, sondern ernähren sich vorwiegend von Aas. Daneben frisst sie kleine Nagetiere, Vögel und Eidechsen, aber auch Ziegen, Schafe und streunende Hunde.
SonstigesIm alten Ägypten war die Streifenhyäne bekannt und findet sich auf zahlreichen Reliefs und Fresken jener Zeit wieder. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass Streifenhyänen sogar wie Haustiere gehalten wurden; ob zur Hilfe bei der Jagd oder als bloße Fleischlieferanten, ist nicht bekannt.
Viele Legenden ranken sich um diese Hyänenart. So sollen Streifenhyänen auf Friedhöfen nachts Leichen ausgraben und diese verspeisen, manchmal auch schlafende Menschen. Das Verspeisen von Hyänenzungen soll gegen Krebstumore helfen. Dagegen verleiht das Essen eines Hyänenherzens dem Empfänger Stärke und Mut. All diese Geschichten sind natürlich bloße Erfindungen."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Streifenhy%C3%A4ne. -- Zugriff am 2006-05-21]
"Das Wort Totem stammt aus der Algonkin-Sprache des südlichen Kanada und bedeutet "Verwandtschaft, Familienabzeichen oder auch persönlicher Schutzgeist". Totem bezeichnet etwas Ähnliches wie heute der Nachname, schließt aber eine animistische Vorstellungswelt und eine besondere Form der Verwandtschaftsbeziehung mit ein (siehe auch Totemismus). Er ist ein wesentliches Merkmal etlicher (aber nicht aller) alten Gesellschaften und wurde insbesondere durch einige Indianergruppen in Nordamerika und die Aborigines in Australien bekannt. Der Totem wird als Wesen empfunden, von dem die Person abstammt - also der Urahn eines Menschen oder seiner Gruppe. Der Totem ist daher auch eine Art Schutzgeist, meist eine Pflanze oder ein Tier, die für die Gesellschaft eine bestimmte Bedeutung hat. Manchmal stellen Totems auch Naturerscheinung, Berge, Steine oder Flüsse dar.
Für den Totem muss die Person bestimmte Tabus respektieren, Regeln, deren Missachtung als Inzest oder schweres Vergehen bestraft wurden - zumeist mit dem Tod oder dem Ausschluss aus der Gesellschaft. In aller Regel durften Totems weder getötet noch verletzt oder gegessen werden, aber hier gibt es auch Ausnahmen. In Zeiten großer Not durften die Totem-Tiere beispielsweise nur noch von Personen getötet werden, die diesem Totem angehören.
Ein Totem hat ein Mensch immer von Geburt an. Je nachdem ob die Verwandtschaftszurechnung patrilinear oder matrilinear ist, erbt man das Totem von der väterlichen oder der mütterlichen Linie. In Zentralafrika kommt es jedoch bei matrilinearen Klans auch vor, dass zwar das Totem vom Matriklan übernommen wird, dass aber das wichtigere Totem vom Patriklan kommt.
Umgestaltung der Totem-Vorstellung über die ZeitDa der Totemismus eng an die Vorstellung der Verwandtschaftsbeziehung gebunden ist, haben sich auch die Totems in den Kulturen gemeinsam mit diesen verändert. Bei den nordamerikanischen Indianer gab es zunehmend Stämme, bei denen der Totem nicht nur per Geburt vergeben, sondern später vom Heranwachsenden angenommen werden konnte (Individualtotemismus). Auch der Wechsel des Individualtotems war bei den Indianern möglich. Totems mit diesen Eigenschaften werden Krafttiere oder Schutzgeister genannt, die für diesen Menschen im Gegenzug für Verehrung und Kulthandlungen "zuständig" waren. Ein Krafttier oder Tierschutzgeist ist ein persönlicher Helfer einer Einzelperson. Indianer sind dafür bekannt, dass sie durch körperliche und geistige Strapazen (zum Beispiel lange Wanderungen, langes Fasten, besuchen einer Schwitzhütte, körperliche Schmerzen und vieles mehr) eine Vision herbeizuführen versuchen. In dieser Vision zeigt sich ihnen dann ihr persönlicher Schutzgeist. In manchen Fällen wird zur Entschlüsselung der Vision ein Schamane benötigt - d.h. eine erfahrene Person, die helfend bei Seite steht. Ein Krafttier kann dem Menschen auf vielerlei Weise helfen, beispielsweise bei der Jagd oder während einer schweren Krankheit. In manchen Kulturen kamen Krafttiere und Totems nebeneinander vor."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Totem. -- Zugriff am 2006-05-21]
3 Kuliṅga ("Sperber"): Clan, benannt nach Totemtier. In Indien und Sri Lanka kommen z.B. Accipiter trivirgatus, Accipiter virgatus und Accipiter badius vor.
"Kuliṅga. The name of a clan, probably Sinhalese. Mahinda VI. belonged to this clan (Cv.lxxx.15). The Kulingas were among the tribes sent to Ceylon by Asoka with the Bodhi-tree. Mhv.xix.2; see also Mhv. Trs.128, n.2, and Cv.Trs.i.29, n.2, and ii.126, n.5."
[Quelle: Malalasekera, G. P. <1899 - 1973>: Dictionary of Pāli proper names. -- Nachdruck der Ausgabe 1938. -- London : Pali Text Society, 1974. -- 2 vol. -- 1163, 1370 S. -- ISBN 0860132692. -- s. v.]
Abb.: Accipiter trivirgatus
[Bildquelle: http://www.bird-stamps.org/recent/srilan/birds2003/13.htm. -- Zugriff am 2006-05-21]"The Crested Goshawk (Accipiter trivirgatus) is a bird of prey in the family Accipitridae which also includes many other diurnal raptors such as eagles, buzzards and harriers.
Crested Goshawk breeds in southern Asia from India and Sri Lanka to south China, Indonesia and the Philippines. It is a forest bird which builds a stick nest in a tree and lays two or three eggs.This raptor has short broad wings and a long tail, both adaptations to manoeuvring through trees. It is 30-46cm in length, with the female much larger than the male. The larger size and a short crest are the best distinctions from its relative, the Besra, Accipiter virgatus.
The male has a dark brown crown, grey head sides and black moustachial and throat stripes. The pale underparts are patterned with rufous streaks on the breast and bars on the belly.
The larger female has a browner head and brown underpart streaks and bars. The juvenile has pale fringes to its head feathers, and the underpart background colour is buff rather than white.
The flight is a characteristic "slow flap, slow flap, straight glide" similar to other Accipiter species such as Northern Goshawk. Like its relatives, this secretive forest bird hunts birds, mammals and reptiles in woodland, relying on surprise as it flies from a perch to catch its prey unaware."[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Crested_Goshawk. -- Zugriff am 2006-05-21]
"The Besra, Accipiter virgatus, is a bird of prey in the family Accipitridae which also includes many other diurnal raptors such as eagles, buzzards and harriers. The Besra is a widespread resident breeder in dense forests throughout south Asia from India to south China and Indonesia. It nests in trees, building a new nest each year. It lays 2-5 eggs.
This bird is a medium-sized raptor (29-36cm) with short broad wings and a long tail, both adaptations to fast manoeuvring. The normal flight of this species is a characteristic "flap – flap – glide", and the barred underwings are a distinction from Shikra, A. badius.
This species is like a darker version of the widespread Shikra, but all plumages have a dark vertical throat stripe. The adult male Besra has dark blue-grey upperparts, and is white, barred reddish below. The larger female is browner above than the male. The juvenile is dark brown above and white, barred with brown below. It has a barred tail.
In winter, Besra will emerge into more open woodland including savannah and cultivation. Its hunting technique is similar to other small hawks such as Sparrowhawk, A. nisus, or Sharp-shinned Hawk, A. striatus, relying on surprise as it flies from a hidden perch or flicks over a bush to catch its prey unaware.
The prey is lizards, dragonflies, and small birds and mammals."[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Besra. -- Zugriff am 2006-05-21]
"The Shikra (Accipiter badius) is a small bird of prey in the family Accipitridae which also includes many other diurnal raptors such as eagles, buzzards and harriers.
Abb.: Accipiter badiusThe Shikra is a widespread resident breeder throughout south Asia and sub-Saharan Africa. It nests in trees, building a new nest each year. It lays 3-7 eggs.
This bird is a small raptor (26-30cm) with short broad wings and a long tail, both adaptations to fast manoeuvring. The normal flight of this species is a characteristic "flap – flap – glide".
The adult Shikra has pale grey upperparts, and is white, finely barred reddish below. Sexes are similar except that female is larger than the male. The juvenile is brown above and white, spotted with brown below. It has a barred tail.
Shikra is a bird of open woodland including savannah and cultivation. Its hunting technique is similar to other small hawks such as Sparrowhawk, A. nisus, or Sharp-shinned Hawk, A. striatus, relying on surprise as it flies from a hidden perch or flicks over a bush to catch its prey unaware.
The prey is lizards, dragonflies, and small birds and mammals."
[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Shikra. -- Zugriff am 2006-05-21]
4 Nāga [Kobragottheiten] und Yakkha: siehe Mahāvaṃsa, Kapitel 1
4. Hemasajjughaṭe ceva,
datvā aṭṭhaṭṭha
mānado;
āropetvā mahābodhiṃ,
nāvaṃ gaṅgāya bhūsitaṃ.
4. Der Ehrfurcht Gebietende gab ihnen je acht Töpfe aus Gold und aus Silber. Dann brachte der König den Mahābodhibaum auf ein Schiff1 auf dem Ganges2.
Kommentar:
1 Schiff: Zur Schifffahrt siehe:
Wiebeck, Erno <1932 - >: Indiens Schifffahrt in fünf Jahrtausenden : ein maritim-ethnologisches Sachbuch. -- Rostock : Koch, 2003. -- 230 S. : Ill., Kt. ; 22 cm. -- ISBN 3-935319-47-9
2 Ganges
"Der Ganges (Sanskrit, f., गङ्गा, Gaṅga) ist ein 2.511 km langer Fluss bzw. Strom in Indien und Bangladesch (Asien) und der heilige Fluss der Hindus. Er entsteht im indischen Garhwal (im Südwesten des Himalaya) durch den Zusammenfluss von Alaknanda [अलकनंदा] und Bhagirathi [भागीरथी]; von diesen ist der zuletzt genannte der längere der beiden Hochgebirgs-Quellflüsse. Von der "Flusshochzeit", die noch in Garhwal stattfindet, fließt er zumeist in südöstlicher Richtung durch Indien in das Bengalische Tiefland. Dort gelangt der Ganges nach Bangladesch. Nach Durchfließen seines gewaltigen Mündungsdeltas, in dem ihm der Brahmaputra zufließt (siehe Gangesdelta), mündet er in den Golf von Bengalen und damit in den Indischen Ozean.
Auf dem Ganges ist zwar Binnenschifffahrt möglich, sie hat jedoch keinerlei Verkehrsbedeutung. Die größten Städte am Ganges, dessen Einzugsgebiet 1.125.000 km² umfasst, sind Kanpur [कानपुर], Varanasi [वाराणसी], Patna [पटना], Kolkata [কলকাতা] und Khulna [খুলনা].Delhi [दिल्ली] liegt nicht am Ganges, sondern am Yamuna [यमुना].
Den meisten indischen Religionen ist Ganga, wie Inder den Ganges nennen, heilig. Das Bad in ihm soll von Sünden reinigen und verspricht Absolution. Viele Hindus wollen nach Möglichkeit am Ganges sterben - vorzugsweise in Varanasi - und ihre Asche im Fluss verstreut wissen.
ÖkologieDer Ganges ist der Lebensraum des seltenen und wenig erforschten Gangesdelfins [Platanista gangetica] sowie des Gangeshais [Glyphis gangeticus], über den ebenfalls nur wenig bekannt ist.
Die Verschmutzung des Flusses ist abnorm: Täglich werden über 1,2 Mrd. Liter vergiftetes Abwasser eingeleitet, allein in Kolkata 320 Mio. Liter. Die Belastung durch Kolibakterien ist 2000mal höher als in Indien erlaubt. In jedem Tropfen Wasser wimmelt es nur so von Cyaniden, Arsenen, Blei, Zink, Chrom und Quecksilber, von Exkrementen und Leichenresten, von Milliarden Cholera- und Typhusbazillen. Selbst Malaria erregende Moskitos brüten dort nicht mehr. Jeder Tropfen Gangeswasser ist ein Generalangriff auf den menschlichen Organismus.
Vor mehr als 15 Jahren startete die indische Regierung den „Ganges Actionplan“, der das Ziel hatte, die Verschmutzung zu bekämpfen. Viele Millionen US$ wurden in den Bau der Anlagen gesteckt, aber für den Betrieb ist kein Geld vorhanden. Wassertests beweisen, dass sich nicht viel geändert hat.
Die großen Städte entlang des Ganges beziehen 70 Prozent ihres Trinkwassers aus dem Fluss. Erst die Aktivitäten der Umweltschützer („Eco Friends“) brachten das größte Problem zutage: Die Entsorgung von Leichen im Ganges. Zu Beginn der Aktion wurden täglich 170 Leichen aus dem Fluss gezogen.
Außerdem funktionieren nur wenige Kläranlagen effektiv. Im Einmannbetrieb wird der grobe Müll herausgefischt. Dennoch vermischt sich halbwegs gereinigtes Wasser unterhalb der Anlage wieder mit chemischen Abfällen."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ganges. -- Zugriff am 2006-05-21]
"Ganga (Sanskrit, f., गङ्गा, gaṅgā), der indische Name für den Fluss Ganges, ist auch der Name einer Göttin des Hinduismus.
Abb.: Ganges (गङ्गा) mit Opfergaben
[Bildquelle: meredith415. -- http://www.flickr.com/photos/meredith415/138601660/. -- Creative Commons Lizenz. -- Zugriff am 2006-09-29]Ganga gilt Hindus nicht nur als heilig sondern ist die lebendige Wasserform der Göttin, der Fluss selbst ist ihre Personifizierung. Mehr als alles Andere verkörpert er Reinheit, und dementsprechend dient Gangeswasser in allen Riten zur materiellen und spirituellen Reinigung. Für jede Puja, den hinduistischen Gottesdienst, ist es als "Weihwasser" unerlässlich. Gläubige Hindus haben oft einen kleinen Vorrat im Hause, selbst wenn sie vom Fluss weit entfernt leben. Millionen von Pilgern besuchen das ganze Jahr hindurch unzählige große und kleine Wallfahrtsorte entlang den Ufern; mindestens einmal im Leben möchte jeder rituell in die heiligen Fluten tauchen. Für die eigene Familie und die Nachbarn nimmt man das kostbare Nass dann in Flaschen mit nachhause. Viele versprechen sich davon sogar Heilung, wenn sie es als 'Medikament' nehmen, und manche Homöopathen brauchen es als Basis für ihre Medizin.
Trotz der extremen Verschmutzung des Flusses ist die Bedeutung als heiliger Fluss ungebrochen; viele Hindus vertrauen weiter Ganges unendlicher Reinigungskraft. Aber selbst wenn hinsichtlich der Verschmutzung Skepsis angebracht ist - immer wieder entdeckt man sowohl chemische als auch biologischer Phänomene, die den Strom als etwas Besonderes ausweisen: Methodisch belegt ist die Tatsache, dass er im Vergleich zu anderen Gewässern über eine dreifache Selbstreinigungskraft verfügt. Jeder Indienreisende kann eine ganz besondere Eigenschaft selbst überprüfen: Gangeswasser - nicht nur das aus der Quelle, sondern sogar in der Nähe der Mündung geschöpft, nachdem es allen Unrat der großen Städte aufgenommen hat - kann jahrelang in Behältern aufbewahrt werden und bleibt dabei stets frisch!
Die Verehrung gilt dem Wasser selbst, aber auch anthropomorphe Darstellungen sind bekannt: Dort ist die Göttin Gang eine junge Frau deren Begleittier ein krokodilähnliches Seetier ist.
Über die Entstehung der Ganga erzählt folgender Mythos:Der Weise Kapila hatte die Söhne des Königs Sagara wegen ihrer schlechten Verhaltensweisen durch einen Glutstrahl aus seinen Augen zu Asche verbrannt. Einem Verwandten des Königs hatte Kapila anvertraut, das erlösende Totenritual für die Söhne könne nur mit Hilfe der als Milchstraße am Himmel fließenden Ganga vollzogen werden. Jedoch wurde erst drei Generationen später mit Baghiratha jemand geboren, der imstande sein sollte, Ganga vom Himmel zu holen. Er brachte Ganga an die Stelle, wo seine toten Vorfahren lagen, ihr heiliges Wasser erlöste sie.
Baghiratha gelang es nach vielen Jahren der Askese so viel innere Kraft und Verdienste anzusammeln, dass die Göttin vor ihm erschien. Sie warnte jedoch davor, sie auf die Erde zu holen: ihre herabstürzenden Wassermassen würden die Erde zerschmettern. Allein Shiva sei in der Lage, die Wasser sanft aufzufangen. Tausend Jahre trieb Bagirath am heiligen Berg Kailash Askese, bis Shiva seine Hilfe zusagte. Als die Wassermassen herabstürzten, bremste der Gott den Aufprall mit seinen Haaren und ließ den Schwall über seine langen Flechten in sieben Strömen auf die Erde laufen. Indien besitzt seitdem sieben heilige Flüsse. Die Ganga ist der heiligste dieser Flüsse und fließt im Golf von Bengalen in den Indischen Ozean. Da Bhagiratha sie nach der Legende einst zur Erde brachte, heißt Ganga auch Bhagirathi. Als Erinnerung daran gibt es jedes Jahr ein großes Pilgerfest, die Sagar-Mela.
Noch heute spielt Ganga an vielen Stellen für Hindu-Pilger eine zentrale Rolle.
Die Bedeutung der Ganga für Hindus ist im folgenden Gebet aus dem Epos Ramayana ersichtlich:
- O Mutter Ganga!
- Du bist der Halsschmuck auf dem Kleid der Erde.
- Du bist es, durch die man den Himmel erreicht.
- O Bhagirathi! Ich bitte dich, möge mein Körper vergehen,
- nachdem er an Deinen Ufern gelebt und dein reines Wasser getrunken hat;
- nachdem ihn Deine Wellen geschaukelt und er Deines Namens gedacht hat."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ganga. -- Zugriff am 2006-05-21]
"गंगा दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है जो उत्तरी भारत में बहती है। गंगा का उदगम हिमालय से भागीरथी के रुप मे गंगोत्री हिमनद से उत्तरांचल में होता है। बाद में यह देवप्रयाग के पास अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद से गंगा उत्तरी भारत के विशाल मैदानी इलाके से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में बहुत सी शाखाओं में विभाजित होकर मिलती है। इनमें से एक शाखा का नाम हुगली नदी भी है जो कोलकाता के पास बहती है, दूसरी शाखा पद्मा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस नदी की पूरी लंबाई लगभग 2507 किलोमीटर है। इस नदी और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल पर बनने वाले मुहाना को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है जो विश्व की बहुत सी प्रसिद्ध वनस्पतियों और मशहूर बंगाल टाईगर का गृहक्षेत्र है।
यमुना नदी यूँ तो अपने आप में एक स्वतंत्र और बड़ी नदी है। यह गंगा में प्रयाग/ इलाहाबाद में आकर मिलती है।डालफिन की दो प्रजातियाँ गंगा में पाई जाती हैं। जिन्हें गंगा डालफिन और इरावदी डालफिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गंगा में पाई जाने वाले शार्क की वजह से भी गंगा की प्रसिद्धि है जो बहते हुये पानी में पाये जानेवाले शार्क के लिहाज से काफी दिलचस्प है।
हिंदू धर्म में गंगागंगा को हिन्दू धर्म में एक देवी के रूप में निरुपित किया गया है हिन्दुओं के बहुत से पवित्र तीर्थस्थल गंगा नदी के किनारे बसे हुये हैं जिनमें वाराणसी, हरिद्वार सबसे प्रमुख हैं। गंगा में डुबकी लगाने का मतलब पाप से छुटाकारा समझा जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिये आवश्यक समझते हैं, यहाँ तक कि लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं।
शिव की जटाओं में गंगा
मिथकों के अनुसार ब्रह्मा ने विष्णु के पैर के पसीनों की बूँदों से गंगा का निर्माण किया। त्रिमूर्ति के दो सदस्यों के स्पर्श की वजह से यह पवित्र समझा गया।
बहुत वर्षों के पश्चात एक राजा सगर ने जादुई रुप से साठ हजार पुत्रों की प्राप्ति की। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिये एक यज्ञ किया। यज्ञ के लिये घोड़ा आवश्यक था जो ईर्ष्यालु इंद्र ने चुरा लिया था। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला जो एक ॠषि के समीप बँधा था। सगर के पुत्रों ने यह सोच कर कि ॠषि ही घोड़े के गायब होने की वजह हैं उन्होंने ॠषि का अपमान किया। तपस्या में लीन ॠषि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आँखें खोली और उनके क्रोध से सगर के सभी साठ हजार पुत्र जल कर वहीं भष्म हो गये।सगर के पुत्रो की आत्माएँ भूत बनकर विचरने लगे क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। सगर के पुत्र अन्शुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अन्शुमान के पुत्र दिलीप ने भी। भगीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे उन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया जिससे उनके संस्कार का राख स्वर्ग में जा सके।
भगीरथ ने ब्रह्माकी घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा प्रसन्न हुये और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिये तैयार हुये और गंगा को पृथ्वी पर और उसके बाद पाताल में जाने का आदेश दिया ताकि सगर के पुत्रों के आत्माओं की मुक्ति संभव हो सके। गंगा को यह आदेश अपमानजनक लगा और उन्होंने समूची पृथ्वी को बहा देने का निश्चय किया, स्थिति भाँप कर भगीरथ ने शिव से प्राथना की और शिव गंगा के रास्ते में आ गये।गंगा जब वेग में पृथ्वी की ओर चली तो शिव ने अपनी जटाओं में उसे स्थान देकर उसका वेग कम किया। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गयी और पृथ्वी वासियों के लिये बहुत ही श्रद्धा का केन्द्र बन गयीं। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मन्दाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं।"
[Quelle: http://hi.wikipedia.org/wiki/
%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE. -- Zugriff am 2006-05-21]"கங்கை ஆறு இந்தியாவின் முக்கிய ஆறாகும். இமய மலையில் உத்தராஞ்சல் மாநிலத்திலுள்ள கங்கோத்ரியில் தொடங்கும் பாகிரதி நதியானது, தேவப்பிரயாக் எனுமிடத்தில் அலக்நந்தா ஆற்றுடன் கலந்து கங்கையாகிறது. பிறகு உத்தரப் பிரதேசம், பீகார் ஆகிய மாநிலங்கள் வழியாகச் சென்று, ஹூக்லி, பத்மா என இரு ஆறுகளாக பிரிந்து முறையே மேற்கு வங்காளம், வங்கதேசம் வழியாகச் சென்று வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது. கங்கை ஆறு மொத்தம் 2507கிமீ ஓடுகிறது. ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார், அலகாபாத், வாரணாசி, பட்ணா, கொல்கத்தா ஆகியவை இவ்வாற்றின் கரையில் அமைந்த முக்கிய நகரங்களாகும்."
[Quelle: http://ta.wikipedia.org/wiki/
%E0%AE%95%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88_%E0%AE%86%E0%AE%B1%E0%AF%81. -- Zugriff am 2006-05-21]
5. Saṅghamittaṃ mahātheriṃ,
sahekādasabhikkhuniṃ;
tathevāropayitvāna,
Ariṭṭhapamukhe pi ca.
5. Auch die große Therī Sanghamittā [seine Tochter] mit elf Nonnen ließ er das Schiff besteigen, ebenso Ariṭṭha1 und sie Seinen.
Kommentar:
1 Ariṭṭha: Schwestersohn des Devānampiyatissa, Leiter der Delegation zu Asoka
6. Nagarā nikkhamitvāna,
Viñjāṭavim aticca so;
Tāmalitthiṃ anuppatto,
sattāhen’ eva bhūpati.
6. Der König verließ dann die Stadt [Pātaliputta], durchquerte den Viñjha-Wald1 und erreichte nach sieben Tagen Tāmalitti2 [heute Tamluk, West Bengal].
Kommentar:
Abb.: Landweg und Flussweg Pātaliputta -- Tāmalitti (der Lauf des Ganges war sicher anders als heute, die Meeresküste lag bei Tāmalitti)
(©MS Encarta)1 Viñjha-Wald: Vindhyā-Gebirge
"Viñjha, Viñjhāṭavi. The Vindhyā mountains and the forests surrounding them, through which lay the road from Tāmalitti to Pāṭaliputta. Along this road Asoka travelled bearing the Bodhi tree (Mhv.xix.6; Dpv.xvi.2). This was also the road leading from Ceylon to Pātaliputta (Dpv.xv.87). Near the forest was a great monastery from which sixty thousand monks, led by Uttara, went to attend the Foundation Ceremony of the Mahā Thūpa (Mhv.xx.ix.40). At the foot of the mountain was a market town named Munda. DhA.iv.128 ; elsewhere, however e.g. Sp.iii.655, Viñjhāṭavi is described as agāmakam araññam.
The forest was the abode of petas. See, e.g., PvA. 43, 192, 244."
[Quelle: Malalasekera, G. P. <1899 - 1973>: Dictionary of Pāli proper names. -- Nachdruck der Ausgabe 1938. -- London : Pali Text Society, 1974. -- 2 vol. -- 1163, 1370 S. -- ISBN 0860132692. -- s. v.]
"Les monts Vindhya sont une chaîne de montagnes gréseuses et basaltiques de faible altitude — de 460 à 1100 m — de l'Inde centrale, qui sépare géographiquement le sous-continent indien subcontinent en Inde du nord et Inde du sud, séparant la plaine gangétique du plateau du Dekkan. Les Vindhya se déroulent sur près d'un millier de kilomètres, au nord de la Narmadâ [नर्मदा], commençant à l'ouest dans l'état du Goujerat [ગુજરાત] près de sa frontière avec le Madhya Pradesh [मध्य प्रदेश], courant vers le nord-est pour trouver le Gange à Mirzapur. Sur ses pentes méridionales coulent des affluents de la Narmadâ, qui s'écoule vers l'ouest dans une dépression entre les Vindhya au nord et la chaîne parallèle des Satpura au sud avant de se jeter dans la mer d'Oman. Les cours d'eau de ses pentes septentrionales, tels que la Kalisindh ou la Betwā, alimentent le Gange. La Sone, quant à lui, est un affluent du Gange qui drainent des eaux provenant des pentes méridionales des Vindhya à son extrémité orientale.
Le plateau des Vindhya est situé au nord de la partie centrale de la chaîne et surplombe la plaine gangétique. On y trouve les villes de Bhopal( भोपाल, بھوپال) , la capitale du Madhya Pradesh, et d'Indore [इंदौर].
D'après la légende, le rishi Agastya, Celui qui fait bouger les montagnes, força les Vindhya à s'agenouiller devant lui, lui laissant le passage vers l'Inde du sud où il inventa le tamoul et y propagea le brahmanisme.
Le parc national de Bandhavgarh se situe dans les Vindhya."
[Quelle: http://fr.wikipedia.org/wiki/Vindhya. -- Zugriff am 2006-05-21]
2 Tāmalitti: heute Tamluk, West Bengal
"Tāmalitti (Tāmalitthi) The port from which the branch of the Bodhi-tree was sent to Ceylon by Asoka (Mhv.xi.38; Dpv.iii.33). It is said (Sp.i.90f) that Asoka came from Pātaliputta, crossed the Ganges by boat, traversed the Vinijhātavi, and so arrived at Tāmalitti.
It is identified with modern Tamluk, formerly on the estuary of the Ganges, but now on the western bank of the Rūpnārāyana.
When Fa Hsien came to Ceylon, he embarked at Tāmluk. Giles: op. cit. p.65."
[Quelle: Malalasekera, G. P. <1899 - 1973>: Dictionary of Pāli proper names. -- Nachdruck der Ausgabe 1938. -- London : Pali Text Society, 1974. -- 2 vol. -- 1163, 1370 S. -- ISBN 0860132692. -- s. v.]
"Tamluk is an ancient city of West Bengal [পশ্চিম বঙ্গ] state in India, near the Rupnarayan River. Tamluk is the headquarters of Midnapore [েমিদনীপুর] East district. It was home of many great leaders during independence movement.
Kolaghat is another town on the bank of Rupnarayan River and famous for Hilsa (Ilish) [ইলিশ] [Tenualosa ilisha] fishes.
Archaeological remains show continuous settlement from about 3rd century BC; it was known as Tamralipta or Tamalitti, and was a seaport, now buried under river silt."
[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Tamluk. -- Zugriff am 2006-05-18]
7. Accuḷārāhi pūjāhi,
devā nāgā narā pi
ca;
mahābodhiṃ pūjayantā,
sattāhen’ ev' upāgamuṃ.
7. Während die Götter, Nāga und Menschen den Mahābodhibaum mit allerhöchsten Ehrungen verehrten, kamen auch sie [auf dem Flussweg] nach sieben Tagen [in Tāmalitti] an.
8. Mahāsamuddatīramhi,
mahābodhiṃ
mahīpati;
ṭhapāpetvāna pūjesi,
mahārajjena so puna.
8. Der König ließ den Mahābodhibaum an den Strand des großen Ozeans stellen und verehrte ihn nochmals, indem er ihn zum großen König weihte.
9. Mahābodhiṃ mahārajje,
abhisiñcīya kāmado;
maggasirasukkapakkhe,
dine pāṭipade tato.
10. Uccāretuṃ mahābodhiṃ,
tehi yevaṭṭha
aṭṭhahi;
sālamūlamhi dinnehi,
jātuggatakulehi so.
11. Ukkhipitvā mahābodhiṃ,
galamattaṃ
jalaṃ tahiṃ;
ogāhetvā sa nāvāya,
patiṭṭhāpayi sādhukaṃ.
9. /10. 11.Als der Wunscherfüller den Mahābodhibaum zum großen König geweiht hatte, am ersten Tag der hellen Hälfte des Monats Maggasira1, ließ er ihn von denselben jeweils acht Personen aus Familien von hoher Herkunft hochheben, die er am Fuß des Sal-Baums [Shorea robusta] beauftragt hatte, ihn hochzuheben. Dann ging er dort ins Wasser bis es ihm zum Hals reichte und ließ den Mahābodhibaum gut auf das [Ozean-]Schiff2 stellen.
Kommentar:
1 Maggasira: 9. indischer Monat, entspricht Oktober/November bzw. November/Dezember
2 Ozean-Schiff
Abb.: Indisches (?) Ausleger-Schiff, 8. Jhdt. n. Chr. Borobodur, Java
Abb.: Ausleger-Schiffe (tōṇi) für den Verkehr an der Ostküste Indiens, oben Sri Lanka, unten Coromandelküste[Bildquelle: Deloche, Jean: Transport and communications in India prior to steam locomotion. -- Delhi : Oxford Univ. Pr. -- (French studies in South Asian culture and society ; 7). -- Originaltitel: La circulation en Inde avant la révolution des Transports (1980). -- Vol 2.: Water transport. -- 1994. -- 292 S. : Ill. -- Originaltitel: La voie d'eau (1980). -- S. 184. -- Dort Quellenangabe]
12. Nāvaṃ āropayitvā taṃ,
mahātheriṃ
satherikaṃ;
Mahāriṭṭhaṃ mahāmaccaṃ,
idaṃ vacanamabravi.
12. Er ließ die große Therī [Sanghamittā] mit den anderen Therī's das Schiff besteigen und sprach dann zum Chefberater [des Devānampiyatissa] Mahārittha folgende Worte:
13. “Ahaṃ rajjena tikkhattuṃ,
mahābodhim apūjayiṃ;
evam evābhipūjetu,
rājā rajjena me sakhā”.
13. Ich habe den Mahābodhibaum dreimal dadurch geehrt, dass ich ihn zum König weihte, ebenso soll mein Gefährte, der König [Devānampiyatissa] ihn durch die Königsweihe ehren."
14.
Idaṃ vatvā mahārājā,
tīre pañjaliko
ṭhito;
gacchamānaṃ mahābodhiṃ,
passaṃ assūni vattayi.
14. Nach diesen Worten stand der große König am Strand mit zu Añjali geformten Händen und vergoss Tränen als er sah, wie der Mahābodhibaum wegfuhr.
15. Muñcamāno mahābodhi-
rukkho dasbalassa so
jalaṃ sarasaraṃsiṃ va
gacchati vata re iti
15. "Ach, da geht der Mahābodhibaum des Besitzers der zehn Kräfte1 [eines Buddha], ein Netz von Sonnenstrahlen aussendend."
Kommentar:
1 Die zehn Kräfte eines Buddha:
- thānāthāna-ñāna n. -- Erkenntnis, was möglich und was unmöglich ist
- vipāka-ñāna n. -- Erkenntnis der Reifung von Kamma in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit Möglichkeiten und Ursachen
- sabbatthagāminī-patipadā-ñāna n. -- Erkenntnis, wohin jeder Weg führt
- nānā-dhātu-ñāna n. -- Erkenntnis der Welt mit ihren Elementen
- nānādhimuttika-ñāna n. -- Erkenntnis der verschiedenen Neigungen der Wesen
- indriya-paro-pariyatti-ñāna n. -- Erkenntnis der Fähigkeiten anderer Wesen
- jhānādi-sa°nkilesa-ñāna n. -- Erkenntnis der Versenkungszustände (jhāna n.), Befreiungen (vimokkha m.), Zustände der Sammlung (samādhi m.) mit ihren Befleckungen, ihrer Reinigung und Entstehung
- pubbe-nivāsānussati-ñāna n. -- Erinnerung an frühere Geburten
- cutūpapāta-ñāna n. -- Erkenntnis des Vergehens und Entstehens der Wesen im Sa.msāra
- āsava-kkhaya-ñāna n. -- Erkenntnis, dass die Triebe (āsava) verschwunden sind
(Mahāsīhanādasutta : Majjhimanikāya I, 69 - 71)
siehe auch: Nāgārjuna: La traité de la grande vertu de sagesse (Mahāprajñāpāramitā`sāstra) / [Trad. par] Étienne Lamotte. -- Tome III. -- p. 1505 - 1566.
16. Mahābodhiviyogena,
Dhammāsoko sasokavā;
kanditvā paridevitvā,
agamāsi sakaṃ puraṃ.
16. Wegen der Trennung vom Mahābodhubaum kehrte Dhammasoka bekümmert1 [sa-soka, Wortspiel zu a-soka] weinend und klagend in seine Stadt [Pātaliputta] zurück.
Kommentar:
1 bekümmert: sa-soka, Wortspiel zu a-soka = ohne Kummer
17. Mahābodhisamāruḷhā,
nāvā pakkhandhi
toyadhiṃ;
samantā yojane vicī,
sannisīdi mahaṇṇave.
17. Das Schiff mit dem Mahābodhibaum stach in See. Rundherum im Umkreis von einem Yojana [ca. 11 km] wurde die See wogenlos still.

Abb.: Am Golf von Bengalen
[Bildquelle: limemintcooler. --
http://www.flickr.com/photos/limemintcooler/85476885/. -- Creative Commons
Lizenz. -- Zugriff am 2006-05-29]
18. Pupphiṃsu pañcavaṇṇāni,
padumāni
samantato;
antalikkhe pavajjiṃsu,
anekatūriyāni ca.
18. Lotusse in fünf Farben blühten rund herum [um das Schiff], in der Luft ertönten viele Musikinstrumente.

Abb.: Lotus (Nelumbo nucifera)
(©Corbis)
19. Devatāhi anekāhi,
pūjānekā
pavattitā;
gahetuñ ca mahābodhi,
nāgākāsuṃ vikubbanaṃ.
19. Viele Gottheiten vollzogen vielerlei Verehrungen. Nāga's1 vollbrachten magische Verwandlungen, um den Mahābodhibaum zu bekommen.
Kommentar:
1 Nāga: Kobragottheiten, hier Seeschlangengottheiten

Abb.: Gestreifte Seeschlange, Thailand
[Bildquelle: Wikipedia]
20. Saṅghamittā mahātheri,
abhiññābalapāragā;
supaṇṇarūpā hutvāna,
tāsesi mahorage.
20. Die große Therī Sanghamittā, die alle höheren Geisteskräfte1 [abhiññā] erlangt hatte, nahm die Gestalt eines Adlers2 an und versetzte die großen Schlangen in Schrecken.
Kommentar:1 Die 6 abhiññā f. -- höheren Geisteskräfte sind:
- iddhi-vidhā f. -- die verschiedenen Fähigkeiten außergewöhnlicher Macht (iddhi):
- adhitthānā iddhi f.: die außergewöhnliche Macht durch Entschluss: jemand entschließt sich z.B., vielfach zu werden
- vikuppanā iddhi f.: die außergewöhnliche Macht der Verwandlung: Aufgeben der ursprünglichen Gestalt und Annehmen z.B. der Gestalt einer Kobra, oder eines Armeeteiles
- manomayā iddhi f.: die außergewöhnliche Macht des geistgezeugten (Körpers): man lässt einen "Astralleib" hervorgehen
- dibba-sota -- das himmlische Ohr: Fähigkeit himmlische und menschliche Töne zu hören, ferne und nahe
- parassa ceto-pariyañāna n. -- das Durchschauen der Herzen anderer: Erkennen des Bewusstseins anderer, ob gierbehaftet usw.
- pubbe-nivāsānussati f. -- Erinnerung an frühere eigene Daseinsformen
- dibba-cakkhu n. -- das himmlische Auge: man sieht wie andere Wesen vergehen und wiederentstehen
- āsava-kkhaya-ñāna n. -- Wissen um die eigene Triebversiegung
Sanghāmitta nutzt also ihre vikuppanā iddhi, die Macht der Verwandlung.
2 In den indischen Küstengewässern kommt der Weißbauchseeadler (Haliaeetus leucogaster) vor
"Der Weißbauchseeadler (Haliaeetus leucogaster) ist ein im indomalayischen und australasiatischen Raum weit verbreiteter Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen (Accipitridae). Mit bis zu 85 Zentimetern Körperlänge erreicht er fast die Größe des Seeadlers (Haliaeetus albicilla), ist aber insgesamt schlanker und im Mittel bedeutend leichter als dieser. Trotz des weiten Verbreitungsgebietes werden keine Subspecies unterschieden. Zusammen mit dem Salomonenseeadler (Haliaeetus sanfordi) bildet er eine Superspecies. Aussehen
Weißbauchseeadler (Haliaeetus leucogaster)Im Alterskleid ist der Weißbauchseeadler unverwechselbar. Kopf, Hals, der Vorderrücken sowie die gesamte Unterseite des Vogels sind rein weiß. Ebenso gefärbt sind die Gefiederpartien an den Unterschenkeln (Hosen), sowie die Oberen Deckfedern am Schwanzansatz. Die Oberseite des sitzenden Vogel ist bis auf die beschriebenen Bereiche schiefergrau, alle Schwungfedern sind schwarz. Der Schnabel des erwachsenen Weißbauchseeadlers ist an der Schnabelspitze schwarz und wird zum Schnabelansatz heller. Der Fußbereich ist nicht befiedert und blassgrau gefärbt; die Krallen sind schwarz. Im Flug wirkt ein voll ausgefärbter Weißbauchseeadler bis auf die schwarzen Schwungfedern weiß. Auch der keilförmige Schwanz ist bis auf zwei schwarze seitliche Abzeichen im oberen Schwanzdrittel weiß.
Das Jugendgefieder und die Gefiederfärbungen subadulter Weißbauchseeadler unterscheiden sich von Erwachsenenkleid wesentlich. Die reinweißen Gefiederteile des adulten Vogels sind bei juvenilen und subadulten Individuen blass rötlichbraun und weisen eine deutliche dunkle Längsstrichelung auf, die von Jahr zu Jahr mehr ins Weiße wechselt. Die Oberseite ist dunkelbraun. Im Flug wirken nicht ausgefärbte Vögel cremefarben ohne starke Farbkontraste. Der Schwanz endet in einem dunklen Subterminalband. Frühestens mit vier Jahren zeigen Weißbauchseeadler das Erwachsenengefieder.
In der Gefiederfärbung unterscheiden sich die Geschlechter nicht, wohl aber in der Größe und im Gewicht. Weibchen können bis zu 20 Prozent größer und schwerer als die Männchen werden. Sehr große Weibchen erreichen eine Spannweite von fast 220 Zentimeter bei einem Gewicht von annähernd 4 Kilogramm.
StimmeDie Rufe des Weißbauchseeadlers sind vor allem in der Balzzeit am frühen Morgen und in der Abenddämmerung zu hören, gelegentlich auch in hellen Nächten. Sie erinnern etwas an Gänserufe beziehungsweise an nasale Entenrufe. Der Alarmruf ist ein raues, eher misstönendes Krächzen.
Verbreitung und LebensraumDer Weißbauchseeadler ist in den Küstengebieten des indomalayischen- und australasiatischen Raumes verbreitet, wo er außer auf dem Festland auf den meisten Inseln dieses Gebietes vorkommt. Stellenweise ist er in seinem Verbreitungsgebiet nicht selten. Neuerdings werden Bestandsrückgänge aus Thailand und anderen Gebieten Südostasiens gemeldet.
Er besiedelt vor allem Küstengebiete und das küstennahe Hinterland. Gelegentlich bewohnt er auch Lebensräume entlang großer Ströme, sowie die Ufer von Seen. Seine Hauptverbreitung liegt vertikal hauptsächlich auf Meeresniveau, doch wurden lokal auch Vorkommen bis 1500 Meter über NN, auf Sulawesi sogar aus einer Höhe von 1700 Metern gemeldet. Grobe Bestandsschätzungen bewegen sich zwischen 10 000 und 100 000 Brutpaaren. Sein Gesamtbestand gilt zur Zeit nicht als gefährdet. Langfristig können aber, wie lokale Bestandsabnahmen nahelegen, die üblichen Gefährdungsursachen, wie Störungen am Brutplatz, direkte Verfolgung, Lebensraumzerstörung sowie Pestizideintrag auch für diese Art gefährlich werden.
VerhaltenAm ehesten kann man sie morgens entdecken, wenn sie mit dem warmen Aufwind die Küsten entlanggleiten. Dabei halten sie die Flügel v-förmig, nicht wie andere Greifvögel waagerecht.
Bei Streitigkeiten um einen Partner oder um das Revier zu verteidigen, fliegen die Weißbauchseeadler bis in eine Höhe von etwa 1000 m hinauf, verkeilen sich ineinander und stürzen sich dann in die Tiefe. Dies wird so oft wiederholt, bis einer der beiden Kontrahenten aufgibt oder tot ist. Meist wird dieses Ritual nur zu einem gewissen Nerventest verwendet. Jedoch sind Revierverteidigungen auf diese Art nicht sehr häufig, es werden meist nur sehr laute Schreie ausgestoßen, wenn sich ein fremder Weißbauchseeadler dem Nest oder wichtigen Ausschau- und Futterstellen nähert. Diese Schreie kann man bis zu 1000 m weit hören.
Weißbauchseeadler sind keine Zugvögel, jedoch legen sie zur Partnersuche sehr weite Strecken zurück. Pärchen bleiben immer in Nestnähe.
ErnährungEine Besonderheit der Weißbauchseeadler ist es, mit Vorliebe die giftigsten Schlangen, die Seeschlangen, zu jagen, obwohl sie nicht gegen deren Gift immun sind. Sie greifen ihre Beute, hauptsächlich Fische, Krabben und Seeschlangen, an der Wasseroberfläche und jagen dann mit einem rückwärtigen Schlag ihre scharfen Klauen hinein. Sie tauchen dabei nie ins Wasser, so wie es Fischadler tun. Aber auch an Land jagen sie, und zwar vornehmlich Vögel, Schildkröten und Fledermäuse.
FortpflanzungWeißbauchseeadler bilden eine lebenslange Partnerschaft. Sie vollziehen Balzspiele wie beispielsweise Klauentänze beim Toben durch die Lüfte. Dabei stoßen sie immer wieder Töne wie Gänsegeschrei aus. Um die richtige Stelle für den Nestbau zu finden, fliegen sie sehr hoch hinaus, dort machen sie den größten Baum nahe der Küste oder einer großen Wasserstelle aus. Das Nest wird 150 bis 200 cm im Durchmesser groß und besteht aus Reisig und grüner Vegetation. Es wird jedes Jahr genutzt und immer weiter ausgebaut, so dass es eine Höhe von 200 cm erreichen kann. Sollte das Nest nicht mehr genutzt werden, wird es meist von anderen Greifvögeln besiedelt.
Das Weibchen legt zwei bläuliche, etwa 70 x 55 cm große Eier ins Nest und brütet sie aus, derweil das Männchen sie füttert und Feinde oder Bruträuber fernhält."
21. Te tāsitā mahātheriṃ,
yācitvāna
mahoragā;
nayitvāna mahābemadhiṃ,
bhujaṅgabhavanaṃ tato.
21. Erschrocken baten die großen Schlangen die große Therī um den Mahābodhibaum und brachten ihn ins Schlangenreich.
22. Sattāhaṃ nāgarajjena,
pūjāhi
vividhāhi ca;
pūjayitvāna ānetvā,
nāvāyaṃ ṭhapayiṃsu te.
22. Sieben Tage verehrten sie ihn mit der Weihe zum Nāgakönig und verschiedenen anderen Ehrungen. Dann brachten sie ihn zurück und stellten ihn auf das Schiff.

Abb.: Ein Nāga verehrt den Mahābodhibaum. -- Ausschnitt aus Wandmalerei,
Anurādhapura, 19. Jhdt.
[Vorlage der Abb.: Sri Lanka : aus Legende, Märchen, historischer Überlieferung und Bericht./ hrsg. von Heinz Mode. -- Hanau : Müller & Kiepenheuer, 1981. -- S. 36]
23a. Tadaheva mahābodhi,
jambukolam idhāgamā;
23a. Noch am gleichen Tag kam der Mahābodhibaum hier [in Lankā] in Jambukola1 [Hafen für Anurādhapura, heutiges Kankesanturai auf der Jaffna-Halbinsel auf Nāgadīpa, der Jaffna-Halbinsel] an.
Kommentar:
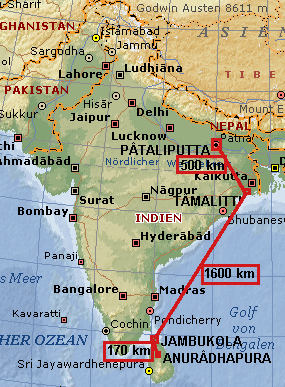
Abb.: Pātaliputta -- Tāmalitti -- Jambukola -- Anurādhapura
(©MS Encarta)
1 Jambukola: Hafen für Anurādhapura, heutiges Kankesanturai auf Nāgadīpa, der Jaffna-[யாழ்ப்பாணம-]Halbinsel
Devānaṃpiyatisso tu,
rājā lokahite rato.
24. Sumanasamaṇeraṃhā
pubbe sutatadāgamo
maggasirādidinato
pabhutīva sadādaro
25. Uttaradvārato yāva
Jambukolaṃ mahāpathaṃ
vibhūsazitvā sakalaṃ
mahabodhigatāsayo.
23b./24./25. König Devānampiyatissa, auf das Heil der Welt bedacht, hatte zuvor vom Novizen Sumana über die Ankunft gehört. Er ließ vom ersten Tag des Monats Maggasira1 an voll Ehrfurcht die ganze Hauptstraße vom Nordtor [Anurādhapura's] bis Jambukola in Erwartung des Mahābodhibaums schmücken.
Kommentar:
1 Maggasira: 9. indischer Monat, entspricht Oktober/November bzw. November/Dezember
26. Samuddapaṇṇasālāya,
ṭhāne ṭhatvā
mahaṇṇave;
āgacchantaṃ mahābodhiṃ,
mahātheriddhiyāddasa.
26. An der Stelle des [späteren] Samuddapaṇṇasālā stand er am Ozean und sah durch die Wundermacht der Therī den Mahābodhibaum herankommen.
27. Tasmiṃṭhāne katā sālā,
pakāsetuṃ
tam abbhutaṃ;
Samuddapaṇṇasālā ti,
nāmenāsidha pākaṭā.
27. Die Halle, die an dieser Stelle errichtet wurde, um dieses Wunder bekannt zu machen, war hier unter dem Namen Samuddapannasālā bekannt.
28. Mahātherānubhāvena,
saddhiṃ therehi
tehi ca;
tadahe vāgamā rājā,
Jambukolaṃ sasenako.
28. Durch die Macht des großen Thera [Mahinda] kam der König mit seinem Heer zusammen mit den Thera's noch am selben Tag nach Jambukola.
29. Mahābodhāgame pīti-
vegen’ unno udānayaṃ;
galappamāṇaṃ salilaṃ,
vigāhetvā suviggaho.
29. Aus Freude über das Kommen des Mahābodhibaums high rief der Schöne einen begeisterten Vers und ging bis zum Hals ins Wasser.
30. Mahābodhiṃ soḷasahi,
kulehi saha
muddhanā;
ādāyoropayitvāna,
velāya maṇḍape subhe.
31. Ṭhapayitvāna Laṃkindo,
Laṃkārajjena
pūjayi;
soḷasannaṃ samappetvā,
kulānaṃ rajjam attano.
32. Sayaṃ dovārikaṭṭhāne,
ṭhatvāna divase
tayo;
tattheva pūjaṃ kāresi,
vividhaṃ manujādhipo.
30./31./32. Zusammen mit 16 Personen aus guter Familie nahm er den Mahābodhibaum auf sein Haupt, setzte ihn am Strand ab und ließ ihn in einen schönen Pavillon stellen. Dann verehrte ihn der Herr Lankā's indem er ihn zum König über Lankā weihte. Der Herr der Menschen übertrug den 16 Personen aus guten Familien seine Regierungsgeschäfte, stellte sich selbst an die Stelle des Türhüters und lies dort drei Tage lang verschiedenerlei Verehrung vollziehen.

Abb.: Die Ankunft des Mahābodhibaums. -- Wandmalerei, Anurādhapura, 19. Jhdt.
[Vorlage der Abb.: Sri Lanka : aus Legende, Märchen, historischer Überlieferung und Bericht./ hrsg. von Heinz Mode. -- Hanau : Müller & Kiepenheuer, 1981. -- S. 36]
33. Mahābodhiṃ dasamiyaṃ,
āropetvā
rathe subhe;
ānayanto manussindo,
dumindaṃ taṃ ṭhapāpayi.
34. Pācinassa vihārassa,
ṭhāne
ṭhānavicakkhaṇo;
pātarāsaṃ pavattesi,
sasaṅghassa janassa so.
33./34. Am zehnten Tag ließ er den Mahābodhibaum auf einen schönen Wagen stellen. Der Herr der Menschen brachte den Herrn der Bäume. Er, der gute Plätze erkannte, ließ ihn an die Stelle des [späteren] Ostklosters stellen. Dann veranstaltete er für den Orden und die Leute ein Morgenmahl.
35. Mahāmahindather’ ettha,
kataṃ
dasabalena taṃ;
kathesi nāgadamanaṃ,
rañño tassa asesato.
35. Dort erzählte der große Thera Mahinda dem König vollständig die Bezähmung1 der Nāga durch den zehn Kräfte Besitzenden [Buddha].
Kommentar:
1 Das bezieht sich auf Buddhas Besuch in Nāgadīpa, d.h. der Jaffna-Halbinsel, Mahāvaṃsa, Kapitel I, Vers 44 - 70
36. Therassa sutvā kāretvā,
saññāṇāni
tahiṃ tahiṃ;
paribhuttesu ṭhānesu,
nisajjādīhi satthunā.
36. Als der König das hörte, ließ er Gedenkmonumente überall an den Stellen errichten, die der Lehrer [Buddha] besucht hatte und dort sich hingesetzt hatte oder dergleichen.
37. Tivakkassa brāhmaṇassa,
gāmadvāre ca
bhūpati;
ṭhapāpetvā mahābodhiṃ,
ṭhānesu tesu tesu ca.
38. Suddhavālukasanthāre,
nānāpupphasamākule;
paggahītadhaje magge,
pupphaagghikabhūsite.
37. /38. Der König ließ den Bodhibaum am Ortseingang des Dorfes des Brahmanen Tivakka1 abstellen, ebenso an vielen Stellen am Weg. Der Weg war mit weißem Sand bestreut, mit verschiedensten Blüten bedeckt, mit Fahnen überspannt, mit Blumengirlanden geschmückt.
Kommentar:
1 Tivakka
"Tivakka (Tavakka) A village, administered by the brahmins of the same name. Here halted the procession bearing the Sacred Bodhi-tree from Jambukola to Anurādhapura.
The brahmin, Tivakka, probably the head of the village, was present at the ceremony of the planting of the Bodhi-tree and later, one of the eight saplings from the tree was planted in the village. (Mhv.xix.37, 54, 61; Mbv. p.162; Sp.i.100)."
[Quelle: Malalasekera, G. P. <1899 - 1973>: Dictionary of Pāli proper names. -- Nachdruck der Ausgabe 1938. -- London : Pali Text Society, 1974. -- 2 vol. -- 1163, 1370 S. -- ISBN 0860132692. -- s. v.]
39. Mahābodhiṃ pūjayanto,
rattindivam atandito;
ānayitvā cuddasiyaṃ,
Anurādhapurantikaṃ.
39. Der König verehrte den Mahābodhibaum Tag und Nacht ohne Unterlass und brachte ihn am 14. Tag in die Nähe von Anurādhapura.
40. Vaḍḍhamānakacchāyāya,
puraṃ sādhu
vibhūsitaṃ;
uttarena duvārena,
pūjayanto pavesiya.
40. Als die Schatten lang wurden [d.h. am Spätnachmittag] brachte er ihn unter ständigen Ehrerbietungen durch das Nordtor in die wohlgeschmückte Stadt.
41. Dakkhiṇena duvārena,
nikkhamitvā
pavesiya;
Mahāmeghavanārāmaṃ,
catubuddhanisevitaṃ.
41. Durch das Südtor führte er ihn in Mahāmeghavanakloster, das vier Buddhas beehrt hatten1.
Kommentar:
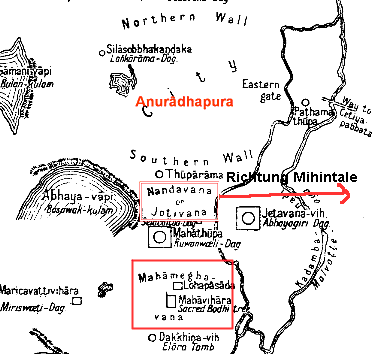
Abb.: Plan von Anrādhapura mit dem Mahāmeghavanakloster
1 siehe Mahāvaṃsa, Kapitel 15, Vers 55 - 172
42. Sumanasseva vacasā,
padesaṃ
sādhu saṅkhataṃ;
pubbabodhiṭhitaṭṭhānaṃ,
upanetvā manoramaṃ.
42. Dort ließ der König den Mahābodhibaum zu der entzückenden Stelle, an der die früheren Bodhibäume [der drei früheren Buddhas] gestanden hatten und die auf Anweisung Sumana's gut vorbereitet worden war.
43. Kulehi so soḷasahi,
rājālaṅkāradhārihi;
oropetvā mahābodhiṃ,
patiṭṭhāpetum ossajji.
43. Der König hob den Mahābodhibaum herunter gemeinsam mit den 16 Personen aus guten Familien, die königlichen Schmuck trugen. Dann ließ er ihn los, um ihn hin zu stellen.
44. Hatthato muttamattā sā,
asītiratanaṃ
nabhaṃ;
uggantvāna ṭhitā muñci,
chabbaṇṇā rasmiyo subhā.
44.. Kaum hatte er ihn losgelassen, erhob sich der Baum 80 Ratana1 in die Luft, blieb stehen und sandte reine Strahlen in sechs Farben1 aus.
Kommentar:
1 Ratana: ein Längenmaß = 12 Finger
2 sechs Farben:
nīla - dunkelblau
pīta - gelb
lohitaka - rot
odāta - weiß
mañjeṭṭha - purpur
pabhassara - leuchtend
45. Dīpe patthariyāhacca,
brahmalokaṃ ṭhitā ahuṃ;
sūriyatthaṅgamā yāva,
rasmiyo tā manoramā.
45. Diese entzückenden Strahlen breiteten sich über die Insel aus und reichten bis zur Brahmawelt1. Sie blieben bis Sonnenuntergang.
Kommentar:

Abb.: Sonnenuntergang Sri Lanka
[Bildquelle: amparabill. --
http://www.flickr.com/photos/billbarkle/88839679/. -- Creative Commons
Lizenz. -- Zugriff am 2006-05-29]
1 Brahmawelt
Loka m. -- Welten
- manussa-loka m. -- Menschen-Welt
- Deva-loka m. -- Götterwelten:
- 6. Para-nimittavasavatti
- 5. Nimmāṇa-rati
- 4. Tusita
- 3. Yāma
- 2. Tavatiṃsa
- 1. Cātum-mahārājika
- brahma-loka m. -- Brahma-Welten = rūpa-bhava m. Existenzebene der Formen, feinkörperliche Existenzebene = rūpa-loka m. -- Welt der Formen, feinkörperliche Welt:
- 4. Catuttha-jhāna-bhūmi f. -- Ebene der vierten Versenkungsstufe:
- 3. Suddhāvāsa -- reine Gefilde:
- 5. Akaniṭṭha
- 4. Sudassī
- 3. Sudassa
- 2. Âtappa
- 1. Aviha
- 2. Asaññāsatta -- Wesen ohne Wahrnehmung und Empfindung
- 1. Vehapphala
- 3. Tatiya-jhāna-bhūmi f. -- Ebene der dritten Versenkungsstufe:
- 3. Subhakiṇṇa
- 2. Appamāṇasubhā
- 1. Parittasubhā
- 2. Dutiya-jhāna-bhūmi f. -- Ebene der zweiten Versenkungsstufe:
- 3. Âbhassarā
- 2. Appamāṇābhā
- 1. Parittābhā
- 1. Paṭhama-jhāna-bhūmi f. -- Ebene der ersten Versenkungsstufe:
- 3. Mahābrahma
- 2. Brahmapurohitā
- 1. Brahmaparisajjā
(Papañcasūdanī 269)
46. Purisā dasasahassāni,
pasannā
pāṭihāriye;
vipassitvāna arahatthaṃ,
patvāna idha pabbajuṃ.
46. 10.000 Menschen wurden bei diesem Wunder voll Vertrauen, bekamen Durchblick durch die Wirklichkeit, erreichten Arhatschaft und traten in den Orden ein.
47. Orohitvā mahābodhi,
sūriyatthaṅgame
tato;
rohiṇiyā patiṭṭhāsi,
mahiyaṃ kampi medinī.
47. Bei Sonnenuntergang stieg der Mahābodhibaum [aus der Luft] herab und stellte sich auf die Erde unter dem Mondhaus Rohinī1. Da bebte die Erde.
Kommentar:

Abb.: Die Pflanzung des Mahābodhibaums. -- Wandmalerei, Anurādhapura, 19. Jhdt.
[Vorlage der Abb.: Sri Lanka : aus Legende, Märchen, historischer Überlieferung und Bericht./ hrsg. von Heinz Mode. -- Hanau : Müller & Kiepenheuer, 1981. -- S. 37]
1 Mondhaus Rohiṇī
Zu den Mondhäusern siehe:
Payer, Alois <1944 - >: Dharmashastra : Einführung und Überblick. -- 10. Sakramente und Übergangsriten (samskara). -- Anhang A: Mondhäuser (Nakshatra). -- URL: http://www.payer.de/dharmashastra/dharmash10a.htm
Abb.: Aldebaran = Rohiṇī
[Bildquelle: Wikipedia]
Abb.: Mond im Taurus
[Bildquelle: Lone Primate. -- http://www.flickr.com/photos/loneprimate/108271768/. -- Creative Commons Lizenz. -- ZUgriff am 2006-05-26]
"A nakshatra (Devanagari: नक्षत्र) or lunar mansion is one of the 27 or 28 divisions of the sky, identified by the prominient star(s) in them, that the Moon passes through during its monthly cycle, as used in Hindu astronomy and astrology. Therefore, each represents a division of the ecliptic similar to the zodiac. The mansion associated with a given date corresponds to the constellation which the Moon is passing through at that time. Nakshatra computation appears to have been well known at the time of the Rig Veda (2nd–1st millennium BC). The starting point for this division is the point on the ecliptic directly opposite to the star Spica called Chitrā in Sanskrit. (Other slightly-different definitions exist.) It is called Meshādi or the "start of Aries". The ecliptic is divided into the nakshatras eastwards starting from this point.
The 27 Nakshatras cover 13°20’ of the ecliptic each. Each Nakshatra is divided into quarters or padas of 3°20’. The nakshatras with their corresponding regions of sky are given below, following [Basham]'s Appendix: Astronomy.
An additional 28th intercalary nakshatra, Abhijit (अभिजित)(alpha, epsilon and zeta Lyrae - Vega - between Uttarasharha and Sravana), is required to compensate for the sidereal month being eight hours more than 27 days. Unlike the 13°20' range of the 27 proper nakshatras, Abhijit spans 4°14' to reflect the extra span of 7¾ hours.
# Name Western equivalent Location 1 Ashvinī (अश्विनि) β and γ Arietis 00AR00-13AR20 2 Bharanī (भरणी) 35, 39, and 41 Arietis 13AR20-26AR40 3 Krittikā (क्रृत्तिका) Pleiades 26AR40-10TA00 4 Rohinī (रोहिणी) Aldebaran 10TA00-23TA20 5 Mrigashīrsha (म्रृगशीर्षा) λ, φ Orionis 23TA40-06GE40 6 Ārdrā (आर्द्रा) Betelgeuse 06GE40-20GE00 7 Punarvasu (पुनर्वसु) Castor and Pollux 20GE00-03CA20 8 Pushya (पुष्य) γ, δ and θ Cancri 03CA20-16CA40 9 Āshleshā (आश्लेषा) δ, ε, η, ρ, and σ Hydrae 16CA40-30CA500 10 Maghā (मघा) Regulus 00LE00-13LE20 11 Pūrva Phalgunī (पूर्व फाल्गुनी) δ and θ Leonis 13LE20-26LE40 12 Uttara Phalgunī (उत्तर फाल्गुनी) Denebola 26LE40-10VI00 13 Hasta (हस्त) α to ε Corvi 10VI00-23VI20 14 Chitrā (चित्रा) Spica 23VI20-06LI40 15 Svātī (स्वाति) Arcturus 06LI40-20LI00 16 Vishākhā (विशाखा) α, β, γ and ι Librae 20LI00-03SC20 17 Anurādhā (अनुराधा) β, δ and π Scorpionis 03SC20-16SC40 18 Jyeshtha (ज्येष्ठा) α, σ, and τ Scorpionis 16SC40-30SC00 19 Mūla (मूल) ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ and ν Scorpionis 00SG00-13SG20 20 Pūrva Ashādhā (पूर्वाषाढ़ा) δ and ε Sagittarii 13SG20-26SG40 21 Uttara Ashādhā (उत्तराषाढ़ा) ζ and σ Sagittarii 26SG40-10CP00 22 Shravana (श्रावण) α, β and γ Aquilae 10CP00-23CP20 23 Shravishthā (श्रविष्ठा) α to δ Delphinis 23CP20-06AQ40 24 Shatabhishā (शतभिषा) γ Aquarii 06AQ40-20AQ00 25 Pūrva Bhādrapadā (पूर्वभाद्रपदा) α and β Pegasi 20AQ00-03PI20 26 Uttara Bhādrapadā (उत्तरभाद्रपदा) γ Pegasi and α Andromedae 03PI20-16PI40 27 Revatī (रेवती) ζ Piscium 16PI40-30PI00
The list of Nakshatras is found in the Vedic texts and also in the Shatapatha Brahmana. The first astronomy text that lists them is the Vedanga Jyotisha of Lagadha."[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Nakshatra. -- Zugriff am 2006-05-21]
48. Mūlāni tāni uggantvā,
kaṭāhamukhavaṭṭito;
vinandhantā kaṭāhaṃ taṃ,
otariṃsu mahītalaṃ.
48. Die Wurzeln [des Mahābodhibaums] traten aus dem Topf oben heraus, umschlossen den Topf und wuchsen in die Erde.
49. Patiṭṭhitaṃ mahābodhiṃ,
janā sabbe
samagatā;
gandhamālādipūjāhi,
pūjayiṃsu samantato.
49. Das Volk, das von überall her zusammengekommen war, verehrte den Mahābohibaum, der Wurzel gefasst hatte, mit Geruchsopfern, Girlanden und dergleichen Opfern.

Abb.: Einzäunung des Mahābodhi-Baums, 2004
[Bildquelle: Dennis Sylvester Hurd. --
http://www.flickr.com/photos/dennissylvesterhurd/50827323/in/set-804644/. --
Creative Commons Lizenz. -- Zugriff am 2006-05-26]
50. Mahāmegho pavassittha,
himagabbhā
samantato;
mahābodhiṃ chādayiṃsu,
sītalāni ghanāni ca.
50. Eine große Wolke brach in Regen aus, von allen Seiten verbargen kalte, dichte Himālaya stammende Wolken den Mahābodhibaum.
51. Sattāhāni mahābodhi,
adassanā;
himagabbhe sannisīdi,
pasādajananī jane.
51. Sieben Tage lang war der Mahābodhibaum in dieser Schneewolke1 unsichtbar und erzeugte dadurch Glauben beim Volk.
Kommentar:
1 "Schneewolke", vermutlich ist eine Cumulus-Wolke gemeint

Abb.: "Schneewolke" über Colombo, in Wirklichkeit eine Cumulus-Wolke
[Bildquelle: The Albanian. --
http://www.flickr.com/photos/merkur/144913282/. -- Creative Commons Lizenz.
-- Zugriff am 2006-05-29]
52. Sattāhātikkame meghā,
sabbe
apagamiṃsu te;
mahābodhi ca dassittha,
chabbaṇṇāraṃsiyo pi ca.
52. Nach sieben Tagen vergingen alle Wolken und der Mahābodhibaum und die Strahlen in sechs Farben1 wurden sichtbar.
Kommentar:
1 sechs Farben:
nīla - dunkelblau
pīta - gelb
lohitaka - rot
odāta - weiß
mañjeṭṭha - purpur
pabhassara - leuchtend
53. Mahāmahindatthero ca,
Saṅghamittā ca
bhikkhuṇī;
tatthāgañchuṃ saparisā,
rājā saparisopi ca.
53. Der große Thera Mahinda und die Nonne Sanghamittā kamen mit ihrem Gefolge dorthin, ebenso der König mit seinem Gefolge.
54. Khattiyā Kājaraggāme,
Candanaggāmakhattiyā;
Tivakkabrāhmaṇo ceva,
dīpavāsijanā pi ca.
55. Devānubhāvenāgañchuṃ,
mahābodhimahussukkā;
mahāsamāgame tasmiṃ,
pāṭihāriyavimhite.
56. Pakkaṃ pācinasākhāya,
pekkhataṃ
pakkam ’akkhataṃ;
thero patantam ādāya,
ropetuṃ rājino adā.
54./55./56. Die Khattiya's [Fürsten] von Kājaraggāma1, die Khattiya's von Candanaggāma2, der Brahmane Tivakka3 und die Bewohner der Insel kamen sehnsüchtig nach dem Mahābodhibaum hierher durch die Macht der Götter. In dieser großen Versammlung, die über das Wunder verwundert war, kam am Ostzweig während sie zuschauten eine reife, unverletzte Frucht hervor. Der Thera hob sie auf, als sie herunterfiel, und gab sie dem König, damit er sie pflanze.
Kommentar:
1 Kājaraggāma: heute Kataragama, ein berühmter Wallfahrtsort zu Gott Skanda/Kārtikkeya

Abb.: Lage von Kataragama
(©MS Encarta)

Abb.: Kataragama Dagoba
[Bildquelle: romanedirisinghe. --
http://www.flickr.com/photos/romanedirisinghe/7838587/. -- Creative Commons
Lizenz. -- Zugriff am 2006-05-29]
"Kataragama also Katharagama,and Katirkamam (Tamil கதிர்காமம்) is a regionally popular place of pilgrimage to Buddhist, Hindu, Muslim and indigenous Vedda communities of Sri Lanka and South India. Current township
Today it is a fast developing township in the deep south of Sri Lanka. But in medieval times it was only a small village. It is situated 228km south of Colombo, the capital of Sri Lanka.
Buddhist KataragamaSome believe that it is one of the 16 principal places of Buddhist pilgrimage to be visited in Sri Lanka. According to the chronicle of Sri Lankan history the Mahawamsa, when the Bo-sapling or Pipil tree sapling under which Goutama Buddha attained enlightenment in North India was brought to the city of Anuradhapura 2,300 years ago, the warriors or Kshatriyas from Kataragama were present on the occasion to pay homage and respect.
The Budhist Kiri Vehera Dagoba which stands in close proximity to the Hindu temple was built by the King Mahasena. According to the legend Lord Buddha on his third and the last visit to Sri Lanka was believed to have met the King Mahasena who ruled over the Kataragama area in B.C.580. Thus the local Sinhalese Buddhists believe that Kataragama was sanctified by Lord Buddha. The King met the Lord Buddha and listened to the Buddha’s discourse and as a token of gratitude, the Dagoba was built on that exact spot where it now stands.
Hindu Katirkamam(see main article for transformation of Katirkamam Hindu temple)
Tamil Hindus of Sri Lanka and South India refer to the place as Katirkamam and it has a famous Hindu shrine dedicated to Lord Katirkaman. The presiding deity is popularly identified with Lord Murukan or Skandha. Saivite Hindus of South India call him also as Subramanya. Following are the other names to identify the same deity in the Hindu texts; Kandasamy, Katiradeva, Katiravel, Kartikeya, and Tarakajith. Some of these names are derived from the root Katir from Katirkamam.
The deity’s image is depicted either with six heads and 12 hands, or one head and 4 hands. The God’s vehicle is the peacock, which is native to Sri Lanka and India. Many local Tamils undertake long pilgrimage journeys across the island to reach temple complex. There is also a related shrine called as Sella Katirkamam dedicated to Lord Ganesh nearby.
The local river namely Manik Ganga or Manika Gangai functions as a place of ablution where a sacred bath is taken to remove ones sins.
Pre Hindu and Buddhist originsThe deity at Kataragama is indigenous and long-celebrated in Sri Lankan lore and legend, and originally resides on the top of mountain called Wædahiti Kanda (or hill of the indigenous Vedda people) just outside of the Kataragama town. Since ancient times an inseparable connection between the God and his domain has existed. At one time the local deity was identified with God Saman , a deity that was important to the Sinhalese people before their conversion to Buddhism.
Till today the indigenous Vedda people come to venerate at the temple complex from their forest abodes. As a link to the Vedda past the temple holds its annual festival, that celebrates the God’s courtship and marriage to a Vedda princess, in July to August.Secretive shrines outside the main temple complex is also used in sorcery and cursing by local Sinhalese
Temple of SyncretismKataragama is a multi-religious sacred city as it contains an Islamic Mosque within its temple complex as well.
In spite of the differences of caste and creed, all Sri Lankans show great reverence to God Kataragama. They honor him as a very powerful deity and beg divine help to overcome their personal problems or for success in business enterprises etc., with the fervent hope that their requests would be granted. They believe that God Kataragama actually exists and is vested with extraordinary power to assist those who ever appeal to him with faith and devotion in times of their distress or calamity."
[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Kataragama. -- Zugriff am 2006-05-11]
"Katirkamam also Kathirgamam and Katirgamam (Tamil கதிர்காமம்) is the name of the Hindu temple dedicated to lord Murukan in Sri Lanka. Today it has become primarily a Buddhist place of worship. Historic Roots
The temple dedicated by the Hindus in Kathirkamam has been a place of pilgrimage and religious sanctity since prehistoric times. At some point in history it came to be identified with Lord Murukan by devotees in Sri Lanka and South India. 1966 the German scholar Paul Wirz observed in his book Kataragama, the Holiest Place in Ceylon, "One could say that all religions are represented in Kataragama and that all are getting on well with each other. All ritual differences seem to be resolved out here; all are reconciled with each other and even the feeling of caste is completely forgotten."According to a Hinduism Today report that appeared in the magazine in 1986, twenty year later, rancor has replaced reconciliation at Sri Lanka's southernmost shrine. In recent years, however, religious, social, cultural and economic changes have left this lord Murukan sanctuary all but a Buddhist citadel. Few traces of the Hindu past in Kataragama remain.
Takeover of the templeOn a 1986 July visit to attend the Lord Murukan festival and investigate claims of a Buddhist takeover, Hinduism Today magazine editors found the sanctuary almost beyond recognition from earlier times. In each of its main sections Kataragama the Sacred Area, Sella Katirkamam and Katira Malai the most important sacred peak-one now sees Buddhist shrines, houses, shops and other business concerns. Not a single Pipil or bo-tree, not a Hindu temple under Buddhist control is spared the ubiquitous Buddhist flag.
The Work of 35 YearsThe move on Kataragama began shortly after Sri Lanka's independence in 1948, even before Mr. Wirz wrote his book. Sinhalese Buddhist politicians who dominated the country's legislative, aggressively maneuvered to transform it to a prominent place of Buddhist worship. After making the village motor able in 1950, Sinhalese were encouraged to settle there. Previously, pilgrimage was on foot through dense jungle tracks. The place covering the main Murukan Temple and the ruined Kiri Vihare was declared Kataragama Sacred Area. . Introducing the Development Scheme, the outskirts of the Murugan Temple were given a Buddhist outlook by demolishing all the 21 Hindu pilgrim abodes - like the 150-year old Chetty Madam - and shrines attached to each of them, like the Mutumani Amman Temple. This included removing shops crammed with puja offerings, rudraksha malas and vegetarian food and other Hindu business establishments such as barber stalls for pilgrims taking vows.
Under the same scheme, Kiri Vihare, about one third of a mile from the Murugan temple, was renovated and its environs, including lands formerly used by Hindus, were developed to facilitate Buddhist worship. In this way, the Hindus have been suppressed and their power and influence in the area reduced.
Out with the old, in with the newOn the land were demolition was effected, four new shrines, built according to Buddhist architecture, have come up. The Ramakrishna Mission Madam was taken over in 1960 by the Sirimavo Bandaranaike government, given to be used as bhikkus' quarters. More recently it has become a Buddhist Archaeological Museum, with a statue of Buddha at its entrance. Kavadi dance has become baila dance, in the past, Kavadi attam threw a bewitching spell of bhakti on on-lookers. But today the Western band music and the drumming provided for it gives pep for pop music." Puja offerings kept in an 'archanai thattu' for sale are similar to those at Buddhist temples. Paper garlands are kept instead of fresh flowers. The Hindu holy ash, kumkum, sandalwood paste and lime are not to be found.
The changing face of holy festivalsThose interested in projecting Kataragama as a Buddhist centre have capitalized on the colorful festival procession by introducing Buddhist features into it. On the day before the water-cutting ceremony, Lord Murugan goes to Sooran Kottai or Kiri Vihare to the Buddhists, the fortress of the Asura, to meet the mother of Soora Padman whom He vanquished in the Sooran Por. Now, a 'relic' is taken ceremoniously from the Buddhist temple (formerly Perumal Hindu Temple) in the inner courtyard of the Murugan Temple, placed on a caparisoned elephant and made to lead the procession.
With Buddhist monks, banners and torchbearers in the procession (in which there is a well-organized Buddhist cultural display of Kandyan dance of various forms) and the voice of 'Sadhu, Sadhu' reverberating from the vast Buddhist crowd - any foreign tourist or television viewer would feel that a Buddhist pageant is in progress!
The shortage of both local Hindus and Hindu pilgrims has adversely affected regular features of the festivals. In 1986 July, the absence of the traditional Aum Vadivela Varuga canopy held over Lord Murugan in the procession was conspicuous. It is normally carried by 12 of the pilgrims who walk long distances from the North and the East, covering more than 300 miles. Also absent were the groups of Hindu devotees who go dancing and singing the praises of Lord Murugan. A few elders who braved dangers to be present for the festival sang bhajans. The Ananda Nama Bhajan or chanting Aum Muruga mantra at the Palani Andavar Temple could not be continued throughout the night.
Muscling InEmboldened by the attitude of Buddhist dominated governments towards Hindu worship at Kataragama, exploiting the turmoil of the country and sensing the utter helplessness of the few Hindus who maintain Hindu interests in the sacred village, individuals with the sole aim of making money for themselves are bent on creating mischief to erode the rights of the Hindu Theivanai Amman Trust managed by 66-year-old Swami Dattaramagiri Bawa of the Swami Kalyanagiri succession. "Some Hindus will be surprised to hear that all temples in the village of Kataragama were managed by the successors of Kalyanagiri Swami some years ago," states an authoritative source.
An interested party forcibly took over the Kandasamy Temple at Katiramalai in June 1969. Prior to this, a Reverend Bhikku Siddhanta stayed there with the residing priest, Sankaraswamy, and learned Hindu mantras and puja practice from him. The bhikku demolished the Pillaiyar Temple at Pillaiyar Peak in 1970 and built a new shrine a few yards away from the old sacred spot. In 1971, the Theivanai Amman Devasthanam was looted and valuables taken. On September 26, 1979, the Manicka Pillaiyar Temple at Sella Katirkamam was taken over under threat. As late as 5th December, 1985, unruly elements intruded into the Theivanai Amman Devastanam and manhandled Swami Dattaramagiri Bawa, Nagalingam, a cashier in his seventies, and others who were there.
Temples under non-Hindu control have begun shedding established Hindu principles and practices also known as Agamic rituals. While puja goes on for Lord Ganesh at Sella Katargama, tickets are thrust on worshippers to collect money for a building fund.
In the past, the victory Vel or lance of Lord Murukan on a rock atop Katira Malai or hill was the only symbol of worship. When a pilgrim took the old route which is blocked now before, he prayed at the Vairavar Rock at the foot of the hill and at the Pillaiyar Rock half way before reaching the summit. The new path leads through a huge Buddhist structure at the entrance. The sacred Vel or lance lies buried under a concrete Sivalingam It was done to according to a divine order given in his dream to a local Buddhist monk
Ethnic WarRecurrent ethnic riots between Sri Lanka's Sinhalese Buddhist majority and Hindu Tamil minority which commenced in 1956 and exploded into the Black July 1983 holocaust have caused the prevailing turmoil in the country. The Tamils whose homeland is the North and the East are frightened to go to the South where Kataragama is situated
The flow of Hindus from other lands has also naturally dwindled, especially after one Dhanapathi, a Hindu pilgrim from India, was hacked to death at a barber salon in Kataragama in 1983. Those Tamils who lived there and in the neighborhood of the holy village have fled from their homes. There existed a Hindu village, Tanjai, about 10 miles off Kataragama, which had 2 temples and about 130 Tamil. This village has disappeared.
Hindu Appeal for Help at KatirkamamVishwa Hindu Parishad, Sri Lanka, appealed in his Presidential message: "It is the sacred duty of all Hindus to help the Swami of the Theivanai Amman Trust in their efforts to consolidate and strengthen the position of the Hindus in Kataragama. They are struggling against many difficulties and are trying their best to overcome many obstacles. Moral support alone is not sufficient. Financial assistance and aid in other forms should be made available to them. Prominent Hindus should place at their disposal their talents and skills. Wealthy Hindus should support them liberally. Hindu societies and organizations must come forward to encourage them."
[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Katirkamam_%28Hindu_temple%29. -- Zugriff am 2006-05-11]
2 Candanagāma
"Candanagāma A village in Rohana.
The nobles of the village took part in the festival of the arrival of the Bodhi-tree in Ceylon, and in the village one of the eight Bodhi-saplings was planted. Mhv.xix.54, 62; Sp.i.100; Mbv.161."
[Quelle: Malalasekera, G. P. <1899 - 1973>: Dictionary of Pāli proper names. -- Nachdruck der Ausgabe 1938. -- London : Pali Text Society, 1974. -- 2 vol. -- 1163, 1370 S. -- ISBN 0860132692. -- s. v.]
"Rohana. One of the three main provinces of early Ceylon comprising the south eastern part of the island, the Mahāvālukanadī forming its northern boundary. It was probably colonized by Rohana (3). The capital of the province was Mahāgāma. When the northern parts of the island were in the hands of foreigners or usurpers, the Singhalese court, its nobles and loyalists, often sought refuge in Rohana. It seems, for the most part, to have been very little controlled from the capital, and many rebellions against the ruler of the capital originated in Rohana. See Dutthagāmani and Vijayabāhu; also, e.g., Mhv.xxiii.13; xxxiii.37; xxxv.27f., 67, 125; Cv.xxxviii.12, 39; xli.89ff.; xliv.54; xlviii.59, etc.
In times of persecution and scarcity the Buddhist monks found patronage and shelter among the inhabitants of Rohana (E.g., Mhv.xxxvii.6). Even till about 600 A.C., Rohana was regarded as a separate kingdom, holding, or at least claiming to hold, an independent position beside Anurādhapura (See, e.g., Cv.xlv.41)."
[Quelle: Malalasekera, G. P. <1899 - 1973>: Dictionary of Pāli proper names. -- Nachdruck der Ausgabe 1938. -- London : Pali Text Society, 1974. -- 2 vol. -- 1163, 1370 S. -- ISBN 0860132692. -- s. v.]
3 Tivakka: siehe oben zu Vers37f.
4 Frucht
Abb.: Blatt mit Früchten von Ficus religiosa
[Bildquelle: http://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/html/starr_010820_0005_ficus_religiosa.htm. -- Zugriff am 2006-05-21]
57. Paṃsūnaṃ gandhamissānaṃ,
puṇṇe soṇṇakaṭāhake;
mahāāsanaṭhāne taṃ,
ṭhapite ropayissaro.
57. Der Herrscher pflanzte sie in einen goldenen Topf, der voll war von mit Geruchsstoffen vermischter Erde. und der dort stand, wo [jetzt] das Mahā-āsana ist.
58. Pekkhataṃ yeva sabbesaṃ,
uggantvā
aṭṭha aṅkurā;
jāyiṃsu bodhitaruṇā,
aṭṭhaṃsu catuhatthakā.
58. Während alle zuschauten wuchsen acht Sprosse heraus und wurden zu acht Hand großen Bodhibäumchen.
59. Rājā te bodhitaruṇe,
disvā
vimhitamānaso;
setacchattena pūjesi,
abhisekam adāsi ca.
59. Als der König diese Bodhibäumchen sah verehrte er sie verwundert mit einem weißen Schirm und weihte sie zu Königen.
60. Patiṭṭhāpesuṃ aṭṭhannaṃ,
Jambukolamhi
paṭṭane;
mahābodhiṭhitaṭhāne,
nāvāyorohane tadā.
61. Tivakkabrāhmaṇagāme,
Thūpārāme
tatheva ca;
Issarasamaṇārāme,
Paṭhame cetiyaṅgaṇe.
62. Cetiyapabbatārāme,
tathā Kājaragāmake;
Candanagāmake cāti,
ekekaṃ bodhilaṭṭhikaṃ.
60./61./62. Von den acht Bodhischößlingen pflanzte man
63. Sesā catupakkajātā,
dvattiṃsabodhilaṭṭhiyo;
samantā yojanaṭhāne,
vihāresu tahiṃ tahiṃ.
63. Die übrigen 32 Bodhischößlinge, die aus vier [weiteren] Früchten wuchsen, [pflanzte man] im Umkreis von einem Yojana [ca. 11 km] überall in den Klöstern.
64. Dīpāvāsījanass' evaṃ,
hitatthāya
patiṭṭhite;
mahābodhidumindamhi,
sammāsambuddhatejasā.
65. Anulā sā saparisā,
Saṅghamittāya
theriyā;
santike pabbajitvāna,
arahattam apāpuṇi.
64./65. Als nun zum Heil der Bewohner der Insel der Mahābodhibaum, der Herr der Bäume, durch die Kraft des vollkommenen Buddha gepflanzt worden war, wurden Anulā und ihr Gefolge Novizinnen bei der Therī Saṅghamittā und erreichten Arhantschaft.
66. Ariṭṭho so pañcasata-
parivāro ca
khattiyo;
therantike pabbajitvā,
arahattam apāpuṇi.
66. Der Fürst Ariṭṭha mit seinem 500 Gefolgsleuten trat beim Thera in den Orden ein und erreichte Arhantschaft.
67. Yāni
seṭṭhikulāna’ṭṭha-mahābodhimidhāharuṃ;
bodhāharakulānīti, tāni tena pavuccare.
67. Die acht Personen aus der Kaufmannsgilde, die den Mahābodhibaum hierher gebracht hatte, werden deswegen "Familien der Bodhibaumbringer" genannt.
68. Upāsikāvihāro ti,
ñāte
bhikkhuṇupassaye;
sasaṅghā Saṅghamittā sā,
mahātherī tahiṃ vasi.
68. Im Nonnenheim, das als Upāsikāvihāra bekannt ist, wohnte die große Therī Saṅghāmittā mit ihrem Sangha.
69. Agārattayapāmokkhe
agāre tattha
kārayi;
dvādase tesu ekasmiṃ,
mahāgāre ṭhapāpayi.
70. Mahābodhisametāya,
nāvāya
kūpayaṭṭhikaṃ;
ekasmiṃ piyam ekasmiṃ,
arittaṃ tehi te vidu.
69./70 Sie ließ dort 12 Gebäude errichten, von denen drei Gebäude herausragten:
Nach diesen [Gegenständen] sind diese [Gebäude] benannt.
71. Jāte aññanikāye pi,
agārā dvādasāpi
te;
Hatthāḷhakabhikkhuṇīhi,
vaḷañjayiṃsu sabbadā.
71. Auch als andere Nikāya's entstanden wurden diese zwölf Gebäude immer von den Hatthāḷhaka-Nonnen1 benutzt.
Kommentar:
1 Hatthāḷhaka-Nonnen: d.h. den Nonnen aus dem Elefantenpfosten-Kloster, s. das Folgende
"Hatthālhaka-vihāra A nunnery built by Devānampiyatissa for the use of Sanghamittā. It was called Hatthālhaka because it was built near the spot where the king's state elephant was fettered. Sanghamittā's following came to be called Hatthalhakā from living in the vihāra.
Later, they occupied also all the twelve buildings attached to the Upāsikā-vihāra, even when other sects arose (Mhv.xix.71, 83; xx.21f, 49). The vihāra was originally within the city wall of Anurādhapura; but later, when Kutikanna-Tissa and Vasabha raised the boundary wall, part of the vihāra grounds lay outside. The original boundary included the Kadambanadī. MT. 611."
[Quelle: Malalasekera, G. P. <1899 - 1973>: Dictionary of Pāli proper names. -- Nachdruck der Ausgabe 1938. -- London : Pali Text Society, 1974. -- 2 vol. -- 1163, 1370 S. -- ISBN 0860132692. -- s. v.]
72. Rañño maṅgalahatthī so,
vicaranto
yathāsukhaṃ;
purassa ekapassamhi,
kandarantamhi sītale.
73. Kadambapupphagumbante,
aṭṭhāsi
gocaraṃ caraṃ;
hatthiṃ tatth arataṃ ñatvā,
akaṃsu tattha āḷhakaṃ.
72./73. Der Glückselefant1 des Königs, der herumlief wie es ihm gefiel, machte bei seinem Weidegang auf der einen Seite der Stadt in einer kühlen Höhle, an der Grenze eines Kadambablumen2-Dickicht Halt. Da man wusste, dass es dem Elefanten dort gefiel, machte man ihm dort einen Elefantenpfahl3.
Kommentar:
1 Glückselefant: vermutlich ein "weißer" Elefant

Abb.: "Two Men on Sacred White Elephant, Bangkok, Thailand,
William Henry Jackson, photographer, 1895.
[Bildquelle: http://memory.loc.gov/ammem/today/jun24.html. -- Zugriff am 2006-05-18]
"Thailand In Thailand heißen die weiße Elefanten Chang Phueak (in Thai: ช้างเผือก), sie sind heilig und ein Symbol für königliche Macht. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts schmückte ein weißer Elefant die Flagge Thailands.
In dem alten siamesischen Text Traiphum Phra Ruang (Die Drei Welten von König Ruang) [ไตรภูมิกถา] steht geschrieben: „Der glorreiche König besitzt sieben Dinge: eine perfekte Ehefrau, einen fähigen Schatzmeister, einen weisen Minister, ein pfeilschnelles Pferd (genannt „Valahaka“), ein Rad des Gesetzes (genannt „Cakkaratana“) und einen wertvollen Edelstein um seine Aktionen zu leiten, außerdem den nobelsten der Weißen Elefanten.“
Chronisten haben bereits im Jahre 1471 erwähnt, dass König Boromatrailokanat [สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ] (er war zwischen 1448 und 1488 König des Reiches Ayutthaya [อยุธยา]) einen weißen Elefanten gefangen hat. Der portugiesische Jesuit Fernao Mendez Pinto hat uns von seinem Besuch 1554 in Siam überliefert, dass der Titel des Königs „Phra Chao Chang Phueak - Herr der Weißen Elefanten“ war. Am Ende des 19. Jahrhunderts schrieb der Amerikaner Frank Vincent einen Reisebericht mit dem Titel „Im Land der Weißen Elefanten“, danach war der Weiße Elefant überall bekannt als ein Wunder des Königreiches Siam.
Alle entdeckten weißen Elefanten werden nach dem Gesetz („The Elephant Maintenance Act“, 1921) dem König präsentiert (normalerweise in einer Zeremonie - sie werden nicht in Gefangenschaft genommen). Je mehr weiße Elefanten der König hat, desto größer ist sein Ansehen. Der aktuelle König Bhumibol Adulyadej [ภูมิพลอดุลยเดช] besitzt zehn.
Ein weißer Elefant in Thailand ist nicht zwangsweise ein Albino, jedoch muss er eine blasse Haut haben. Mögliche Kandidaten werden nach verschiedenen Kriterien bewertet, die in alten Texten festgeschrieben sind:
- Eine weiße oder rosa Färbung des Auges rund um die Hornhaut,
- Der Gaumen muss rosafarben und glatt sein,
- Eine charakteristische Hautfalte an den Schultern,
- Die Haut um die Stoßzähne hat die gleiche Farbe wie die unter den Schultern,
- Weiße oder rosa Genitalien,
- Weiße oder rosa Zehennägel,
- Die Nagelhaut muss heller sein, als die umgebende Haut,
- Das Haar ist von hellbrauner Farbe und durchscheinend, wenn gegen das Licht gehalten,
- Aus einem Haarfollikel wachsen zwei Haare,
- Die Schwanzhaare müssen besonders lang sein,
- Die Öffnung der Musth-Drüse hat eine hellere Farbe als bei gewöhnlichen Elefanten,
- Die allgemeine Körperfärbung ist ein „Kastanien-Grau“.
Elefanten die diesen Test bestehen werden in vier Kategorien eingeteilt und dann dem König angeboten. Manchmal werden Elefanten aus den niedrigen Kategorien zurückgewiesen.
Auf dem Gelände des Vimanmek Mansion (Das himmlische Palais) in Bangkok gibt es in der nordöstlichen Ecke an der Uthong Nai Road ein kleines aber feines Museum: The Royal Elephant National Museum. In zwei Häusern, in denen ursprünglich die weißen Elefanten des Königs im Grand Palace untergebracht waren, gibt es neben einem lebensgroßen Modell eines Elefanten zahlreiche Fotos und Kultgegenstände sowie Stoßzähne von verstorbenen Elefanten. Leider sind alle Beschreibungen nur in thailändischer Schrift.
Historische BedeutungIn der Vergangenheit wurden Elefanten, die schlecht abschnitten, als Geschenke an Freunde des Königs und Verbündete weitergegeben. Die Tiere brauchten sehr viel Pflege und weil sie heilig sind, durften sie nicht zur Arbeit benutzt werden. Deshalb waren sie eine hohe finanzielle Last für den Empfänger - nur der König und sehr Reiche konnten es sich leisten. Einer Geschichte zur Folge wurden weiße Elefanten manchmal an Feinde (meistens niederer Adel, welcher beim König in Ungnade gefallen war) verschenkt. Der unglückliche Empfänger musste für den Unterhalt des Tieres aufkommen und konnte keinen Profit aus dem Tier erwirtschaften, weil es nicht arbeiten durfte. Durch die Pflicht auf das Geschenk des Königs gut aufzupassen erlitt der Empfänger schwere finanzielle Einbußen bis hin zum Bankrott."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Elefant. -- Zugriff am 2006-05-18]
2 Kadambablumen: Nauclea bzw. Adina cordifolia
3 Elefantenpfahl: um ihn nachts daran anzubinden
74. Athekadivasaṃ hatthī,
na gaṇhi kabaḷāni so;
dīpappasādakaṃ theraṃ,
rājā so pucchi taṃmanaṃ.
74. Eines Tages nahm der Elefant keinen Bissen zu sich. Der König fragte den Thera, der die Insel bekehrt hatte, was der Elefant wolle.
75. Kadambapupphagumbasmiṃ,
thūpassa
karaṇaṃ karī;
icchatī ti mahāthero,
mahārājassa abravi.
75. Der große Thera sagte dem König, dass der Elefant wolle, dass im Kadambablumendickicht ein Stūpa errichtet werde.
76. Sadhātukaṃ tattha thūpaṃ,
thūpassa
gharam eva ca;
khippaṃ rājā akāresi,
niccaṃ janahite rato.
76. Immer auf das Heil des Volkes bedacht, ließ der König dort schnell einen Stūpa mit Reliquien sowie ein Stūpagebäude erbauen.
77. Saṅghamittā mahātherī,
suññāgārābhilāsinī;
ākiṇṇattā vihārassa,
vussamānassa tassa sā.
77. Die große Therī Sanghamittā wünschte sich ein leeres Gebäude, da das Kloster, in dem sie wohnte, überbelegt war.
78. Vuddhatthinī sāsanassa,
bhikkhunīnaṃ
hitāya ca;
bhikkhunupassayaṃ aññaṃ,
icchamānā vicakkhaṇā.
78. Bedacht auf das Wachstum der Religion und das Heil der Nonnen schaute sie sich nach einem anderen Nonnenheim um.
79. Gantvā cetiyagehaṃ taṃ,
pavivekasukhaṃ subhaṃ;
divāvihāraṃ kappesi,
vihārakusalāmalā.
79. Deshalb ging sie zum [genannten] schönen Stūpagebäude, das angenehm einsam lag, und die Reine, die klug war in der Wahl von Aufenthaltsorten, verbrachte dort den Tag.
80. Theriyā vandanatthāya,
rājā
bhikkhuṇupassayaṃ;
gantvā tattha gataṃ sutvā,
gantvā taṃ tattha vandiya.
81. Sammoditvā tāya saddhiṃ,
tatthāgamanakāraṇaṃ;
tassā ñatvā adhippāyaṃ,
adhippāyavidū vidū.
82. Samantā thūpagehassa,
rammaṃ
bhikkhuṇupassayaṃ;
Devānaṃpiyatisso so,
mahārājā akārayi.
80./81./82. Der König ging zum Nonnenheim, um die Therī zu begrüßen. Dort hörte er, dass sie gegangen sei. Er folgte ihr, begrüßte sie und tauschte mit ihr Höflichkeiten aus. Als er vom Wunsch hörte, der sie bewegt hatte dorthin zu gehen, da ließ der weise, der Wünsche kundige große König Devānampiyatissa um das Stūpagebäude herum ein liebliches Nonnenheim erbauen.
83. Hatthāḷhakasamīpamhi
kato
bhikkhuṇupassayo;
Hatthāḷhakavihāro ti,
vissuto āsi tena so.
83. Weil das Nonnenheim in der Nähe des Elefantenpfostens (Hatthālhaka) erbaut wurde, wurde es unter dem Namen Elefantenpfostenkloster (Hatthāḷhakavihāra) bekannt.
84. Sumittā Saṅghamittā sā,
mahātherī
mahāmati;
tasmiñ hi vāsaṃ kappesi,
ramme bhikkhuṇupassaye.
84. Die große Therī Sanghamittā, die freundliche Geistesgröße, ließ sich in diesem lieblichen Nonnenheim nieder.
85. Evaṃ Laṃkālokahitaṃ sāsanavuddhiṃ;
saṃsādhento esa mahābodhidumindo;
Laṃkādīpe rammamahāmeghavanasmiṃ,
aṭṭhā dīghaṃ kālam anekabbhutayutto
ti.
85. Der Mahābodhibaum, der Herrscher der Bäume, der mit vielerlei Wunderbarem verbunden ist, stand lange Zeit auf der Insel Lankā, im entzückenden Mahāmegha-Hain und bewirkte so Heil für die Leute auf Lankā, Wachstum der Religion.
Kommentar:
Versmaß:
Mattamayūram
(13 Silben; 4.9.; Schema: ma ta ya sa ga: vedair andhrair mtau yasagā Mattamayūram: Mattamayūra besteht aus ma ta ya sa ga mit Zäsur nach vier [Veden = 4] und 9 [Andhra?] Silben")ˉˉˉˉˉ˘˘ˉˉ˘˘ˉˉ
ˉˉˉˉˉ˘˘ˉˉ˘˘ˉˉ
ˉˉˉˉˉ˘˘ˉˉ˘˘ˉˉ
ˉˉˉˉˉ˘˘ˉˉ˘˘ˉˉ
Sujanappasādasaṃvegatthāya kate Mahāvaṃse
Bodhiāgamano nāma ekūnavīsatimo paricchedo.
Dies ist das neunzehnte Kapitel des Mahāvamsa, der zum Vertrauen und zur Erschütterung der guten Menschen verfasst wurde. Der Titel dieses Kapitels ist "Ankunft des Bodhi-Baums".
"Sri Lanka seemed gripped by madness last week as a series of violent attacks resulted in the slaughter of more than 200 people. The killings began when separatist guerrillas belonging to the country's predominantly Hindu Tamil minority hijacked a bus and headed for Anuradhapura, a city largely inhabited by Buddhist Sinhalese. As the guerrillas drove into the city's crowded main bus station, they opened fire with automatic weapons, killing about 100 men, women and children. Then they drove to the Sri Maha Bodhiya, a sacred Buddhist site, and fired indiscriminately into a crowd that included nuns and monks. The rebels continued on to Sri Lanka's northwest coast, attacking a police station and a game sanctuary on the way, and may have escaped by boat to India, where the Tamil Nadu state is home to 50 million Tamils. The macabre ride resulted in the massacre of 146 people. By attacking the Sri Maha Bodhiya, the site of a sacred 2,200-year-old bo tree said to have grown from a sapling of the tree under which Buddha found enlightenment, the guerrillas seemed almost eager to provoke retaliation. It did not take long. In the bloodiest strike, assailants boarded a ferry off the northern coast of Sri Lanka, near Jaffna, and hacked 39 Tamils to death with axes, swords and knives. The Sri Lankan navy has denied accusations that it was involved in the slaughter; the same day, police surprised Tamil rebels hiding in a cave in the Eastern province and killed 20 guerrillas. The week's death list was evidence of the growing struggle between the island's 2.6 million Tamils and its 11 million Sinhalese. Over the past two years Tamil guerrillas have stepped up their attacks on troops in an effort to force the government into granting them an independent homeland. The Tamils claim that in the 37 years since Sri Lanka achieved independence from Britain, their political rights have been gradually eroded by the Sinhalese majority. Last week's Tamil rampage through Anuradhapura was the guerrillas' first major attack on unarmed civilians. As the violence becomes more widespread, the country is growing increasingly angry at the government of President J.R. Jayawardene, who seems paralyzed by the rebel challenge. Indeed, at week's end Jayawardene, who is ) both the Defense Minister and the Commander in Chief of the armed forces, had not even visited the site of the Anuradhapura massacre." [Sri Lanka Tamil terror : blood flows at a Buddhist shrine. -- Time. -- 1985-05-27. -- S. 43.]
Zur Verehrung des Mahābodhi-Baums siehe:
Kapitel 19, Exkurs 1: Bodhi-Pūjā = Verehrung des Bodhibaums. -- URL: http://www.payer.de/mahavamsa/chronik19e1.htm
Zu Mahāvamsa, Kapitel 20: Mahinda's vollkommenes Erlöschen