

mailto: payer@payer.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - >: Kulturen von Arbeit und Kapital. -- Teil 1: Betriebs- und Unternehmenskulturen. -- 2. Auf individueller Ebene. -- 1. Voraussetzung: Individuelle Unterschiede. -- Fassung vom 2006-04-09. -- URL: http://www.payer.de/arbeitkapital/arbeitkapital01201.htm
Erstmals publiziert: 2005-11-08
Überarbeitungen: 2006-04-09 [Ergänzungen]; 2005-11-27 [Ergänzungen]; 2005-11-21 [Ergänzungen]
Anlass: Lehrveranstaltung an der Hochschule der Medien Stuttgart, Wintersemester 2005/06; Sommersemester 06
Copyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Verfassers.

Diese Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Länder und Kulturen von Tüpfli's Global Village Library
"Et se trouve autant de difference de nous à nous mesmes, que de nous à autruy. " "Es gibt genausoviel Unterschied zwischen uns und uns selbst wie zwischen uns und anderen." Michel de Montaigne (1533 - 1592), Essays, 1588. -- Livre II, chapitre 1

Abb.: Zum Image der Firma gehört Diversity
"At Chevron Phillips Chemical, we view diversity as more than just a country of origin, age, or race. Diversity is about the blending of experience levels, cultures, talents, competencies, differing perspectives, and decision-making styles. We embrace a culture that respects unique differences and recognizes the perspectives of all our employees.
We encourage global communication between our employees because the best solutions are developed when people from a variety of backgrounds come together to build upon each other’s knowledge. Much like the blending of high-quality ingredients makes a superior chemical product, blending the unique skills and talents of a diverse workforce creates a superior chemical company.
Diversity in all its possibilities is valued at Chevron Phillips Chemical.
It is fundamental to the quality of our products and services, and is crucial to our continued success."
[Quelle von Bild und Text: http://www.cpchem.com/enu/diversity.asp. -- Zugriff am 2005-09-06]
..." die enorme Variabilität der menschlichen Persönlichkeit. Deshalb lautet eine naheliegende, doch nur äußerst selten gestellte Frage der Persönlichkeitspsychologie: Warum sind nicht alle Menschen gleich? Warum gibt es überhaupt so große Persönlichkeitsunterschiede in jeder Kultur?"
..." hoffe ich doch, deutlich gemacht zu haben, dass ihre" [die Frage] "Beantwortung sowohl unser genetisches als auch unser kulturelles Erbe einbeziehen muss. Sie erfordert also biologische und kulturwissenschaftliche Überlegungen. Hierfür bietet sich das Konzept der genetisch-kulturellen Koevolution an, wie es z.B. von Durham (1991) entwickelt wurde. Danach hat sich im Verlauf der genetischen Evolution des Menschen eine Fähigkeit zur Weitergabe kulturellen Wissens vor allem durch sprachliche Kommunikation entwickelt, dessen Erwerb genetisch nicht prädisponiert ist"...
"Biologische und kulturelle Evolution beruhen auf dem erstmals von Darwin (1859) erkannten Zusammenspiel von Variation und Selektion."..."Genetische und kulturelle Evolution basieren beide auf einer hohen Variabilität der ausgelesenen Einheiten (Genome bzw. Kulturträger). Diese hohe Variabilität stellt so etwas wie ein Sicherheitsreservoir für das Überleben dar. Denn Gene bzw. kulturelle Inhalte sind nur den Umweltbedingungen ihrer evolutionären Vergangenheit gut angepasst; ändert sich die Umwelt, ändern sich die Anpassungsbedingungen. Je variabler Genome bzw. kulturelle Inhalte sind, desto höher ist die Chance, dass jedenfalls einige diese Umweltveränderungen überleben werden.
Aus dieser Sicht ist die hohe genetische Variabilität und die hohe Variabilität in den Meinungen, Überzeugungen und Werten innerhalb von Kulturen nicht etwa nur ein Ausdruck von Unvollkommenheit (Betriebsunfällen bei der Genreplikation oder Missverständnissen in der Kommunikation), sondern ein förderlicher Faktor für das langfristige Überleben. Leben beruht auf hoher genetischer Variabilität, menschliches Leben auf hoher genetischer und kultureller Variabilität. Das scheint mir der tiefere Grund für die hohe Variabilität der Persönlichkeit zu sein.
Nicht nur in westlichen Kulturen besteht aber eine starke Tendenz, nicht die vorhandene Vielfalt der Persönlichkeit, sondern ein einseitiges Persönlichkeitsideal als erstrebenswert anzusehen. Ob »gottesfürchtig«, »nordisch«, »allseits entwickelte sozialistische Persönlichkeit« oder »dynamischer Unternehmer« - die gerade vorherrschende Ideologie einer Kultur beinhaltet mit großer Regelmäßigkeit auch ein bestimmtes Persönlichkeitsideal.
Aus der Einsicht in die Vielfalt der Persönlichkeit und ihrer Notwendigkeit für das genetische und kulturelle Überleben erwächst dagegen die Forderung, gerade nicht einen bestimmten Persönlichkeitstyp anzustreben, sondern die Vielfalt der Persönlichkeit zu achten und zu bewahren. Nicht nur biologische Arten gilt es zu bewahren, sondern auch die Vielfalt der Persönlichkeitsvarianten innerhalb der Art Homo sapiens sapiens. Je stärker unser Wissen über die genetischen und Umweltbedingungen von Persönlichkeitseigenschaften und deren Wechselwirkungen zunimmt und damit auch die Eingriffsmöglichkeit in die Persönlichkeitsentwicklung, um so wichtiger wird es, diese Forderung zu einem ethischen Prinzip zu erheben:"[Quelle: Asendorpf, Jens <1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit. -- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S. 449. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Individuen mit ihren Unterschieden, ihrer Diversity, sind die Grundlage aller wirtschaftlichen Tätigkeiten und damit der Kulturen von Kapital und Arbeit. Asendorpf (s. oben) weist daraufhin, dass dieser Unterschied sowohl biologische als auch kulturelle Gründe hat. Der biologische Unterschied erklärt sich mit der Vielfalt der Gene und deren Evolution, während der kulturelle Unterschied - vereinfacht gesagt - sich durch sprachliche Kommunikation entwickelt. Asendorpf weist ferner daraufhin, wie wichtig es ist, solche Unterschiede als etwas Positives anzusehen und nicht - wie es manchmal eher die Tendenz ist, ein bestimmtes Menschenbild als Ideal anzunehmen und daran den Mitmenschen zu messen - oder die Menschen fremder Kulturen.
Da wir individuelle Unterschiede im Nahbereich unserer mitmenschlichen Beziehungen im Allgemeinen viel differenzierter wahrnehmen als in der meist äußerst verallgemeinernden Fernsicht ("DIE Chinesen"), ist es bei zunehmender Globalisierung von besonderer Wichtigkeit, ein Gespür für individuelle Unterschiede in der Nähe und in der Ferne zu entwickeln. Dieses Kapitel will dazu einige Anregungen bieten.
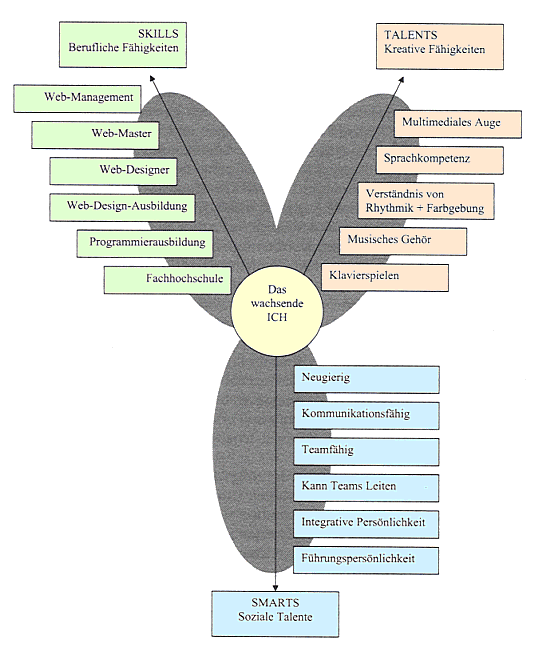
Abb.: Die Persönlichkeit als Portfolio
[Quelle der Abb.: Horx, Matthias <1955 - >: Smart capitalism : das Ende der Ausbeutung. -- Frankfurt am Main : Eichborn, 2001. -- 202 S. ; 23 cm. -- ISBN 3-8218-1664-3. -- S. 49. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Hat ein Arbeitssuchender vor sich zu bewerben und schaut sich die unendliche Anzahl von Internettexten zum Thema an, findet er jede Menge psychologischer Tests. Probiert man einige dieser Tests selbst aus, erfährt man, dass völlig unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Leider scheint es so zu sein, dass auch Arbeitgeber beliebige Tests heranziehen um Bewerber zu beurteilen.
Daher sollte die Warnung von Hofstätter und Tack bezüglich Tests sehr ernst genommen werden. Sehr wichtig ist weiterhin die Mahnung, dass auch gute Tests richtig ausgelegt werden müssen, d.h. man dazu Experten braucht:
"Die Forschung befindet sich auf diesem Gebiet noch durchaus im Fluss, und die Fragen, mit denen sie sich auseinanderzusetzen hat, werden häufig schon sehr bald ungemein schwierig. Aus diesem Grunde scheint der Hinweis geboten, dass die psychologische Diagnostik eine sehr sorgfältige fachliche Ausbildung verlangt. Das gilt übrigens auch in den Fällen, wo bereits wirklich brauchbare Tests konstruiert wurden. Sie zu geben, mag verhältnismäßig leicht sein; dieser Umstand aber sollte niemanden dazu verführen, als psychologischer Laie diagnostisch zu verfahren. Er würde dabei wahrscheinlich weit mehr Schaden als Nutzen stiften. Zu bedenken bleibt immer, dass es bei der Diagnostik um Menschenschicksale geht, in die wir durch richtige oder falsche Ratschläge — so oder so — eingreifen." [Quelle: Hofstätter, Peter Robert <1913 - 1994> ; Tack, Werner H.: Menschen im Betrieb : Zur Sendung Rädchen Im Getriebe. -- Stuttgart : Klett, 1967. -- 178 S. : Ill. ; 22 cm. -- S. 59]
Wenn alles, wie Gautama Buddha erkannte, unbeständig ist und es keine bleibende Seele gibt, muss man zurecht fragen, wie stabil Persönlichkeitsmerkmale sind. Dies ist keine nur theoretische Frage, sondern eine Frage größter praktischer Bedeutung: Wieweit kann ich aus dem Verhalten eines Menschen in Vergangenheit und Gegenwart auf sein Verhalten in der Zukunft schließen. Alle Prüfungen, Zeugnisse, Einstellungstests usw. setzen voraus, dass gegenwärtiges Verhalten aussagekräftig für zukünftiges Verhalten ist. Die lässt sich mit der Allgemeinen Veränderlichkeit Buddhas insofern vereinbaren, als diese allgemeine Veränderlichkeit ja nicht ein sprunghaftes, unberechenbares Phänomen ist, sondern den Regelmäßigkeiten eines Bedingungszusammenhangs unterliegen. Andernfalls wäre eine gezieltes Selbsttraining in Verhaltensänderung (Buddhas Trainingspunkte der Sittlichkeit) auch nicht möglich.
Peter R. Hofstätter widmet in
Hofstätter, Peter R. <1913 - >: Differentielle Psychologie. -- Stuttgart : Kröner, 1971. -- 434 S. : Ill. ; 18 cm.. -- (Kröners Taschenausgabe ; Bd. 403.). -- ISBN 3-520-40301-3
der Frage ob Persönlichkeitsmerkmale stabil sind, ob man also von so etwas wie einer bleibenden Persönlichkeit sprechen kann ein ganzes, sehr lesenswertes Kapitel (S. 106 - 133, hier ist nur der Anfang zitiert). Die Frage leitet er so ein:
"Die Stabilität von Merkmalen
Wir müssen noch einmal zu den Ereignissen in Mozarts Oper »Cosi fan tutte« zurückkehren, indem wir uns nach den Konsequenzen fragen, die von den beiden Liebhabern aus dem Resultat des Experimentes gezogen werden könnten. Die beiden jungen Damen haben sich bezüglich ihrer Liebeswahl als unbeständig erwiesen; aber eine weit verbreitete Redensart erlaubt uns, diesen einmaligen Befund zu ignorieren, denn »einmal ist keinmal«. Auf der anderen Seite bestünde auch die Möglichkeit, die Beobachtung im Sinne des Sprichwortes »wer einmal lügt, dem glaubt man nicht« als generell gültig aufzufassen. Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich jeder Versuch der Voraussage von Verhaltensweisen auf Grund einmaliger Feststellungen. Dabei scheinen wir in der Praxis so zu verfahren, dass wir unsere eigenen Wesenszüge und die Merkmale unserer Mitmenschen für ziemlich unveränderlich halten. Anderenfalls vermöchten wir ja einen uns bekannten Menschen nach längerer Trennung kaum wiederzuerkennen, wir wüssten dann auch nicht, was wir von ihm halten bzw. erwarten sollten. In einer Welt zu leben, auf deren Stabilität man sich nicht wenigstens einigermaßen verlassen kann, wäre unerträglich, und in einer solchen Welt müssten auch Messoperationen als durchaus sinnlos bezeichnet werden."[Quelle: Hofstätter, Peter R. <1913 - >: Differentielle Psychologie. -- Stuttgart : Kröner, 1971. -- 434 S. : Ill. ; 18 cm.. -- (Kröners Taschenausgabe ; Bd. 403.). -- ISBN 3-520-40301-3. -- S. 106f.]
Hofstätter vermutet, dass eine "Wahrscheinlich sehr wesentliche Voraussetzung für eine über die Zeit hinweg stabile Persönlichkeit ... eine ausreichende Übereinstimmung des Selbstbildes mit dem Wunschbild" ist (a.a.O., S. 115). Das würde bedeuten, dass vor allem Personen, die wenig Selbstkritik üben, langfristig gleich bleiben (die wenigen, die so vollkommen sind, dass es nichts zu verbessern gibt, kann man ruhig außer Acht lassen).
Die Ergebnisse seiner Darstellung fasst Hofstätter in folgender Graphik zusammen:
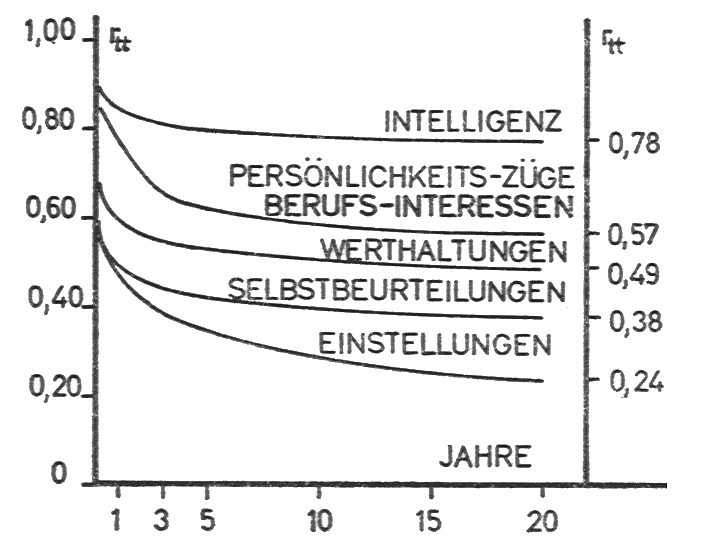
Abb.: Die Stabilität menschlicher Merkmale
[Bildquelle: Hofstätter, Peter R. <1913 - >: Differentielle Psychologie. -- Stuttgart : Kröner, 1971. -- 434 S. : Ill. ; 18 cm.. -- (Kröners Taschenausgabe ; Bd. 403.). -- ISBN 3-520-40301-3. -- S. 123.]
|
Ladwig geht von einem Diversity-Parameter mit fünf Parametern aus: Demografische Merkmale, Know-How und Erfahrungen, Wertesystem, Charakter Persönlichkeit und Sozialer Status. In der Wirklichkeit lassen sich aber diese Parameter nicht so schön trennen. So wird unter "demographische Merkmale" die Ausbildung angeben, dann aber ein eigener Punkt Know-How eingeführt. Das gilt wohl auch für den Unterpunkt Religion in A und dem Unterpunkt "Glauben/Überzeugung" in C.
"A. Demographische Merkmale, z. B.:
- Alter
- Geschlecht
- Religion
- Körperliche Konstitution (Körperliche und/oder geistige Behinderung, angeboren oder unfallbedingt etc.)
- Kultureller Hintergrund (Geburtsland, Rasse, familiäre Wurzeln, z.B. Bürgertum, Arbeiterklasse etc.)
- Ausbildung (Facharbeiter, Akademiker, Fachrichtungen: Ingenieur, Betriebswirt etc.)
- Familienstand (Single, gebunden, verheiratet, ohne Kinder, mit großen oder kleinen Kindern, mit pflegebedürftigen Familienmitgliedern, etc.)
B. Know-How und Erfahrungen, z. B.:
- aufgabenbezogenes Wissen
- Fähigkeiten aus unterschiedlichen Karrierewegen
- frühere Einsatzgebiete
- Berufserfahrungen
C. Wertesystem, z. B.:
- Werte
- Glauben/Überzeugung
- Geisteshaltung
D. Charakter/Persönlichkeit, z.B.:
- Verhalten
- Auftreten
- Ausstrahlung
- Arbeitsorganisation
E. Sozialer Status, z. B.:
- Rang
- Position/Hierarchie
- Macht/Autorität
- Netzwerkzugehörigkeit
- Meinungsführerschaft"
[Quelle: Désirée H. Ladwig <1964 - >. -- In: Führung von Mitarbeitern : Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement / hrsg. von Lutz von Rosenstiel ... -- 5., überarb. Aufl. -- Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2003. -- XX, 890 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN 3-7910-2060-9. -- S. 450. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
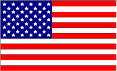
USA-spezifisch
In den USA bezieht sich Diversity vor allem auf
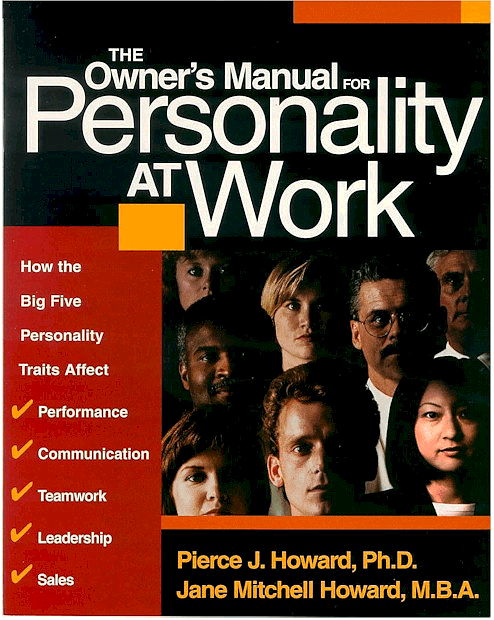
Abb.: Buchtitel
Die fünf großen Faktoren (The Big Five) beschreiben fünf unabhängige Dimensionen, aus denen sich ein wesentlicher Teil der in der Alltagspsychologie (Populärpsychologie) der englischen, deutschen und holländischen Sprache verwendeten Persönlichkeitseigenschaften reproduzieren lässt. Dazu wurden zunächst in Websters New International Dictionary (1925) diese Adjektive, Partizipien und Substantive herausgesucht, die Persönlichkeitsdispositionen bezeichneten. Diese Liste von 17953 Wörtern wurde stufenweise auf 339 Adjektive reduziert, die in 100 Gruppen klassifiziert wurden. Daraus konnte man durch Beurteilungsverfahren und Faktorenanalyse fünf Faktoren, die Big Five, gewinnen. Für den Vergleich mit anderen Sprachen haben sich davon die Big Three — Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit — als geeignet erwiesen. Fasst man weitere in der Alltagspsychologie verwendete Persönlichkeitsbereiche dazu, kommt man z.B. zu den Big Seven (= Big Five weniger Kultur plus Konventionalität, positive Valenz ("hervorragend"), negative Valenz ("bösartig"). Die Struktur der Big Seven wurde auch im Hebräischen und Spanischen gefunden.
Die 5 großen Faktoren der Persönlichkeit. (»The Big Five«):
Merkmalsdimension Inhalte Neurotizismus, Emotionale Unstabilität(neuroticism, emotional instability) Nervosität, Ängstlichkeit, Traurigkeit, Unsicherheit, Verlegenheit, Gesundheitssorgen, Neigung zu unrealistischen Ideen, geringe Bedürfniskontrolle, unangemessene Reaktionen auf Stress Extraversion
(extraversion, surgency)Geselligkeit, Aktivität, Gesprächigkeit, Personenorientierung, Herzlichkeit, Optimismus, Heiterkeit, Empfänglichkeit für Anregungen und Aufregungen Kultur. Offenheit für Erfahrung, Intellekt
(culture, openness to experience, intellect)Hohe Wertschätzung für neue Erfahrungen und Abwechslung, Wissbegierde, Kreativität, Phantasie, Unabhängigkeit im Urteil, vielfältige kulturelle Interessen, Interesse für öffentliche Ereignisse Liebenswürdigkeit, Verträglichkeit
(agreeableness)Altruismus, Mitgefühl, Verständnis, Wohlwollen, Vertrauen, Kooperativität, Nachgiebigkeit, starkes Harmoniebedürfnis Gewissenhaftigkeit
(conscientiousness)Ordnungsliebe, Zuverlässigkeit, Anstrengungsbereitschaft, Pünktlichkeit,
Disziplin, Ehrgeiz
[Vorlagen für die Tabelle: Myers, David G. <1942 - >: Psychologie. -- Heidelberg : Springer, 2005. -- XX, 1029 S. : Ill., graph. Darst. ; 29 cm. -- (Springer-Lehrbuch). -- ISBN 3-540-21358-9. -- Originaltitel: Psychology (2004). -- S. 588. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen} ; Asendorpf, Jens <1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit. -- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S. 147. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Getestet wird auf die Big Five mit Fragebögen
Borkenau, Peter ; Ostendorf, Fritz: NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI) nach Costa und McCrae : Handanweisung. -- Göttingen [u.a.] : Hogrefe, Verlag für Psychologie, 1993. -- 32 S. ; 30 cm
Enthält nur 60 Items (Aussagen). Damit man sich eine Vorstellung machen kann, folgen ein paar Beispiele. Versucht man diese selbst zu beantworten, wird man - wie bei vielen solchen Aussagen - oft antworten wollen "wenn die Situation so oder ist, würde ich das ankreuzen". Z.B. die Aussage "Ich versuche zu jedem, dem ich begegne, freundlich zu sein" : am liebsten würde ich antworten "das hängt von meiner momentanen Verfassung ab".
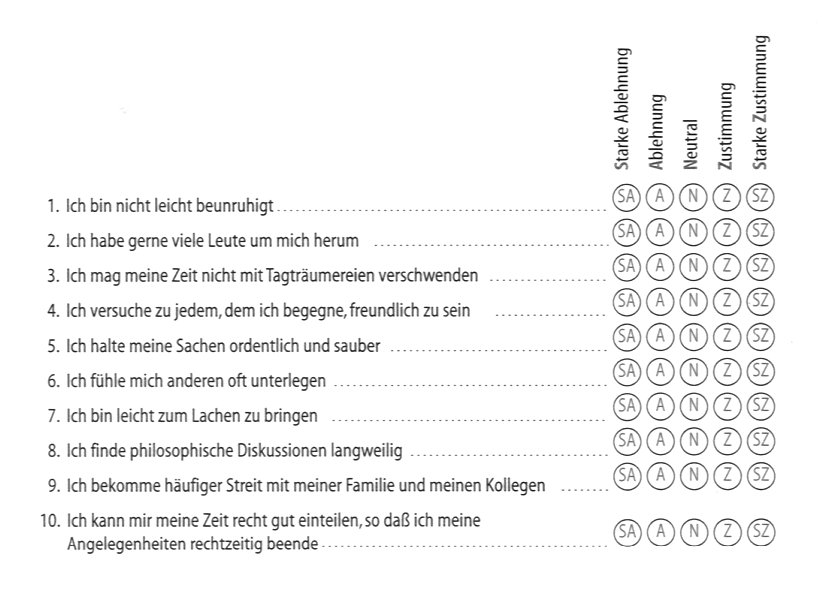
Abb.: Item 1 bis 10 aus NEO-FFI
[Quelle der Abb.:
Asendorpf, Jens
<1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit.
-- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004.
-- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S.
47. -- {Wenn Sie
HIER klicken, können Sie dieses Buch bei
amazon.de
bestellen}]
Costa, Paul T. ; McCrea, Robert R.: Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). -- Odessa, Fla. : Psychological Assessment Resources, ©1992. . -- VI, 101 S. : Ill. ; 28 cm.
In NEO PI-R werden für jeden der fünf Faktoren sechs Unterfaktoren
(Facetten) unterschieden, die jeweils durch eine Skala aus acht Items
(Aussagen) erhoben werden. Insgesamt muss also zu 240 Aussagen Stellung
genommen werden.
| Big Five/Facetten | Englische Bezeichnungen |
|---|---|
Neurotizismus
|
Neuroticism
|
Extraversion
|
Extraversion
|
Offenheit für Erfahrungen
|
Openness to Experience
|
Verträglichkeit
|
Agreeableness
|
Gewissenhaftigkeit
|
Conscientiousness
|
| [Quelle: Asendorpf, Jens <1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit. -- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S. 149. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}] | |
Eine modifizierte Form des Tests online:
http://de.outofservice.com/bigfive/. -- Zugriff am 2005-09-06
Zur Kritik an auf dem Sprachgebrauch des Alltags beruhenden Persönlichkeitsmodellen (lexikalischer Ansatz), zu denen die Big Five gehören, bringt Asendorpf einen überzeugenden Vergleich aus dem Mittelalter:
"Kritik des lexikalischen Ansatzes - eine Parabel
Die Faktoren alltagspsychologischer Eigenschaften werden oft mit »Elementen der Persönlichkeit« verglichen. Dass dieser Vergleich hinkt, mag die folgende Parabel zeigen (Asendorpf, 1991): Bekanntlich waren die Alchemisten im Mittelalter auf der Suche nach einer Formel, die es ihnen ermöglichte, Gold künstlich herzustellen. Annahme war, dass Gold kein Element ist, also ein nicht weiter analysierbarer Stoff, sondern sich aus anderen Elementen synthetisieren ließe (wie wir heute wissen, war das eine falsche Annahme). Die Strategie der Alchemisten war: Klassifiziere Stoffe nach ihren Eigenschaften, finde Grundeigenschaften heraus und reduziere so die Möglichkeiten der Stoffkombinationen bei den Syntheseversuchen auf ein praktikables Minimum. Man stelle sich nun vor, Alchemisten hätten auf den Märkten an lesekundige Kundschaft Fragebögen verteilt, worin jeweils ein Stoff auf Eigenschaften wie hart-weich, leicht-schwer oder glänzend-stumpf einzuschätzen gewesen wäre. Hätten die Alchemisten die chemischen Elemente durch Faktorenanalysen dieser Fragebogenantworten des Marktpublikums herausgefunden? Verrückt nach Gold, wie die Alchemisten waren, hätten sie es sicher jedenfalls versucht; ihr ausgeprägter Sinn für Zahlenmystik hätte diesen Versuch nur gefördert. So verblendet, dass sie die Faktoren von Eigenschaftsbeschreibungen für chemische Elemente gehalten hätten, wären aber wohl nicht einmal Alchemisten gewesen. Was die Faktorenanalytiker unter den Alchemisten herausgefunden hätten, wären bestimmte, sinnlich leicht wahrnehmbare Oberflächeneigenschaften von Stoffen, an denen sich die Alltagschemie ihres Marktpublikums orientierte. Das Periodensystem der Elemente wäre so nie entdeckt worden."[Quelle: Asendorpf, Jens <1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit. -- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S. 151. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Für unser Thema ist es sehr wichtig, zu untersuchen, wie das Leistungsverhalten der Mitarbeiter und vor allem der zukünftigen Mitarbeiter überprüft oder eingeschätzt werden können. Ein Arbeitgeber, der einen Bewerber aussucht, wäre erleichtert, hätte er eindeutige Hinweise auf das Leistungsverhalten eines Bewerbers.
Ansfried B. Weinert nennt sieben Schlüsseldimensionen, die als starke Indikatoren des Leistungsverhaltens eingestuft werden können:
Locus of Control: "der Grad zu dem eine Person der Meinung ist, dass sie Herr ihres eigenen Schicksals ist."
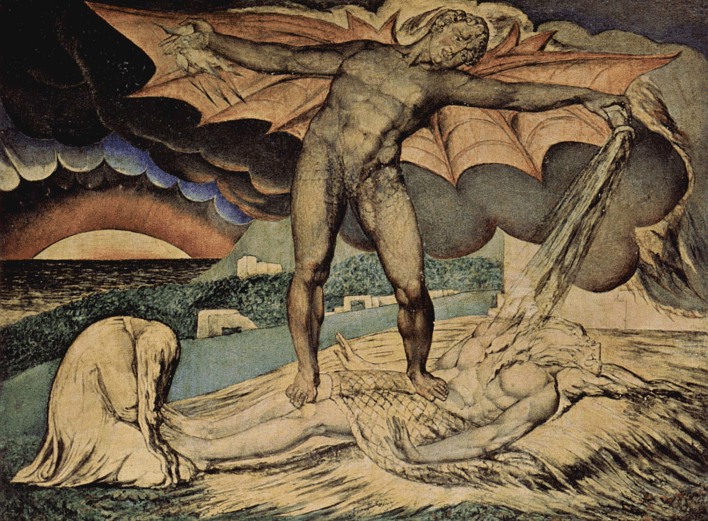
Abb.: "Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen; / gelobt
sei der Name des Herrn". -- Hiob, das Musterbild aller gottergebenen
Dulder. -- Gemälde von William Blake (1757 - 1827): Satan schüttet
die Plagen über Hiob aus (Hiob 1, 13–19). -- 1826–1827
Selbstwertschätzung (Self-Esteem): "bezieht sich auf die an sich selbst wahrgenommene Kompetenz und auf [das] Selbstbild."
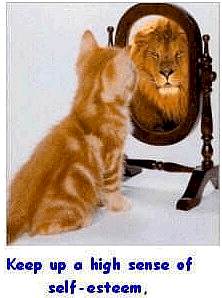
Abb.: Selbstwertschätzung kann auch Selbstüberschätzung sein
[Bildquelle:
http://www.forsythpets.com/adptcats.htm. -- Zugriff am 2005-09-06]
Selbstwirksamkeit (Self-Efficacy): "bezieht sich auf die Meinung der Person darüber, dass sie fähig ist, eine Aufgabe erfolgreich zu erledigen (= ihr gewachsen sein)."

Abb.: Arnold Alois Schwarzenegger (1947 - ), Governor of California ist ein
Muster an Self-Efficacy ("I consider myself an expert in looking into a
particular idea or goal and then going after it without anything else in
mind... It's always the same kind of thing. You pick a goal, and then you
just go after it, accomplish it, and get satisfaction out of that." )
[Bildquelle:
http://www.photos.gov.ca.gov/essay105.html. -- Zugriff am 2005-11-07]
Selbststeuerung (Self-Monitoring): "bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, das eigene Verhalten äußeren Situationsfaktoren anpassen zu können." (Anpassungsfähigkeit)
Kognitiver Stil: "bezieht sich auf die Art und Weise, wie Personen Informationen verarbeiten, auswerten, verwerten und organisieren, um basierend auf ihrer Einschätzung der Situation zu Urteilen und zu Schlussfolgerungen zu kommen."
Risikoverhalten (Risikofreudigkeit)

Abb.: Buchtitel
Typ A bzw. Typ B: "Eine Person vom Typ A ist getrieben vom Erfolgs- und Konkurrenzstreben, von Eile und Aggressivität. Eine Person vom Typ B ist ausgeglichener, entspannt und umgänglich."
[Quelle der Zitate: Weinert, Ansfried B.: Organisationspsychologie : ein Lehrbuch. -- 4., vollst. überarb. und erw. Aufl. -- Weinheim : PsychologieVerlagsUnion, 1998. -- XVIII, 823 S. : graph. Darst. ; 24 cm. -- ISBN 3-621-27399-9. -- S. 106 - 113. -- Der Verfasser ist seit 1982 Professor für Personalwesen, Organisationsforschung und Organisations-/Personalpsychologie an der Universität der Bundeswehr Hamburg.]
Nebenbei bemerkt (die Erfahrungen, von denen Schneider im Folgenden berichtet, hat sicher jeder, der sich mit Klausuren, Hausarbeiten usw. beschäftigt, schon gemacht):
"Selig sind die geistig Armen / von Reto U. Schneider
Haben Sie sich auch schon über Leute gewundert, die an Singwettbewerben teilnehmen, obwohl sie überhaupt nicht singen können? Oder die Witze erzählen, die niemand lustig findet?
Der Versuch, das Phänomen der verzerrten Wahrnehmung der eigenen Leistung zu untersuchen, führte zur Arbeit «Unfähig und sich dessen nicht bewusst: Wie Schwierigkeiten bei der Einschätzung der eigenen Kompetenz zu einer übersteigerten Selbsteinschätzung führen» (Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 77, S. 1121-1134).
Die Forscher ließen Studenten Fragebogen zu Themen wie Humor, Grammatik oder Logik ausfüllen. Nach dem Test mussten sie angeben, wie gut sie im Vergleich zu den anderen Studenten abgeschnitten zu haben glaubten.
Das fatale Resultat: Je schlechter das Testresultat, desto stärker die Selbstüberschätzung. In allen Tests glaubte der schlechteste Viertel der Studenten, weit über dem Durchschnitt zu liegen. Selbst als man ihnen später die unkorrigierten Testbogen der besten Versuchsteilnehmer zur Ansicht gab, blieben sie bei ihrer übersteigerten Selbsteinschätzung.
Diesem Problem, so die Autoren, sei kaum beizukommen, denn die Fähigkeiten, die den Studenten im Test fehlten, waren dieselben, die sie gebraucht hätten, um sich richtig einzuschätzen. Mitleid mit den Einfaltspinseln dieser Welt ist also fehl am Platz: Sie mögen zwar bedauerliche Fehler machen, doch ihre Inkompetenz nimmt ihnen immerhin die Fähigkeit, etwas davon zu merken."
[Quelle: NZZ Folio : Die Zeitschrift der Neuen Zürcher Zeitung. -- ISSN 1420-5262. -- September 2005. -- S. 17.]
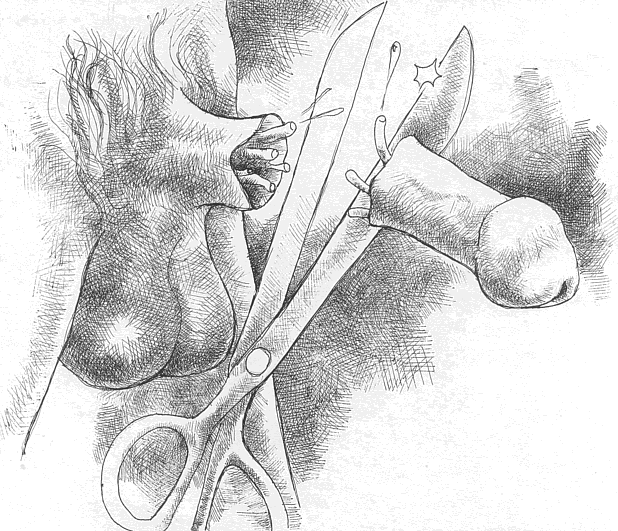
Abb.: Ohne Worte
[Bildquelle:
http://web.mit.edu/justice/www/cartoons.html. -- Zugriff am 2005-09-14]
"Die männliche Rolle scheint in einer Gesellschaft unseren Typus vor allem darum leichter zu sein, weil ein Weniger an Aktivität dem Mann viel eher konzediert wird als der Frau ein Mehr." Hofstätter, Peter R. <1913 - >: Differentielle Psychologie. -- Stuttgart : Kröner, 1971. -- 434 S. : Ill. ; 18 cm.. -- (Kröners Taschenausgabe ; Bd. 403.). -- ISBN 3-520-40301-3. -- S. 294.
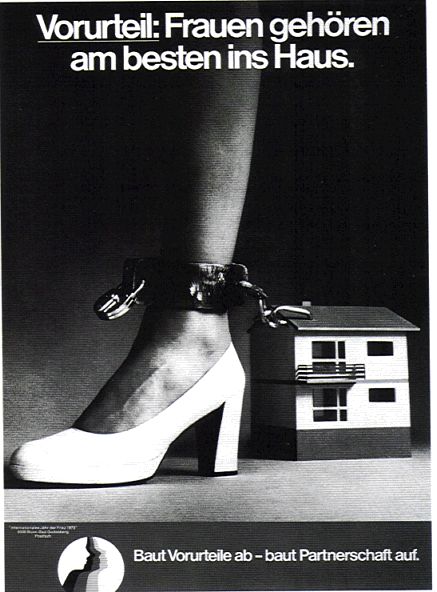
Abb.: Plakat des Komitees "Internationales Jahr der Frau", 1975
Dass Frauen es schwerer haben in der Arbeitswelt ist eine allgemeine Erfahrung. Untersucht man die Vorstellungen, die man sich über Frauen macht, genauer, ist das Bild allerdings sehr viel differenzierter. Vergleicht man verschiedene Kulturen zur Frage, ist das Bild noch unterschiedlicher, s. die Zitate zu Geschlechtsstereotypen und zu Geschlechtsrollen:
"Geschlechtsstereotype im Kulturvergleich
Williams und Best (1982) ließen in 30 Ländern insgesamt 2800 Studenten beiderlei Geschlechts 300 Eigenschaftsworte daraufhin beurteilen, ob das jeweilige Wort in ihrer Kultur »häufiger mit Männern oder häufiger mit Frauen assoziiert wird« (die 300 Worte wurden dazu in die jeweiligen Sprachen übersetzt und die Übersetzung durch Rückübersetzung kontrolliert). Ein Wort wurde als Beschreibung eines Geschlechtsstereotyps betrachtet, wenn mindestens zwei Drittel der Befragten das Wort demselben Geschlecht zuordneten (Tabelle). Eine Faktorenanalyse aller Geschlechtsstereotype ergab drei Faktoren: soziale Bewertung, Aktivität und Stärke. Die interkulturelle Analyse der Faktorenwerte zeigte, dass die männlichen Stereotype in allen Kulturen höhere Aktivitäts- und Stärkewerte erhielten als die weiblichen (der seltene Fall nichtüberlappender Verteilungen). Im Mittel über alle Kulturen gab es keinen signifikanten Unterschied in der sozialen Bewertung zwischen männlichem und weiblichem Stereotyp. Dies widerspricht der verbreiteten Meinung, Frauen seien schon vom Geschlechtsstereotyp her generell benachteiligt. Darüber hinaus ergaben sich aber durchaus deutliche Unterschiede zwischen den Kulturen in der sozialen Bewertung des männlichen bzw. weiblichen Stereotyps. Das männliche Stereotyp war besonders erwünscht in Japan, Nigeria und Südafrika; das weibliche Stereotyp war besonders erwünscht in Italien und Peru.
Aufstellung derjenigen Worte, die in mindestens 90% der Kulturen
ein Geschlechtsstereotyp beschreiben. (Nach Williams & Best, 1982)Typisch männlich Typisch weiblich active aktiv affectionate herzlich adventurous abenteuerlich attractive attraktiv aggressive aggressiv dependent abhängig autocratic selbstherrlich dreamy träumerisch courageous mutig emotional emotional daring wagemutig fearful furchtsam dominant dominant sensitive sensibel enterprising unternehmungslustig sentimental gefühlsbetont forceful kraftvoll softhearted weichherzig independent unabhängig submissive unterwürfig progressive progressiv superstitious abergläubisch robust robust weak schwach severe hart stern streng strong stark unemotional unemotional wise weise "
[Quelle: Asendorpf, Jens <1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit. -- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S. 396. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Geschlechtsrollenideologie im Kulturvergleich
Williams und Best (1990) ließen in 14 Ländern insgesamt 1 563 Studenten beiderlei Geschlechts die Sex Role Ideology Scale von Kaiin und Tilby (1978) ausfüllen. Diese Skala erhebt auf einer Zustimmungsskala (1-7) ein »traditionelles« Geschlechtsrollenverständnis (Beispiel: »Die erste Pflicht einer jungen Frau ist es, zu Hause bei den Kindern zu sein«) und ein »egalitäres« Geschlechtsrollenverständnis (Beispiel: »Heirat sollte die Berufskarriere der Frau genausowenig stören wie die des Mannes«); die Antworten zum traditionellen Verständnis wurden umgepolt, so dass hohe Werte immer ein egalitäres Verständnis bedeuten (Tabelle).
Mittelwerte von Frauen und Männern, geordnet nach den Mittelwerten der Länder. (Nach Williams & Best, 1990) Land Frauen Männer Niederlande 5,72 5,47 »egalitärer« Westdeutschland 5,62 5,35 Finnland 5,69 5,30 England 5,15 4,73 Italien 4,90 4,54 Venezuela 4,90 USA 4,66 4,05 Kanada 4,54 4,09 Singapur 4,39 3,61 Malaysia 4,01 4,05 Japan 4,01 3,70 Indien 3,88 3,81 Pakistan 3,30 3,34 Nigeria 3,39 3,11 »traditioneller« "
[Quelle: Asendorpf, Jens <1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit. -- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S. 397. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
DDR-bezüglich

Abb.: "Wer hilft uns, wenn Mutti arbeitet?". -- Plakat. -- DDR, 1959

BRD-bezüglich
Die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Leistung ist schon älter. Ulla Ralfs weist in ihrem (unten genannten Buch) darauf hin, dass auf dem Gründungskongress des Deutschen Gewerksschaftbundes 1949 ein getrennter Tagungsordnungspunkt eingeführt wurde, in dem über die Forderungen für erwerbstätige Frauen diskutiert wurde. Vor 1933 waren die Gewerkschaften weniger an der Frauenfrage interessiert und haben vor allem nach dem ersten Weltkrieg eher die These vertreten, dass die Frauen zurück ins Haus sollten. Aus diesen Erfahrungen heraus haben Frauen dann nach 1945 auf ihre Leistungen beim Wiederaufbau verwiesen und auf ihre Rechte gepocht. Speziell über die Schwierigkeiten der Frauen in der Gewerkschaftsarbeit berichtet Ralfs. Nach Ralfs haben sich die Gewerkschaftsfrauen beinahe selbst aufgegeben und haben die alte Frauenrolle als gegeben übernommen. Man lese die ausführliche Begründung von Ralfs. Trotzdem sind die Aussagen m.E. zumindest ausgesprochen einseitig: spricht man mit Betriebsrätinnen ergibt es sich ein anderes Bild. Diese sind sich sehr wohl bewußt, dass er um gleichen Lohn für gleiche Leistung geht, und man als Frau auf keinen Fall zurückstehen muss.
"Ulla Ralfs: "Gleicher Lohn für gleiche Leistungen" : Gewerkschaftsfrauen in den 50er Jahren
Die Aufbruchphase
[...] Auf allen Organisationsebenen des DGB, den örtlichen, bezirklichen und auf der Bundesebene, wurden Frauenreferate bzw. -abteilungen und Frauenausschüsse eingerichtet. In den Frauenausschüssen verständigten sich die aktiven Kolleginnen über ihre Forderungen, und die Frauenabteilungen unterstützten sie bei diesem Prozess, bzw. trugen die Belange und die Forderungen der Frauen in die übrige Organisationsarbeit hinein. Dieses Organisationsmodell übernahmen viele Einzelgewerkschaften des DGB, insbesondere solche mit hohen Frauenanteilen in der Gesamtmitgliedschaft: die Industriegewerkschaft (IG) Metall, die IG Chemie / Papier / Keramik, die IG Textil und Bekleidung, die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) und die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV). Voller Stolz konnten die aktiven Gewerkschafterinnen auf einen steigenden Organisationsgrad verweisen, der zu Beginn der 50er Jahre mit über 17 % in der Gesamtheit der Organisierten bei weitem den Organisationsgrad von Frauen in der Weimarer Republik übertraf. Damals - insbesondere Ende der 20er und zu Beginn der 30er Jahre - hatte der nämlich - trotz vergleichbarer Erwerbsquote - knapp über 10% betragen. In ihren zentralen Forderungen waren sich die Gewerkschaftsfrauen einig: Das Recht auf Erwerbsarbeit und der gleiche Lohn für gleiche Arbeiten und Leistungen sollten endlich durchgesetzt werden. Mit ihrer Arbeit in den Frauenausschüssen und den Abteilungen wollten sie innerhalb der gesamten Organisationen für diese Forderungen werben und streiten. Wenn diese Ziele erreicht seien - so die Gewerkschaftsfrauen - könnten sie getrost auf die Frauenausschüsse und -abteilungen verzichten.
Nun: Die Frauenreferate sind keine Provisorien geblieben. Sie existieren heute noch."[...]
Das Qualifikationsproblem
Zuerst einmal: Die Gewerkschafterinnen diskutierten kompetent und lebhaft auf ihren Konferenzen. Das belegen die Protokolle der ersten Frauenkonferenzen des DGB und seiner Einzelgewerkschaften. Die anwesenden Vorstandsmänner stellten immer wieder erstaunt die Qualität der Diskussionen, die rege Beteiligung und nicht zuletzt die Kompetenz der Frauen in der Beherrschung der komplizierten Konferenzmaschinerie fest. Die Frauen aber reagierten selber mit Unsicherheit. Wohl wissend, dass die Männer an ihren Kompetenzen und Fähigkeiten zweifeln, forderten sie von sich viel. Und so brachten sie eine wahre Antragsflut zur Qualifizierung weiblicher Funktionäre ein.
Das Dilemma einer solchen Frauenqualifizierungspolitik deutet sich schon an: Das hohe Durchschnittsalter der aktiven Funktionärinnen und die Tatsache, dass viele alleinstehend oder zumindest nicht mehr für die Versorgung kleiner Kinder zuständig waren, weist die gewerkschaftliche Frauenarbeit in den 50er Jahren als eine politische Arbeit aus, die eine große und zunehmend größer werdende Gruppe erwerbstätiger Frauen ausschloss: die Frauen mit kleinen Kindern. Für diese Frauen wurden die Barrieren für eine aktive Gewerkschaftsarbeit immer unüberwindbarer. Dem politischen Anspruch, die Interessen aller erwerbstätigen Frauen zu vertreten und eine eigenständige Interessenvertretung zu ermöglichen, standen die von den aktiven Gewerkschafterinnen nicht durchbrochenen Ausformungen der politischen Kultur in den Gewerkschaften gegenüber. Diese politische Kultur orientierte sich weiterhin an dem von allen Familienaufgaben befreiten männlichen Gewerkschafter, der seine ganze Kraft und Freizeit in die politische Arbeit einbringen konnte. Sie war ausgerichtet auf eine ehrenamtliche Feierabendtätigkeit und eine diesen Zeitstrukturen folgende hauptamtliche Tätigkeit. Sie war in ihren hierarchischen Strukturen außerdem von der Vorstellung geprägt, dass die Führung einer solchen Organisation nur von besonders bewährten Personen geleistet werden kann, und als bewährt galt, wer die zeitlich aufwendige »Ochsentour« durch die vielen Organisationsgremien gegangen war.
Das bedeutete, sich auf der betrieblichen Ebene im Betriebsrat, dem Vertrauenskörper oder der Gewerkschaftsgruppe zu bewähren und viel Kraft und Freizeit in diese Arbeit zu investieren. Das bedeutete, sich in verschiedene Organisationsgremien delegieren zu lassen, an Schulungen teilzunehmen, informelle Kontakte zu pflegen, den »Stammtisch« nach getaner Arbeit aufzusuchen, Feierabende und Wochenenden zu »opfern«. Das bedeutete, erst einmal hauptamtliche Tätigkeit, keine geregelte Arbeitszeit und Arbeitszeiten, die weit über dem gesellschaftlichen Durchschnitt lagen. Für die Frauen bedeutete das zusätzlich, sich überall mit dem Zweifel auseinanderzusetzen, den die Männer gegenüber den Kompetenzen und Führungsqualitäten der politisch aktiven Frauen anmeldeten.
Die Statistiken über die Beteiligung von Frauen auf den verschiedenen Funktionärsebenen bilden die Folgen dieser »Ochsentour« deutlich ab: Während die Frauen auf der betrieblichen und örtlichen Ebene entsprechend ihrer Mitgliedsstärke überall präsent waren, schwand ihre Zahl, je höher die Organisationsebenen angesiedelt waren. Unter den hauptamtlichen Funktionären wurde ihr Anteil zur unbedeutenden Größe. Selbst in der IG Textil und Bekleidung (Organisationsanteil der Frauen über 50%), war im Bundesvorstand immer nur eine Frau.
Kein Wunder, dass sich Selbstzweifel und Zweifel an den Qualifikationen von Frauen immer mehr einschleichen. Am Ende fordern die Funktionärinnen spezielle Bildungsangebote für Frauen mit der Begründung, dass diese überhaupt erst auf den Stand der männlichen Funktionäre gebracht werden müssten.
Vom Recht auf Arbeit zum besonderen Arbeitsschutz für Frauen
Bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die ersten Beamtinnen und weiblichen Angestellten aus dem Öffentlichen Dienst entlassen, um den heimkehrenden Männern die Arbeitsplätze zu räumen. Die staatlichen Instanzen beriefen sich dabei auf einen Paragraphen des Beamtengesetzes, den die Nazis 1937 in dieses Gesetz aufgenommen hatten und der lautete:
»Ein verheirateter, weiblicher Beamter ist zu entlassen, wenn er es beantragt oder wenn seine wirtschaftliche Versorgung nach der Höhe des Familieneinkommens gesichert erscheint. Die oberste Dienstbehörde entscheidet endgültig darüber, ob die wirtschaftliche Lage als gesichert erscheint . . . .«
Die Gewerkschaftsfrauen protestierten gegen eine solche Praxis. In ihrer Stellungnahme heißt es:
»Wir fordern, dass solche Versuche sofort unterbunden werden, denn der Grundsatz der Gleichberechtigung der Frauen, der von den Gewerkschaften vertreten wird, muss sich auch im Wirtschaftsleben unseres Volkes Geltung verschaffen. Die Tatsache, dass es in der Hauptsache Frauen waren, die das Wirtschaftsleben während des Krieges aufrechterhielten, muss insofern gewürdigt werden, dass heute nach dem Kriege jeder Frau das Recht auf Arbeit zugestanden wird.«
Hier geht es um ein Recht auf Erwerbsarbeit ohne Wenn und Aber: ein Recht, das unteilbar ist, also jeder Frau ohne Berücksichtigung ihres Familienstandes zugestanden und für sie eingeklagt wird. Erwerbsarbeit von Frauen erscheint in dieser Perspektive als notwendige Voraussetzung für deren Selbständigkeit und als Garant für eine von Männern unabhängige Lebensplanung von Frauen. Dieser positive Bezug zur weiblichen Erwerbsarbeit ist unmittelbar geprägt von eigenen Erfahrungen: Die Gewerkschaftsfrauen hatten in ihrer Lebensgeschichte erfahren, dass es ratsamer ist, sich auf die eigene Arbeits- und Versorgungfähigkeit als auf die der Männer zu verlassen.
Wenige Jahre später ist diese offensiv vertretene Forderung nach einem Recht auf Arbeit für alle Frauen einer defensiven Auffassung der Berufstätigkeit gewichen. In den Argumentationen geht es nunmehr um Not und Notlösungen und nicht mehr um selbstverständliche Rechte. Die Frauen - so heißt es in den gewerkschaftlichen Publikationen, und so sagen es die Gewerkschafterinnen selber - arbeiten nur, weil sie sich in aktueller wirtschaftlicher Not befinden: die vielen alleinstehenden, verwitweten, geschiedenen, ledigen Frauen, weil sie keinen Mann haben, der sie versorgt, und die verheirateten Frauen, weil sie einen Mann haben, der aufgrund der wirtschaftlichen Lage (noch) nicht genug verdient, um seine Familie, seine Frau zu ernähren. Mit Bedauern registrieren die Gewerkschaftsfrauen die Zunahme erwerbstätiger Mütter mit Kindern unter vierzehn Jahren. Mit Bedauern registrieren sie die Notwendigkeit weiblicher Erwerbstätigkeit schlechthin.
In Übereinstimmung mit dieser gewandelten Einstellung zur Berufstätigkeit fordern sie, körperliche Zusatzbelastungen von den erwerbstätigen Frauen fernzuhalten: Sie konzentrieren sich auf einen besonderen Arbeitsschutz für Frauen. Getreu dieser Grundstimmung nimmt es nicht
wunder, wenn die wenigen kritischen Stimmen ungehört bleiben, denen es im Zusammenhang mit der Lohnfrage nicht darum geht, dem Manne als Ernährer und Geldbringer der Familie erstmal einen ausreichenden Verdienst zu sichern, sondern um die Verbesserung der Lohnsituation von Frauen. Die Forderung »Gleicher Lohn für gleiche Leistung« kann bei dieser Grundhaltung nur noch passiv und verbal behauptet werden, aber sie wird nicht mehr mit Nachdruck in die tarifpolitischen Auseinandersetzungen der damaligen Zeit eingebracht.
Es ist in der Tat ein historisches Phänomen, dass gerade mit dem Anstieg der Frauenerwerbsquote und der Zunahme der Frauenbeschäftigung in der Mitte der 50er Jahre sich in den Köpfen aktiver Gewerkschafterinnen immer stärker die Vorstellung von der Bedeutungslosigkeit der Erwerbsarbeit und dem Vorrang der Haus- und Familienarbeit der Frauen durchsetzt. Und es ist ebenso interessant, dass darin nicht mehr ein gesellschaftlicher Zustand gesehen wird, der verändert werden kann und muss, eine Herausforderung, die Beziehung zwischen den Geschlechtern zu entwickeln und die Arbeitsteilung im kleinen und im großen neu anzugehen, sondern ein quasi naturhaft gegebener Zustand, der zwar durch geringe Veränderungen und Reformen erträglicher und leichter lebbar, aber nicht in seinen wesentlichen Grundzügen geändert werden kann. Indem die Gewerkschaftsfrauen die Erwerbsarbeit von Frauen als notwendiges Übel oder als Zuverdienst begreifen und die Haus- und Familienarbeit ja nicht als Arbeit, sondern als Aufgaben und Pflichten ansehen, die dem weiblichen Geschlecht qua biologischer Konstitution unentrinnbar aufgezwungen sind, tragen sie dazu bei, dass die tatsächlichen Arbeiten und Leistungen der Frauen unsichtbar werden können.
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit:
Aber was macht den Wert der Frauenarbeit aus?
Der Wandel in den Einstellungen lässt sich aber nicht nur im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit sondern auch im Hinblick auf das Problem der angemessenen Entlohnung feststellen. Auch in diesem Bereich spannt sich der Bogen von offensiv vorgetragenen Forderungen und Vorstellungen zu außerordentlich defensiven Argumentationsmustern.
Als sich die Gewerkschaftsfrauen vor dem Gründungskongress des DGB (1949) zusammen setzen und ihre Forderungen zur Gestaltung des Tarifwesens beraten, weisen sie alle tarifpolitischen Konzeptionen, die das Prinzip des »Soziallohnes« beinhalten, energisch zurück. »Soziallohn«: darunter wurde ein Lohnfindungssystem begriffen, das in der Weimarer Republik in seinem Kernbereich von den Unternehmern und den Gewerkschaften getragen und praktiziert, von den Nationalsozialisten nach der Zerschlagung der Gewerkschaften in den »lohnordnenden Maßnahmen« bruchlos fortgesetzt und von den Alliierten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges durch die Kontrollratsdirektiven nicht aufgehoben wurde. »Soziallohn«: das bedeutete, dass in jeder Lohngruppe Abschläge für weibliche Arbeitnehmer festgeschrieben wurden mit der Begründung: Der Mann ist der Ernährer der Familie, deshalb hat er einen Anspruch auf einen Familienlohn; die Frau ist nur für ihre eigene Versorgung zuständig; deshalb hat sie auch nur einen Anspruch auf einen Individuallohn... Die ersten Tarifverträge, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges abgeschlossen wurden, knüpfen an diese Tradition an und enthalten Abschläge für alle weiblichen Arbeitnehmer.
Die Gewerkschaftsfrauen unterstützen und fördern offensiv alle Initiativen von Frauen, gegen eine solche Praxis gerichtlich vorzugehen, um das Gleichberechtigungsgebot des Grundgesetzes auch im lohnpolitischen Bereich einzuklagen. Den ersten Prozess in Sachen Lohngleichheit konnte die Industriegewerkschaft Holz durch Revision beim Bundesarbeitsgericht (BAG) gewinnen. In diesem Verfahren ging es um Frauen, die als Hilfsarbeiterinnen bei einer kleinen Firma beschäftigt waren und nachweisbar die gleichen Tätigkeiten wie die als Hilfsarbeiter eingestellten Männer verrichten mussten. In seinem Urteil (1955) hatte der BAG den Frauen das Recht auf 92,- DM vorenthaltenen Lohn zugebilligt und zugleich wesentliche Teile aller damals geltenden Tarifverträge für verfassungswidrig erklärt. Damit war die Frage höchstrichterlich entschieden, dass Frauen bei gleicher Arbeit den gleichen Lohn wie Männer zu beanspruchen hatten. Der Tarifvertrag, um den es in diesem Prozess ging, sah eine Lohnabschlagsklausel für weibliche Arbeitnehmer vor, die zwischen 20 und 25 % der , vergleichbaren Männerlöhne betrug.
In seinem Urteilsspruch äußerte sich das BAG aber nicht nur zur Frage der Lohngleichheit bei gleichen und unmittelbar vergleichbaren Arbeiten: es befasste sich auch mit der Gleichwertigkeit von nicht vergleichbaren Tätigkeiten. Die Gleichwertigkeit spezifisch weiblicher Tätigkeiten - so das Gericht - dürfe nicht einseitig vom Arbeitgeber
festgelegt werden, weil damit die tatsächlichen Leistungen der Frauen unterbewertet würden. Vielmehr müsse die Gleichwertigkeit der Leistungen mit Hilfe arbeitswissenschaftlicher Methoden ermittelt werden.
Das Problem der Gleichwertigkeit weiblicher Tätigkeiten und Leistungen war in der Tat zum entscheidenden Konfliktfeld der Entlohnung von Frauen geworden: Mitte der 50er Jahre hatte sich ein Arbeitsmarkt entwickelt, der geschlechtsspezifisch polarisiert war. Die Tätigkeiten und Tätigkeitsfelder, in denen Frauen beschäftigt wurden, waren deutlich von den Berufszweigen der Männer abgegrenzt, der Arbeitsmarkt in seiner traditionellen Ordnung restauriert. Während in der Kriegswirtschaft und kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Frauen in solche Arbeitsbereiche eindrangen, die als typisch männliche galten, weil in ihnen körperlich schwere Arbeit verrichtet werden musste, änderte sich dieser Zustand vor allen Dingen nach der Währungsreform (1948) rasch. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten sich die Frauen in einigen Positionen halten: Sie arbeiteten als Bauarbeiterin, als Metallarbeiterin in qualifizierten Metallberufen und im Transport- und Verkehrsgewerbe. Aber als nach der Währungsreform die Männer verstärkt auf den Arbeitsmarkt drangen, konnten die Frauen ihre Positionen in den typischen Männerberufen nicht weiter ausbauen. Die in dieser Zeit einsetzenden Berufslenkungsmaßnahmen der Arbeitsämter unterstützen den Prozess der Restaurierung des geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktes: Umschulungsmaßnahmen für Männer zum Baufacharbeiter oder Bergmann sollten »Leichtarbeitsplätze« für Frauen freimachen.
Die Zunahme der Erwerbsarbeit von Frauen besonders seit der Mitte der 50er Jahre konzentriert sich dann auch auf typisch weibliche Tätigkeitsfelder: Die Frauen finden Arbeit im sozialen Bereich, im Dienstleistungsbereich: Sie arbeiten als Sekretärin, Bürogehilfin, Schreibkraft, Sozialarbeiterin, Kindergärtnerin, Krankenschwester. Und in der Industrie? Nun, da arbeiten sie als un- und angelernte Arbeiterinnen auf den »Leichtarbeitsplätzen«, also überall da, wo körperlich leichte Arbeit verrichtet werden muss.
Ja, und da geht es nun darum, die Gleichwertigkeit dieser Arbeiten festzustellen. Die Gewerkschafterinnen, die für die Verbesserung der Lohnsituation der Frauen eintreten, verlassen sich - wie das Bundesarbeitsgericht es empfiehlt - auf die Arbeitswissenschaften. Auf ihren Konferenzen räumen sie - in der Hoffnung auf gute Argumente - den Vertretern dieser Disziplin breiten Raum ein. Nicht selten können diese einen ganzen Konferenztag (bei insgesamt zwei Konferenztagen) für ihre Selbstdarstellung in Anspruch nehmen. In alle ihre Darstellungen gehen stereotype Vorstellungen von weiblicher und männlicher Wesensart ein. »Das weibliche Denken ist vergleichbar mit einer photographischen Platte, das männliche ähnelt der Tätigkeit eines Zeichners. Die photographische Platte ist empfangend, der Zeichner aktiv.« Deshalb muss der Frau am Arbeitsplatz alles vorgegeben und angeordnet werden. Sie ist zu selbsttätigen, selbständigen Leistungen nicht fähig.
»Hinsichtlich der psychologischen Differenzierung zwischen Mann und Frau besteht eine natürliche Unterlegenheit der Frau; beim Mann sind die Entschlusskraft, Logik, Kritik und der Formensinn deutlich ausgeprägt, er steht zu seinem Werkzeug, seiner Maschine, seinem Arbeitsprodukt in einem persönlichen, inneren Verhältnis und hat Freude am Technischen, Gestalten und Formen...
Bei der Frau überwiegen die unterbewussten Funktionen des Seelenlebens...
Es herrschen die Gemütsanteile vor, Geschmack, Farbsinn und Geschicklichkeit und die Feinheiten der Bewegung sind gut ausgebildet. ..«
Mit anderen Worten: Die Frau hat Gefühl, der Mann ist rational. Die Frau hat die Logik des Herzens, der Mann die Logik des Kopfes. Die Frau hat einen freilich treffsicheren Instinkt, der Mann denkt, um Probleme zu lösen. Sie empfängt, ist personengebunden, anschaulich und konkret, er ist sachlich, begrifflich, abstrakt. Sie liebt oder hasst Personen, er beherrscht die Technik.
Nun, die Arbeitswissenschaften sagen auch in den 50er Jahren wie bereits seit den 20er Jahren nichts anderes, als dass die Wesensart der Frau hundertprozentig ihren Tätigkeiten auf den »Leichtarbeitsplätzen« entspricht, wie umgekehrt die Männer ihrer Wesensart gemäß für andere Tätigkeiten disponiert sind. In diese arbeitswissenschaftliche Sichtweise ist aber nicht nur die Festschreibung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung eingeschlossen: Sie enthält auch mittelbar die Vorstellung von der Minderwertigkeit der beruflichen Tätigkeiten von Frauen. Wo so deutlich von Trieb, Instinkt und Unterordnung als Merkmal der Frauen im Verhältnis zu Triebbeherrschung, Gestaltung, Entschlusskraft und Wollen als Merkmal der Männer gesprochen wird, bleibt kein Raum für die Vorstellung der Gleichwertigkeit von Tätigkeiten.
Die Gewerkschaftsfrauen, sich auf die Arbeitswissenschaften verlassend, haben sich selbst verlassen. Was zählt bei so viel wissenschaftlichem Sachverstand die eigene Erfahrung, das Wissen um die Leistungen der Frauen beim Aufbau der Wirtschaft nach dem Krieg und die tatsächlichen, täglichen Leistungen in der Erwerbsarbeit und zu Hause? »Ich habe immer wieder den Eindruck«, sagt eine Gewerkschafterin im Anschluss an ein Referat einer arbeitswissenschaftlichen Koryphäe, »dass die Wissenschaft eigentlich nur um der Wissenschaft selbst willen da ist und dass lediglich diejenigen, die schlau genug sind, daraus Profit zu ziehen, das auch tatsächlich tun.«
Recht hat sie! Denn aus den arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen ziehen in der Tat nur die Schlauen, die Unternehmer, Profit, indem sie mit Hilfe solcher wissenschaftlicher Argumentationen die Rechtmäßigkeit von Leichtlohngruppen legitimieren. Aber solche Kritik bleibt vereinzelt: Die Vorstellung von der Unveränderbarkeit der Rollenteilung zwischen Frauen und Männern, von der wesensmäßigen Begründung dieser Arbeitsteilung hat im Denken der Gewerkschaftsfrauen bereits Platz ergriffen und die eigenen Erfahrungen überlagert.
Die Gewerkschaftsfrauen waren ihrer Zeit voraus, aber ihre Zeit holte sie ein.
1953 schreibt Irmgard Enderle in den Gewerkschaftlichen Monatsheften:
»Wenn sich die Frauen im öffentlichen Leben betätigen, stoßen sie sehr häufig - zumindest in Deutschland - mit dem persönlichen Ehrgeiz und Geltungsbedürfnis von Männern zusammen, mit dem sie nicht fertig werden. Viele Frauen ziehen sich deshalb wieder auf Tätigkeitsgebiete zurück, bei denen sie unter dieser Art >Konkurrenz< weniger zu leiden haben. Andere verhärten in solchen Auseinandersetzungen. Dann sind es aber gerade diejenigen, die daran mitschuldig sind, die ihre >verloren gegangene Weiblichkeit beklagen. Die Folge: Sehr zahlreiche Frauen der verschiedenen Lebenskreise leiden an Minderwertigkeitskomplexen, die sich, auch wo es vom sachlichen Können nicht notwendig wäre, in einer Scheu vor öffentlichen Auftritten oder in Arroganz äußern.«
Die so beschriebene Entwicklung von Frauen in der Nachkriegszeit gilt ohne Abstriche auch für die Gewerkschafterinnen: Sie waren angetreten mit der Hoffnung, endlich eine grundlegende Änderung in den Geschlechterbeziehungen durchsetzten zu können. Sie mischten sich mit ihren Forderungen selbstbewusst in die Öffentlichkeit und in die große Politik ein, mussten aber schnell erfahren, dass ihre Hoffnungen und ihr Wollen nicht nur nicht geteilt, sondern diskreditiert und begrenzt wurden. Das Recht auf Arbeit einklagend, wurden sie zuerst damit konfrontiert, dass in der Öffentlichkeit wieder die Rede vom »Doppelverdienertum« die Runde machte und mit dieser Parole Frauen in qualifizierten Positionen (Akademikerinnen, Lehrerinnen, Verwaltungsangestellte) aus dem Erwerbsleben verdrängt wurden.
Nach der Währungsreform, als die Frauen von der hohen Arbeitslosigkeit besonders betroffen waren, wurde die Parole vom Frauenüberschuss als Waffe gegen ihre Forderungen und ihr Recht auf Arbeit eingesetzt. Es hieß, dass die hohe Frauenarbeitslosigkeit schlichtweg darin begründet sei, dass die Frauen als Folge des Krieges keine Männer bekämen und allein deshalb auf den Arbeitsmarkt drängen würden. Und dann - als das Wirtschaftswunder begann -und die Frauen für die Konsumproduktion rekrutiert wurden, ihre Tätigkeit auf den »Leichtarbeitsplätzen« überhaupt erst das Wirtschaftswunder als Massenerfahrung möglich machte, da hatten die Wechselbäder der ideologischen Gegenoffensive die Gewerkschaftsfrauen schon so entmutigt, dass sie sich mit dem Bestehenden arrangierten und sich auf die ihnen zugewiesenen Bereiche beschränkten. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie in diesen Auseinandersetzungen nur wenig Unterstützung in ihrer eigenen Organisation, der Gewerkschaft fanden. Allzuoft mussten sie sich auch hier mit ähnlichen Vorurteilsstrukturen auseinandersetzen wie in der übrigen Öffentlichkeit.
Aber die Selbstbeschränkung, die sich zunehmend beobachten lässt, wird nicht nur passiv vollzogen. Sie wird zum Selbstverständnis und letztlich von den Gewerkschafterinnen aktiv in der Gewerkschaftsöffentlichkeit vertreten. Sie machen sich selber zum Herz der Aktion, zum Mittelpunkt des sozialen Geschehens. Mütterlichkeit und Internationalität der weiblichen Schöpfer- und Erhaltungskraft sind am Rande ihrer Konferenzen sentimentale und beschwörende Tendenzen zugleich. »Wenn die Männer sich totschlagen, ist die Frau immer bereit, es auszugleichen.«18 So zu lesen im Protokoll der 2. Bundesfrauenkonferenz des DGB 1955. In dieser Formulierung wird die Frau zur Verkörperung einer passiv leidenden, immerwährend das Beste aus einer Situation machenden Mutter stilisiert, die im Grunde als Opfer der Verhältnisse einen aussichtslosen Kampf ficht."[Quelle: Ulla Ralfs <1951 - >. -- In: Hart und zart : Frauenleben 1920 - 1970. -- Berlin : Elefanten Press, 1990. -- 492 S. : Ill. ; 28 cm. -- (EP ; 351). -- ISBN: 3-88520-351-0. -- S. 287 - 296.]
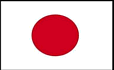
Japan-spezifisch
"Der japanisch-englische Begriff Office Lady, abgekürzt O.L. (japanisch: ōeru; Katakana: オーエル), bezeichnet eine weibliche Angestellte in einer japanischen Firma, die einfache Bürotätigkeiten ausübt und den männlichen Kollegen, (Sarariman) untergeordnet ist. Office Lady ist eine leicht abfällige Bezeichnung für Mitarbeiterinnen in Büros. In der populären Kultur (in Mangas, Animes und Filmen) werden die O.L. oft als von ihren beruflichen Tätigkeiten unterfordert und gelangweilt dargestellt.
HierarchieIn den japanischen Großraumbüros ist die Hierarchie klar zu erkennen. Die Office Lady sitzt hinter der Eingangstür, direkt am Eingangsbereich, die Besucher als Erste anspricht. Von da an steigt die Hierarchie stetig bis in die Tiefe des Raums.
Office Ladies erhalten nur ein geringes Gehalt und müssen aus diesem Grund auch oft bei ihren Eltern wohnen. Es wird von ihnen erwartet, dass sie mit ihrer Heirat oder dem Erreichen einer Altersgrenze von etwa 30 Jahren aus dem Betrieb ausscheiden.
Office Ladies müssen in vielen Unternehmen im Gegensatz zu den Männern uniformierte Kleidung tragen; sie servieren Tee, machen die Ablage; aber immer häufiger übernehmen die O.L. auch wichtigere Aufgaben.
Die Arbeitskräfteknappheit bei jungen Mitarbeitern führt aber inzwischen dazu, dass die jungen Kolleginnen nicht mehr automatisch Ende zwanzig aus dem Job gedrängt werden. Sie nehmen mittlerweile an Fortbildungsmaßnahmen teil und haben sich zur „Karriiru wuman" (career woman) [キャリアウーマン] gewandelt."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Office_Lady. -- Zugriff am 2005-11-10]
"Der japanische Begriff Sarariman (jap.: サラリーマン) ist ein Scheinanglizismus (salary man, von salary = Gehalt, man = Mann). Er bezeichnet den Büroangestellten in einer renommierten Firma. Früher war es das Ziel von Oberschülern und Studenten Sarariman in renommierten Unternehmen zu werden. Dies änderte sich mit der schrittweisen Auflösung der lebenslangen Beschäftigung.
Das weibliche Gegenstück zum Sarariman ist die OL (Office Lady = Bürodame), eine weibliche Angestellte, die meist weniger Befugnis als ihre männlichen Kollegen hat. Dies ändert sich jedoch: Frauen, die den selben Beruf wie ein Sarariman ausüben werden als キャリアウーマン (career woman) bezeichnet.
Scherzhaft spricht man von den „Drei Künsten“ des typischen Sarariman:
- Pachinko,
- Karaoke und
- Golf.
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Sarariman. -- Zugriff am 2005-11-10]

Abb.: Junges Verbrauchsmaterial? In vielen Produktionsstätten Asiens und
Lateinamerikas werden junge Frauen buchstäblich so lange ausgebeutet wie sie
noch jugendliche Kräfte haben, dann werden sie durch neue Kräfte ersetzt
(©MS Office)

Abb.: "Wir sind ein junges, dynamisches Team" (©MS
Office)
Liest man die üblichen Stellenanzeigen insbesondere in der IT-Wirtschaft, stößt man häufig auf die Angabe "Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team" mit der Angabe, dass das Höchstalter des Bewerbers 35 Jahre sein darf. Bei jungen Mitarbeitern wirkt sich das inzwischen so aus, dass man überzeugt ist, dass nur von einem solchen Team gute und interessante Arbeit geleistet werden kann. Man verdrängt, dass man selbst recht schnell über 35 sein wird.
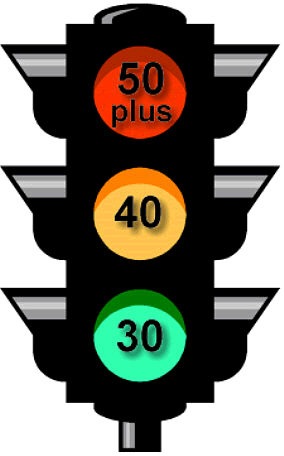
Abb.: Ageism im Turbokapitalismus
[Bildquelle:
http://www.brueckenhof-kassel.de/50plus/50plus.htm. -- Zugriff am
2005-09-14]
Der folgende Wikipedia-Artikel beschreibt eindrücklich die Probleme der sogenannten Alten. Man muss sich darüber klar sein, dass Menschen über 35 oder spätestens über 40 Jahren in Betrieben als alt angesehen werden: 41% der Betriebe in der BRD beschäftigen keine Mitarbeiter, die älter als 41 sind (vgl. das folgende Zitat). Man versucht diese Mitarbeiter auf verschiedenen Wegen loszuwerden. U.a. indem man Abfindungen anbieter, den Betrieb umorganisiert (um betreibsbedingte Kündigungen aussprechen zu können) oder Leute in eine Art Auffanggesellschaft steckt (vgl. später im Skript). Dass das ganze Wissen erfahrener Mitarbeiter verloren geht, wird in Kauf genommen.
Allerdings kann man jetzt hie und da in der Zeitung lesen, dass einige wenige Firmen sich allmählich der Problematik des Verzichts auf das Wissen bewußt werden (man vgl. regelmäßig die "Computerwoche" zum Thema).
"Der Ausdruck Altersdiskriminierung bezeichnet die soziale und ökonomische Benachteiligung von Personen aufgrund ihres Lebensalters. Die Betroffenen werden daran gehindert, in angemessener Weise am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. In der europäischen Charta der Menschenrechte ist das Verbot von Altersdiskriminierung enthalten.
Das Grundgesetz kennt kein ausdrückliches Diskriminierungsverbot wegen des Alters. Jedoch wird im allgemeinen Gleichheitssatz des Artikels 3, Absatz 1, generell die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz als Grundrecht festgeschrieben.
Trotzdem wird das Lebensalter hierzulande nicht als biologische, sondern als soziale Eigenschaft betrachtet, die über die Zuteilung von Chancen entscheidet. Das gilt für den Arbeitsmarkt, der Altersgrenzen von der Stellenausschreibung bis zur Weiterbildung, Beförderung und Entlassung etabliert hat. Das gilt ebenso für die Möglichkeit der Bürger, Waren und Dienstleistungen kaufen zu können. So wird das Alter beim Abschluss und der Prämienhöhe von Lebens-, Kranken- und Reiserücktrittsversicherungen eine wesentliche Rolle. Das Alter ist wichtiger Faktor bei der Vergabe von Krediten oder Hypotheken durch Geldinstitute.
Augenfällig ist die Tendenz der gesetzlichen Krankenversicherung - zumindest in Großbritannien, Altersgrenzen für bestimmte Behandlungen festzulegen, und dadurch bestimmte Altersgruppen von Behandlungen auszuschließen.
Auch in Pflege- und Altenheimen zeigt sich Altersdiskriminierung. Laut Bericht des Sozialverbands Deutschland, sterben in den Altenheimen in Deutschland mindestens 10.000 Menschen im Jahr vorzeitig aufgrund von Vernachlässigung und Mangelversorgung (teilweise an Unterernährung). (s. Süddeutsche Zeitung, 28.08.04, Seite 6, "Versorgungsnotstand in Altenheimen")
Inzwischen verlangt die EG-Richtlinie 2000/78/EG (sogenannte Rahmenrichtlinie) von den Mitgliedsstaaten die Umsetzung unter anderem des Verbots der Altersdiskriminierung. Diese muss spätestens bis zum 2. Dezember 2006 in deutsches Recht umgesetzt werden.
Ausgrenzung der Alten aus dem gesellschaftlichen LebenIns besondere wird die Furcht vor Altersdiskriminierung gespeist von der mit Plänen des Renten- und Sozialabbaus einhergehenden generellen Tendenz zur Privatisierung der persönlichen Lebensrisiken unter dem Aspekt einer ökonomischen Rationalität, der sich die Gesellschaft anzupassen hat. Statt dem Prinzip der Rücksichtnahme und der Solidarität gilt das Leistungsprinzip, das im Kern ein Selektionsprinzip ist. Die mit dem Alter verbundene verminderte Reaktionsfähigkeit und das höhere Krankheitsrisiko werden als Mangel und erhöhter Kostenfaktor betrachtet, für das der Betroffene zu zahlen hat, wenn er nicht ausgeschlossen bleiben will. Statt das Gemeinschaftsleben den Erfordernissen des Alters anzupassen, werden ältere Mitbürger ausgegrenzt und entmündigt. Nicht der Straßenverkehr stellt sich im Fahrverhalten auf die Älteren ein, sondern diese sollen den Führerschein abgeben. Nicht das Arbeitsleben wird altersgerecht umgestaltet, sondern Alte gelten auf dem Arbeitsmarkt als unvermittelbar. Sogar die Herstellung altersgerechter Produkte, etwa benutzerfreundlicher Tastaturen für Handys und andere elektronische Geräte, um sie für ältere Benutzer mit alterstypischer Sehschwäche handhabbar zu machen, wird zur Zeit von der Industrie noch weitgehend verweigert.
AgeismIn den angelsächsischen Ländern werden Vorurteile gegen eine Person aufgrund ihres Alters seit den 60er Jahren als Ageism diskutiert. Wenn diese Vorurteile (bias) zur Diskriminierung einer Person führen, spricht man von age discrimination.
HauptformenPrinzipiell kann sich die Diskriminierung aufgrund des Alters gegen jede Altersgruppe richten, aber gewöhnlich richtet sie sich hauptsächlich gegen zwei Gruppen:
Beispiele
- Jugendliche
- Alte Menschen
Ageism Ein Beispiel von ageism wäre die Vorstellung alle Teenager mögen Rockmusik, seien unreif und widerspenstig, benutzen Slang und eine aggressive Sprache und alle alten Menschen wären senil, schwach, langsam und abhängig.
Age discrimination
Die Diskriminierung von Berufstätigen aufgrund ihres Alters kommt in allen Branchen vor, ist aber in der Unterhaltungsindustrie und in der Computerindustrie besonders ausgeprägt. Viele ältere Schauspieler, Musiker, Drehbuchschreiber, Programmierer und Elektroingenieure haben sich darüber beklagt, daß sie trotz hervorragender Qualifikationen keine Arbeit finden können. Als 'älter' gelten in diesem Zusammenhang schon 40-Jährige.
Abb.: Im Arbeitsleben unbrauchbar? (©MS Office)In der Bundesrepublik Deutschland beschäftigen 41% der Betriebe keine Mitarbeiter, die älter als 41 Jahre sind. Die Erwerbsquote älterer Arbeitnehmer (55 bis 64 Jahre) beträgt lediglich 41,2% (nach dem 5. Altenbericht 2005.)
AntwortenGrass-roots Aktivismus
Viele Gruppen haben sich in verschiedenen Ländern gebildet, um gegen Altersdiskriminierung zu kämpfen. Dazu zählen:
- Deutschland
Deutschland-spezifisch
- Graue Panther
- Großbritannien
UK-spezifisch
- Age Concern
- Help the Aged
- USA
USA-spezifisch
- Americans for a Society Free from Age Restrictions
- Gray Panthers: In den frühen 1970er, gründete Maggie Kuhn die Gray Panthers, eine Organisation mit dem Ziel, alle Formen von Altersdiskriminierung zu beseitigen.
- Old Lesbians Organizing for Change (OLOC)
- National Youth Rights Association
Gewerkschaften
- weltweit: Weltaltenplan
In den USA haben zahlreiche Gewerkschaften den Kampf gegen Altersdiskriminierung aufgenommen. Ein prominentes Beispiel ist die Writers Guild of America West, eine Vereinigung von Drehbuchautoren, die seit 2002 in umfangreichen juristischen Auseinandersetzungen mit der Unterhaltungindustrie steht, um die Diskriminierung von Drehbuchautoren aufgrund ihres Alters zu beenden.
GesetzeIn den USA gibt es Gesetze gegen die Diskriminierung aufgrund des Alters.
USA-spezifischAltersdiskriminierung und andere Formen von Diskriminierung
- Age Discrimination in Employment Act
Altersdiskriminierung trifft nicht alle alte Menschen im gleichen Maße. Reiche und/oder mächtige Männer gelten auch im Alter noch als attraktiv, arme Alte haben kaum noch Chancen, etwas gegen ihre Armut zu tun."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Altersdiskriminierung. -- Zugriff am 2005-11-07]

Abb.: Plakat der Schweizerischen Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus,
2003
[Bildquelle:
http://www.gra.ch/ggra/ggra.html. -- Zugriff am 2005-09-14]
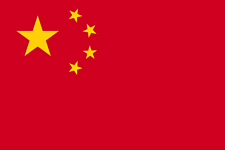
China-spezifisch
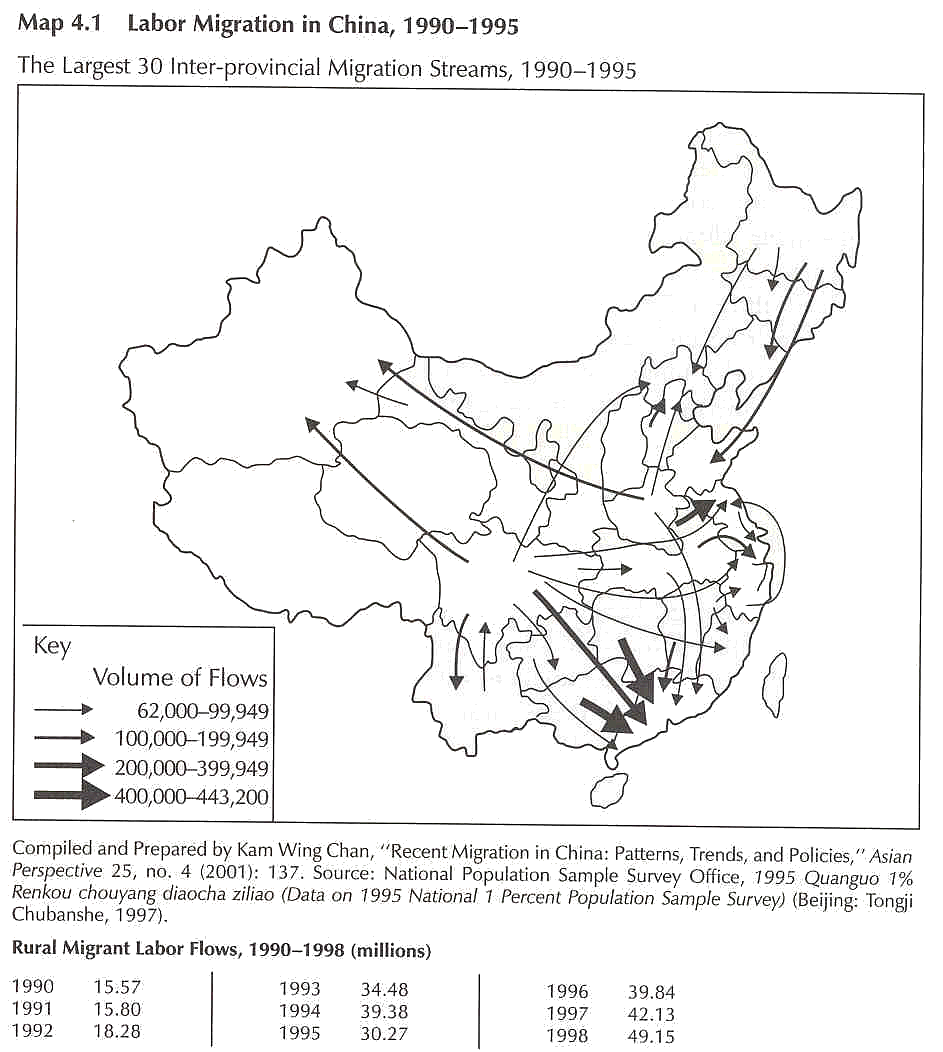
Abb.: Arbeitsmigration in China 1990 - 1995
[Bildquelle:
http://www.colorado.edu/geography/courses/geog_1982_s05/labor_migration.jpg.
-- Zugriff am 2005-11-07]

DDR-spezifisch

Abb.: Vietnamesische Gastarbeiter in der DDR / Betriebszeitung des VEB Leipziger
Baumwollspinnerei. -- 1988
[Bildquelle: Schüle, Annegret <1959 - >: "Die Spinne" : die Erfahrungsgeschichte weiblicher Industriearbeit im VEB Leipziger Baumwollspinnerei. -- Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2001. -- 398 S. : Ill. ; 24 cm. -- Zugl.: Jena, Univ., Diss., 2000. -- 3-934565-87-5. -- S. 284. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Unter Arbeitsmigration versteht man das Auswandern (von migratio, lat. für Wanderung, Auswanderung) von Menschen zum Zweck einer Arbeit in einem fremden Land. Dabei ging (und geht auch heute noch) die Wanderung vorwiegend aus industriell unterentwickelteren Ländern in die Industrienationen. Einleitung
Arbeitsmigration nach Deutschland
Deutschland-spezifischDie große Einwanderungsphase der Arbeitsmigranten (auch Gastarbeiter genannt) begann in Deutschland während der 1950er, als Deutschland während der Phase des Wirtschaftswunders ein Mangel an Arbeitskräften erfuhr und Gastarbeiter aus dem Ausland anwarb.
Geplant war, auch im anfänglichen Sinne vieler Angeworbener, ein Rotationsprinzip: Ein zeitlich begrenzter Aufenthalt (i.d.R. zwei bis drei Jahre) und dann wieder in die Heimat zurück.
Viele dieser Gastarbeiter änderten jedoch ihre Meinung, holten ihre Familien nach und blieben für immer. Bis in die 1970er Jahre kamen so über fünf Millionen Gastarbeiter und ihre Familien nach Deutschland, vorwiegend aus den Mittelmeerländern Türkei, Italien, Spanien, ehemaliges Jugoslawien, Griechenland, Marokko, Tunesien und Portugal.
Arbeitsmigration weltweit
Abb.: Plakat des Württembergischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, um 1980Ähnlich wie Deutschland begannen auch andere europäische Länder, Gastarbeiter anzuwerben, z.B. Frankreich oder Großbritannien. Diese warben vermehrt in den Ländern, die damals oder einstmals zu ihren Kolonien zählten.
Durch den Ölboom warben auch viele nahöstliche Staaten Gastarbeiter an, vor allem aus Pakistan, Indien und Bangladesch, aber auch aus ärmeren arabischen Ländern und aus Schwarzafrika. In manchen Ländern, wie etwa in Kuwait, machen Arbeitsemigranten bis zu 80 % der Wohnbevölkerung aus. Integrationsbestrebungen gibt es hier im Allgemeinen kaum, und es ist oft gesetzlich auch nach Jahrzehnten nicht möglich, die Staatsbürgerschaft zu erlangen.
Auch in den USA ist eine Arbeitsmigration zu betrachten, vorwiegend aus Mexiko. Der Demograph Jeff Passel schätzte die Zahl der illegalisierten Ausländer in den USA im März 2004 auf 10,3 Millionen, davon sollen 57 % oder 5,9 Millionen Mexikaner sein. (Quelle: "Migration News", April 2005)
In Asien gibt es Millionen von Arbeitsmigranten; den höchsten Anteil machen sie in Singapur aus, wo die Ausländer etwa 30% der Arbeitskräfte stellen.
Vom Westen fast vollkommen unbeachtet findet in Westafrika Arbeitsmigration in großem Stile statt. Millionen von jungen Menschen vor allem aus den Sahelländern arbeiten unter oft unmenschlichen Bedingungen z. B. auf Plantagen in den Küstenstaaten wie Ghana, Côte d'Ivoire und Liberia, aber auch im Senegal. Auch Großstädte wie Lagos und die nigerianische Erdölindustrie haben große Anziehungskraft.
LegalisierungenAnders als in Deutschland kam es in anderen Ländern immer wieder zu umfangreichen Legalisierungen vorher illegalisierter Ausländerinnen und Ausländer.
Im Jahr 2004 erlaubte die thailändische Regierung allen nichtautorisierten Ausländern, die vor dem November 2003 gekommen waren, sich registrieren zu lassen. 1,5 Millionen Personen nutzten diese Möglichkeit. Von Februar 2005 bis Mai 2005 haben in Spanien 700.000 Illegalisierte eine Aufenthaltserlaubnis beantragt.
ToteDa die Möglichkeiten zur legalen Migration für viele Menschen sehr begrenzt sind, nutzen viele Migrantinnen und Migranten die Hilfe kommerzieller Anbieter. Dabei kommt es immer wieder zu Todesfällen. Im Juni 2000 waren im Hafen der englischen Stadt Dover 58 asiatische Flüchtlinge erstickt in einem Lastwagen aufgefunden worden.
Folgen für die GastländerDie Probleme, die aus der Arbeitsmigration resultierten, waren, und sind zum Teil bis heute, hausgemacht, da eigentlich ein dauerhafter Zuzug nicht geplant war und somit keine Integrationsprogramme vorlagen:
Einerseits Ablehnung der sesshaft gewordenen Ausländer durch Ausgrenzung, Diskriminierung bis hin zu Ausländerhass und Anstieg der kriminellen Delikte und Anschläge gegen Ausländer. Andererseits auch das Gruppenbilden der einzelnen Nationen unter sich, das bis hin zu Bandenbildung und kriminellen Auswüchsen führte und das Ablehnen der neuen Lebensweise und der Kultur (diese vor allem bei türkischen Staatsangehörigen).
Ein Zuwanderungsgesetz für 2003, das eine einheitliche Regelung der Arbeitsmigration in Deutschland regeln sollte, wurde wegen uneinheitlicher Stimmabgabe im Bundesrat nicht verabschiedet.
Folgen für die HerkunftsländerMindestens so groß wie in den Gastländern ist der Impakt massiver Arbeitsmigration auch für die Herkunftsländer. Einerseits können die Geldsendungen von Gastarbeitern einen großen Teil des jeweiligen Bruttornationaleinkommens darstellen - so übertreffen diese Summen zum Beispiel in Moldawien und Albanien bei weitem die im Land erwirtschafteten Leistungen. Andererseits können durch massive Abwanderung vor allem junger Menschen ganze Landstriche überaltern.
Auch die sozialen Folgen können bedeutend sein. So werden oft Familien jahrzehntelang zerissen. Oft fällt es rückkehrenden Gastarbeitern schwer, sich in ihrer Heimat wieder einzufinden. Sie sind zerissen zwischen alter und neuer Heimat und werden oft von den daheimgebliebenen abgelehnt. Im ehemaligen Jugoslawien besteht zum Beispiel das Klischee vom Landarbeiter, der nach zehn Jahren Baustelle im weißen Mercedes nach Hause kommt und hier den hohen Herrn spielt. Da meist vor allem Männer auswandern, kann sich Emigration auch auf die demographische Situation einer Region auswirken.
Andererseits hat in Ländern mit einer langen Tradition der "Gastarbajteri", wie etwa Jugoslawien, diese zu einem fruchtbaren Austausch mit den Gastländern, hier vor allem der deutschsprachige Raum, geführt.
"Brain Drain"Als Brain Drain bezeichnet man die Auswanderung der qualifizierteren Bevölkerungsschichten, wenn diese nicht die Möglichkeiten gegeben sehen, im eigenen Land eine ihrer Ausbildung entsprechende Arbeit zu finden und davon leben zu können. Brain Drain führt oft zu einem Teufelskreis: Durch einen Mangel an qualifiziertem Personal verschlechtert sich die Attraktivität des Standorts und damit auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation noch weiter. Brain Drain findet auch zu Zeiten statt, wo ansonsten der Migration enge Riegel vorgeschoben sind, da trotzt aller Einwanderungsbeschrängungen Experten noch immer gesucht sind.
Viele Länder haben "Brain Gain"-Programme eingeführt, um diese Entwicklung aufzuhalten. Dabei versucht man durch besondere Angebote und Unterstützung vor allem für junge Akademiker, diese zum Bleiben zu bewegen. Ein Schwerpunkt ist dabei oft auch, das Bildungssystem zu verbessern, da ein Studium in einem anderen Land erfahrungsgemäß oft der erste Schritt zum Auswandern ist. Der Erfolg solcher Bestrebungen hält sich jedoch in Grenzen, da sie ohne Verbesserung der allgemeinen Situation meist nicht viel mehr als Absichtserklärungen sind.
Unter anderem in Ländern Südosteuropas ist Brain Drain eines der größten Hindernisse für Fortschritt sowie in der öffentlichen politischen Diskussion eines der brennendsten Themen."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsmigration. -- Zugriff am 2005-11-07]
Deutschland-spezifisch"Seit 1955 werden "Gastarbeiter" angeworben, um den Mangel an Arbeitskräften in der westdeutschen Wirtschaft zu vermindern. Verträge mit Italien (1955), Spanien und Griechenland (1960), der Türkei (1961), Portugal (1964) und Jugoslawien (1968) regeln ihre Anwerbung und Vermittlung. Für einen Teil der Zugezogenen wird Deutschland zur neuen Heimat. Während der Wirtschaftskrise 1973 beschließt die Bundesregierung einen Anwerbestopp für Arbeiter aus Nicht-EG-Ländern, um den Arbeitsmarkt zu entlasten. Gleichzeitig bemüht man sich um eine Integration der in Deutschland lebenden ausländischen Mitbürger.
Abb.: Broschüre der Ford-Werke mit Informationen für türkische Arbeitnehmer. -- Köln, 1962Bis Mitte der 60er Jahre kommen die meisten "Gastarbeiter" aus Italien, danach steigt besonders die Zahl der türkischen Arbeitnehmer. Insgesamt steigt die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer von rund 330.000 im Jahr 1960 über 1,5 Millionen 1969 auf 2,6 Millionen 1973. Ihre Anwerbung und Vermittlung übernehmen in den jeweiligen Heimatländern Außenstellen der Bundesanstalt für Arbeit in Absprache mit interessierten deutschen Unternehmen. Vorrangig werden die "Gastarbeiter" dort beschäftigt, wo geringe Vorkenntnisse erforderlich sind.
Abb.: Bekanntmachung über die Wahlvorschläge für die Wahl zum Ausländerbeirat am 11. November 1973 und über die Stimmabgabe, Abschnitt in deutscher Sprache, 1973Kontakte zu deutschen Kollegen sind anfangs schon wegen der Sprachprobleme eher selten. Einfache Gemeinschaftsunterkünfte in firmeneigenen Baracken sind häufig das erste "Zuhause" in der Bundesrepublik. Trotzdem ändern viele "Gastarbeiter" ihre Absicht, nach einigen Jahren als "gemachter Mann" in die Heimat zurückzukehren. Mit längerem Aufenthalt kommt es zu verstärktem Familiennachzug. Erste Schritte in Richtung politischer und gesellschaftlicher Integration der zugezogenen Ausländer folgen. Seit 1973/74 werden in vielen Gemeinden Ausländerbeiräte gewählt, die die Belange der ausländischen Mitbürger gegenüber Politik und Verwaltung vertreten sollen."
[Quelle: http://www.dhm.de/lemo/html/DasGeteilteDeutschland/KontinuitaetUndWandel/WirtschaftlicheEntwicklungenInOstUndWest/gastarbeiter.html. -- Zugriff am 2005-11-07]
"GENEVA - Many concerns that surround migration, such as loss of jobs, lower wages, increased welfare costs and the belief that migration is spiralling out of control, are not only exaggerated or unfounded but contrary to evidence, according to the World Migration Report 2005, released today by the International Organization for Migration (IOM). According to the report, the first ever comprehensive study looking at the costs and benefits of international migration, there is ample evidence that migration brings both costs and benefits for sending and receiving countries, even if these are not always shared equally.
“We are living in an increasingly globalized world which can no longer depend on domestic labour markets alone. This is a reality that has to be managed,” says IOM Director General, Brunson McKinley. “If managed properly, migration can bring more benefits than costs. The 2005 World Migration Report illustrates this clearly.”
Migrants represent only 2.9% of the global population. The UN Population Division estimates the migrant population in 2005 at between 185-192 million people – up from 175 million in 2000. Nearly half of them are female. However, the socio-economic and political visibility of migrants, especially in highly industrialised countries, is much greater than this percentage would suggest.
igration flows have also shifted in recent years and in some cases, international migration is actually decreasing. Although Asia, which has traditionally represented the largest international migrant stock, has seen an increase in the number of migrants from 28.1 million in 1970 to 43.8 million in 2000, in real terms, this represents a drop from 34.5% to 25% of the migrant stock in the same time frame. In addition, more and more Asians are finding job opportunities within Asia itself.
In Africa, international migration, usually within the continent rather than outside of it, has dropped over the past 30 years from 12% to 9% of the global stock and this is a pattern repeated in several other regions. Only two areas in the world have seen an increase in their migrant stock – Northern America and the former USSR.
The perception that migrants are more of a burden on host countries than a benefit is not sustained by research, according to the World Migration Report. In the UK, for example, a recent Home Office study calculated that in 1999-2000, migrants contributed US$ 4 billion more in taxes than they received in benefits. In the US, the National Research Council estimated that national income had expanded by US$ 8 billion in 1997 because of immigration.
Albanian citizen Flurije Lekaj has now a steady job in Italy, thanks to IOM's labour migration programme that connects Albanians with the Italian labour market.
The report also notes that in a wide variety of jobs in Western Europe, there is rarely direct competition between immigrants and local workers. Migrants occupy jobs at all skill levels, with particular concentration at the higher and lower ends of the market, often in work that nationals are either unable or unwilling to take.
Regular migrants are not likely to put a greater burden on health and welfare services than host population as they pay taxes. Irregular migrants, who run the highest health risks, are less likely to seek medical attention. The report stresses that this not only poses risks for the health of the migrant, but is also a public health concern and can contribute to fuelling sentiments of xenophobia and discrimination against all migrants. The report, therefore, underlines the need for government to invest in the health of migrants.
According to World Migration Report 2005, migration brings a much wider range of benefits.
Remittances are an important indicator of the benefits of migration, their huge potential for supporting development and poverty reduction having captured the attention of governments and development agencies alike. In 2003, remittances through official channels totalled US$ 93 billion. By 2004, they had already surpassed US$ 126 billion and now seriously rival development aid in many countries. However, while remittances can enable developing countries to repay foreign debt and improve their creditworthiness, they cannot be a replacement for development aid.
Receiving remittances from a family member working abroad.
Migrants also contribute to development strategies in their home countries by transferring their skills and investing in local economies. Diaspora associations such as the African female-based ones in France, or Mexican Hometown Associations in the USA, can strengthen cooperation between communities at home and abroad. Some countries are also seeing a shift from brain drain to brain gain as a result of increasingly pro-active policies to attract back émigrés with newly acquired skills and education. Countries like the Philippines and Morocco have established special ministries or agencies to support their émigré communities. Trends suggest a greater movement toward circular migration, with substantial benefits to both home and host societies.
At a time of growing resistance to migration in some receiving countries, World Migration Report 2005 highlights the need for effective policies of socio-economic inclusion of migrants into host communities, even on a temporary basis to maximise productivity. These measures have a cost but can ensure social cohesion in the face of cultural diversity and enable migrants to be productive for themselves, their host and home communities.
Finally, the report underlines the value of migrant-sending countries in engaging in dynamic and broad-based development, combining job creation and economic growth with a fairer distribution of income to create general optimism about the future of the country. It also emphasizes the need for governments to work together and make the right policy choices to steer migration more in the direction of benefits than costs."
[Quelle: http://www.iom.int/en/news/pr882_en.shtml. -- Zugriff am 2005-11-07]

Abb.: Attraktivität als Wert
"Beautycheck - Ursachen und Folgen von Attraktivität (Zusammenfassung) Schönheit fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden. Wir alle können sagen, ob ein bestimmtes Gesicht schön ist oder nicht. Aber wir tun uns schwer, wenn wir unser Urteil begründen sollen.
In der vorliegenden Arbeit untersuchten wir, was Gesichter attraktiv macht und welche sozialen Konsequenzen Attraktivität nach sich zieht. Dazu überprüften wir in insgesamt sieben Teiluntersuchungen mit einer für die Gesamtbevölkerung repräsentativen Stichprobe von ca. 500 Versuchspersonen mehrere Hypothesen zur Attraktivität. Dies sind die Durchschnittshypothese (Langlois & Roggman, 1990: "durchschnittliche Gesichter sind am attraktivsten"), der Einfluss der Symmetrie (Thornhill & Gangestad, 1993: "Symmetrie macht attraktiv") und die Theorie der Merkmalsausprägungen (Cunningham, 1986: "Reifezeichen gepaart mit Merkmalen des Kindchenschemas machen attraktiv"). Darüber hinaus wurde untersucht, welchen Zusammenhang es zwischen Attraktivität und bestimmten Eigenschaftszuschreibungen gibt (Berscheid, 1972: "Was schön ist, ist auch gut").
Dazu fotografierten wir 64 Frauengesichter und 32 Männergesichter (im Alter zwischen 17 und 29 Jahren; davon acht Models) in standardisierter Weise. In einer Voruntersuchung wurden die Gesichter mit Hilfe eines eigens programmierten Präsentationsprogramms von Versuchspersonen bezüglich ihrer Attraktivität auf einer Skala von 1 (= sehr unattraktiv) bis 7 (= sehr attraktiv) beurteilt. Aufgrund dieser Ergebnisse wurden sie für das weitere Vorgehen in eine Rangreihenfolge gebracht.
Wir berechneten danach systematisch mit Hilfe eines Computerprogramms (Morphing) neue Gesichter, in denen unterschiedlich viele Originalgesichter zu immer gleichen Anteilen enthalten sind. Für die Berechnung eines neuen Gesichts setzten wir über 500 Referenzpunkte. Durch dieses äußerst aufwendige Vorgehen (für die ganze Arbeit wurden insgesamt über 75.000 Referenzpunkte gesetzt!) konnten Durchschnittsgesichter erzeugt werden, die "echten" Gesichtern täuschend ähnlich sehen, und in ihrer Qualität alle anderen Durchschnittsgesichter, die von anderen Autoren für bisherige Untersuchungen zu ähnlichen Fragestellungen verwendet wurden, bei weitem übertreffen. Daher sind unsere Ergebnisse wesentlich aussagekräftiger als die früherer Untersuchungen, da nur ein Vergleich von sehr realistisch aussehenden Computergesichtern mit Originalgesichtern überhaupt Sinn macht.
Analog zur Beurteilung der Originalgesichter wurde in einer zweiten Untersuchung die Attraktivität aller gemorphten Gesichter auf der gleichen Skala (s.o.) von Versuchspersonen eingeschätzt. Alle Originalgesichter und gemorphten Gesichter wurden darüber hinaus von Mitarbeitern einer Modelagentur daraufhin beurteilt, ob sie als Model für die Kategorie "Beauty" geeignet wären (dritte Untersuchung).
In einem vierten Experiment untersuchten wir den Einfluss der Symmetrie auf die Attraktivitätswahrnehmung von Gesichtern. Für die fünf unattraktivsten, fünf mittel attraktiven und fünf attraktivsten Gesichter jedes Geschlechts stellten wir mit Hilfe der Morphing-Software symmetrisch optimierte Versionen der Originalgesichter her. Dabei verwendeten wir ein eigenes Verfahren, durch das wir Gesichter erzeugen konnten, die völlig symmetrisch sind und dennoch absolut natürlich wirken. In einem Paarvergleichsexperiment wurde erhoben, inwieweit die symmetrisch optimierten Gesichter als attraktiver beurteilt werden als die Originalgesichter.
Für das fünfte Experiment näherten wir für jedes Geschlecht drei unattraktive und drei attraktive Gesichter in ihren Gesichtsproportionen zu 50% an die des Durchschnittsgesichts an. Die Gesichtsoberfläche (d.h. insbesondere die Haut) wurde dabei konstant gehalten und nur die Proportionen wurden durchschnittlicher gemacht. Sämtliche Versionen wurden von Versuchspersonen in einem Paarvergleichsexperiment mit dem Originalgesicht verglichen. Im Gegenzug stellten wir für jedes Geschlecht zwei Gesichterpaare her, die in ihren Gesichtsproportionen identisch waren. Durch Konstanthalten der Gesichtsproportionen konnten verschiedene Gesichtsoberflächen in Paarvergleichsexperimenten miteinander verglichen werden.
Als sechste Fragestellung untersuchten wir, inwieweit eine Annäherung der Gesichtsproportionen erwachsener Frauen an das Kindchenschema attraktivitätssteigernd wirkt. Dafür erstellten wir für sechs verschiedene Frauengesichter fünf Gesichtsvariationen, deren Gesichtsproportionen in 10%-Schritten (bis 50%) denen des Kindchenschemas angenähert wurden. Dabei verwendeten wir ein eigenes, verbessertes Verfahren, das die erwachsenen Frauengesichter nur in ihren Proportionen, nicht aber in der Gesichtsoberfläche (Haut) kindlicher macht. Aus den fünf Variationen zuzüglich dem Originalgesicht wählten die Befragten das für sie attraktivste Gesicht aus.
Um herauszufinden, welcher Zusammenhang zwischen Attraktivität und der Zuschreibung bestimmter Eigenschaften besteht, wurden 21 Gesichter aus den Kategorien "unattraktiv", "mittel attraktiv" und "attraktiv" von Versuchspersonen auf einer 7-stufigen Skala hinsichtlich zehn verschiedener Persönlichkeitseigenschaften eingeschätzt (siebte Untersuchung).
Die Ergebnisse sind interessant und teilweise auch unerwartet: Gemorphte Gesichter werden im Mittel attraktiver eingeschätzt als Originalgesichter (4,3 bzw. 3,5 auf der 7-stufigen Skala). Je mehr Originalgesichter in einem gemorphten Gesicht enthalten sind, desto attraktiver wird es beurteilt (r = 0,57** für Frauengesichter, r = 0,64** für Männergesichter). Dies stützt zwar einerseits tendenziell die Durchschnittshypothese von Langlois & Roggman (1990), andererseits gilt aber auch: Je attraktiver die in einem gemorphten Gesicht enthaltenen Originalgesichter sind, desto attraktiver wird auch das gemorphte Gesicht beurteilt (r = 0,75** für Frauengesichter, r = 0,68** für Männergesichter). Es kommt also nicht nur auf die Anzahl der in einem Gesicht vermorphten Originalgesichter an, sondern vor allem auch darauf, wie attraktiv die verwendeten Originalgesichter sind. Dies widerspricht der Durchschnittshypothese, wonach durchschnittliche Gesichter am attraktivsten sein müssten. Überraschend ist, dass vor allem Männergesichter durch das Vermorphen deutlich an Attraktivität gewinnen. Dies widerspricht älteren (von uns kritisierten) Untersuchungen, die einen attraktivitätssteigernden Effekt für Männergesichter nicht finden konnten. Mangelnde Qualität (Unschärfe) der erzeugten Mischgesichter könnte dafür der Grund gewesen sein.
Die Expertenbefragung in der Model-Agentur ergab, dass von den ausgewählten Gesichtern, die als Model für die Kategorie "Beauty" geeignet wären, 88% (14 von 16) gemorpht waren, also von einem Computer neu berechnet wurden und in der Realität nicht existieren.
Die Ergebnisse aus unserem Experiment zur Symmetrie zeigen, dass Symmetrie zwar ein Faktor ist, der Attraktivität beeinflusst, jedoch bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es häufig angenommen wird. Es gilt vielmehr: Gesichter, die sehr asymmetrisch sind, sind eher unattraktiv (--> Ergebnis bei den unattraktiven Männern), aber sehr unattraktive Gesichter sind deswegen noch lange nicht automatisch asymmetrisch (--> Ergebnis bei den unattraktiven Frauen). Umgekehrt gilt ebenso: Sehr symmetrische Gesichter sind noch lange nicht attraktiv und sehr attraktive Gesichter zeigen durchaus Abweichungen von der Symmetrie. Insgesamt scheint Symmetrie ein nur eher schwaches Kriterium für Attraktivität zu sein.
Durch die Experimente zur Schemaanpassung von Gesichtern konnte eindeutig gezeigt werden, dass nicht die Gesichtsproportionen, sondern die Oberflächen durchschnittliche Gesichter attraktiv machen. Die Durchschnittshypothese ist – angewendet auf Gesichtsproportionen – damit widerlegt!
Bei Frauengesichtern sind kindliche Merkmale wie große, rundliche Augen, eine große gewölbte Stirn, sowie kleine, kurze Ausprägungen von Nase und Kinn stark attraktivitätserhöhend. Nur sehr wenige (9,5%) Versuchspersonen fanden in unserem Kindchenschema-Experiment die reifen "Original-Frauen" am attraktivsten. Die meisten bevorzugten Frauengesichter, denen ein Kindchenanteil von 10 - 50% beigemischt war. Dies bedeutet: Selbst die attraktivsten Frauen werden noch schöner, wenn wir ihre Gesichtsproportionen kindlicher machen. Interessant dabei ist wiederum, dass die Frauen, die bei diesem Experiment am attraktivsten beurteilt wurden, in der Realität nicht existieren.
Durch die Berechnung von Prototypen für ein sehr unattraktives und ein sehr attraktives Gesicht je Geschlecht erhielten wir Gesichter, die sich durch charakteristische Merkmale voneinander unterschieden. Eine Befragung von Versuchspersonen ergab, dass attraktive Frauen eine braunere Haut, ein schmaleres Gesicht sowie vollere und gepflegtere Lippen besitzen. Sie haben zudem einen weiteren Augenabstand, dünnere Augenlider, mehr, längere und dunklere Wimpern, dunklere und schmalere Augenbrauen, höhere Wangenknochen und eine schmalere Nase. Für attraktive Männer gilt erstaunlicherweise zum großen Teil das gleiche wie für attraktive Frauen: Auch sie haben eine braunere Haut, ein schmaleres Gesicht, vollere Lippen, dünnere Augenlider, mehr und dunklere Wimpern, dunklere Augenbrauen und höhere Wangenknochen. Zudem unterscheiden sie sich durch einen markanteren Unterkiefer und ein markanteres Kinn von den unattraktiven Männern.
Schließlich ergaben die Ergebnisse der Untersuchung zur sozialen Wahrnehmung von Gesichtern, dass es ein ausgeprägtes Attraktivitätsstereotyp gibt: Je attraktiver die präsentierten Gesichter waren, desto erfolgreicher, zufriedener, sympathischer, intelligenter, geselliger, aufregender, kreativer und fleißiger wurden die Personen eingeschätzt. Dies zeigt, welche weitreichenden sozialen Folgen Attraktivität nach sich ziehen kann. Zusätzlich erstellten wir auf der Grundlage dieser Ergebnisse mit Hilfe einer speziellen Software dreidimensionale, animierte Kopfmodelle, die von Versuchspersonen hinsichtlich dieser Charaktereigenschaften als extrem eingeschätzt werden.
In unserer Untersuchung stellte sich heraus, dass die als am attraktivsten beurteilten Gesichter keine echten Gesichter waren, sondern von uns am Computer erzeugte. Diese virtuellen Gesichter zeichnen sich durch Merkmale aus, die für uns normale Menschen völlig unerreichbar sind. Indem uns aber die Medien solche perfekten Gesichter täglich vor Augen führen – man denke nur an die bis ins letzte Detail computertechnisch nachbearbeiteten Gesichter für Kosmetikwerbung, besteht die Gefahr, dass wir selbst zu Opfern unseres eigenen, völlig unrealistischen Schönheitsideals werden. "
[Quelle: http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_II/Psychologie/Psy_II/beautycheck/zusammen/zusammen_d.htm. -- Zugriff am 2005-11-07]
Der ganze Bericht mit Abbildungen: http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_II/Psychologie/Psy_II/beautycheck/bericht/beauty_ho_zensiert.pdf. -- Zugriff am 2005-11-07]

Abb.: (Buchtitel) Ein Anstellungskriterium mancher Personalchefs und ein
Beliebtheitskriterium für manche männlicher Mitarbeiter
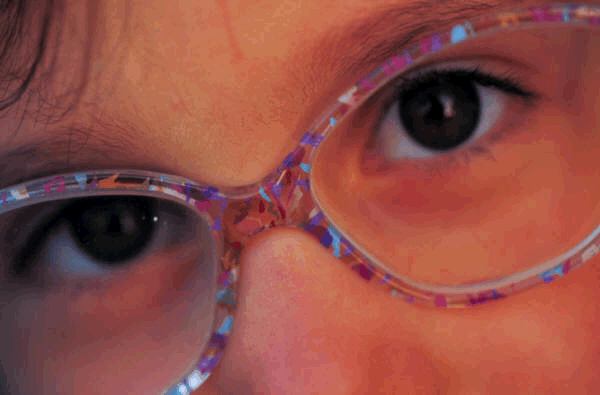
Abb.: Bei Behinderung sollte man auch an alltägliche Behinderungen wie
Sehbehinderung und Hörbehinderung denken
(©MS Office)
"Von einer Behinderung spricht man bei individuellen Beeinträchtigungen eines Menschen, die umfänglich, vergleichsweise schwer und langfristig sind. Die infrastrukturellen Umweltbedingungen, insbesondere aber gesellschaftliche Einstellungen und Verhalten gegenüber von Menschen mit Behinderung, nehmen in modernen Ansätzen zur Definition des Begriffs einen größeren Raum ein.
Kategorien und UrsachenGrundsätzlich lassen sich Behinderungen grob kategorisieren in:
- körperliche Behinderung
- Sinnesbehinderung (Sehbehinderung, Blindheit, Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Taubblindheit)
- Sprachbehinderung
- psychische (seelische) Behinderung
- Lernbehinderung
- geistige Behinderung
- Eine modernere Bezeichnung ist Entwicklungsbeeinträchtigung. Diese umfasst alle Kategorien und soll laut Unterstützer abwertende Konnotationen, wie sie z.B. "geistige Behinderung" mitbringen, umgehen.
Hinsichtlich der Ursachen lässt sich unterscheiden zwischen:
- erworbenen Behinderungen
- durch perinatale (während der Geburt) entstandene Schäden
- durch Krankheiten
- durch Unfälle
- durch Gewalteinwirkung
- durch Alterungsprozesse
- angeborenen Behinderungen
- durch Vererbung bzw. chromosomal bedingt
- durch pränatale (vor der Geburt entstandene) Schädigungen.
Behinderungen können auch als Kombination aus mehreren Ursachen und Folgen auftreten (Mehrfachbehinderung, Schwerste Behinderung), oder weitere Behinderungen zur Folge haben, z.B. Kommunikationsbehinderung als Folge einer Hörbehinderung.
HäufigkeitNach einem im Mai 2005 erschienenen Bericht der Deutschen Bundesregierung zur Lage behinderter Menschen und zur Entwicklung ihrer Teilhabe gelten über acht Prozent der Bevölkerung als behindert.
Im Dezember 2003 lebten nach Angaben des statistischen Bundesamtes 6,639 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung in Deutschland. Ein hoher Anteil von ihnen (52 Prozent) sind ältere Menschen über 65 Jahre. Jeweils 22 Prozent umfassen die Altersgruppen von 55 bis unter 65 Jahre und von 25 bis unter 55 Jahre. Die restlichen 4 Prozent sind unter 25 Jahre alt. 68 Prozent der Behinderungen werden von dieser Statistik als "körperliche Behinderung und 17 Prozent als "geistig-seelische" Behinderung eingeordnet. 84 Prozent der Behinderungen seien durch Krankheit, 2 Prozent durch Unfall erworben.
Von einer solchen Statistik werden allerdings nur Personen erfasst, die den rechtlichen Status eines Schwerbehinderten und den damit verbundenen Schwerbehindertenausweis erfolgreich beantragt haben. Dies vermeidet jedoch ein Teil der Betroffenen. Weil es keine „Meldepflicht“ für Behinderungen gibt, lässt sich die tatsächliche Zahl der Menschen mit Behinderung nur schätzen, wobei häufig die Zahl von 10 Prozent der Gesamtbevölkerung genannt wird. Nationale und internationale Statistiken weisen erhebliche Varianzen auf, da außerhalb des rechtlichen Rahmens nicht einheitlich und verbindlich festgelegt wurde, welche Kriterien für eine vorliegende Behinderung erfüllt sein müssen.
In der Schweiz sind Schwerbehindertenausweise unbekannt. Dort sind beim Bundesamt für Sozialversicherung die IV-Renten statistisch erfasst. 2003 bekamen 271'039 Personen einfache Invalidenrenten und 185'476 noch Zusatzrenten. Die durchschnittliche Rente betrug 1396 CHF. Individuelle Maßnahmen (Hilfsmittel, Sonderschulen, Berufliche Ausbildung usw.) bezogen 400'537 Personen. Bei den Männern ist einer von fünf kurz vor der Pensionierung IV-Rentner.
DefinitionenSozialrechtliche Definition
Nach deutschem Recht!Im bundesdeutschen Recht wird die Behinderung im Sozialgesetzbuch IX (dort: § 2 Abs. 1), so festgelegt: Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Erweiterte SichtEine Behinderung bringt in der Regel auch Schwierigkeiten dahingehend mit sich, als Betroffener an der Gesellschaft teilhaben zu können („Behindert ist man nicht, behindert wird man! Aktion Mensch). So erweitert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2001 den Behinderungsbegriff in der International Classification of Functioning, Disability and Health" ICF) wie folgt:
- Schädigung: Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder -struktur im Sinn einer wesentlichen Abweichung oder eines Verlustes,
- Beeinträchtigung der Aktivität: Aus der Schädigung resultierende Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, eine Aufgabe oder Tätigkeit durchzuführen,
- Beeinträchtigung der Partizipation: Ein nach Art und Ausmaß bestehendes Problem einer Person bezüglich ihrer Teilhabe in einem Lebensbereich bzw. einer Lebenssituation,
- Umfeldfaktoren: beziehen sich auf die physikalische, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der die Menschen ihr Leben gestalten.
Beispielhaft für eine erweiterte Begriffsdefinition unter Einbeziehung der Umgebung ist die Formulierung Alfred Sanders: Behinderung liegt vor, wenn ein Mensch mit einer Schädigung oder Leistungsminderung ungenügend in sein vielschichtiges Mensch-Umfeld-System integriert ist (H. Eberwein, S. Knauer: Handbuch der Integrationspädagogik, Beltz 2002). Er führt Behinderung also nicht nur auf eine Schädigung oder Leistungsminderung eines einzelnen Menschen zurück sondern auf die Unfähigkeit des Umfelds des betreffenden Menschen diesen zu integrieren.
BegriffsdiskussionEs gibt darüber hinaus eine Vielzahl von Definitionen des Behinderungsbegriffs, nicht zuletzt im ständigen Bemühen, eine (behindernde) Diskriminierung und Stigmatisierung schon bei der eingesetzten Sprache auszuschließen – schließlich werden Behinderte in spanischsprachigen Ländern auch heute noch häufig als „minusválidos“ (Minderwertige) bezeichnet. Mit dem Ziel einer „Political Correctness“ wurde gar versucht, den Begriff ganz zu verbannen bzw. durch Euphemismen wie „besondere Befähigung“ oder „besondere Bedürfnisse“ zu ersetzen. Aus den englischsprachigen Ländern kommt die begriffliche Umschreibung „people with special needs“ („Menschen mit besonderen Bedürfnissen“).
Regelmäßig werden im akademischen Diskurs oder von Lobby-Organisationen einschlägige Begriffe hinsichtlich ihrer Passgenauigkeit oder aufgrund ihres diskriminierenden Potenzials in Frage gestellt, um sie durch fortschrittlichere Bezeichnungen zu ersetzen. (Noch) nicht durchgesetzt hat sich beispielsweise die kognitive Behinderung an Stelle der geistigen Behinderung. Der ursprünglich mathematische Begriff Inklusion schickt sich an, die bisherige Integration behinderter Menschen abzulösen, weil er nach Meinung seiner Befürworter der Gesellschaft eine höhere Verantwortung für die Einbeziehung betroffener Menschen mit all ihren Eigenarten zuweist, statt eine Anpassung zu verlangen.
Von den zumeist selbst betroffenen Vertretern der Krüppelbewegung wurde der Begriff Behinderung dagegen bewusst durch den alten, eigentlich verpönten Ausdruck „Krüppel“ ersetzt, um damit provozierend auszudrücken, was nichtbehinderte Menschen nach ihrem Empfinden ohnehin über sie dachten.
Letztlich ist Pragmatismus bei der Definition spätestens dann notwendig, wenn Kriterien für die Leistung von Hilfe durch die Gesellschaft festgelegt werden müssen (z.B. Schwerbehindertenausweis, Eingliederungshilfe, Rehabilitation, ...). Diese Situation wird in der sonderpädagogischen Fachdiskussion als Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma bezeichnet.
Der im süddeutschen und österreichischen Sprachgebrauch übliche Ausdruck „bresthaft“ für behindert wird heute als diskriminierend abgelehnt.
Hilfe und SelbstbestimmungTraditionelle karitative Einrichtungen
Seit dem späten 18. Jahrhundert betrachteten es vor allem kirchliche und andere karitative Einrichtungen als ihre Aufgabe, Kinder und Erwachsene mit einer Behinderung zu fördern und zu pflegen. Seit dem 19. Jahrhunderts wurde die Pflege und schulische Förderung staatliche Aufgabe.
Anfangs fand die Unterstützung von Menschen mit Behinderung überwiegend in dafür spezialisierten Einrichtungen wie Sonderschulen, Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), Internaten oder Heimen statt.
Inzwischen ist die Landschaft der Einrichtungen und der Konzepte der Behindertenhilfe breit aufgefächert, was auch Ergebnis der lebendigen politischen und wissenschaftlichen Diskussion der letzten Jahrzehnte ist.
Gesetzliche Vorgaben
Nach deutschem Recht!Durch die neuere Gesetzgebung ist die Gesellschaft aufgefordert, Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung zu schaffen. In Deutschland findet dies Ausdruck in Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“.
Dieses Prinzip muss vom Staat in der Gesetzgebung, der Verwaltung und bei der Rechtsprechung berücksichtigt werden. So finden sich zahlreiche Regelungen zum Nachteilsausgleich und zum Schutz der Rechtsposition von Menschen mit Behinderung u.a. im Sozialrecht, im Steuerrecht, im Arbeitsrecht oder auch in Bauvorschriften, hier insbesondere zum Thema Barrierefreiheit. Die Leistungen der Rehabilitation sind in den Sozialgesetzbüchern verankert.
Konzepte, Maßnahmen und Einrichtungen der Behindertenhilfe setzen schon bei Kleinkindern (Frühförderung) an und gehen weiter über verschiedene Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, insbesondere in den Fachgebieten der Sonderpädagogik und der Heilpädagogik. Auch für Erwachsene existieren Leistungsansprüche und Hilfsangebote im Bereich der Eingliederungshilfe im Alltag, im Beruf sowie im Bereich der medizinischen Rehabilitation.
Behindertenspezische Regelungen sind notwendig in allen Lebensbereichen.
Neue Ansätze zu Rehabilitation und IntegrationSeit den 1970er Jahren entstanden neue Denkansätze zur Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen. Politisch engagierte Mitglieder der Selbsthilfevereine fühlten sich von Vertretern und Mitarbeitern historisch gewachsener Strukturen der Rehabilitation weniger gefördert und forderten mehr persönliche Freiheiten in Pflegeheimen und Sonderarbeitsplätzen.
Im Zusammenhang mit reformpädagogischen Überlegungen bestehen heute auch integrative Ansätze, so z.B. integrative Kindergärten, integrative Schulen oder Integrationsfirmen. Dies sind reguläre Organisationen, in denen durch konzeptionellen, personellen und strukturellen Aufwand auch die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden, wodurch gemeinsames Lernen und Arbeiten ermöglicht werden soll.
Als Rehabilitation werden alle Maßnahmen verstanden, die auf eine Integration von Menschen in die Gesellschaft abzielen. Leistungen werden im Bereich der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Medizin und der Förderung zur Teilnahme am sozialen Leben erbracht. In den Folgejahren entstanden neue soziale Initiativen und Modelle zur eigenständigen Organisation von Pflege und Betreuung (unter anderem persönliche Assistenz, persönliche Budget, die Arbeitsassistenz im Beruf, oder die betriebliche Mitbestimmung in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die heute durch den Werkstattrat ausgeübt wird.
Seit einigen Jahren zeichnet sich ein Paradigmawechsel ab. Behinderung wird zunehmend als krisenhaftes Ereignis nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für seine Angehörigen und Freunde begriffen (Schuchhardt, 1982). Rehabilitation wird daher auch als Anbahnung eines Lernprozesses gedeutet, an dessen Ende nicht nur die Verarbeitung des Eintritts einer Behinderung durch die Betroffenen erfolgreich gemeistert werden können, sondern auch die Umgebung des Behinderten „behindertengerecht“ für die spezifischen Bedürfnisse und das natürliche „anders Sein“ angepasst würden. Wichtige Leitgedanken sind hier:
Behindertenbeauftragte, Behindertenorganisationen und Selbsthilfegruppen
- Soziale Teilhabe statt Pflege
- Überlegte Planung statt Barrierenerrichtung
- Achtung und Respekt statt Diskriminierung
- Integrierte Teilhabe statt vorgeburtliche Selektion und gesellschaftlich-institutionelle Ausgrenzung
Die Interessen von Menschen mit Behinderungen sollen im Bund sowie in den Bundesländern, Städten und Gemeinden von Beauftragten für ihre spezifischen Belange vertreten werden.
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Behindertenorganisationen, Verbänden und Selbsthilfegruppen, die entweder als Lobby Einfluss auf die Sozialpolitik versuchen zu nehmen oder dem Erfahrungsaustausch von Menschen mit Behinderungen dienen sollen.
Gesetze
Nach deutschem Recht!
- Grundgesetz der BRD, Artikel 3
- Das Behindertengleichstellungsgesetz macht unter anderem Vorgaben für barrierefreies Bauen.
- Landesgleichstellungsgesetz
- Schwerbehindertenrecht (Deutschland) (SGB IX Teil 2)
- Die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV) gibt Vorgaben für behindertengerechte IT-Systeme, beispielsweise barrierefreies Internet.
- Das SGB XII: hier regeln im 6 Kapitel die §§ 53 bis 60 die Eingliederungshilfe für Menschen die im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des SGB IX als behindert gelten."
Abb.: Kündigungsschutzverfahren für schwerbehinderte Arbeitnehmer
[Bildquelle: http://admin.integrationsaemter.de/uploads/534/Kuendigungsschutzverfahren.pdf. -- Zugriff am 2005-10-31][Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung. -- Zugriff am 2005-11-07]
"The language and terminology of disability
USA-spezifischMany people use the term disability to replace the designation handicapped. While these two designations are often used interchangeably, proponents of the social model of disability use the latter term to describe the social and economic consequences of the former; i.e., an individual with a physical or intellectual disability is said to be "handicapped" by the bias of society towards ability (e.g., a building without an elevator handicaps a person who uses a wheelchair). Similarly, in the United Kingdom, people within the disability rights movement commonly use the term "disabled" to denote someone who is "disabled by society's inability to accommodate all of its inhabitants."
The Person First Movement has added another layer to this discourse by asking that people with disabilities be identified first as individuals. "Person First Language" -- referring, for example, to a “woman who is blind,” rather than to "a blind woman" - is a form of political correctness designed to further the aims of the social model by removing attitudinal barriers.
Some people with disabilities support the Person First Movement, while others do not. People who are Deaf in particular may see themselves as members of a specific community, properly called the Deaf culture, and so will reject efforts designed to distance them from the central fact of their identity. This is a view that is becoming increasingly prevalent within other disabled communities, that are becoming self-aware and self defining by seeing their impairments as a central part of their upbringing, education, personality & Lifestyle.
The American Psychological Association style guide devotes a large section to the discussion of individuals with disabilities, and states that in professional writing following this style, the person should come first, and nominal forms describing the disability should be used so that the disability is being described, but is not modifying the person. For instance, "people with autism," "man with schizophrenia," "girl with paraplegia." Similarly, a person's adaptive equipment should be described functionally as something that assists a person, not as something that limits a person. "A woman who uses a wheelchair" -- she is not "in" it or "confined" to it, and she leaves it at the very least for sleeping and bathing. "A communication aid user." "A girl who uses a ventilator." "A man who takes antipsychotic medications to optimize his daily functioning."
Many people with disabilities especially dislike "disabled person" or "the disabled," as this implies that one's overall "personness" is defective, while "person with a disability" acknowledges the disability without implying anything about the overall person. However, according to the "social model", as it is society that disables a person, the reality of being a "person with a disability" is not really possible because it is impossible for an individual to "have" a society, therefore the term "disabled person" does not signify the lack of one's own "person-ness" but points an accusing finger at society for excluding those with impairments."
[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Disability. -- Zugriff am 2005-11-07]
"List of disability-related terms with negative connotations
USA-spezifischThe following is a list of terms which have been in use in recent history to describe disabled people or their disabilities, but which are regarded as offensive or inappropriate by disabled and non-disabled people. Levels of acceptance of the terms below vary with geography, and have varied over time; in addition attitudes to this issue vary from person to person. It should be noted that some disabled people are choosing to reclaim certain offensive terms, using them to describe themselves, with high-impact effect. However, it should be assumed that all terms listed here are unacceptable to disabled people, unless informed otherwise by the individual in question!
- "Maniac" generally used disparagingly to describe non-disabled people, with no regard to the actual lived reality of folks with manic-depression or other diagnoses bestowed by the medical industrial complex.
- "Schizo" or "Schizoid" used to describe people that have been labelled by the medical industrial complex as "schizophrenic," also used to insult supposedly non-disabled people who act in "unacceptable" or "unpredictable" ways
- Cripple used as a general term for a physically disabled person. In its shortened form 'crip', often used by impish disabled people as a term of endearment. See also the essay 'on being a cripple' by Nancy Mairs
- Handicapped or "Handicapper" used as a general term for a disabled person, and Handicap as a generic term for a disability.
- Joey used as a derogatory term for someone with Cerebral Palsy (see Joey Deacon)
- Mentally retarded used to describe someone with a learning disability, a significantly low IQ, and/or developmental disability (and Mental retardation to describe their disability)
- Midget
- Mongol or mongoloid for someone with Down's syndrome
- Retard or Retarded used to describe someone with a learning disability (and retardation to describe their disability) - Now used as a common insult by members of the public with insufficient understanding of the condition or its meaning of both sufferers and average people.
- Slow or Slow learner used to describe someone with a learning disability
- Spastic, referring to someone with Cerebral Palsy (shortened/altered forms such as Spaz, Spazzy, Spack or Spackhead are regarded as particularly offensive by many, especially with the incorrect derrogatory use of these terms to describe any people who react differently from others to external stimuli)
- The Disabled, The Blind etc. are objected to by many; "disabled people", "blind people" are considered slightly better; "people with disabilities", "people who are blind" are preferred instead. On the other hand, some use "The Blind" in a manner similar to Deaf_culture, as they see themselves as a valid subculture separate from "The Sighted", and "The Disabled" or "The Disabled Community" is used similarly as well. This is an area of some controversy.
- Wheelchair-bound for someone who uses a wheelchair
- Special - A patronising term for someone with a learning diffixulty. It is often an insult leveled at person who are considered as not being very clever
- Windowlicker
- Brave - Often seen as patronising. A person may not consider themselves brave simply because they have a disability.
- Psycho
- I am sorry that you are disabled"
[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_disability-related_terms_with_negative_connotations. -- Zugriff am 2005-11-07]

Abb.: Melancholiker: Wiener Raunzer
Temperament: Neigung, bestimmte Emotionen oder Stimmungen oft oder intensiv zu erleben bzw. zu zeigen. Bei Einstellungsgesprächen spielt u.a. eine Rolle, wie man das Temperament des Bewerbers einschätzt. Eine Persönlichkeit wird nach seinem Temperament kategorisiert und daraus wird der Schluss gezogen, ob die Person für die gewünschte Stelle geeignet ist oder nicht. Man fragt sich z.B.: paßt diese Person mit diesem Temperament in das Team.
Als Unterlage zur Einschätzung kann man dazu u.a. den Myers-Briggs-Indikator (s. unten) verwenden-
"Das Temperament beschreibt die Art und Weise, wie ein Lebewesen agiert und reagiert, seinen Verhaltensstil also. Der Begriff umschreibt relativ konstante, daher typische Merkmale des Verhaltens wie Ausdauer, Reizschwelle, Stimmung, Tempo. Etymologisch wird das Wort temperamentum im 16. Jh. im Sinne von "ausgeglichenes Mischungsverhältnis" in der Pharmazie verwendet, beschreibt dann das "Mischungsverhältnis der Körpersäfte" und erhält im 18. Jh. die heutige Bedeutung.
Die traditionellen Einteilungen in Temperamente und deren zugeordnete Verhaltensmuster sind stark abhängig vom Kulturkreis. Am bekanntesten sind die chinesische und griechische Einteilung der Temperamente. Lange Zeit unterschied man im europäischen Rahmen zwischen vier, auf Hippokrates zurückgehenden Typen.
- Choleriker,
- Melancholiker,
- Phlegmatiker und
- Sanguiniker.
Abb.: Das zweidimensionale Temperamentssystem von Hans-Jürgen Eysenck (1916 - 1997)[Bildquelle: Asendorpf, Jens <1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit. -- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S. 171. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Im 20. Jahrhundert differenzierte die Forschung stärker, konnte sich jedoch auf kein endgültiges Schema einigen. Die bekannteste Formulierung ist der Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), die bekannteste Weiterentwicklung dessen stammt von David Keirsey. In der heutigen empirischen Psychologie ist die Annahme von Persönlichkeitstypen allgemein umstritten.
Es sind vor allem vier Merkmale, mit denen Psychologen heute das Temperament beschreiben:
- Aktivität - Kraft, Stärke und Geschwindigkeit der Bewegungen, des Denkens und Sprechens.
- Reaktivität - Tempo und Stärke, mit der man auf äußere Reize reagiert. Wie offen man für Reize ist.
- Emotionalität - Häufigkeit und Stärke, mit der Gefühle geäußert werden und die Stimmungen wechseln.
- Soziabilität - der Wunsch, die Nähe anderer zu suchen, und die Art und Weise, mit ihnen umzugehen.
Aus der Zusammensetzung dieser charakteristischen Eigenschaften ergibt sich das Temperament. Das Temperament ist vor allem Veranlagung, wird aber durch die Umwelt nicht unwesentlich mit beeinflusst."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Temperament. -- Zugriff am 2005-11-07]
Der Myers-Briggs-Typindikator, kurz MBTI (von englisch Myers-Briggs type indicator - nach Katharine Briggs und Isabel Myers) ist ein Werkzeug der Psychologie zur Einschätzung der Persönlichkeit. Es stellt eine Form der Temperament-Kategorisierung dar. Der MBTI ist eine Weiterentwicklung der Typologie von Carl Gustav Jung, der seine Beobachtungen in "Psychologische Typen" niederschrieb. Katherine Cook Briggs und ihre Tochter Isabel Myers griffen diese auf und führten Messreihen durch. Sie nutzten die Ergebnisse um das Institut CAPT (Center for Applications of Psychological) zu gründen, das Persönlichkeitseinschätzung kommerziell angeboten hat. Der Begriff MBTI ist in diesem Sinne eine Schutzmarke des amerikanischen Unternehmens CPP Inc. und der Begriff MBTI blieb in Europa weithin unbekannt.
iStJ iSfJ iNFj iNTj iStP iSfP iNFp iNTp eStP eSfP eNFp eNTp eStJ eSfJ eNFj eNTj Temperamente mit den vier
Hauptklassen nach KeirseyDurch die Publikationen von David Keirsey gewann die Jung'sche bzw. Myers-Briggsche Einschätzung eine erweiterte Bekanntheit. Die Temperamenteinschätzung wird gern im Personalwesen eingesetzt, da es charakteristische Korrelationen von MBTI-Typus und beruflicher Eignung gibt.
Ähnlich wie in der Astrologie existiert die Kritik der selbsterfüllenden Einschätzungen. Wer sich einem Typ zuordnet, passt sich dem beschriebenen Eigenschaftsprofil zunehmend an. Neben einem Haupttyp kann man leicht Übereinstimmungen mit einigen anderen der 16 Unterklassen finden, und so je nach Tagesform und Situation über mehrere Klassen changieren. Es ist jedoch offenbar, dass Menschen nicht in allen vier Dimensionen der MBTI-Einschätzung variabel sind, sodass die Zuordnung eng beschränkt bleibt.
KlassifikationCarl Gustav Jung bemerkte in seinem täglichen Umgang mit Patienten, dass der Umgang mancher Menschen mit der Welt schlicht anders ist als sein eigener. Er notierte diese Beobachtungen und deren charakteristischen Merkmale, benannte sie und machte sich die Kenntnis der Temperamenteinschätzung wieder für seine Arbeit zu nutze. Grundlegend für das Modell ist die Einschätzung des Temperaments in vier Dimensionen, die in der MBTI-Notation mit vier Buchstaben notiert werden, und jeweils die dominierende Richtung in dieser bezeichnet. Die Abfolge der Buchstaben entspricht der Signal-Reaktion Verarbeitung im Gehirn, geteilt in zwei Wahrnehmungsfunktionen und zwei Beurteilungsfunktionen (bei Jung waren es zwei plus eine).
- I bis E - Introversion bis Extraversion
- Dies beschreibt die Motivation zur Sinneserfahrung. Diese Unterscheidung ist weit geläufig. Ein außenorienter Mensch ist kontaktfreudiger und handlungsbereiter, ein innenorienter Mensch konzentrierter und intensiver. Man spricht auch von der Tendenz zur Weite (E) bis Tiefe (I) der Sinneserfahrung.
- N bis S - Intuition bis Sensing
- Dies beschreibt die Verarbeitung der Sinneseindrücke, der sensorische Geist wichtet die "Rohdaten" bzw. unmittelbaren Eindrücke am höchsten, der intuitive Geist verlässt sich stärker auf seinen sechsten Sinn, also auf seine Spekulationen und Vermutungen. Der sensorische Geist ist detailorientiert und gewandter im exakten Verarbeiten von konkreter Information sowie im Einschätzen der Realität. Der intuitive Geist achtet eher auf das Ganze als auf dessen Teile und ist gewandter im Erkennen von Gesetzmäßigkeiten, Relationen und Möglichkeiten.
- F bis T - Feeling bis Thinking
- Dies beschreibt die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, der Denker (thinking) betrachtet die ihm vorliegenden Informationen eher von einem rationalen Standpunkt und versucht, mittels Logik zu objektiven Erkenntnissen und optimalen Entscheidungen zu gelangen. Da er Klarheit liebt, kategorisiert er die ihm vorliegenden Sinneseindrücke stark. Der Fühlende (feeling) beachtet seine Emotionen stärker. Er urteilt subjektiv nach seinen Gefühlen und berücksichtigt dabei vorwiegend Werte, Ideale oder zwischenmenschliche Aspekte.
- J bis P - Judging bis Perceiving
- Dies beschreibt die Sicherheit, mit der man Entscheidungen trifft und zu ihnen steht. Entweder man ist offen für neue Eindrücke und zeigt sich bereit, seine Entscheidungen und Pläne zugunsten neuer Informationen zu überdenken. Dies bedeutet auch, dass man spontaner handelt und sich flexibler unregelmäßigen Umständen anpassen kann (perceiving). Im Gegensatz dazu steht die Entschiedenheit. Der Urteilende (judging) entscheidet bereits, bevor ihm alle Informationen vorliegen und hält an einmal getroffenen Entscheidungen und eingeschlagenen Wegen auch unter widrigen Umständen fest. Bevorzugt handelt er systematisch und planmäßig. Falls erforderlich, werden Pläne angepasst, jedoch werden diese ungern völlig verworfen. Der Urteilende hat außerdem eine stärkere Neigung zum Dominieren und Kontrollieren. Er zeigt im Handeln weniger Spontaneität, dafür jedoch mehr Disziplin und Konsistenz.
Jeder Mensch ist in der Lage, entsprechend den vorliegenden Ereignissen angepasst zu handeln, jedoch bevorzugen die Menschen bestimmte Herangehensweisen. Dies wird hier als Temperament bezeichnet. Grundsätzlich sind Menschen von Natur aus eher defensiv eingestellt, arbeiten eher introvertiert und korrigierend. Die Zivilisation fördert jedoch die Ausbildung offensiver straffer Charaktere.
Über Gruppenstudien wurden Tests entwickelt, die ohne Einzelgespräch schon eine Abschätzung des MBTI-Typus erlauben. Wenn ein solcher Test I(3) S(5) T(6) J(5) ergibt, dann schreibt man kurz iSTj als Kurzbezeichnung. Jedes Vierertupel hat dabei auch Eigennamenstock, die jedoch zeitbezogen und landesbezogen verschieden sein können, und Assoziationen mit typischen Beobachtungen des sozialen Lebens nahelegen sollen. Der iSTj heißt so auch "Inspektor" und beschreibt besonders verlässliche Zeitgenossen.
TestbogenDer Test zur Abschätzung des MBTI erfolgt in der Regel zweistufig, in dem zuerst ein Testbogen ausgefüllt werden, und das Ergebnis anschließend mit dem Probanden diskutiert wird. Der Testbogen selbst enthält eine lange Serie dichotomer Fragen, deren Beantwortung auch ausbleiben kann - als Antwortmöglichkeiten stehen also je Frage "eher ja", "eher nein" und "weiß nicht".
Von den möglichen Fragestellungen werden für den Testbogen jene mit möglichst diskriminierendem Wert verwendet, deren Antwort häufig von einem erwarteten Mittelwert abweicht. Es darf so verschiedene Testbögen geben, sinnvoll sind diese jedoch nur, wenn sie mittels eines Gruppentests geeicht wurden. Neben den offiziellen MBTI-Testbögen der Firma CPP ist weithin noch der "Keirsey Temperament Sorter" bekannt, der geeicht wurde und kostenlos zur Verfügung steht. Es gibt verschiedene Webseiten, die den Keirsey-Test in vielen Sprachen online stellen.
Die Diskussion des Testergebnisses sollte immer erfolgen, da die Zusammenstellung und Wertung der Teilfragen letztlich willkürlich ist. Die Jung'sche Beobachtung verschiedener Temperamentklassen bleibt jedoch bestehen, bei denen sich Charakteristika der Herangehensweisen an Aufgaben gruppieren lassen und zuordnen lassen, letztlich typisch sind. Ohne Einzelgespräch erfolgt dies, in dem man die Beschreibungen der 16 Temperamenttypen nachliest, und der Proband selbst den passendsten wählt. Das Ergebnis des Testbogens gibt dabei einen Hinweis, welcher Temperamenttyp am wahrscheinlichsten ist, nur selten wählt man abweichend einen Typus als passendsten, bei dem ein Vorzeichen einer Dimension verkehrt ist.
Die Einfachheit dieser Testmethode ist zugleich vorteilhaft wie kritikwürdig. Insbesondere wird kein Maß der Variabilität der Herangehensweisen aufgestellt, die bei allen Menschen vorhanden aber meist stark beschränkt ist. Die Mittelantwort heißt "weiß nicht" und nicht "mal so mal so", auf letzteres sind die Testbögen nicht geeicht.
AnwendungDie Anwendung der MBTI-Tests bei Arbeitseinstellungen ist insbesondere im angloamerikanischen Raum gebräuchlich. Dies basiert auf statistischen Erhebungen, in denen deutliche Korrelationen zwischen dem Arbeitsfeld, dem Temperament und der Zufriedenheit der Arbeitenden mit dem Arbeitsfeld gefunden wurden. Hier ergibt sich die Vermutung, dass eine zum Job passende Persönlichkeit langfristig bessere Arbeitsleistungen liefert, z.B. seltener krank wird.
Kritik an der Verwendung bei Einstellungstests ergibt sich in soweit, dass Menschen sich auch an ihre Umwelt anpassen und mit der Zeit in die Anforderungen des Arbeitsfeldes hineinwachsen. Der MBTI beschreibt nicht andere wichtige Faktoren der langfristigen Anpassung wie Intelligenz und Disziplin. Der MBTI-Wert ist nur ein Wert unter mehreren zur besseren Persönlichkeitseinschätzungen über die persönliche Menschenkenntnis hinaus.
Die Verfügbarkeit von Testbögen hat auch die Anwendung von MBTI-artigen Systemen außerhalb der beruflichen Eignung hervorgebracht. So werden im angloamerikanischen Raum auch in der Eheberatung diese Tests eingesetzt, um den Partnern Hinweise geben zu können, auf welche Temperamentsunterschiede Rücksicht genommen werden muss. Die Erfolge haben jedoch teils auch zu einer Überbewertung des MBTI geführt.
Für den privaten Gebrauch kann mit anderen Testbögen verglichen werden, die etwa in Zeitschriften abgedruckt werden. Diese sind häufig ebenfalls dichotom aufgebaut, die Punkte werden aufsummiert und ergeben eine Klassenzuordnung. In der Regel wurden diese Testbögen nicht mit Gruppentests geeicht, sodass die Klassenzuordnung schon fragwürdig ist, und die in der Klassenzuordnung gegebenen Verhaltenstipps sind in der Regel ebenfalls nicht durch Studien belegt.
Demgegenüber existieren im MBTI-Umfeld jahrzehntelange Erfahrungen einschließlich fundierter Studien zu Korrelationen der definierten Typen mit fast jedem anderen Feld der Psychologie bzw. Soziologie. Der Grad der Anwendbarkeit des MBTI kann so fallweise belegt oder auch widerlegt werden. Wenn er auch nicht allein stehen kann, so bringt die Kenntnis über den eigenen und anderer MBTI-Typen mehr als beliebige Zeitschriftentests oder Astrologie.
Weiterführende WerkeGunter Dueck greift in einigen seiner Werke auf das MBTI-Modell (wobei er die Ausführungen von David Keirsey benutzt) zurück und entwirft darauf basierend sogar sein eigenes Charakter-Modell.
Die weitgehende Anwendung der MBTI-ähnlichen Modelle hat dazu geführt, dass andere Modelle zu Temperament und Charakter sich damit vergleichen. Das MBTI-Modell und mehr noch Keirseys Ableitungen greifen die klassische Vier-Elemente-Lehre der abendländischen Welt auf, die auf die hippokratische Temperamentenlehre zurückgeht. Diese hatten schon ein Verbindung von Temperament und Gesundheit eines Menschen gesehen (daraus folgend die Viersäftelehre). Demgegenüber fußt die fernöstliche Tradition auf einer Fünf-Elemente-Lehre, die sich auch in der Traditionellen Chinesischen Medizin finden. Die Klassifizierung der fünf Emotionen wird dann auf fünf Persönlichkeiten übertragen (derzeit nur englisch unter Big five personality traits), zu denen ebenfalls modernisierte Varianten bereitstehen, die mit modernen wissenschaftlichen Methoden in Studien untersucht werden."
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator. -- Zugriff am 2005-11-07]

Abb.: Ängstlich (©MS Office)
Da man von einem ängstlichen Mitarbeiter keine Entscheidungskraft, langsames Arbeiten und eventuell ungünstigen Einfluss auf die anderen Mitarbeiter erwartet, wird man versuchen ängstliche Bewerber zu erkennen und nicht zu übernehmen. Ein Bewerber kann eventuell einem Test unterworfen werden, mit dem versucht wird, Faktoren zu ermitteln, die auf Ängstlichkeit hinweisen. Daher ist es wichtig, Ängstlichkeitsfaktoren zu kennen. Es folgt ein Beispiel dafür.
Ängstlichkeitsfaktoren nach Peter Becker:
Angst vor
- physischer Verletzung
- Auftritten
- Normüberschreitung
- Erkrankungen und ärztlichen Behandlungen
- Selbstbehauptung
- Abwertung und Unterlegenheit
- physischer Schädigung
- Bewährungssituationen
- Missbilligung.
[Becker, Peter <1942 - >: Interaktions-Angst-Fragebogen : IAF ; Manual. -- 3., rev. und erw. Aufl.. -- Göttingen : Beltz Test, 1997. -- 96 S. : graph. Darst. ; 30 cm]
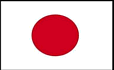
Japan-spezifisch
"Taijin kyofusho (対人恐怖症, TKS, for taijin kyofusho symptoms), is a culture-specific syndrome (cultural disorder, or mental illness) specific to Japan. Taijin kyofusho is usually described as a form of social anxiety (social phobia), with the sufferer dreading and avoiding social contact. However, instead of the anxiety focusing on a fear of embarrassing themselves or being judged by other people because of their social ineptness (as in cases in the Western world), sufferers of taijin kyofusho instead display a fear of hurting or offending other people; the focus is thus on avoiding harm to others rather than to oneself.
In the official Japanese diagnostic system, taijin kyofusho is subdivided into the following categories:
- Sekimen-kyofu, the phobia of blushing
- Shubo-kyofu, the phobia of a deformed body, similar to Body dysmorphic disorder
- Jikoshisen-kyofu, the phobia of eye-to-eye contact
- Jikoshu-kyofu, the phobia of having foul body odor
Being specific to non-American culture, taijin kyofusho is not detailed in the DSM IV (as noted in the DSM cautionary statement). This, however, is under debate as symptoms indicative of taijin kyofusho are sometimes found in patients in the United States."
[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Taijin_kyofusho. -- Zugriff am 2005-11-07]

Abb.: Hikikomori (ひきこもり; 引き篭り)
[Bildquelle:
http://www.rinku.zaq.ne.jp/takahashi/hana/item/e_hikikomori.jpg. -- Zugriff
am 2005-11-07]
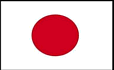
Japan-spezifisch
"Hikikomori (ひきこもり or 引き篭り lit. "pulling away, being confined," i.e.. "acute social withdrawal") is a Japanese term to refer to the phenomenon of reclusive adolescents and young adults who have chosen to withdraw from social life — often seeking extreme degrees of isolation and confinement due to various personal and social factors in their lives. The term "hikikomori" refers to both the sociological phenomenon in general, such as the hikikomori issue, as well as those individuals who display behaviors considered within the boundaries of the social label as in Hiroshi is a hikikomori. As the word 'hikikomori' is taken directly from the Japanese language, it is often used for both the singular and plural form in English without modification: I.E. a hikikomori, those hikikomori, the hikikomori phenomenon.
While there are mild and extreme degrees, the Japanese Ministry of Health defines a hikikomori as an individual who refuses to leave their parent's house, and isolates themselves away from society and family in a single room for at period exceeding six months, though many such youths remain in isolation for a span of years, or in rare cases, decades. Many cases of hikikomori may start out as school refusals, or tohkohkyohi in Japanese. According to estimates by psychologist Saito Tamaki, who first coined the phrase, there may be 1 million hikikomori in Japan, 20 percent of all male adolescents in Japan, or 1 percent of the total Japanese population. Surveys done by the Japanese Ministry of Health as well research done by health care experts suggest a more conservative estimate of 50,000 hikikomori in Japan today. As reclusive youth by their very nature are difficult to poll, the true number of hikikomori most likely falls somewhere between the two extremes.
Though acute social withdrawal in Japan appears to affect both genders equally, due to differing societal expectations for maturing boys and girls, the most widely reported cases of hikikomori are from Japanese families with male children who seek outside intervention when their son, usually the eldest, refuses to leave the family home.
CausesSometimes referred to as a kind of social problem in Japanese discourse, the hikikomori phenomenon has a number of possible contributing factors — young adults may feel overwhelmed by modern Japanese society, or be unable to fulfill their expected social roles as they have not yet formulated a sense of personal tatemae [建前; "façade"] and honne [本音;a person's true feelings and desires] needed to cope with the daily paradoxes of adulthood. The dominant nexus of the hikikomori issue centers around the transformation from young life to the responsibilities and expectations of adult life — indications are that advanced capitalist societies such as modern Japan are unable to provide sufficient meaningful transformation rituals for promoting certain susceptible types of youth into mature roles within society.
Three contributing factorsAs with many advanced capitalist societies with an affluent middle class, there exists a great deal of pressure on adolescents and young adults in Japan by family and society to be successful and perpetuate the existing social status quo. The pressure comes from a number of different sources, though there appear to be three primary factors encouraging hikikomori tendencies:
- 1) Middle class affluence in a post-industrial society such as Japan allows parents to support and feed an adult child indefinitely in the home. Lower income families do not have hikikomori children because a socially withdrawing youth is forced to work outside the home if he cannot finish school, and for this reason isolation in the room stops at an early stage.
- 2) The inability of Japanese parents to recognize and act upon the youth's slide into isolation, soft parenting, or even a codependent collusion between mother and son known as amae [甘え] in Japanese. When a youth withdraws from life, parents fail to act or respond in such a way that causes the child to become even more seclusionary.
Social pressures to conform
- 3) A decade of flat economic indicators and a shaky job market in Japan makes the pre-existing system requiring years of competitive schooling for elite jobs a pointless effort. While Japanese fathers of the current generation of youth still enjoy life employment at multi-national corporations, incoming employees in Japan enjoy no such job guarantees in today's job market (See Freeters and NEET for more on this). Young Japanese people are savvy enough to see the system in place for their grandfathers and fathers no longer works, and for some the lack of a clear life goal makes them susceptible to social withdrawal as a hikikomori.
The Japanese education system, like those found in China, Singapore, Taiwan, and Korea is demanding upon the youth. High expectations, high emphasis on competition, and the rote memorization of facts and figures for the purpose of passing entrance exams into the next tier of education in what could be termed a rigid pass-or-fail ideology, induce a high level of stress. Echoing the traditional Confucian values of society, the educational system is still viewed as playing an important part in society's overall productivity and success. In this social frame, students often face significant pressure from parents and the society in general to conform to its dictates and doctrines. These doctrines, while part of modern Japanese society, are increasingly being rejected by Japanese youth in varying ways such as hikikomori, freeter [フリーター ], NEET, and parasite singles.
Beginning in the 1960s, the pressure on Japanese youth to succeed began successively earlier in their lives, sometimes starting before pre-school, where even toddlers had to compete through an entrance exam for the privilege of attending one of the best pre-schools. This was said to prepare children for the entrance exam of the best kindergarten, which in turn prepared the child for the entrance exam of the best primary school, junior high school, high school, and eventually for their university entrance exam. Many adolescents took 1 year off after high school to study exclusively for the exam hell of the university entrance exam. The higher the prestige of the university, the more difficult the exam, the most prestigious university with the most difficult exam being the University of Tokyo.
Since 1996, the Japanese Ministry of Education, Monbukagakusho, has taken steps to address this 'pressure-cooker' educational environment and instill greater creative thought in Japanese youth by significantly relaxing the school schedule from six day weeks to five day weeks and dropping two subjects from the daily schedule, with new academic curricula more comparable to Western educational models. However this may be too little too late, as highly competitive Japanese parents are sending their children to private cram schools to 'make up' for the newly lax curricula in the Japanese public schools.
After graduating from high school or university, Japanese adolescents also have to face a very difficult job market in Japan, often finding only part time employment and ending up as freeters with little income, unable to start a family.
Another source of pressure is from their co-students, who may harass and bully some students for a variety of reasons, including physical appearance (especially if they are overweight or have severe acne problems), educational or athletic performance, wealth, ethnicity, or even having lived overseas even for a short time. Some have been punished for bullying or truancy, bringing shame to their families.
Withdrawal symptomsWhile many people feel the pressure of the outside world, and may feel uncomfortable in public, a hikikomori reacts by complete social withdrawal to avoid all outside pressure. Typically male, they may lock themselves into their bedroom or another room of their parent's house for prolonged periods of time, often measured in years. They usually do not have any friends. Hikikomori males have been reported to have a penchant for pornography. A hikikomori's days are characterized by long spells of sleeping, while their nighttime hours are spent watching TV, extensively playing computer games (role-playing games), surfing the internet, reading, or simply staring at the wall in angst over their plight.
This refusal to participate in society and fulfill their expected roles on the way to maturity makes hikikomori an extreme case and subset of a much larger group of the younger Japanese generation that includes parasite singles and freeters. All three groups seem to be rejecting the current social norms society has placed upon them in their own unique ways, with lifestyles considered deviant by society at large.
The withdrawal from society usually starts gradually before the hikikomori locks the door of his room. Often they appear unhappy, lose their friends, become insecure, shy, and talk less. Frequently they are bullied at school, which, atop the already high pressures of school and family, may be the final trigger for the withdrawal.
The phenomenon's effects on its victimsTypical patterns for hikikomori behavior
The lack of social contact and prolonged solitude has a profound effect on the mentality of the hikikomori, who gradually lose their social skills and the necessary social references and mores of the outside world. Anguished about their isolation and acutely self aware of their problem, they immerse themselves into the fantasy worlds of manga, television or computer games, which in turn becomes their only frame of reference. As time passes, the hikikomori, lacking interpersonal stimulus, developmentally stagnates into routine behaviors of sleeping all day and staying up all night only to sneak out into the kitchen for food when the family is asleep. Eventually, hikikomori may abandon their diversions of books and TV and simply stare into space for hours at a time.
If the hikikomori finally - often after several years - re-emerges voluntarily or through the aid of a care worker, they must face the problem of lacking social skills and years of education that their peers already possess through normal daily interaction with society. Also making reentry into society difficult for recovered hikikomori is the recent social stigma that has come to be attached to the condition due to mass media attention since 1998. The fear exists that others will discover their hikikomori past, and so they often feel uncertain around people, especially strangers, in how they should act. Also detrimental is the fact they lack a work history, making anything beyond menial labor jobs difficult to acquire.
Violence and hikikomoriTheir fear of the social pressure and the inability to effect change in their situation may also turn into frustration or even anger— some hikikomori have even physically attacked their parents, though most of the time anger manifests in others ways such as nightly harassment by banging on walls while the rest of the family sleeps.
This hostility often arises when parents continue to exert pressure on the hikikomori to come out of their rooms after many months of isolation, despite the fact a status quo has been allowed to develop between the parents, usually the mother, and the hikikomori. This status quo, called the Strange Peace, occurs because parents passively allow their child to stay withdrawn and has many reasons but mostly centers on an amae relationship between mother and son, the fear and social stigma of the local community knowing the family has a hikikomori, and the simple notion that it is better to have the child in the house even in isolation than as a runaway.
It was initially argued in the mass media when hikikomori came into public spotlight in 2000 that the loss of a social frame of reference might also lead hikikomori to commit violent or criminal behaviors. However, it has been argued by hikikomori experts that ‘true hikikomori’ are too socially withdrawn and timid to venture outside of their rooms, let alone venture outside the home and attack someone. If hikikomori physically attack anyone, it is usually confined to family members.
Media and the hikikomoriPart of the reason that hikikomori gained worldwide attention was the fact that the media attributed a number of high profile crimes to hikikomori. In 2000, a 17 year old labeled as a hikikomori by the press hijacked a bus and killed one passenger. In fact, it was discovered later that the hijacker was originally a hikikomori but his parents didn’t know how to deal with him, so they admitted him to a mental hospital for two months of observation. Feeling betrayed by his parents, it was the period in the hospital that disintegrated the boy’s self esteem and made him mentally unstable— the violence during the bus hijacking was directed at his mother by proxy. In the coming days, the media reported other extremely violent cases as perpetrated by hikikomori, such as one man who kidnapped a young girl and held her captive for nine years or a young man who killed 4 girls to reenact scenes of his pornographic hentai [変態 漫画] manga [変態 漫画]. As a result of the media spotlight, a great social stigma of hikikomori being violent and mentally ill came to be attached to the condition that exists to this day.
Reaction of the parentsHaving a hikikomori in the family is often considered embarrassing, so usually it is acknowledged as an internal private matter of the family, and many parents wait for a long time before seeking help by a third party within the hikikomori support industry. Also, in Japan the education of the children is traditionally done by the mother, and the father may leave the problem of a hikikomori to the mother, who feels very protective of her child. Initially, most parents simply wait and hope that the child will eventually overcome his problems and return to society by his own will. They see it as a phase the child has to overcome. Also, many parents are uncertain about what to do with a hikikomori, and wait simply due to lack of other options. An aggressive approach by the parents forcing the child back into society is usually not taken or only after a considerable waiting period.
School homeroom teachers and social workers may make inquiries, but usually do not get involved with the situation. In recent years, due to widespread media attention, having a family member who is a hikikomori has come to have a social stigma attached to the condition akin to mental illness though it is debatable whether or not hikikomori deserve such a pariah status in society. Due to this stigma and the resultant shame, many families strive to keep their child's hikikomori condition a secret from those in the community, thus further delaying parents from seeking outside intervention for their child.
TreatmentThere are different opinions about the treatment of a hikikomori, and the opinions often split into a Japanese and a western point of view. Japanese experts usually suggest waiting until the hikikomori reemerges, whereas western doctors suggest dragging the hikikomori back into society, by force if necessary.
While there are a growing number of doctors and clinics specialized in helping hikikomori, many hikikomori and their parents still feel a lack of support for their problems on an institutional level and feel that society at large has been slow to react to the hikikomori crisis. In the last several years, a hikikomori support industry has sprung up in Japan, each with its own style or philosophy in treating hikikomori cases. Despite this diversity, there seem to be two general camps for treatment:
The Psychological argument on hikikomoriThe first approach suggests psychological help is needed for these isolated young people, as many parents are overwhelmed with the problems of a hikikomori child whom they don’t understand. The standard psychological approach to hikikomori behavior in a youth is to treat the condition as a behavioral or mental disorder and so admit the child to a hospital ward in order to administer counseling, observation, and drug therapy using standard institutional procedures.
The Socialization argument on hikikomoriThe other approach to hikikomori treatment views the problem as one of socialization rather than mental illness. Instead of clinical treatment in a hospital, the hikikomori is removed from the original environment of the home into a shared living environment and encouraged to reintegrate into social groups through daily activities with other hikikomori who are already in various states of recovery; this approach shows the person that they are not alone in their condition and appears to be successful for most cases.
WorldwideWhile total social withdrawal seems to be mainly a Japanese phenomenon, there are reports of similar phenomena developing in South Korea, Taiwan and Hong Kong which possess similar high pressure educational systems. With the appearance of NEET in the United Kingdom and Twixters in the United States in recent years, there are indications that hikikomori may be part of a larger global phenomena in affluent and highly developed Post-Industrial countries."
[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Hikikomori. -- Zugriff am 2005-11-07]
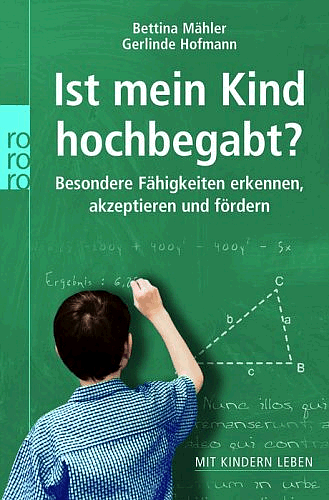
Abb.: Buchtitel
Man kann für eine Tätigkeit sowohl zu hoch als auch zu wenig begabt sein.
"Von Begabung oder Talent wird gesprochen, wenn eine Person über eine besondere Leistungsvoraussetzung verfügt. Meist ist das eine oder mehrere überdurchschnittliche Fähigkeit/en. Wenn man auch davon ausgehen kann, dass fast alle Menschen mehr oder minder begabt sind, so ist die Verwendung des Begriffs Begabung doch meist auf überdurchschnittliche Leistungsvoraussetzungen bezogen. Nicht selten spricht man auch von Hochbegabung oder Spitzentalent, um das Außerordentliche noch zu betonen. Eine Begabung ist angeboren. Um auf einem Gebiet herausragende Leistungen zu erzielen, sind außer und zusätzlich zur Begabung aber auch Lernen und Training unumgänglich, ehe eine Begabung in entsprechende Fertigkeiten umgesetzt werden kann.
Es gibt Begabungen in den verschiedensten Wissens- und Könnensbereichen, die sich aber im allgemeinen der intellektuellen, künstlerischen oder sportlichen Sphäre zuordnen lassen.
- Sport
- Kunst
- Handwerk
- Gedächtnis: Photographisches Gedächtnis
- Mathematik: Berechnung sehr großer Zahlen im Kopf; Verständnis logischer Zusammenhänge, siehe auch logisches Denken, Logik
- Intelligenz: Hochbegabung
- Sprachgefühl
- Organisation: militärische Führung, Unternehmensleitung, Politik
- Reaktionsvermögen
Begabungen setzen zweifellos eine günstige Kombination der Erbanlagen (siehe auch Genetik) voraus, insbesondere hinsichtlich der Allgemeinen Intelligenz bei hoher geistiger Begabung. Unerlässlich sind aber auch Elternhaus, Schule und alle anderen Faktoren der Ausbildung und Umwelt, ohne die keine Hochleistung denkbar ist.
Ein immer wieder reizvoller und zugleich wichtiger Forschungsgegenstand der Genealogie ist die Häufung von Begabungen in bestimmten Familien (siehe z.B. Gelehrtenfamilien, Künstlerfamilien, Mathematikerfamilien)
Begabung äußert sich durch eine relativ frühe spezifische Ansprechbarkeit, für ein bestimmtes Material, eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Sache. Der Begabte verspürt zudem eine Neigung, für dieses Material usw. interessiert zu werden. Im Falle einer Begabung zeigt sich auch eine lustbetonte Leichtigkeit im Umgang mit der Bemeisterung dieses Materials etc. Ein Begabter kann sich durchaus für seinen Stoff aufopfern, da dieser ein gesteigertes Bedürfnis hat, auf seinem Gebiet mehr zu erleben. Außerdem ist die begabte Person ständig unzufrieden mit den bereits erlangten Leistungsstufen, was die Anstrengungsbereitschaft in diesem Bereich erhöht. Wissenschaftler bezeichnen es als ,, produktive Unzufriedenheit". Wachsendes Selbstvertrauen ist ein weiterer Indikator einer Begabung, da ein Talentierter (= Begabter) weiß, wie sehr er seine Materie, Aufgabe, Sache... beherrscht. Schließlich führt dies dazu, dass ein Begabter auf seine überdurchschnittlichen Fähigkeiten vertraut. Ein begnadeter Sänger z. B. würde sich eher wagen, vor einem Publikum aufzutreten als eine Person, deren Begabung nicht das Singen ist. Der letzte und vollkommenste Schritt dieser Entwicklung, eine Begabung umzusetzen, ist die schöpferische Produktivität. Der Begabte wird hier selbstständig und schöpferisch tätig. Er kreiert Neues wie man es bei einem Genie vorfinden kann."[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Begabung. -- Zugriff am 2005-11-07]
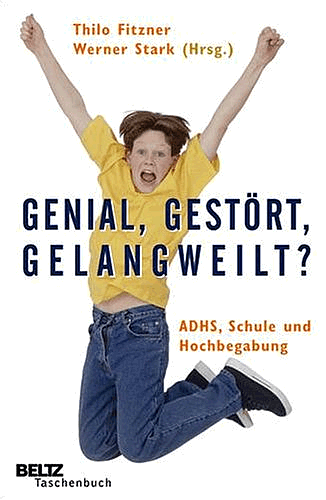
Abb.: Buchtitel
| Dummheit, die man bei andern sieht, Wirkt meist erhebend auf's Gemüt. Wilhelm Busch (1832 - 1908) |

Abb.: Buchtitel (Zitat aus Wilhelm Busch)
Peter R. Hofstätter fasst Intelligenz, so wie sie in Intelligenztest meist gemessen wird, als "Fähigkeit zu Auffindung von Ordnung". Eine Form von Dummheit ist dann die Überschätzung des Ordnungsgrades der wirklichen Welt, eine andere Form der Dummheit ist die Unfähigkeit, Ordnung in der Wirklichkeit zu erkennen (man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht). Höhere Intelligenz muss kein Vorteil für die Arbeits- und Lebenszufriedenheit sein (Sprichwörter: Je dümmer der Mensch, desto größer das Glück; Beaucoup d'argent, peu d'entendement; Dummheit und Stolz wachsen auf Einem Holz; Inscientia mater arrogantiae).
Folgende Graphik zeigt die Instrumente der Intelligenz nach Hofstätter:
Abb.: Instrumente der Intelligenz[Bildquelle: Hofstätter, Peter R. <1913 - >: Differentielle Psychologie. -- Stuttgart : Kröner, 1971. -- 434 S. : Ill. ; 18 cm.. -- (Kröners Taschenausgabe ; Bd. 403.). -- ISBN 3-520-40301-3. -- S. 123.]
Seit dem Erscheinen von Hofstätters Buch wurde der Intelligenzbegriff mehrfach neu überdacht, trotzdem bilden die obigen Analysatoren und Faktoren auch heute noch die wichtigste Grundlage der Intelligenztests.
Intelligenz wird mit verschiedenen Intelligenztests ermittelt. Es ist immer zu beachten, ob Intelligenztests nur konvergentes Denken (Finden der von den Testkonstrukteuren vorgegebenen Lösung) berücksichtigen oder auch divergentes Denken (Finden einer Vielfalt möglicher Lösungen, an die die Testkonstrukteure vielleicht gar nicht gedacht haben).
Berliner Intelligenzstruktur-Test von Von A. O. Jäger, A. Beauducel und H.-M. Süß
"Einsatzbereiche Zweck: Auswahldiagnostik und Beratung
Konstruktionsgrundlagen:
Zielgruppe: Jugendliche und jüngere Erwachsene mit mittlerer und höherer SchulbildungDer BIS-Test ist ein konstruktvalides Meßinstrument für das Berliner Intelligenzstrukturmodell (BIS) von Jäger (1982). Die strukturelle Übereinstimmung des Tests mit dem Modell konnte in zahlreichen Untersuchungen bestätigt werden. Die Interpretation von Intelligenzmessungen mit dem BIS-Test kann daher auf der Grundlage des BIS-Modells erfolgen, dessen Entstehung im folgenden skizziert und dessen derzeitige Geltungsbereiche dargestellt werden.
Das BIS ist ein integratives Strukturmodell der Intelligenz. Ziel der Modellentwicklung war es, Divergenzen konkurrierender Strukturmodelle der Intelligenz, z.B. von Spearman, Thurstone und Meili, zu erklären und diese Modelle zu einem Gesamtmodell zu integrieren. Zu diesem Zweck wurden alle bis Mitte der siebziger Jahre in der einschlägigen Literatur beschriebenen Intelligenztestaufgaben inventarisiert, insgesamt mehr als 2000. Der Aufgabenpool wurde dann in mehreren Schritten reduziert, wobei versucht wurde, die Vielfalt der kognitiven Anforderungen zu erhalten. Aufgaben wurden eliminiert, wenn ihre Anforderungen sehr ähnlich waren. Die verbliebenen 98 unterschiedlichen Aufgabentypen wurden im nächsten Schritt einer großen Stichprobe von Berliner Abiturienten im Abstand von 4 Jahren zweimal vorgegeben und auf der Grundlage dieser Daten das Modell entwickelt.
Das BIS ist ein hierarchisches und bimodales Strukturmodell der Intelligenz und basiert auf drei Grundannahmen:
An jeder Intelligenzleistung sind (neben anderen Bedingungen) alle intellektuellen Fähigkeiten beteiligt, allerdings mit deutlich unterschiedlichen Gewichten.
Intelligenzleistungen und Fähigkeitskonstrukte lassen sich unter verschiedenen, Modalitäten genannten Aspekten klassifizieren. Bislang wurde eine bimodale Klassifikation in Operationen und Inhalte spezifiziert.
Fähigkeitskonstrukte sind hierarchisch strukturiert, d.h. sie lassen sich unterschiedlichen Generalitätsebenen zuordnen.
Abb.: Berliner Intelligenzstrukturmodell (BIS)An der Spitze der Fähigkeitshierarchie steht als Integral aller Fähigkeiten die Allgemeine Intelligenz (AI; die BIS-spezifische Operationalisierung von "g"), auf der Ebene darunter sind sieben hochgradig generelle Fähigkeitskonstrukte in zwei Modalitäten, Operationen und Inhalte, angeordnet (Abb. 1). Das Hierarchiekonzept des BIS betrifft die Rangfolge der Generalitätsgrade der Fähigkeitskonzepte und findet sich in vergleichbarer Weise z.B. in der Strukturtheorie von Carroll (1993). Das Modalitätskonzept hat große Ähnlichkeit mit dem Facettenkonzept von Guttmann (1965) und betrifft unterschiedliche Aspekte, nach denen Leistungen und Fähigkeiten klassifiziert werden können. Die Zellen des BIS liefern einen Orientierungsrahmen für Weiterentwicklungen und für die Lokalisierung unterschiedlicher Tests, die in einen umfassenderen Kontext eingeordnet werden können. So konnte beispielsweise gezeigt werden, daß g-Tests wie CFT und APM in die Zelle KF, ZVT und Aufmerksamkeitstests wie FAIR und d2 in B-Zellen klassifiziert werden können. Eine Besonderheit des BIS ist ferner, daß Kreativität, soweit mit psychometrischen Methoden faßbar, unter das Dach der Intelligenz integriert wird.
Die Geltungsbereiche des Modells wurden in der Zwischenzeit sukzessive ausgelotet. Das BIS konnte dabei auch mit anderem Aufgabenmaterial repliziert werden, etwa mit den "Kit of Reference Tests for Cognitive Factors" von French, Ekstrom und Price (1963), einer Sammlung von Markiertests der empirisch bestgesicherten Intelligenzfaktoren. Ferner auch mit den wichtigsten deutschsprachigen Intelligenztests, was seinen Geltungsanspruch auf der Generalitätsdimension belegt (Jäger & Tesch-Römer, 1988). Auf der Universalitätsdimension konnten Belege für die Gültigkeit des Modells in der Population Jugendlicher und junger Erwachsener, auch in kulturübergreifenden Studien (Chile, Brasilien), geliefert werden.
Inhalte (erfaßte Merkmale bzw. Dimensionen):
Operative Fähigkeiten:
K Verarbeitungskapazität: Verarbeitung komplexer Informationen bei Aufgaben, die nicht auf Anhieb zu lösen sind, sondern Heranziehen, vielfältiges Beziehungsstiften, formallogisch exaktes Denken und sachgerechtes Beurteilen von Informationen erfordern. K umfaßt die Fähigkeiten zum induktiven und deduktiven Denken und wird in der englischsprachigen Literatur als "Reasoning" bezeichnet. E Einfallsreichtum: Flexible Ideenproduktion, die Verfügbarkeit vielfältiger Informationen, Reichtum an Vorstellungen und das Sehen vieler verschiedener Seiten, Varianten, Gründe und Möglichkeiten von Gegenständen und Problemen voraussetzt, wobei es um problemorientierte Lösungen geht, nicht um ein ungesteuertes Luxurieren der Phantasie. M Merkfähigkeit: Aktives Einprägen und kurzfristiges Wiedererkennen oder Reproduzieren von verschiedenartigem Material. B Bearbeitungsgeschwindigkeit: Arbeitstempo, Auffassungsleichtigkeit und Konzentrationskraft beim Lösen einfach strukturierter Aufgaben von geringem Schwierigkeitsniveau.
Inhaltsgebundene Fähigkeiten:
V Sprachgebundenes Denken: Grad der Aneignung und der Verfügbarkeit des Beziehungssystems Sprache. N Zahlengebundenes Denken: Grad der Aneignung und der Verfügbarkeit des Beziehungssystems Zahlen. F Anschauungsgebundenes, figural-bildhaftes Denken: Einheitsstiftendes Merkmal scheint hier die Eigenart des Aufgabenmaterials zu sein, dessen Bearbeitung figural-bildhaftes und/oder räumliches Vorstellen erfordert.
AI Allgemeine Intelligenz: Das Integral aller sieben Fähigkeiten. Subtests
Die Gesamtform des Tests besteht aus 45 verschiedenen Aufgabentypen und einer warming up-Aufgabe, die nicht in die Auswertung eingeht. Es handelt sich um je 9 B- und M-Aufgaben, 12 E- und 16 K-Aufgaben, die wiederum gleichmäßig auf die 3 Inhaltsbereiche aufgeteilt sind. Die meisten Aufgabentypen bestehen aus einer Reihe typgleicher, aber unterschiedlicher Einzelaufgaben. Die Klassifikation der Aufgaben in die 12 Zellen des BIS gibt Tabelle 1 wieder. Die Baukastenanordnung erlaubt es, daß jede Aufgabe zur Messung einer operativen und einer inhaltsgebundenen Fähigkeit verwendet werden kann sowie zur Messung der Allgemeinen Intelligenz. Die mehrfache Verwendung der Testleistungen steht in Übereinstimmung mit den theoretischen Annahmen des BIS und spart zudem Testzeit.
Der Kurztest besteht aus 15 Aufgaben, die zur Messung der Allgemeinen Intelligenz (AI-S; 15 Aufgaben, je 2 für die drei K-Zellen und je eine für die anderen neun Zellen) und der Verarbeitungskapazität (K-S; 6 Aufgaben, je 2 pro Zelle) verwendet werden. Die Kurzskala AI-S basiert somit auf der ganzen Bandbreite kognitiver Anforderungen, die im BIS-Modell spezifiziert werden, und nicht nur auf einer homogenen Skala."
[Quelle: Dietrich Wagener. -- http://www.psychologie.uni-mannheim.de/psycho2/prod/bis/bis4.htm. -- Zugriff am 2005-09-14]
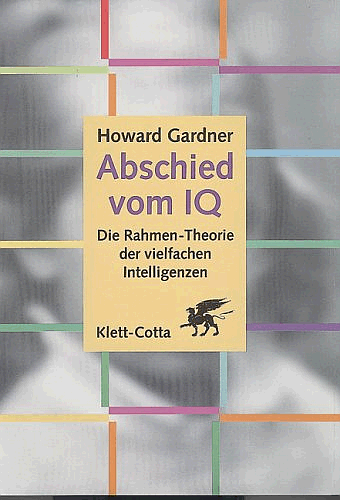
Abb.: Einbandtitel
Howard Gardner wirbelte mit seiner Theorie multipler Intelligenzen ziemlich Staub auf:
Gardner, Howard <1943 - >: Frames of mind : the theory of multiple intelligences. -- London [u.a.] : Heinemann, 1983. -- X,438 S. -- 0-434-28245-6
deutsch:
Gardner, Howard <1943 - >: Abschied vom IQ : die Rahmentheorie der vielfachen Intelligenzen. -- Stuttgart : Klett-Cotta, 1994. -- 395 S. ; 22 cm. -- (Greif-Bücher). -- Originaltitel: Frames of mind. -- ISBN: 3-608-91698-9. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
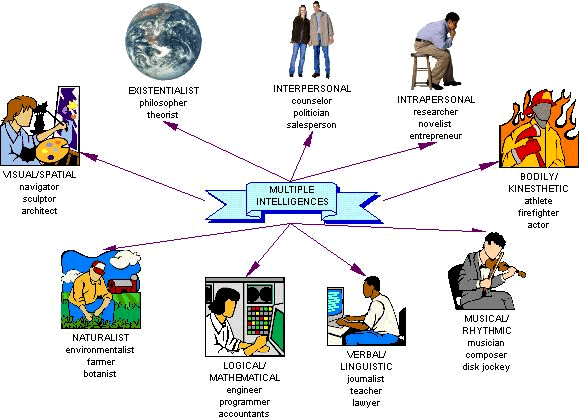
Abb.: Multiple Intelligenzen
[Bildquelle:
http://wik.ed.uiuc.edu/index.php/Intelligence(s) . -- Zugriff am 2005-09-14]
Er behauptet, dass es im alltäglichen Verhalten verschiedene Intelligenzen gibt:
Gardners Theorie ist eine allgemeine Fähigkeitstheorie, die auch den klassischen Intelligenzbereich enthält.
|
Wilhelm Busch (1832 - 1908): Maler Klecksel |
Hohe Intelligenz ist für manche Formen der Kreativität zwar notwendige, aber keineswegs hinreichende Voraussetzung (intelligente Langweiler). Daneben gibt es auch das Phänomen des idiotischen Genies, d.h. hoher Kreativität in einem Bereich (z.B. Malerei) bei unterdurchschnittlicher Allgemeinintelligenz. Das Schlimmste sind allerdings dumme Pseudokreative, Scharlatane und Wichtigtuer.
Die Forderung nach Kreativität findet sich in vielen Stellenanzeigen.
Kreativität gehört heute zu den social skills, die jemand haben muss, weshalb in den verschiedensten Studienordnungen steht, dass Kreativität gefördert werden soll. - (obwohl man sich beim Unterrichten von Kreativität schwer tut).
Kreativitätskomponenten:
Besteht aus zwei Komponenten:
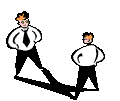
Abb.: Durchsetzungsfähigkeit (©MS Office)

Abb.: Beziehungsfähigkeit (©MS Office)
Hat zwei Aspekte

Abb.: Schwangerschaftsbauch-Einfühlungs-Simulator ("The Empathy Belly"
® Pregnancy Simulator)
[Bildquelle:
http://www.empathybelly.org/home.html. -- Zugriff am 2005-10-31]

Abb.: Kann sie die schwierige Situation meistern? (©MS
Office)
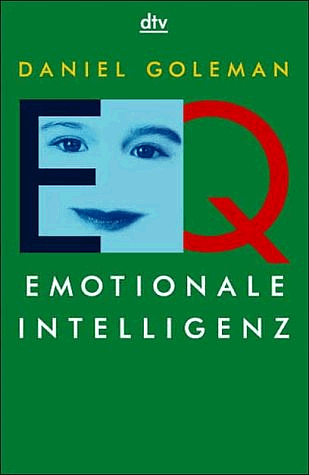
Abb.: Einbandtitel
Daniel Golemann machte den Begriff emotionale Intelligenz (emotional intelligence) populär.
Goleman, Daniel <1946 - >: Emotional intelligence. -- New York : Bantam Books, 1995. -- XIV, 352 S. : Ill. ; 25 cm. -- ISBN: 055309503X
deutsch:
Goleman, Daniel <1946 - >: Emotionale Intelligenz. -- München [u.a.] : Hanser, 1996. -- 423 S. ; 22 cm. -- Originaltitel: Emotional intelligence. -- ISBN: 3-446-18526-7. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Das Konzept stammt von Peter Salovey.
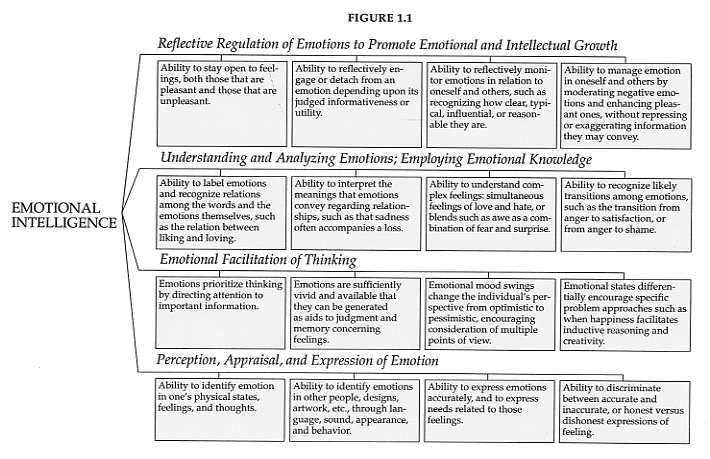
Abb.: Emotional intelligence nach Peter Salovey
[Bildquelle:
http://emotions.psychologie.uni-sb.de/vorlesung/emo_intell/emo_iq.html. --
Zugriff am 2005-09-14]
In der neuen Fassung werden bei emotionaler Intelligenz vier Fähigkeitsbereiche unterschieden:
Wahrnehmung von Emotionen bei sich und anderen, emotionale Ausdrucksfähigkeit
Förderung des Denkens durch Emotionen
Verstehen und Analysieren von Emotionen
Regulation von Emotionen
"Setzen Sie Ihre emotionale Intelligenz ein Wer im Leben Erfolg haben will, muss das Alphabet der Gefühle beherrschen. Das sagte Daniel Goleman in seinem Bestseller «Die emotionale Intelligenz». Wie man seine Gefühle auch noch trainiert und gewinnbringend im Arbeitsleben einsetzt, schreibt er in «EQ2, Der Erfolgsquotient». Ein Gespräch mit dem Erfolgsautoren.
[...]
«Brückenbauer»: Daniel Goleman, seit der Publikation Ihres ersten Bestsellers «Die emotionale Intelligenz» hat sich Ihr Konzept durchgesetzt...
Daniel Goleman: ... und es wurde oft sehr schlecht eingesetzt. Bei den Unternehmen, die das Konzept der emotionalen Intelligenz aufgenommen und in ihre Ausbildung integriert haben, wurde es oft missbraucht. Das Konzept ist zum Trend geworden. Emotionale Intelligenz musste für alles herhalten: für die Entwicklung der Arbeit im Team und der Führungsqualitäten, für die Förderung des Kundendienstes und der Selbstverwirklichung der Angestellten und so weiter.
Es wurden wahllos Seminare angeboten, Konferenzen gegeben, Ateliers und Wochenendkurse organisiert... Einige Firmen haben bedeutende Beträge in diese Ausbildungsmethoden investiert, oft ohne das geringste Resultat.Aber nach Ihrer Ansicht hätte dieses Konzept doch ein Allheilmittel sein sollen ?
Tatsächlich. Nur besteht das Problem darin, dass emotionale Intelligenz nicht in Kursen, Seminaren, Konferenzen und so weiter vermittelt werden kann. Sie kann nicht verordnet werden. Man darf nicht vergessen, dass emotionale Intelligenz andere Schaltkreise des Gehirns durchläuft als jene, welche die Rationalität anlegt. Jedes Ausbildungsprogramm, das diese Unterschiede vernachlässigt, ist zum Scheitern verurteilt.
Was also ist zu tun?
Zunächst muss man sich einprägen, dass emotionale Intelligenz am Arbeitsplatz selbst gelernt und geübt wird. Und dass sie ständigen Einsatz erfordert. Das lernt man nicht wie das Einmaleins und auch nicht von heute auf morgen. Da ist monatelange Arbeit an sich selbst gefragt.
Trotzdem sprechen Sie von einer guten Nachricht, weil nämlich emotionale Intelligenz, im Gegensatz zum unveränderlichen Intelligenzquotienten, lernbar ist.
Genau, sie kann trainiert werden. Nehmen wir einen Mitarbeiter, der sich nur um sich selbst kümmert und sich nicht die Zeit nimmt, herauszufinden, ob die Kolleginnen und Kollegen seine Hilfe brauchen: «Solange ich gut mit meiner Arbeit zurechtkomme, können die andern zum Teufel gehen!» Das sind mentale Gewohnheiten, von denen man sich befreien muss. Dies ist schwer zu erreichen, weil solche Gewohnheiten in neuronalen Schaltkreisen festgeschrieben sind. Es braucht Anstrengung, neue Schaltkreise anzulegen und so weit zu entwickeln, dass sie im Verhalten die alten überlagern und dass man, ohne nachzudenken, die richtige Wahl trifft.
Es gibt also kein simples Rezept?
Nein, denn im Grunde genommen entspricht die emotionale Intelligenz dem, was man früher «Reife» nannte. Sie ist ein Produkt der Erfahrung und der Lebensschule ...
Ja, aber was unterscheidet dann emotionale Intelligenz von eben solchen Gemeinplätzen?
Die Tatsache, dass in der anspruchsvollen Welt eines heutigen Unternehmens die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Stärken und Schwächen besser sichtbar geworden sind als noch vor Jahren, und zwar aufgrund der Restrukturierungen und dem weit verbreiteten Personalabbau. Schwächen fallen sofort auf. Das Konzept der emotionalen Intelligenz hilft dabei, zu verstehen, was in einem Unternehmen - von der untersten bis zur obersten Ebene - nicht funktioniert. Es geht um Methoden der Bewusstwerdung. In den Vereinigten Staaten tauchte deshalb ein neuer Beruf auf, das Personal Coaching: Man lässt sich von jemandem coachen, der einen bei heiklen Fragen unterstützt.
Sie haben während dreier Jahre eine Studie zu diesem Thema geleitet...
Ich habe mit ungefähr 500 Firmen gearbeitet. Diese Firmen haben beobachtet, dass die emotionale Intelligenz doppelt so stark an ihrem Erfolg beteiligt ist wie Intelligenzquotient und Sachverstand zusammengenommen. Dies gilt für alle Ebenen des Unternehmens. Auf der Ebene des Topmanagements kann man sogar sagen, dass die emotionale Intelligenz zusammen mit emotionalen Kompetenzen 85 bis 90 Prozent der Erfolgsfaktoren ausmacht!
Und was ist mit dem logischen Denkvermögen und mit den erworbenen Kenntnissen?
Dies sind Elemente, welche vor allem im Moment der Bewerbung und Einstellung eine Rolle spielen. Später sind weniger die intellektuellenund fachlichen Fähigkeiten entscheidend als die emotionalen. Was Intelligenz, Kenntnisse und Diplome betrifft, so unterscheidet man sich kaum von seinen Kolleginnen und Kollegen. Aber auf der Ebene der emotionalen Intelligenz kommen Diskrepanzen zum Vorschein.
Wie würden Sie ein emotional intelligentes Unternehmen umschreiben?
Ein solches Unternehmen beruht auf der emotionalen Intelligenz der Individuen und Teams, aus denen es besteht. Diese Intelligenz müsste auf allen Ebenen der Organisation vorhanden sein. Sie hängt vom Gespür für den Enthusiasmus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, oder für deren Unzufriedenheit. Eine emotional intelligente Firma erahnt die Bedürfnisse ihrer Kundschaft, und sie kennt den Markt auswendig. Diese Firma ist flexibel und fähig, die Bedingungen dieses Marktes zu beeinflussen und dabei so vorzugehen, dass sie ihre Ziele erreicht, wenn nötig durch Einflussnahme auf die staatliche Gewalt.
Sie sagen, dass es mit emotionaler Intelligenz allein nicht getan ist, sondern dass man emotionale Kompetenzen entwickeln muss?
Die emotionalen Kompetenzen ergeben sich aus Verhaltensweisen, die auf der emotionalen Intelligenz beruhen. Angenommen, Sie hätten die Gabe, Empathie zu empfinden: Empathie ist eine Eigenschaft, die zur emotionalen Intelligenz gehört. Aber reicht sie aus? Werden Sie sich deshalb auf dem Gebiet der Kundenbetreuung auszeichnen? Nein. Andere Qualitäten müssen ins Spiel kommen, damit die Empathie ihre Wirkung entfalten kann: die Art, die Anliegen der Kundinnen und Kunden zu erfassen, sich in sie hineinzuversetzen, ihre Bedürfnisse vorwegzunehmen. Kurz, Sie müssen Ihre emotionale Intelligenz anwenden.
Ein Paradox unserer Zeit: Die Unternehmen verlangen emotionale Beteiligung von ihren Angestellten, und gleichzeitig entlassen sie Angestellte Knall auf Fall.
Das ist tatsächlich so. Aber selbst angesichts dieser Perspektive glaube ich, dass die emotionale Intelligenz dazu beitragen kann, besser zu überleben. Einerseits, weil sie vielleicht hilft, bei Personalabbau zu den «Überlebenden» zu gehören. Andererseits erweist sich ein guter gefühlsmäßiger Umgang mit der Situation gerade dann als wichtig, wenn man nicht zu den «Überlebenden» gehört. Untersuchungen haben gezeigt, dass in diesem Fall Leute mit einem hohen EQ in kürzerer Zeit die besseren Stellen finden.
Und Sie, der Guru der emotionalen Intelligenz, wären Sie ein guter Topmanager?
Ehm, jedem sein Zuständigkeitsbereich. Ich glaube, dass ich als Kommunikator eine Nische ausfülle, die es mir erlaubt, sehr leistungsfähig zu sein. Ob ich die Qualitäten eines Topmanagers habe? Auf jeden Fall zweifle ich, dass ich die erforderlichen Kenntnisse in geschäftlicher Hinsicht mitbringe: Ich wäre auf die Unterstützung einer Unmenge von Leuten angewiesen. (Lacht.) Nein, es geht mir gut, dort, wo ich bin.
Jean-François Duval/bas"
[Quelle: Der Brückenbauer / Migros. -- 1999-04-13. -- Online: http://www.migrosmagazin.ch/pdfdata/pdfarchiv/bb/Bb-1999/15/BB15s52.pdf. -- Zugriff am 2005-09-14]
Das Anschlussbedürfnis setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:
Demgemäß kann man vier Persönlichkeitstypen unterscheiden:
| Annäherungstendenz | Vermeidungstendenz | |
|---|---|---|
| niedrig | hoch | |
| niedrig | ungesellig | vermeidend |
| hoch | gesellig | schüchtern |
- "Ungesellige Personen haben nur ein geringes Bedürfnis nach Anschluss und fürchten auch keine Ablehnung; sie haben einfach andere Interessen. Sie lesen z.B. lieber ein Buch, als dass sie auf eine Party gehen.
- Gesellige Personen haben ein starkes Bedürfnis nach sozialem Anschluss und keine Angst davor, abgelehnt zu werden; deshalb realisieren sie ihr Anschlussbedürfnis auch im Verhalten. Sie sind häufig auf Partys zu finden.
Abb.: Gesellig und ungesellig
[Bildquelle: http://sites.ausbildernetz.de/c.php/ausbilderportal_V1/Situation_6/Situation6.rsys. -- Zugriff am 2005-09-14]- Schüchterne Personen sind durch einen Annäherungs-Vermeidungs-Konfiikt gekennzeichnet: Sie suchen nach Anschluss, fürchten aber gleichzeitig Ablehnung. Auf Partys stehen sie oft beobachtend in der Ecke. Ihr Verhalten wird leicht fehlinterpretiert als mangelndes soziales Interesse.
Abb.: Buchtitel- Vermeidende Personen schließlich haben kein Bedürfnis nach sozialem Anschluss (vielleicht hatten sie es früher, haben inzwischen aber die Hoffnung aufgegeben) und fürchten sich vor Zurückweisung."
[Quelle: Asendorpf, Jens <1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit. -- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S. 219. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]

Abb.: Heinrich Zille (1858 - 1929): Der Philosoph: "Kinder, lernt nischt,
sonst müsst ihr arbeeten!"
Wie stark Arbeitslosigkeit von der Ausbildung abhängt, zeigt folgende Grafik:
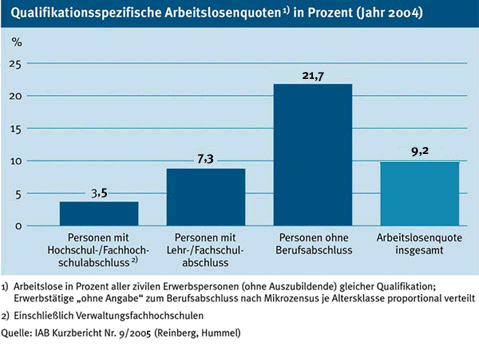
Abb.: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten 2004
[Quelle der Abb.:
http://infobub.arbeitsagentur.de/bbz/modul2/modul_2.html. -- Zugriff am
2005-11-06]
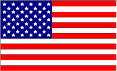
USA-spezifisch
Abb.: Community Service, Indiana University
[Bildquelle: http://www.indiana.edu/~iubhonor/honorvol/CSP.php. -- Zugriff am 2005-09-12]"Soziales Engagement sollte auf keinen Fall nur aus der Absicht des eigenen Vorankommens motiviert sein, sondern als selbstverständlich frühzeitig in unseren Lebensläufen verankert werden. Über das aus den USA stammende Corporate Volunteering hinaus wird hoffentlich bei uns auch der in den USA praktizierte Community Service einen Platz in den Viten unserer Studenten finden."
[Quelle: Frank Busse: Leserbrief. In: Manager Magazin. -- ISSN 0047-5726. -- 35. Jg. (2005), Nr. 9. -- S. 166.]
Abb.: Poster University Community Service Center, University of Chicago.
[Bildquelle: http://communityservice.uchicago.edu/. -- Zugriff am 2005-09-12]

Abb.: Praktisches Interesse: Tüftler-Trio von Bayer MaterialScience erhält
111.000 Euro
[Bildquelle:
http://www.baynews.bayer.de/baynews/baynews.nsf/id/376748253C605D00C1256FEA0046E522.
-- Zugriff am 2005-11-06]
Sechs Faktoren des beruflichen Interesses
Diese sechs Faktoren lassen sich auf zwei Dimensionen abbilden:
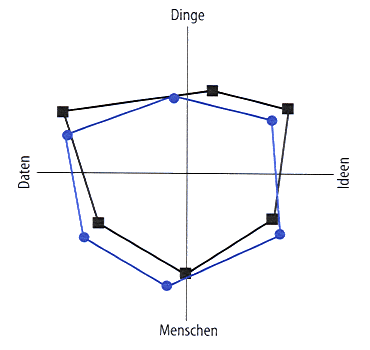
Abb.: Interessenstrukturen zweier Gruppen
[Bildquelle: Asendorpf, Jens
<1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit.
-- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004.
-- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S.
219. -- {Wenn Sie
HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de
bestellen}]
|
Ein kluger Mann verehrt das Schwein; Wilhelm Busch |
1973 schlug Milton Rokeach nach der Durchsicht der Literatur zu Werthaltungen eine Liste mit zweimal 18 Werten vor, den Rokeach Value Survey (RVS). 18 Endziele (beschrieben durch Substantive) und 18 instrumentelle Ziele (beschrieben durch Adjektive) sollen jeweils in eine individuelle Rangfolge nach der Wünschbarkeit für sich selbst und andere gebracht werden. Diese Werthaltungen können auch aufgrund der Äußerungen von Personen in Reden, Büchern usw. inhaltsanalytisch erfasst werden.
| Endziele (Lebensziele) |
Instrumentelle Ziele (Verhaltensmöglichkeiten) |
|---|---|
|
|
[Vorlage der Tabelle: Asendorpf, Jens <1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit. -- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S. 240. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Abb.: Obwohl in deutschen Schulen als "Sekundärtugend" verpönt, ist Höflichkeit gerade in einer globalisierten Wirtschaft eine oft erwartete Tugend
DDR, aber hoffentlich nicht nur DDR[Bildquelle: Smolka, Karl: Gutes Benehmen von A - Z : Alphabetisch betrachtet / Karl Smolka. Mit 109, teils sinnigen, teils unsinnigen Zeichn. von Heinz Bormann und 75 Fotos von Konrad Hoffmeister. -- Berlin <Ost> : Verlag Neues Leben, 1957. -- 359 S. : Ill. -- Nach S. 128]
Aus Anwendung des RVS (Rokeach VAlue Survey) in 20 Kulturen entwickelte S. H. Schwartz 1992 zehn interkulturell feststellbare homogene Wertbereiche:
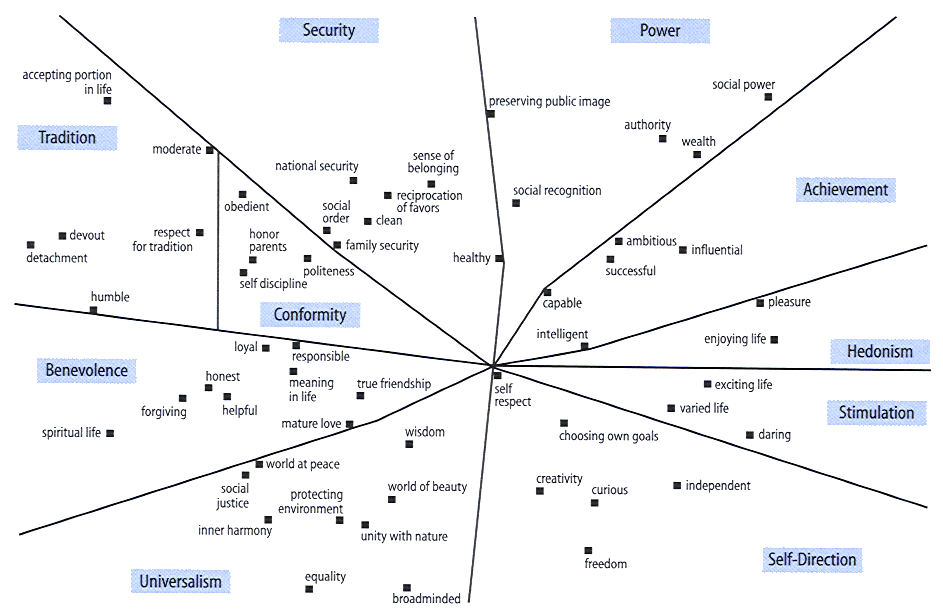
Abb.: Die zehn interkulturell gültigen Wertebereiche mit den zugehörigen Werten.
Der Abstand zwischen den einzelnen Werten gibt ihre mittlere Ähnlichkeit über
alle befragten Personen an.
[Quelle der Abb.: Asendorpf, Jens <1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit. -- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- S. 242. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Siehe auch den World Value Survey:
Entwicklungsländerstudien / hrsg. von Margarete Payer. -- Teil I: Grundgegebenheiten. -- Kapitel 12: Überzeugungen und Einstellungen / zusammengestellt von Alois Payer. -- URL: http://www.payer.de/entwicklung/entw12.htm
Beachte: zwischen Werthaltungen/Einstellungen und dem Verhalten in einer bestimmten Situation besteht oft nur ein geringer Zusammenhang.

Abb.: Mein Kopf gehört mir
[Bildquelle:
http://www.labournet.de/solidaritaet/kopftuch.html. -- Zugriff am
2005-11-07]
Obwohl Weltanschauung und Religion das Verhalten beeinflussen, kann man auch aus Weltanschauung und Religion nicht allgemein aufs Verhalten schließen. Die meisten Menschen sind sehr selektiv in dem, was sie gemäß ihrer Weltanschauung oder Religion verwirklichen. Die Moral der "Sonntagsreden" und das Leben gehen meist weit auseinander. Heuchelei ist ein Grundzug der Menschen. (Siehe dazu: Antiklerikale Karikaturen und Satiren XXVI: Moralapostel und Heuchelei / kompiliert und hrsg. von Alois Payer. -- URL: http://www.payer.de/religionskritik/karikaturen26.htm ).
|
|
|
"Supramensch und Typ A
Gibt es denn niemanden, der als Mensch von seiner Seele her zu den Suprasystemen passt?
Ist denn das Suprasystem universell psychisch ausbeutend?
Es gibt sie, die Supramenschen.
Ich habe sie schon im Buch E-Man beschrieben. Sie sind in der Psychologie unter Type A bekannt.
Das Ursprungsbuch über Type A Behavior and Your Heart stammt von Meyer Friedman und Ray Rosenman. Diese Autoren interessierten sich für die Herzattacken bei bestimmten Charakteren und beschrieben Menschen von Typ A und Typ B. Menschen von Typ A sind fast stresssuchend, die von Typ B stressvermeidend. Ich beschreibe hier kurz die Eigenschaften von Typ A. Sie sehen dann fast blind, dass diese Menschen das Suprasystem repräsentieren.Typ A ist so:
- Ehrgeiziger Leistungsmensch
- Ziemlich aggressiv
- Schnelle Arbeit
- Ungeduldig
- Ruhelos
- „Hyper"-wachsam
- Aufstiegswillig
- Angespannt, fühlt Druck
- Spricht hektisch
Typ A versucht, alles schnell abzuarbeiten, hat kaum Zeit, sich über Erreichtes zu freuen, wird bei „Kaffeegesprächen" ungeduldig. In seinen Augen steht hektisch geschrieben: „Hört auf zu quatschen. Kommt zum Punkt. Lasst uns vorankommen. Keine Zeit verschwenden!" Ihn plagt ein bohrendes Gefühl der Zeitknappheit und der Dringlichkeit. Er vergleicht unablässig seine Leistungen mit denen von anderen. Er setzt sich immer hohe, sukzessiv steigende Standards, denkt pausenlos darüber nach, ob etwas verbessert werden könnte. Andere Menschen sagen oft zu ihm: „Sei ruhig. Du versuchst zu viel." Typ A will gewinnen, er zeigt es mehr oder weniger offen. Er ist dafür bereit, aggressiv zu werden und zu kämpfen („competitive with free-floating hostility"). Er stürzt sich in viele Aufgaben gleichzeitig und bearbeitet sie oft gleichzeitig (hängt am Handy, am Computer, an der Mailbox, an der Sekretärin und macht überall Stress: jetzt!). Er ist dauernd aggressiv gegen Menschen, die nicht wie er Typ A sind, sich also seiner Meinung nach nicht richtig bemühen. Er entscheidet sofort und schneidig. Andere sagen: hastig. Er hat nie das Gefühl, „eine Arbeit getan" zu haben und sich eine Pause oder gar einen Urlaub erlauben zu dürfen. „Ich muss leider eine Mexikoreise machen. Es geht nicht anders. Wir hatten seit zehn Jahren keinen Urlaub. Meine Frau hat mit Scheidung gedroht. Ich bat sie, doch allein zu fahren, mit den Kindern. Sie ist sadistisch, es geht ihr wohl um Macht oder ums Prinzip. Mexiko ist auch schön ohne mich. Sie fragt, ob wir verheiratet sind. Alle diese Probleme spielen doch gar keine Rolle. Ich muss den Mega-Vertrag holen. Ich habe mir zwei Tri-Band-Satelliten-Handys gekauft." Typ A ist ständig im Wettbewerb. „Sie haben drei Kreditkarten! Ich habe fünf, benutze aber nur vier, weil die fünfte nur golden, nicht Platin ist. Mein Anbieter will es nicht kostenlos machen. Da schneide ich ihn."
Im Stress Management Sourcebook von J. Barton Cunningham fand ich den erhellenden Satz:„Type A behavior is not a personality disorder, but might be called a socially acceptable Obsession."
Im Klartext: Das Verhalten von Typ A gilt nicht als Persönlichkeitsstörung, sondern nur als eine gesellschaftlich akzeptable Manie oder Zwangsvorstellung/Besessenheit. In meinem Manual DSM IV über Mental Disorders, in dem Diagnosekriterien für psychische Störungen wie Standards festgehalten werden, kommt der Term Typ A nicht im Stichwortverzeichnis vor. Im Buch Disorders of Personality: DSM-1V and Beyond von Theodore Millon und Roger Dale Davis, das nur von charakterlichen Persönlichkeitsstörungen handelt, die im DSM nur einen kleinen Teil ausmachen, ist auf über 800 eng bedruckten, mehrspaltigen Seiten nur ein einziger Satz zu Typ A zu finden - eine Bemerkung, dass der Typ A in die Nähe der Zwanghaftigkeit gehöre („conforming pattern").
Cunningham schreibt über die Hauptprobleme, die die reineren Typ-A-Menschen haben:
- Hyperaggressivität
- Gefühl der Dringlichkeit (time urgency)
- Tendenz zur Übererfüllung der Ziele
- „Polyphasic Behavior" und Impulsivität
Hyperaggressivität von Typ A: Er hat im Grunde Angst unter dem Druck, unter dem er steht. Druck, zu versagen, die Ziele nicht zu erreichen. Die Angst drückt sich in vermehrter Aggression aus. Auf alle Signale von Unsicherheit und Angst reagiert Typ A mit Leistungswillen, Aktionen und Aktionsplänen, der Annahme von Herausforderungen. Das führt dazu, dass sich dieser Mensch praktisch ständig in Kampfbereitschaft fühlt oder quasi im Krieg steht. Er will die anderen übertrumpfen, koste es, was es wolle. Er verliert das Gefühl für Effizienz (!).
Dringlichkeitsgefühl: Er hat nie Zeit genug, alles zu tun, was eigentlich getan werden könnte. Er übernimmt tendenziell zu viele Aufgaben. Er versucht, immer mehr in der vorgegebenen Zeit zu erledigen. Er hat es dann stets eilig, um mehr zu erreichen. Dafür plant er ständig die Zeit, setzt sich Deadlines und klare Ziele. Er verordnet sich Regeln und Standards, die einzuhalten sind, alles letztlich mit dem Ziel, noch schneller zu arbeiten und noch mehr zu schaffen.
Tendenz zur Übererfüllung: Er will immer mehr erreichen („drive to achieve more and more"). Durch diesen steten, immer präsenten Drang verliert er das Gefühl für die Freude über das Erreichte. Er sagt zu sich nur kurz: „Gut." Und dann macht er innerlich einen Haken an die Liste und sagt: „O.k., weiter!" Er sammelt Orden, Auszeichnungen, Gehaltserhöhungen, Wein, Möbel, Hunde, immer größere Häuser und Autos oder alles, was Status ausdrücken mag: Die Anzahl der Publikationen, die Punktzahl beim Triathlon. Der Wert muss messbar sein. Wirklich messbar. Nicht in Qualität oder Freude oder Schönheit oder Lust. Typ A sagt: „Das ist nicht handfest."
Polyphasic Behavior & Impulsivität: Impulsive springen auf etwas, ohne alles ganz durchzudenken. Sie haben ja solche Lust, sofort anzufangen. Sie stehen in Gefahr, etwas Wichtiges zu übersehen. Vor Eifer hören sie nicht zu, schon gar nicht auf Warnungen oder Einwände. Sie beginnen zu arbeiten, ohne vorher die Bedienungsanleitung angeschaut zu haben! Typ-A-Menschen arbeiten polyphasisch; das heißt, sie unternehmen viele Arbeiten gleichzeitig. Manager erledigen typischerweise die Post, während sie bei einer Präsentation persönlich anwesend sind. Es gibt einen Werbespot, in dem einem Manager telefonisch von der Gattin deren Scheidungswünsche eröffnet werden. Während er mit seiner Frau „verhandelt", kauft er online Aktien am Computer. Resultat: Er ist unkonzentriert und damit überall gleichmäßig weniger effektiv, gleichzeitig jedoch sehr stolz, alles auf einmal zu schaffen.
Ich interpretiere diese Beschreibung von Typ A jetzt einmal unbekümmert schwungvoll:
Typ A ist wie ein zwanghaft pflichtbesessener Mensch, der den vollen Trieb und seine ganze psychische Energie in das Erreichen von ehrgeizigen Systemtriebzielen setzt.
Das ist der Supramensch.
Das ist Score-Man.
Es ist die gelungene Kreuzung von Willenstrieb und Pflichteifer.
Leider ist der Supramensch instabil, aber für eine Zeit lang können wir ihn in dieser Form benutzen.
Typ-A-Menschen werden von Klinikern untersucht, weil sie Herzprobleme und Stresssymptome zeigen, wie ich sie eben beschrieben habe. Psychologen überlegen, ob es eine Krankheit ist, ein Typ-A-Verhalten zu zeigen!
Typ A wird aber offiziell nicht als gestört angesehen, nur eben als gesundheitsgefährdet.
Wir hetzen also alle Menschen in Richtung von Typ-A-Verhalten und dann trauern wir, dass sie krank werden. Wir beklagen, dass Typ A in seinem zerfressenden Trieb, immer mehr zu erreichen, immer weniger Freude am schon Erreichten hat und seine Triebwut stärker und stärker auslebt. Immerfort vergleicht er, misst er und zählt, ob er weitergekommen ist. Er arbeitet immer länger. Cunnigham schreibt von „self-destruct", von Selbstzerstörung.
Psychologen nehmen nun die armen Supramenschen in Behandlung und lehren sie:
- Sei weniger zeitgetrieben!
- Setze deine Feindseligkeit herab!
- Vergleiche nicht so viel, lass das Messen sein!
- Sei nicht andauernd besorgt und um Selbstwertzuwachs bemüht!
- Lass das Perfektionistische!
- Hör auf, alles zu strukturieren und in Systeme zu pressen!
Was meinen Sie? Wird man Typ A mit solchen naiven Appellen heilen? Wird es ihn beeindrucken, wenn man ihm besorgt mitteilt, dass er Typ A ist?
Er wird doch jubeln, so zu sein! Er ist der Supramensch, wie ihn sich das Suprasystem vorstellt! Er ist der gewünschte Prototyp des Nummer-Eins-Sisyphus."[Quelle: Dueck, Gunter <1951 - >: Supramanie : vom Pflichtmenschen zum Score-Man. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- XIV, 350 S. : Ill., graph. Darst. ; 24 cm. -- ISBN 3-540-00901-9. -- S. 317 - 320. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
"Der Begriff Soziales Milieu (milieu social) stammt von Émile Durkheim und beschreibt die soziale Umgebung, in der ein Individuum aufwächst und lebt. Durkheim unterscheidet zwischen innerem und äußerem sozialen Milieu. Rainer Lepsius hat den Begriff später aufgegriffen um Wahlverhalten zu erklären, er unterscheidet innerhalb der Weimarer Republik drei große sozial-moralisches-Milieus, in welchen die Personen "von der Wiege bis zur Bahre" umgeben waren:
- das liberal-protestantische Milieu
- das sozial-demokratische Milieu
- das katholische Milieu
In der Lebensstil- und Ungleichheitsforschung wurde in den 1980er Jahren der "Milieu"-Begriff spezifiziert und eine Unterscheidung zwischen sozialer Lage, Lebenszielen und Lebensstilen getroffen, die Handlungsmuster zur Erreichung von Lebenszielen beschreiben. Der "Milieu"-Begriff geht davon aus, dass der Lebensstil von Menschen nicht nur aufgrund äußerer Umstände, sondern auch von inneren Werthaltungen geprägt wird. Der Begriff soziales Milieu bezieht sich damit auf Gruppen von Individuen mit ähnlichen Lebenszielen und Lebensstilen und umfasst Mentalität und Gesinnung der Personen. Durch die zunehmende Pluralisierung der Gesellschaften und die Individualisierung der Lebensstile wird die vormals enge Verknüpfung zwischen sozialer Lage und Milieus entkoppelt, auch wenn soziale Milieus weiterhin nach Status und Einkommen hierarchisch eingeordnet werden können.
Das Konzept der sozialen Milieus wurde in der Wahlforschung und in der Marktforschung aufgegriffen und weiterentwickelt. Hier werden unterschiedliche, empirisch gewonnene Milieutypologien verwendet und mit Einstellungen in Verbindung gebracht, die bestimmte Konsumorientierungen und Wahlverhalten hervorbringen.
So wurden am SINUS-Institut für Markt- und Wahlforschung durch über 55.000 Interviews Werte, Einstellungen und Alltagsorientierungen erforscht und eine Typologie von Milieus in der postmodernen deutschen Gesellschaft herausgearbeitet (derselbe Milieuansatz wird von SIGMA benutzt; beide Milieumodelle waren bis in die 1990-er Jahre nahezu identisch):
- Konservativ gehobenes Milieu
- Kleinbürgerliches Milieu
- Traditionelles Arbeitermilieu
- Traditionsloses Arbeitermilieu
- Neues Arbeitermilieu
- Aufstiegsorientiertes Milieu
- Technokratisch-liberales Milieu
- Hedonistisches Milieu
- Alternatives Milieu.
Nach der Wende wurde für die Neuen Bundesländer eine eigene Milieutypologie erarbeitet, da von wesentlichen Unterschiede in der Lebenswelten in Ost- und Westdeutschland ausgegangen werden musste:
- Bürgerlich-humanistisches Milieu
- Traditionelles Arbeiter- und Bauernmilieu
- DDR verwurzeltes Milieu
- Linksintellektuell-alternatives Milieu
- Status- und karriereorientiertes Milieu
- Aufstiegsorientiertes Milieu
- Traditionsloses Arbeitermilieu
- Hedonistisches Milieu
- Modernes Arbeitermilieu
- Modernes bürgerliches Milieu
- Kleinbürgerliches Milieu
Die Typologien wurden von den Sozialwissenschaften übernommen und lösten in den 90er Jahren in der "neuen Sozialstrukturforschung" eine Welle von Lebensstiluntersuchungen aus. Aus den jährlichen Erhebungen des SINUS-Instituts lassen sich Veränderungen seit der Jahrtausendwende erkennen. Die traditionellen Arbeiter- und bürgerlichen Milieus schrumpfen deutlich zusammen, während Milieus mit konventionellen, individualistischen und hedonistischen, bzw. erlebnisbezogenen Einstellungen wachsen. Insgesamt differenzieren sich die Milieus weiter aus.
Im Jahr 2001 hat das Sinus-Institut (jetzt: Sinus Sociovision) ein neues, gesamtdeutsches Milieumodell vorgelegt, das sich deutlich vom vorherigen Modell unterscheidet (s. http://www.sinus-sociovision.de [Zugriff am 2005-11-08]"[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Milieu. -- Zugriff am 2005-11-08]
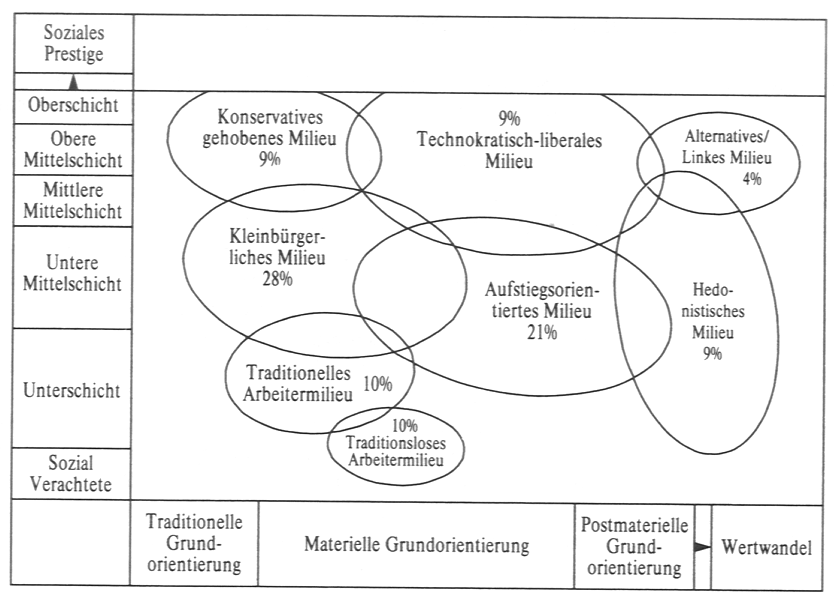
Abb.: Soziale Milieus in der Bundesrepublik: Soziale Stellung und
Grundorientierung (Sinus Institut)
[Bildquelle: Wiswede, Günter: Einführung in die Wirtschaftspsychologie. -- 3., überarbeitete und erweiterte Aufl.. -- München ; Basel : E. Reinhardt, 2000. -- 379 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- (UTB für Wissenschaft ; 8090). -- ISBN 3-8252-8090-X. -- S. 133. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}]
Bei der Beachtung der Nationalität/Kultur einer Person, darf man nicht dem ökologischen Fehlschluss verfallen, indem man aus einer für eine Kultur zutreffenden Aussage auf ein Individuum schließt: etwa aus der richtigen Feststellung, dass Japaner mehr zu Konformität neigen, darauf, dass das Individuum Akemi (明美 ) mehr zu Konformität neigt, nur weil sie Japanerin ist.

Abb.: Aus ihrer Kultur darf man nicht ohne weiteres auf diese Person schließen
(©MS Office)
Aussagen über Kollektive sind nämlich Aussagen über Häufigkeitsverteilungen, wobei die individuelle Streuung sehr breit sein kann, wie folgende Verteilung eines Merkmals in zwei Kulturen zeigt (unter der Annahme, dass es sich um Normalverteilungen handelt):
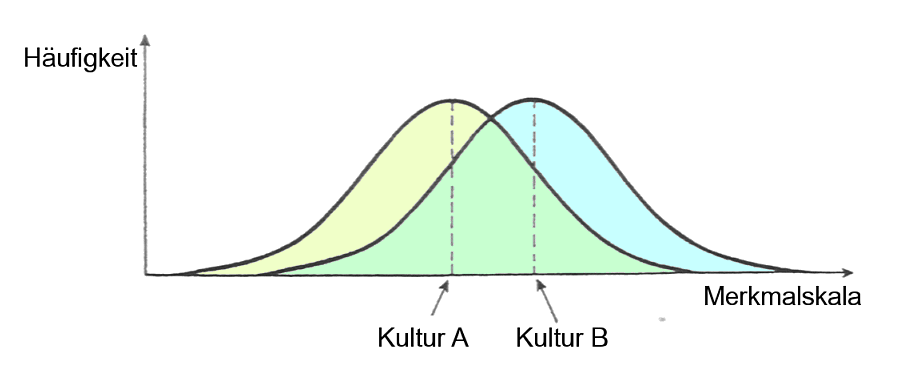
Abb.: Verteilung von Merkmalsausprägungen in zwei Kulturen

Abb.: Georges de Feure <1868 - 1928>: Die Stimme des Bösen oder
Melancholie[= Depression], 1895
Wohl in jedem größeren Betrieb gibt es Mitarbeiter oder Vorgesetzte mit Persönlichkeitsstörungen. Zum ernsthaften Problem werden diese, wenn sie keine Einsicht in die Krankhaftigkeit ihres Zustands haben (z.B. Verfolgungswahn, Größenwahn).
Siehe auch oben:
Persönlichkeitsstörungen werden nach Kapitel V von ICD-10 (Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. -- 10. Revision) klassifiziert und diagnostiziert:
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)
Code Gruppe Wichtiges Beispiel einer Erkrankung F00-F09 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen Demenz (F00-F03) ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen. Das Bewusstsein ist nicht getrübt. Die kognitiven Beeinträchtigungen werden gewöhnlich von Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation begleitet, gelegentlich treten diese auch eher auf. Dieses Syndrom kommt bei Alzheimer-Krankheit, bei zerebrovaskulären Störungen und bei anderen Zustandsbildern vor, die primär oder sekundär das Gehirn betreffen. F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen F20 Schizophrenie Die schizophrenen Störungen sind im allgemeinen durch grundlegende und charakteristische Störungen von Denken und Wahrnehmung sowie inadäquate oder verflachte Affekte gekennzeichnet. Die Bewusstseinsklarheit und intellektuellen Fähigkeiten sind in der Regel nicht beeinträchtigt, obwohl sich im Laufe der Zeit gewisse kognitive Defizite entwickeln können. Die wichtigsten psychopathologischen Phänomene sind Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Wahnwahrnehmung, Kontrollwahn, Beeinflussungswahn oder das Gefühl des Gemachten, Stimmen, die in der dritten Person den Patienten kommentieren oder über ihn sprechen, Denkstörungen und Negativsymptome. F30-F39 Affektive Störungen F32 Depressive Episode Bei den typischen leichten (F32.0), mittelgradigen (F32.1) oder schweren (F32.2 und F32.3) Episoden, leidet der betroffene Patient unter einer gedrückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und Aktivität. Die Fähigkeit zu Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert. Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jeder kleinsten Anstrengung auftreten. Der Schlaf ist meist gestört, der Appetit vermindert. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt. Sogar bei der leichten Form kommen Schuldgefühle oder Gedanken über eigene Wertlosigkeit vor. Die gedrückte Stimmung verändert sich von Tag zu Tag wenig, reagiert nicht auf Lebensumstände und kann von sogenannten "somatischen" Symptomen begleitet werden, wie Interessenverlust oder Verlust der Freude, Früherwachen, Morgentief, deutliche psychomotorische Hemmung, Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust. Abhängig von Anzahl und Schwere der Symptome ist eine depressive Episode als leicht, mittelgradig oder schwer zu bezeichnen. F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen F42 Zwangsstörung Wesentliche Kennzeichen sind wiederkehrende Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Zwangsgedanken sind Ideen, Vorstellungen oder Impulse, die den Patienten immer wieder stereotyp beschäftigen. Sie sind fast immer quälend, der Patient versucht häufig erfolglos, Widerstand zu leisten. Die Gedanken werden als zur eigenen Person gehörig erlebt, selbst wenn sie als unwillkürlich und häufig abstoßend empfunden werden. Zwangshandlungen oder -rituale sind Stereotypien, die ständig wiederholt werden. Sie werden weder als angenehm empfunden, noch dienen sie dazu, an sich nützliche Aufgaben zu erfüllen. Der Patient erlebt sie oft als Vorbeugung gegen ein objektiv unwahrscheinliches Ereignis, das ihm Schaden bringen oder bei dem er selbst Unheil anrichten könnte. Im allgemeinen wird dieses Verhalten als sinnlos und ineffektiv erlebt, es wird immer wieder versucht, dagegen anzugehen. Angst ist meist ständig vorhanden. Werden Zwangshandlungen unterdrückt, verstärkt sich die Angst deutlich. F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
Abb.: Anorexia nervosa
[Bildquelle: http://www.alu.ua.es/s/sm12/index.htm. -- Zugriff am 2005-09-14]F50.0 Anorexia nervosa Die Anorexia ist durch einen absichtlich selbst herbeigeführten oder aufrechterhaltenen Gewichtsverlust charakterisiert. Am häufigsten ist die Störung bei heranwachsenden Mädchen und jungen Frauen; heranwachsende Jungen und junge Männer, Kinder vor der Pubertät und Frauen bis zur Menopause können ebenfalls betroffen sein. Die Krankheit ist mit einer spezifischen Psychopathologie verbunden, wobei die Angst vor einem dicken Körper und einer schlaffen Körperform als eine tiefverwurzelte überwertige Idee besteht und die Betroffenen eine sehr niedrige Gewichtsschwelle für sich selbst festlegen. Es liegt meist Unterernährung unterschiedlichen Schweregrades vor, die sekundär zu endokrinen und metabolischen Veränderungen und zu körperlichen Funktionsstörungen führt. Zu den Symptomen gehören eingeschränkte Nahrungsauswahl, übertriebene körperliche Aktivitäten, selbstinduziertes Erbrechen und Abführen und der Gebrauch von Appetitzüglern und Diuretika.
F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen F60.0 Paranoide Persönlichkeitsstörung Diese Persönlichkeitsstörung ist durch übertriebene Empfindlichkeit gegenüber Zurückweisung, Nachtragen von Kränkungen, durch Misstrauen, sowie eine Neigung, Erlebtes zu verdrehen gekennzeichnet, indem neutrale oder freundliche Handlungen anderer als feindlich oder verächtlich missgedeutet werden, wiederkehrende unberechtigte Verdächtigungen hinsichtlich der sexuellen Treue des Ehegatten oder Sexualpartners, schließlich durch streitsüchtiges und beharrliches Bestehen auf eigenen Rechten. Diese Personen können zu überhöhtem Selbstwertgefühl und häufiger, übertriebener Selbstbezogenheit neigen. F70-F79 Intelligenzminderung Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzminderung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten. Der Schweregrad einer Intelligenzminderung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Diese Meßmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der Intelligenzminderung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab.
Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. Sie können sich, wenn auch nur in geringem Maße, durch Übung und Rehabilitation verbessern. Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen.F80-F89 Entwicklungsstörungen F81.0 Lese- und Rechtschreibstörung Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wiederzuerkennen, vorzulesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, können sämtlich betroffen sein. Bei umschriebenen Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn einige Fortschritte im Lesen gemacht werden. Umschriebene Entwicklungsstörungen des Lesens gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache voraus. Während der Schulzeit sind begleitende Störungen im emotionalen und Verhaltensbereich häufig. F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend F91. Störungen des Sozialverhaltens Störungen des Sozialverhaltens sind durch ein sich wiederholendes und anhaltendes Muster dissozialen, aggressiven und aufsässigen Verhaltens charakterisiert. Dieses Verhalten übersteigt mit seinen gröberen Verletzungen die altersentsprechenden sozialen Erwartungen. Es ist also schwerwiegender als gewöhnlicher kindischer Unfug oder jugendliche Aufmüpfigkeit. Das anhaltende Verhaltensmuster muss mindestens sechs Monate oder länger bestanden haben. Störungen des Sozialverhaltens können auch bei anderen psychiatrischen Krankheiten auftreten, in diesen Fällen ist die zugrundeliegende Diagnose zu verwenden. Beispiele für Verhaltensweisen, welche diese Diagnose begründen, umfassen ein extremes Maß an Streiten oder Tyrannisieren, Grausamkeit gegenüber anderen Personen oder Tieren, erhebliche Destruktivität gegenüber Eigentum, Feuerlegen, Stehlen, häufiges Lügen, Schulschwänzen oder Weglaufen von zu Hause, ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche und Ungehorsam. Jedes dieser Beispiele ist bei erheblicher Ausprägung ausreichend für die Diagnose, nicht aber nur isolierte dissoziale Handlungen.
F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen ICD-10. -- Online: http://icd.web.med.uni-muenchen.de/icd10sv2.0_dimdi/fr-icd.htm. -- Zugriff am 2005-09-13]
Bei seriösen Tests für Berufseignung und Arbeitsplatzeignung wird meist der Korrelationskoeffizient angegeben. Dieser gibt an, wie gut der Test die Eignung voraussagt. Folgender Text erklärt anschaulich, wie ein solcher Wert zu behandeln ist.
"Betrachten wir ein Beispiel! Es geht dabei um Tests für die Auswahl von Verwaltungsangestellten. Man könnte z. B. eine Bewerberin vor die Aufgabe stellen, eine Reihe von Namen in möglichst kurzer Zeit alphabetisch zu ordnen. Eine andere „Probe" mag darin bestehen, den Verlauf einzelner Linien durch ein Gewirr von Linien hindurch zu verfolgen. Die dazu verwendete Vorlage zeigt [die] Abbildung. Links sind zehn nummerierte Kästchen untereinander angeordnet; rechts befinden sich zweimal zehn Kästchen untereinander, die leer sind.
Abb.: Testvorlage für die Aufgabe "Liniengewirr"Von jedem der linken Kästchen läuft eine Linie zu jedem der Kästchenpaare auf der rechten Seite. Die Bewerberin soll nun mit ihren Augen — nicht etwa mit einem Bleistift! — die Linienzüge, die sich mehrfach überschneiden, verfolgen und in dem rechten Kästchen angeben, von welcher Nummer jeder der dort eintreffenden Linienzüge ausgegangen ist. Auf den ersten Blick würde man wohl die Alphabet-Aufgabe für brauchbarer halten, wenn es um die Auslese von Verwaltungsangestellten oder auch von Maschinen-Buchhaltern geht, denn Aufgaben dieser Art müssen in der Büroarbeit häufig genug verrichtet werden. Merkwürdigerweise eignet sich der Alphabet-Test dafür aber keineswegs. Wenn wir uns eine von Null bis Eins reichende Skala anlegen (Abbildung), auf der die Brauchbarkeit von Tests für bestimmte Vorhersagen abgelesen werden kann, erhalten wir für den Alphabet-Test ziemlich genau den Wert Null. Das könnte vielleicht sogar an der „Lebensnähe" dieser Aufgabe liegen. Wer im Büro schon arbeitet oder sich auf eine solche Tätigkeit vorbereitet, hat Ähnliches schon sehr ausgiebig geübt. In diesem Punkt bestehen also zwischen den Bewerbern kaum mehr größere Unterschiede. Wo aber ein Test nicht differenziert, ermöglicht er auch keine Vorhersagen. Besser steht es um die als „Liniengewirr" bezeichnete Aufgabe, die aus dem „MacQuarrie-Test for mechanical ability" stammt. Sie prüft, wie man aus eingehenden Untersuchungen weiß, vor allem das räumliche Vorstellungsvermögen, dessen z. B. der früher erörterte Maschinen-Buchhalter in besonderem Maße bedarf. Dieser zweiten Aufgabe kommt nach den in der einschlägigen Fachliteratur anzutreffenden Ergebnissen (J. Tiffin und E. J. McCormick, 1965) auf unserer Skala ein Wert von etwa 0,45 zu. Was bedeutet nun ein solcher Zahlenwert? Wir bedürfen zur Beantwortung dieser Frage eines Begriffs der Statistik, der in der Psychologie sehr viel verwendet wird. Unter einer „Korrelation" versteht man den Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen, bzw. auch zwischen zwei Reihen von Messwerten.
Abb.: Die Brauchbarkeit von Tests für Vorhersagen, (Die Zahlenwerte sind Korrelations-Koeffizienten)In unserem Fall handelt es sich jeweils auf der einen Seite um Testleistungen und auf der anderen um den Berufserfolg. In ihrem unteren Teil veranschaulicht Abbildung 19 drei verschieden hohe Korrelationen, und zwar die Koeffizienten r = 0,00; r = 0,50 und r = 1,00. Betrachtet werden jeweils sieben Personen (von A bis G), die bezüglich ihrer Testleistungen einerseits und bezüglich ihres Berufserfolges andererseits in zwei Rangreihen gebracht wurden. Die höchste mögliche Korrelation (r = 1,00) ergibt sich in dem am rechten Ende der Skala geschilderten Fall, wo die im Test festgestellte Rangordnung genau der des Berufserfolges entspricht. Das andere Extrem veranschaulicht ganz links in [der] Abbildung eine Korrelation von r = 0,00. Hier rangiert zwar sowohl im Test als auch im Beruf die Person G an letzter Stelle, aber bei den übrigen Personen finden sich sehr viele Überschneidungen; die Person A sinkt z. B. von der ersten Stelle im Test auf die vierte im Beruf ab, während die Person F von der vorletzten Stelle im Test zur ersten im Beruf aufsteigt. Mit einem Test, dessen Vorhersagen sich so schlecht bewähren, wäre niemandem gedient; er ist unbrauchbar. Einige Überschneidungen charakterisieren auch die Korrelation von r = 0,50 in der Mitte der Abbildung, diese halten sich jedoch noch in erträglichen Grenzen. Die hier dargestellten Vorhersagen sind gewiss nicht voll befriedigend, aber tatsächlich liegen die Brauchbarkeitsmaße — man verwendet dafür auch die Ausdrücke „Validität", bzw. „diagnostische Valenz" — sehr angesehener und mit großem Aufwand ausgearbeiteter Tests etwa in diesem Bereich um 0,45. Das muss, auch wenn es peinlich ist, unumwunden eingestanden werden, da wir uns sonst als Psychologen dem Vorwurf der Scharlatanerie aussetzen würden. Da wir nun schon wissen, dass die Aufgabe „Liniengewirr" für unseren Zweck einer Auswahl von Verwaltungsangestellten einigermaßen brauchbar ist, wollen wir uns überlegen, was das für ein Ausleseverfahren bedeutet. Ein Bewerber muss bei diesem Test insgesamt 4 Aufgaben bearbeiten. Auf vier verschiedenen Vorlagen muss er herausfinden, welche Linie am rechten Rand in welchem Kästchen ankommt. Insgesamt kann er also 40 richtige Angaben machen, nämlich 10 auf jeder Vorlage. Soviel schafft aber kaum jemand, da für die gesamte Aufgabe nur 2V» Minuten zur Verfügung stehen. Im Mittel werden 19 Treffer erzielt. Ein Bewerber mit 23 richtigen Aufgaben hat bereits eine Leistung erbracht, die 75 °/o aller Versuchspersonen nicht erreichen. Nur 25 % sind genau so gut wie er oder sogar besser. 27 oder mehr Treffer gelingen von 1000 Versuchspersonen nur 100, das sind 10 %.
Aus dem Brauchbarkeitswert von 0,45 lässt sich nach einem von H. C. Taylor und /. T. Russell (1939) entwickelten Verfahren abschätzen, wieviele für den in Aussicht genommenen Beruf geeignete Personen man in einer Gruppe von Bewerbern erwarten kann, deren Testleistungen über einer bestimmten Trefferzahl liegen.
Tabelle: Der Zusammenhang zwischen Testleistung und Berufseignung bei einer Brauchbarkeit von 0,45Diese Information enthält Spalte unserer Tabelle, wobei wir annehmen wollen, dass sich im allgemeinen jeder zweite Bewerber für diese Tätigkeit eignen würde; unter 1000 Bewerbern wären somit 500 geeignete. Könnten wir uns auf Personen beschränken, die 27 und mehr Treffer erzielt haben, so fänden wir in der auf diese Weise ausgewählten Gruppe 81 °/o geeignete Verwaltungsangestellte. Da unter 1000 Bewerbern aber nur 100 in diesem ' Test so gut abschneiden, befänden sich in der Gruppe mit 27 oder mehr Treffern neben 81 geeigneten Bewerbern auch 19 ungeeignete. In der 200 Personen umfassenden Gruppe mit 22 bis 26 Treffern würden wir bloß 69% Geeignete finden, dass heißt wir würden bei ihrer Einstellung 138 geeignete und 62 ungeeignete Mitarbeiter gewinnen. Fassen wir die beiden Spitzengruppen zusammen und stellen somit alle Bewerber ein, die mindestens 22 Treffer erreicht haben, dann stehen 219 geeigneten Verwaltungsangestellten 81 ungeeignete gegenüber.
Diesen immerhin noch recht erfreulichen Prozentsatz von nunmehr 73 % Geeigneten verdanken wir einem Test, dessen Brauchbarkeit für eine bestimmte Vorhersage im Bereich dessen liegt, was unsere Tests heute im allgemeinen zu leisten vermögen. Hinzugefügt werden muss allerdings, dass uns der Test selbst in keiner Weise eine Aussage darüber erlaubt, ob von den 300 Personen mit mehr als 21 Treffern dieser oder jener individuelle Bewerber zu den 219 Geeigneten oder zu den 81 Ungeeigneten gehört. Wir kennen bloß für alle 300 Bewerber und damit für jeden einzelnen von ihnen eine Wahrscheinlichkeit der Eignung in der Höhe von 73 %.
Die Situation bei der Einstellung dieser Bewerber lässt sich dem Ziehen aus einer Urne vergleichen, die 73 weiße und 27 schwarze Kugeln enthält. Stünde uns kein Test zur Verfügung, befänden wir uns in der erheblich ungünstigeren Lage eines Mannes, der aus einer Urne mit 50 weißen und 50 schwarzen Kugeln eine weiße Kugel zu ziehen hofft. Eine Garantie dafür, dass wir eine weiße Kugel ziehen, bzw. einen geeigneten Mitarbeiter einstellen werden, gibt uns der Test nicht. Ganz allgemein ist deshalb zu sagen, dass unsere Tests uns gewiss nicht „hellsichtig" machen; aber sie reduzieren die Gefahr von Fehlentscheidungen doch ganz beträchtlich. Wie Tabelle 1 zeigt, sinkt die Chance der Auswahl eines geeigneten Bewerbers, wenn die Zahl der Bewerber nicht viel größer ist als die Anzahl der zu besetzenden Arbeitsplätze einer bestimmten Art. In einem solchen Fall müsste man auf Bewerber mit geringeren Testleistungen zurückgreifen. Wollte man sich aber damit zufriedengeben, dass jemand bloß mehr als 16 Treffer erreicht hat, dann würde man zwar 60% aller Bewerber einstellen können, aber in der so ausgelesenen Gruppe würde die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Stellenbesetzung auf 65 % absinken."[Quelle: Hofstätter, Peter Robert <1913 - 1994> ; Tack, Werner H.: Menschen im Betrieb : Zur Sendung Rädchen Im Getriebe. -- Stuttgart : Klett, 1967. -- 178 S. : Ill. ; 22 cm. -- S. 52- 56.]
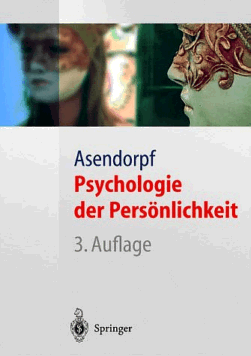
Asendorpf, Jens <1950 - >: Psychologie der Persönlichkeit. -- 3., überarb. und aktualisierte Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- VIII, 517 S. : graph. Darst. ; 25 cm. -- ISBN:3-540-00728-8. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}
Zu Kapitel 2.2.: Motivation