

Zitierweise / cite as:
Payer, Alois <1944 - >: Dharmashastra : Einführung und Überblick. -- 5. Stände (varna) als Modell sozialer Ungleichheit. -- Fassung vom 2003-11-26. -- URL: http://www.payer.de/dharmashastra/dharmash05.htm -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2003-11-26
Überarbeitungen:
Anlass: Lehrveranstaltung 2003/04
Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Teil ist ein Kapitel von:
Payer, Alois <1944 - >: Dharmashastra : Einführung und Übersicht. -- http://www.payer.de/dharmashastra/dharmash00.htm
Dieser Text ist Teil der Abteilung Sanskrit von Tüpfli's Global Village Library
Das Sozialsystem der Dharmashâstras lässt sich so beschreiben. Es ist ein vierklassiges, religiös abgesichertes System von Geburtsständen:
Zwischen dem dritten und vierten Stand verläuft die ständetheoretisch bedeutsame Grenze zwischen. Zweimalgeborenen und Einmalgeborenen in religiöser Hinsicht und zwischen Freien und Unfreien in sozialer Hinsicht.
Versucht man ein.: Schema zu entwerfen, das dieser theoretischen Gesellschaftsstruktur zugrunde liegt, so muss man mindestens folgende Aspekte beachten:
Ein Schema, das z.B., nur den ökonomischen Aspekt der Arbeitsteilung berücksichtigt, ergibt die Schwierigkeit, dass die Einteilung in Produzenten, die den Mehrwert produzieren und Nichtproduzenten, die den Mehrwert appropriieren; nicht mit der Einteilung der Ständeordnung übereinstimmt: Vaishyas wird sowohl der primäre Sektor der Produktion als auch der sekundäre Sektor des Handels zugewiesen. Man könnte nun argumentieren, dass die Ständeeinteilung den Zustand einer Zeit wiedergibt, in der Produktion und Vermarktung noch nicht auseinander getreten waren,. Dies ist durchaus möglich, doch gäbe das nur eine historische Erklärung der theoretischen Ständeordnung wieder, nicht aber ihre Struktur zu der Zeit, die uns interessiert. Eine historische Erklärung entbindet nicht von der Pflicht, Struktur und Funktion einer solchen Ordnung in ihrem ausgebildeten Zustand zu verstehen.
Zur vertiefenden Betrachtung des altindischen Ständesystems, erscheint es mir nützlich, einen Blick auf die moderne soziologische Ungleichheitsforschung zu werfen. Selbstverständlich können Kategorien, die für die Bundesrepublik Deutschland in den 1960er-Jahren entwickelt wurden, nicht ohne weiteres auf das alte Indien angewandt werden. Der Zweck der folgenden Darstellung ist aber, das Augenmerk auf die Vielfalt sozialer Phänomene mit einem elementaren Begriffsinstrumentarium zu richten. Motto: "Was man nicht weiß, nimmt man meistens nicht wahr."
Für das Folgende habe ich besonders verwendet:
Bolte, Karl Martin ; Hradil, Stefan: Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland. -- 5. Aufl. -- Opladen : Leske und Budrich, 1984. -- 97 S. : 20 graph. Darst. -- ISBN: 3-8100-0444-8. -- Daraus alle Zitate mit einfacher Seitenangabe
Soziale Schichtung ist ein Sonderfall sozialer Ungleichheit.
Zur begrifflichen Klarheit ist es sinnvoll
zu unterscheiden:
Als Definition von Status diene dabei - sinngemäß angewandt - die folgende: "Die Stellung, die jemand in irgendeiner dieser Abstufungen im Vergleich zu anderen Mitgliedern des jeweils betrachteten Gesellschaftszusammenhangs (Gemeinde , Betrieb , Gesamtgesellschaft, mehrere Gesellschaften usw.) einnimmt, soll als Status bezeichnet werden. Je nachdem um welche Art von Ungleichheit es geht , wird von Einkommensstatus, Bildungsstatus, Status aufgrund von Berufsprestige usw.: gesprochen. Um zu charakterisieren, welcher gesellschaftliche Zusammenhang jeweils zur Betrachtung steht., wird - falls dies zur Klärung notwendig erscheint - vom betrieblichen Einkommensstatus, vom gesellschaftlichen Prestigestatus usw. eines Menschen die Rede sein." (S. 29)
Die Merkmale von Personen kann man inbezug auf Statusrelevanz u. a. so unterscheiden (S. 22, 238):
Als Statusaufbau bezeichne ich die Statusverteilung innerhalb einer bestimmten Ungleichheitsdifferenzierung, Dieser Statusaufbau kann sein:
Bezüglich sozialer Ungleichheit sind unter anderem folgende Fragestellungen
sinnvoll (S. 25f.):
Bei sozialer Ungleichheit kann man u. a. unterscheiden:
Untersucht man soziale Ungleichheit in einem theoretischen oder empirischen Gesellschaftssystem, so ergibt sich die "Erfordernis zunächst jene Dimensionen herauszuarbeiten, die in einem bestimmten Gesellschaftszusammenhang überhaupt Ungleichheit ausdrücken" (S. 27f.), d. h. die ungleichheitsrelevanten Dimensionen.
Soziale Ungleichheiten
Dimensionen sozialer Ungleichheit:
Soziale Ungleichheit (S. 111 - 255):
Prestige als Ungleichheitsdimension kann zweierlei sein:
Prestigezuerkennung kann geschehen:
Zürn Prestigestatus : Man kann unterscheiden:
Beim Prestigestatus ist ein eventuell vorhandenes dominantes oder primäres Kriterium (z, B, die Standeszugehörigkeit) von sekundären Kriterien zu unterscheiden.
Der Prestigestatus resultiert aus:
Nicht immer kann man im Prestigekontinuum Prestigeschichten mit, festen Grenzen bestimmen, wie es z. B. Heiratsbarrieren sind.
Statusspezifische Bewusstseins- und Verhaltensdifferenzierungen:
|
|
|
| Abb.: Brahmane, 1851 | Abb.: Râjput (Kshatriya) (Zeichnung von
Katherine Vasian, um 1938) [Bildquelle: http://www.arco-iris.com/George/images/rajput.jpg. -- Zugriff am 2003-11-25] |
Status drückt sich aus in Statussymbolen wie Kleidung, Schmuck, Wohngegend, Haustyp, Gebrauchsgütern, Lebensstilen, Sprachstilen.
Von Statussymbol kann man sprechen, "wenn äußerlich erkennbare Gegebenheiten dazu geeignet sind, um zu erkennen, welchen Status jemand hat oder um anderen zu zeigen, wer man ist bzw. sein mochte" (S. 220)
All diese Statussymbole können formell - oder rechtlich - festgelegt sein, z. B. in Kleiderordnungen, der Zuweisung bestimmter Wohnviertel an bestimmte Stände usw. Solche Statussymbole können auch "nur" informell eingespielt sein. Auch müssen sie nicht unbedingt übergreifend sein, sondern können auch nur in Teilgruppen gültig sein.
"To avoid semantic arnbiguity ... specify ...:
- who is evaluating rank;
- whether er not ranking is a matter of local consensus;
- whether the ranking of castes and other aggregates reflects the social interaction between their members or their behavioral attributes, real or stereotyped;
- to which activity contexts these interactional or attributional criteria of rank refer - contexts such as ritual prestige, power wielding, economic affluence; and
- wheter the criteria of rank are employed consistently "
[J. Silverberg. -- In: Social mobility in the caste system in India : an interdisciplinary symposium / ed. by James Silverberg. -- The Hague : Mouton, 1968. -- 155 S. -- (Comparative studies in society and history : suppl. ; 3). -- S. 7f.]
Vgl. Bolte, Karl Martin ; Hradil, Stefan: Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland. -- 5. Aufl. -- Opladen : Leske und Budrich, 1984. -- 97 S. : 20 graph. Darst. -- ISBN: 3-8100-0444-8. -- S. 36 - 72
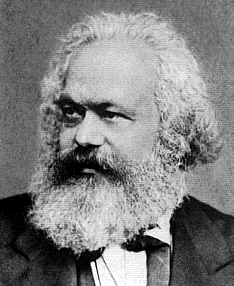
Abb.: Karl Marx

Abb.: Max Weber
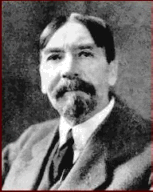
Abb.: Thorstein Veblen

Abb.: Ralf Dahrendorf
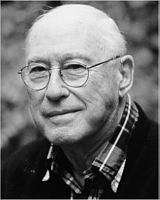
Abb.: Gerhard Lenski
[Bildquelle:
http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Lenski/Index.htm. --
Zugriff am 2003-11-25]
Die in Kapitel 4 in den Gründzügen dargestellte Ständetheorie ist ein Schichtungsmodell der Gesellschaft, nach dem die altindische Agrargesellschaft aus vier säuberlich übereinander liegenden Schichten besteht. Der Wirklichkeit angemessener wäre gewiss ein vieldimensionales Modell sozialer Ungleichheit, in dem die Beziehungen zwischen geschlechtsspezifischer, altersspezifischer, beruflicher, zivilständischer, religiöser, besitzmäßiger, politischer, ethnischer und anderer Ungleichheit und Schichtung mit seinen eventuellen Statusinkonsistenzen dargestellt wäre.
Zu einer Darstellungsmöglichkeit des Verteilungssystems von Macht und Privileg mit verschiedenen, nur teilweise konsistenten Unterklassensystemen siehe
Lenski, Gerhard <1924 - >: Macht und Privileg : eine Theorie der sozialen Schichtung. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1977. -- 649 S. : graph. Darst. -- (Suhrkamp-Taschenbücher Wissenschaft ; 183). -- Originaltitel: Power and privilege : a theory of social stratification (1966). -- ISBN: 3-518-07783-X. -- S. 117 und besonders das Modell einer Agrargesellschaft auf S. 377:
Abb.: Graphische Darstellung des Verhältnisses der Klassen zueinander in Agrargesellschaften [Lenski, a. a. O., S. 377]
Wenn man sich, im Unterschied zu dieser Vorlesung, mit der realen altindischen Gesellschaft beschäftigt und nicht mit dem altindischen Schichtungsmodell, dann muss man sich folgende Beobachtungen von Lenski ständig vor Augen halten:
"Erstens ..., dass man sich Klassen in Agrargesellschaften nicht einfach als eine Reihe säuberlich übereinander liegender Schichten vorstellen darf. Ganz im Gegenteil, jede Klasse beherrscht einen bestimmten Bereich des Verteilungsspektrums, und was viel wichtiger ist, in gewissem Ausmaß gibt es Überlappungen. Zweitens soll dieses Diagramm auf die Unangemessenheit der gängigen Auffassungen von der Gesellschaft als einer Pyramide hinweisen, welche die unterdrückten Klassen am Grunde der sozialen Ordnung ignoriert" ..... gemeint sind die Deklassierten, Unreinen und Entbehrlichen - "und den Grad der Ungleichheit bagatellisiert. ...
Und schließlich soll aus dem Diagramm hervorgehen, dass Macht und Privileg als Kontinuum und nicht als einzelne, genau voneinander abgegrenzte Schichten im geologischen Sinn des Wortes zu denken sind."
[Quelle: Lenski, Gerhard <1924 - >: Macht und Privileg : eine Theorie der sozialen Schichtung. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1977. -- 649 S. : graph. Darst. -- (Suhrkamp-Taschenbücher Wissenschaft ; 183). -- Originaltitel: Power and privilege : a theory of social stratification (1966). -- ISBN: 3-518-07783-X. -- S. 378]
Trotz seiner Eindimensionalität sind in dem Varnaschichtungsrnodel - insbesondere in Verbindung mit dem Âshramadharma und den Bestimmungen für Frauen usw. - die genannten Aspekte berücksichtigt und der Âpaddharma - der Dharma für Fall, dass dem Ständestatus angemessene soziale Positionen in ausreichendem Maße nicht zur Verfügung stehen - trägt Statusinkonsistenzen zum Teil Rechnung.
Es wäre aber ein Missverständnis der Varnalehre, sie nur als soziologisches Schichtungsmodell zu verstehen. Sie trägt vielmehr ausgesprochen ideologischen und institutionellen Charakter, da sie dieses Gesellschaftsmodell als normativ darstellt, ideologisch untermauert und durch die Postulierung und Forderung entsprechender "metaphysischer" und rechtliche Sanktionen durchzusetzen und zu stabilisieren versucht.
Das altindische Ständegesellschaft, wie sie von den Dharmawerken postuliert wird, kann man insofern als geschlossene Gesellschaft bezeichnen, als die klar abgegrenzten Schichten gegeneinander dharmamäßig abgesichert sind.
Im Schichtungsmodell der Varnalehre sind Untersysteme der Schichtung die geschlechtsspezifische Unterscheidung Mann-Frau sowie (zumindest für die Zweimalgeborenen) die Unterscheidung nach Altersklassen (,die für die Zweimalgeborenen ihren Ausdruck in den Âshramas findet).
Die folgende Übersicht fasst einige der Unterscheidungen, die das Varnamodell macht, zusammen:
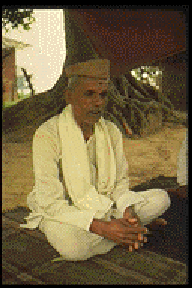 Abb.: Brahmane |
|
[Bildquelle: The Raj : India and the British, 1600 - 1947 ; [exhibition at the National Portrait Gallery, London ; from 19 October 1990 to 17 March 1991] / general ed.: C. A. Bayly. With contributions by Brian Allen .... - London : National Portrait Gallery, 1990. - 432 S. : zahlr. Ill. -- (National Portrait Gallery publications). -- ISBN 1-85514-026-8.. -- S. 293] |
|
[Bildquelle: The Raj : India and the British, 1600 - 1947 ; [exhibition at the National Portrait Gallery, London ; from 19 October 1990 to 17 March 1991] / general ed.: C. A. Bayly. With contributions by Brian Allen .... - London : National Portrait Gallery, 1990. - 432 S. : zahlr. Ill. -- (National Portrait Gallery publications). -- ISBN 1-85514-026-8.. -- S. 320] |
 Abb.: Rajputs (Kshatriyas) |
|
Bildquelle: The Raj : India and the British, 1600 - 1947 ; [exhibition at the National Portrait Gallery, London ; from 19 October 1990 to 17 March 1991] / general ed.: C. A. Bayly. With contributions by Brian Allen .... - London : National Portrait Gallery, 1990. - 432 S. : zahlr. Ill. -- (National Portrait Gallery publications). -- ISBN 1-85514-026-8.. -- S. 317] |
 Abb.: Vaishya |
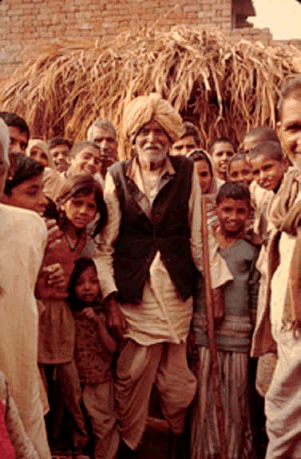 Abb.: Shûdra |
|
|
 Abb.: Friseur (Shûdra) |
|
|
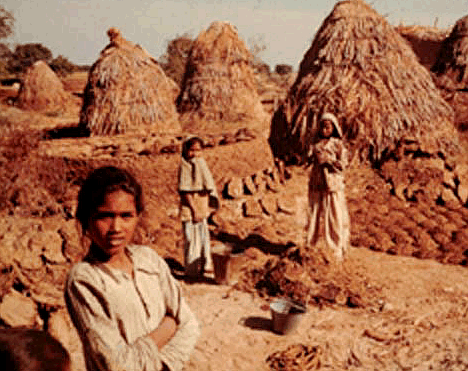 Abb.: Dalits (unterhalb der Ständeordnung) |
 Abb.: Dalit-Musiker (unterhalb der Ständeordnung) |
|
Quelle der Bilder ohne Quellenangabe: Terence Callaham and Roxanna Pavich. -- http://www.csuchico.edu/~cheinz/syllabi/asst001/spring98/india.htm. -- Zugriff am 2003-11-25. -- Dort noch weitere Bilder |
In der modernen indischen Gesellschaft sind Kaste und Stand oft nur noch am Namen erkennbar.
Zu Kapitel 6: Stände (varna) und Soziale Mobilität