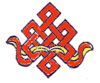
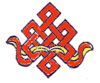
Wir sind miteinander verknüpft
mailto: payer@hdm-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Entwicklungsländerstudien / hrsg. von Margarete Payer. -- Teil I: Grundgegebenheiten. -- Kapitel 8: Tierische Produktion. -- 2. Ziegen und Schafe / zusammengestellt von Alois Payer. -- Fassung vom 2018-10-09. -- URL: http://www.payer.de/entwicklung/entw082.htm. -- [Stichwort].
Erstmals publiziert: 2000-02-21
Überarbeitungen: 2018-10-09 [grundlegend überarbeitet] ; 2001-02-07 [Update]
Anlass: Lehrveranstaltung "Einführung in Entwicklungsländerstudien", HBI Stuttgart, 1998/99
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Herausgeberin.
Dieser Text ist Bestandteil der Abteilung Entwicklungsländer von Tüpfli's Global Village Library.
Skript, das von den Teilnehmern am Wahlpflichtfach "Entwicklungsländerstudien" an der HBI Stuttgart erarbeitet wird.
Statt eines Motto: Bevorzugung des ersten Kleinviehhirten gegenüber dem ersten Ackerbauern durch Gott, nach der Bibel

Abb.: Die Opfer von Kain und Abel / von Hesekiel, Sio, Neuguinea, 1956
[Quelle der Abb.: Lehmann, Arno <1901 - >: Afroasiatische christliche Kunst. -- Konstanz : Bahn, ©1967. -- Abb. 256]
"Adam erkannte seine Frau Eva; sie empfing und gebar den Kain. ... Weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Abel war Kleinviehhirt, Kain ein Ackerbauer. Nach geraumer Zeit begab es sich, dass Kain von den Früchten des Bodens dem Herrn ein Opfer darbrachte. Aber auch Abel opferte von den Erstlingen seiner Herde und ihrem Fett. Der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und sein Opfer sah er nicht. Da ward Kain sehr zornig, und sein Angesicht verfinsterte sich. ... Kain sprach zu seinem Bruder Abel: »Komm, wir wollen aufs Feld gehen!« Als sie auf dem Felde waren, stürzte sich Kain auf seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Der Herr sprach zu Kain: »Wo ist dein Bruder Abel?« Er antwortete: »Ich weiß es nicht. Bin ich denn meines Bruders Hüter?« Er aber sprach: »Was hast du getan? Horch, deines Bruders Blut schreit zu mir vom Erdboden empor. Und jetzt bist du verflucht wegen des Erdbodens, der seinen Rachen aufgerissen hat, deines Bruders Blut aus deiner Hand aufzunehmen. Wenn du diesen Ackerboden bebaust, wird er dir fortan seine Frucht nicht mehr bringen; ziel- und heimatlos sollst du sein auf Erden.«" (Genesis 4, 1 - 12)
"In den Tropen und Subtropen werden Ziegen und Schafe gern in gemischten Herden gehalten und geweidet. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Die Ziege stellt in Schafherden oder gemischten Herden oft das Leittier dar. Sie ist in Gefahrensituationen weniger panikhaft, findet Auswege, zeigt ein abgeklärteres Verhalten und eine bessere Lernleistung als das Schaf."
[Nutztiere der Tropen und Subtropen / Hrsg. Siegfried Legel. -- Leipzig : Hirzel.. -- Bd. 2: Büffel, Kamele, Schafe, Ziegen, Wildtiere. -- ©1990. -- ISBN 3740101768. -- S. 407. ]
Ziegen und Schafe werden zoologisch zur Gattungsgruppe der Caprini -- Böcke gerechnet:

Abb.: Säugendes Schaf, USA (©Corbis)

Abb.: Schafhuf
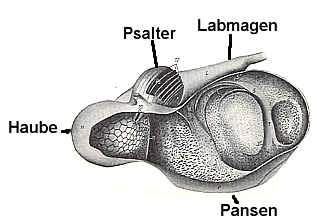
Abb.: Wiederkäuermagen des Schafes
[Vorlage der Abb.: Doberstein, J. ; Hoffmann,
G.: Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. --
Bd. 2. -- Leipzig : Hirzel, 1963. -- S. 52]
|
|
|
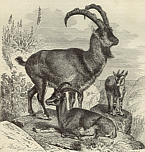
Abb.: Bezoarziege
[Quelle der Abb.: Brehm's Tierleben,
1893]
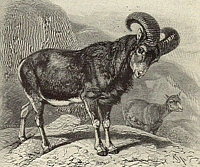
Abb.: Wildschaf (Mufflon)
[Quelle der Abb.: Brehm's Tierleben,
1893]
Die folgende Tabelle nennt einige leicht erkennbare Unterscheidungsmerkmale zwischen Ziegen und Schafen:
| Ziegen | Schafe | |
|---|---|---|
| Kopf |
|
|
| konkave (nach innen gebogene) Profillinie | konvexe (nach außen gebogene) Profillinie | |
| Hörner |
|
Abb.: Widderkopf
|
|
|
|
| Bart und Stirnlocke bei männlichen Tieren | vorhanden | fehlt |
| Schwanz |
|
|
|
|
"Die heutigen Wildschafe und Wildziegen sind Gebirgstiere, ja überwiegend Hochgebirgsbewohner. Ihre Verbreitung ist deshalb überall inselartig. Vor allem bei den Gattungen Capra und Ovis, den eigentlichen Ziegen und Schafen, entwickelte sich auf fast jedem der durch Täler oder Ebenen getrennten Gebirgsstöcke ihres weiten Verbreitungsgebietes eine eigene Form. Ihre Zuordnung zu Arten ist deshalb äußerst schwierig, und die Ansichten der Fachleute über die Zahl der Arten und Unterarten dieser beiden Gattungen gehen weit auseinander." [Grzimeks Tierleben : Enzyklopädie des Tierreichs. -- Bd. 13: Säugetiere 4. -- Zürich : Kindler, ©1968. -- S.473]
Trotz ihres großen -- auch ökologischen -- Nutzens, können Ziegen und Schafe bei unbesonnener Haltung auch große Umweltschäden anrichten:
|
|
|

Abb.: Ungefähres Wohngebiet der Kurumba (©Mindscape)
"Im Gegensatz zum Rind, das der Kurumba niemals selbst hält, zieht er gern selbst Ziegen und Schafe auf. Beide Tiere werden nur während der Regenzeit und bei beginnender Reife am Abend in eigene Ställe in den Gehöften getrieben. Diese Ställe bestehen durchwegs aus verlassenen Hütten, deren Dächer entfernt worden sind. Hier wird auch der Mist für die Düngung der dorfnahen Felder aufgesammelt. Tagsüber sind Ziegen und Schafe im Freien und suchen in der näheren Umgebung des Dorfes ihre spärliche Nahrung. Knapp vor Beginn der Ernte werden sie tagsüber von den kleinen Buben sehr aufmerksam gehütet, um ihr Einbrechen in die Felder zu verhindern. Nach dem Abernten lässt man sie unter Aufsicht dort weiden, damit sie sich an den vielen herabgefallenen Hirsekörnern sattfressen können. Ziegen und Schafmilch wird nicht getrunken; die Tiere ernähren damit ausschließlich ihre eigenen Jungen. Fleisch von Schaf und Ziege dient der Ernährung. Wie beim Rindfleisch wird ein Teil davon gedörrt und erst nach und nach verbraucht.
Unbedingt notwendig ist aber die Ziege für kultische Zwecke. Neben dem Huhn steht sie an zweiter Stelle als Opfertier. Die Verteilung von rituell geschlachteten Tieren ist genau geregelt: Das Blut ist den Ahnen bestimmt; die Brust oder einen Vorderfuß erhält der Chef (er darf niemals vom hinteren Teil eines Tieres bekommen); den Kopf erhält der Schmied, der Schlächter Hals und Innereien, die Leber der Besitzer. Alles übrige wird unter den Festgästen aufgeteilt."
[Schweeger-Hefel, Annemarie ; Staude, Wilhelm: Die Kurumba von Lurum : Monographie eines Volkes aus Obervolta (Westafrika). -- Wien : Schendl, ©1972. -- ISBN 3852680352. -- S. 331]

Abb.: Afghanistan (Quelle: CIA)
"Als überwiegend waldarmes Steppenland eignet sich Afghanistan besonders für die Viehzucht. Weite Gebiete des Landes sind infolge von Wassermangel nur als extensives Weideland nutzbar, wobei im Sommer die Hochsteppen und Matten des Gebirges bevorzugt werden, im Winter dagegen die Steppen und Wüstensteppen der Gebirgsränder, die sich nach den ersten Winterregen rasch begrünen. Das wichtigste Haustier ist daher das anspruchslose Schaf. Unter den verschiedenen Lokalarten und -rassen steht das Fettschwanzschaf an erster Stelle, da es nicht nur Wolle und Fleisch, sondern auch Fett liefert. Besonders in Nordafghanistan wird das Karakulschaf gehalten, und die wertvollen Felle der Jungtiere zählen noch immer zu den Hauptausfuhrgütern Afghanistans. Auch Ziegen und Rinder sind ein wichtiger Faktor der afghanischen Viehwirtschaft." [Maeder, Herbert <1930 - >: Berge, Pferde und Bazare : Afghanistan, das Land am Hindukusch / hrsg, fotografiert und kommentiert von Herbert Maeder, mit Textbeiträgen von ... -- Olten : Walter, ©1972. -- ISBN 3530544000. -- S. 71]
"Mit nahezu 15 Millionen Stück (1969) stehen die Schafe und Ziegen mit großem Abstand an der Spitze. Sie ernähren sich eben weitgehend von der natürlichen Vegetation in den buschbestandenen Steppen und auf den abgeernteten Stoppelfeldern und sind daher kaum von eigens angebauten Futterpflanzen abhängig. Aus den gleichen Gründen sind zwei Drittel dieses Kleinviehbestandes Wanderherden. Es existieren dabei allerdings beträchtliche zahlenmäßige Unterschiede. Das Sommerfutter wird im allgemeinen nicht als Wintervorrat getrocknet, so dass im Herbst ein großer Teil der Tiere geschlachtet werden muss. Eine Dürre kann zur Katastrophe werden. 1971 beispielsweise, als die Trockenheit schon drei Jahre dauerte -- die schlimmste, die in diesem Land je registriert wurde --, stieg der Getreidepreis auf das Dreifache, und die Züchter waren gezwungen, ihre Herden zu Schleuderpreisen zu verkaufen, um sich Lebensmittel beschaffen zu können. Neben den Ziegen (3,2 Millionen -- möglicherweise auch das Doppelte) gibt es verschiedene Rassen Schafe (mindestens 15 Millionen). Das Merino mit seiner feinen, üppigen Wolle ist stark verbreitet, ebenso das Fettschwanzschaf (dessen Wollertrag mehrere Kilo erreichen kann), das den rôghan-e domba («Schwanzfett») liefert. Schaffleisch ist das Fleisch des Landes schlechthin. Aus der Milch gewinnt man den Joghurt (mâst, der über die Türkei und Bulgarien nach Mitteleuropa gelangte) und den rôghan-e zard, «gelbes Fett». Die erfrischende Molke (dôgh) wird unter anderem gekocht, an der Sonne getrocknet und in kleine Stücke gebrochen (qorot), die sich lange halten und im Winter wieder aufgeweicht werden können. Die Haut dient zur Herstellung der pustin, der bestickten Mäntel, die seit einigen Jahren die europäischen Märkte förmlich überschwemmen. Die gebräuchlichste Rasse aber, vor allem im Norden (6,5 Millionen), ist das Karakulschaf (es stammt aus Karakul, einer Region im Nordwesten von Bochârâ; heute trägt noch ein See im sowjetischen Tâdjikistân diesen Namen), welches das sogenannte Astrachanfell liefert (nach Astrachan, dem großen Transithafen an der Wolga), den «Persianer», wie man es deutsch nennt. Das schwarze, graue oder braun-rötlich gefleckte Lämmchen wird schon bei der Geburt getötet, da seine dichten Locken sich schon nach wenigen Lebenstagen öffnen. Ist es eine Tot- oder Frühgeburt (was man künstlich herbeiführen kann, indem man das Mutterschaf erst dürsten lässt und ihm dann Unmengen von stark salzhaltigem Wasser zu trinken gibt), so ist dieses Fell, dann «Breitschwanz» genannt, wegen seines feinen Seidenglanzes noch kostbarer. Astrachan ist ein großer Exportartikel. Aus ihm besteht auch die kolâ, die Kopfbedeckung aller «besseren» Leute, die sich heute im übrigen europäisch kleiden."
[Redard, Georges <1922 - >: Afghanistan. -- Zürich : Silva, ©1974. -- S. 111f.]
"Die wirtschaftliche und soziale Struktur Afghanistans wird noch heute weitgehend vom Nomadentum beeinflusst, da ein Großteil der Bevölkerung -- man schätzt ihn auf mindestens 2 Millionen -- noch immer als Vollnomaden und ein weiterer Teil, für den sich keine genaue Zahl nennen lässt, als Halbnomaden lebt. Bei den Vollnomaden handelt es sich um eine Reihe von Paschtunenstämmen, die ihre Winterquartiere überwiegend im östlichen und südlichen Afghanistan haben, früher auch an den Rändern der Tiefebene des Indus, und von dort im Sommer auf die Hochweiden der benachbarten Gebirge ziehen. Diese Paschtunenstämme gehören der Volksgruppe an, der auch die königliche Familie entstammt. Als im 19. Jahrhundert der afghanische Staat endgültig in seinem heutigen Umfang konsolidiert wurde, erhielten die Nomaden zusätzliche Winterquartiere und Landbesitz in Nordafghanistan sowie Sommerweiden in Zentralafghanistan. Anderseits hat die jüngste politische Entwicklung ihnen das Überschreiten der früheren indischen und heutigen pakistanischen Grenzen immer mehr erschwert. Infolgedessen sind heute, von einzelnen Gebieten im äußersten Nordosten abgesehen, im ganzen Land Nomaden anzutreffen. Das gilt besonders während ihrer Wanderungen im Frühjahr und Herbst, bei denen sie vielfach die großen Verkehrswege benutzen oder in der Nähe von Städten und Bazaren lagern, um Einkäufe zu machen oder andere Geschäfte mit der ansässigen Bevölkerung abzuwickeln. Die Lager der paschtunischen Nomaden sind an den schwarzen Ziegenhaarzelten kenntlich, die das ganze Jahr hindurch bewohnt werden. In Nord- und Zentralafghanistan findet man hier und da noch Jurten der Turkvölker oder von ihnen sich herleitende bewegliche Hütten; sie werden im allgemeinen aber nur noch von Halbnomaden benutzt, die im Winter in festen Stein- oder Lehmhäusern wohnen. Die Wirtschaft der Nomaden beruht vorwiegend auf Viehzucht. Schaf- und Ziegenherden, eine mitunter noch stattliche Zahl von Kamelen, ferner Esel, Rinder und Hühner gehören zum normalen Viehbestand der Nomaden. Pferde hingegen sieht man nur selten, zumindest bei den Paschtunen. Die Herden werden von großen, sehr scharfen Hunden bewacht, denen Schwanz und Ohren gestutzt werden, damit sie besser mit den Wölfen kämpfen können." [Maeder, Herbert <1930 - >: Berge, Pferde und Bazare : Afghanistan, das Land am Hindukusch / hrsg, fotografiert und kommentiert von Herbert Maeder, mit Textbeiträgen von ... -- Olten : Walter, ©1972. -- ISBN 3530544000. -- S. 72f.]
"Ihren Lebensunterhalt liefern ihnen [den Pathanen = Paschtunen] die Schafherden. Sie müssen damit so viel Fleisch, Wolle, Häute und Milchprodukte erzeugen, dass sie davon auch noch verkaufen oder andere Waren dafür eintauschen können, insbesondere Getreide, das sie dringend benötigen, aber gewöhnlich nicht selber produzieren. Die Gewinne, die ihre Herden ihnen einbringen, brauchen sie zur Bezahlung von Brautpreisen, Hochzeitsfeierlichkeiten, Bestattungszeremonien u. ä.
Die Schafe der Nomaden sind Fettschwanzschafe verschiedener Rassen. Am verbreitetsten ist das Kandaharischaf, das in Halbwüsten gut gedeiht und brauchbare Wolle und annehmbares Fleisch liefert. Die Pathanen Turkestans züchten die arabische Rasse, die sich dort sehr gut entwickelt und für ihr Fleisch berühmt ist, wie auch das Karakulschaf, das die begehrten Persianer liefert. Die Schafe werden in Herden von 500 bis 600 Stück gehalten, die etwa fünf Familien, der »Weideeinheit«, gehören; reiche Leute besitzen eine oder ein paar Herden mehr. Jede Herde wird von zwei bezahlten Miethirten betreut, die entweder der Weideeinheit angehören oder Fremde sind. Der erste Hirt wird für ein Jahr unter Vertrag genommen und erhält als Bezahlung einen Anteil an den Lämmern und der Wolle, gewöhnlich ein Zehntel aller Erzeugnisse; die sorgfältige Wartung der Tiere liegt daher in seinem Interesse. Ihm ist der hinter der Herde hergehende Viehtreiber unterstellt; dieser wird monatsweise für einen vereinbarten Lohn beschäftigt, doch erfolgt seine Bezahlung unabhängig vom Zustand der Herde. Er hat auch dann noch Anspruch auf seinen Lohn, wenn die ganze Herde verlorengeht. Die Hirten erhalten darüber hinaus das, was sie täglich an Nahrung und Kleidung brauchen; da sie im Freien übernachten, müssen sie gegen jegliche Witterung geschützt sein.Wenn im März der Frühling naht, werden die Winterlager abgebrochen, und die Familien einer jeden Weideeinheit ziehen hinaus, um in der Nähe ihrer Herde gemeinsam ihr Lager aufzuschlagen. Jetzt gibt es frisches, fettes Gras, die Lämmer kommen zur Welt, die Mutterschafe müssen gemolken und die Milch muss zu Joghurt und Butter, die Molke zu Hartkäse verarbeitet werden. Um Neujahr (21. März) herum findet die erste Schafschur statt. Die im Frühjahr gewonnene lange, rauhe Wolle wird größtenteils verkauft. Ende April hören die Frühjahrsniederschläge auf; die heiße Jahreszeit beginnt, und das Wasser wird vielleicht knapp, aber die Nomaden wissen, dass jetzt der Schnee auf den Hochgebirgsweiden schmilzt, und machen sich auf zu den Sommerweiden.
Manche Nomadengruppen errichten in ihren Winterquartieren Lehmhütten und verfügen damit über feste Wohnsitze. Oft pflanzen die Nomaden auch in der Nähe Getreide an oder veranlassen ortsansässige Ackerbauern, es für sie zu tun, und bezahlen dafür mit einem festgesetzten Prozentsatz des Ernteertrags. Bei vielen Gruppen, besonders bei solchen, deren Winterquartiere Dauersiedlungen mit Ackerland sind, ist es üblich, dass ein großer Teil der Gemeinschaft während des Sommers nicht mitzieht, so dass sich ihr kurzes Nomadenleben auf die beiden Frühjahrsmonate beschränkt, in denen sie gleich ihren nomadischen Vettern mit den Schafherden hinausziehen.
Die Familien, die die Frühjahrswanderung mitmachen, wechseln von Jahr zu Jahr. Oft wechseln zwei Brüder einander ab. Sie verkaufen eine Anzahl Schafe, legen Vorräte an Mehl, Salz u. ä. an, reduzieren ihr Gepäck, verkleinern ihre Zelte um die Hälfte des Umfangs -- und machen sich dann eines Abends bei Vollmond auf den Weg. Nahe Verwandte und Bekannte nehmen für vier oder fünf Monate Abschied voneinander. Bei Gruppen ohne feste Winterquartiere bleibt niemand während des Sommers zurück.
Um auf ihre Sommerweiden zu gelangen, müssen die Nomaden des Westens -- ob aus Kandahar, Farah, Badghis oder Turkestan -- rauhe Gegenden durchqueren, durch tiefeingeschnittene Flusstäler und über reißende Gewässer hinaufziehen, auf 3500 m hohen Pässen gewaltige, schneebedeckte Gebirgsketten überwinden. Einige Gruppen gelangen in weniger als zehn Tagen auf ihre herkömmlichen Bergweiden, andere brauchen für die 300 bis 450 km lange Strecke einen Monat. Während die Kamelkarawanen den Flussläufen folgen und auf den Talsohlen bleiben, nehmen die Hirten oft mit den Herden lieber den kürzeren, aber kälteren Weg längs der Bergkämme, wo sie leichter eine Weide finden. Die Schafe und ihre Besitzer treffen sich dann während des ganzen Trecks nur ein- bis zweimal. ...
Während der Sommerwanderung treiben die Nomaden unterwegs ständig Handel. Frauen kommen aus den Dörfern in ihre Lager und bieten ihnen Kräuter, Eier, frisches und Trockenobst und, in Nordafghanistan, ein besonderes Gericht aus Nudeln und Joghurt im Tausch gegen dringend benötigte Wollreste an. Die Nomaden überlassen ihren Bekannten Vieh oder geben ihnen Vorschüsse gegen das Versprechen der Rückzahlung im nächsten Jahr oder später, gewöhnlich in Form von Getreide oder Futtermitteln. Solche Darlehen sind nicht billig, und die Dorfbewohner sind bei den aus dem Osten kommenden -- weniger bei den westlichen -- Nomaden oft so stark verschuldet, dass sie ihr Land einbüßen. Obschon die Bewohner der Gebirgsdörfer nur Persisch sprechen, bilden die Informationen, Anregungen und Berichte der Nomaden einen bedeutsamen Teil dieser Begegnungen, zumal für die gewöhnlich isoliert lebenden Dorfbewohner.
In den Sommerquartieren haben zuweilen mehrere Weideeinheiten ein gemeinsames Lager; meist schlägt jedoch jede Einheit ihr Lager für sich auf dem eigenen Weideland auf. Die Nomaden haben ihre althergebrachten Areale, müssen aber oft entweder ihrem Anführer oder einem im nächsten Dorf ansässigen Grundbesitzer eine Gebühr entrichten. Sie bleiben nur etwa zwei Monate dort, die indessen für die gesamte Familie eine sehr arbeitsreiche Zeit sind.
Die Schafe gedeihen auf den üppigen Bergweiden zusehends und liefern bis Juli reichlich Milch. Die Hausfrau bereitet fast täglich aus der Milch Joghurt. Jeden Morgen schüttelt sie ihn dann in der Kühle, ehe der neue Tag anbricht, um die Molke vom Quark abzusondern. Sie bereitet aus der Molke Hartkäse und lagert den Quark bis zum Ende der Melkzeit ein, um dann in einer Julinacht ganz allein Ghi (Butterschmalz) daraus zu bereiten.
An diesem Abend bringen die Kinder Pflanzen, Abfall, alte Schuhe und andere Gegenstände, die das Sommerlager versinnbildlichen sollen, herbei und hängen sie am Zelt auf. Nach der Abendmahlzeit verlässt dann die gesamte Familie mit Ausnahme der Frau das Zelt, um bei Nachbarn zu übernachten. Die Hausfrau bleibt zurück und beginnt in den frühen Morgenstunden mit dem langsamen Kochen des Quarks, das ohne einen menschlichen Laut vor sich gehen muss, damit er nicht Feuer fängt -- eine nicht zu unterschätzende Gefahr. In der Dämmerung ist sie fertig. Zum Ausgießen des Ghi aus den Kesseln in die Vorratshäute holt sie Hilfe herbei, und die Nachbarn erscheinen auf der Bildfläche, um zu fragen, wieviel sie gemacht hat, und um sie zu beglückwünschen.
Etwa um die gleiche Zeit werden die Schafe erneut geschoren. Dies ist Männerarbeit, und oft helfen Männer aus den Nachbarlagern dabei; zuweilen werden auch Leute aus Dörfern der Umgebung in Dienst genommen. Nahezu der gesamte Wollertrag wird den Frauen übergeben. Diese lockern die kurze Sommerwolle auf, rollen sie sodann und pressen sie zu Filz zusammen, eine Arbeit, für die ebenfalls Hilfskräfte gebraucht werden, besonders für die großen schwarzen Filze, die den Hauptbestandteil der Brautausstattungen bilden. Außerdem machen sie noch kleinere graue Filze, die als Decken und Teppiche Verwendung finden. Alle Nachbarn, die dabei mithelfen, erhalten vom Gastgeber Schmorfleisch zum Mittagessen.
Noch vom Sommerlager aus besuchen die Männer gewöhnlich die großen Nomadenbasare in Kasi oder Charas. Händler, in der Hauptsache Ghilsai-Pathanen aus Ostafghanistan, schaffen mit Kamelkarawanen und neuerdings mit Lastkraftwagen Waren aus den Städten und aus Pakistan dorthin. Der Verkauf findet in weißen Segeltuchzelten statt. Die Nomaden aus dem Westen und auch Dörfler aus der Umgebung bieten hier Vieh zum Kauf an, kommen aber hauptsächlich, um Getreide und andere Lebensmittel, Tuche, getragene amerikanische Sakkos und Mäntel, Gewehre und Munition, Farben und viele andere Dinge zu kaufen. Die Nomaden kaufen auf Kredit, den sie gewöhnlich im darauffolgenden Frühjahr abbezahlen.
Abb.: Rückkehr einer Ziegenherde von der Sommerweide, Afghanistan, 1994 (Quelle: FAO)
Ende Juli ist es Zeit zum Aufbruch in die Heimat, wie die Nomaden ihre Winterwohnsitze nennen. Die Kamelkarawanen setzen sich unverzüglich in Bewegung; vor allem die Kamele, heißt es, sollten nicht länger verweilen, da sie sich sonst leicht eine rheumatische Entzündung holen. Die Herden könnten, von den Hirten betreut, sehr gut noch einen weiteren Monat bleiben und noch etwas länger von dem kühlen Sommer im Gebirge und den alpinen Gräsern in verschiedenen Höhenlagen profitieren. Ende August, wenn der Unabhängigkeitstag gefeiert wird, treffen die Nomadenfamilien wieder in ihren Winterquartieren ein. Die Ernte ist eingebracht, und es lockt jetzt das reife Obst -- Aprikosen, Trauben und Melonen. Es ist dies eine Zeit relativen Überflusses. Aber es gibt auch Arbeit: Die Futtermittelbevorratung für den Winter und die Vorbereitung des Ackerlandes für die nächste Aussaat müssen erledigt werden. Im September beginnt die Zeit der Festlichkeiten: große Hochzeiten und Zusammenkünfte und in Turkestan dazu Buzkaschi-Spiele.
In den Lagern lebt man sehr gesellig. Das Alleinsein ist den Nomaden verhasst; nichts geht ihnen über eine lebhafte Unterhaltung."
[Tapper, Richard: Die nomadischen Pathanen. -- In: Bild der Völker : die Brockhaus Völkerkunde. -- Bd. 8. -- Wiebaden : Brockhaus, ©1974. -- ISBN 3765302848. -- Originaltitel: Peoples of the world. -- S.105 - 111]
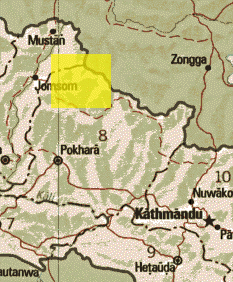
Abb.: Lebensraum der Bhotia, Nepal
"Am Südrand Tibets, im Schatten der hoch aufragenden Berge des Himalaja, wohnt ein Volk, dessen Lebensweise von der Außenwelt noch weitgehend unberührt ist. Die Bhotia lassen ihre Yakherden auf den Hochweiden grasen und ringen der dünnen Ackerkrume ihren kargen Lebensunterhalt ab. Im Winter, wenn der Schnee ihre aus Stein gebauten Dörfer einhüllt, wandern sie hinab ins Tiefland, um ihre Yakprodukte gegen Getreide einzutauschen. Die Siedlungsgebiete der 400 000 Bhotia -- enge, hochgelegene Täler in Nepal und den angrenzenden Gebieten im Westen und Osten -- sind durch Bergketten und Schluchten voneinander getrennt, so dass jede Gemeinschaft ihr eigenes Brauchtum entwickelt hat. Doch sie alle haben ihre Stammheimat in Tibet, von wo sie ihre Sprache und Kultur, ihre buddhistische Religion, ihre bunte, selbstgesponnene Kleidung und ihre Ernährungsweise übernommen haben." (S. 5) "Das Hüten der Schafe und Ziegen ist im allgemeinen Aufgabe der Frauen und Kinder, aber viele Familien von Nar teilen sich in die Bezahlung des Berufshirten des Dorfes -- eines aus Tibet geflohenen Nomaden, der zu diesem Zeitpunkt eine über 200köpfige Herde in der.Nähe von Meta betreute. Es sind nützliche Tiere: Aus ihrer Wolle wird das Tuch der chuba gewoben, jenes Wickelgewandes, das die Bhotia als Oberbekleidung tragen; aus ihren zusammengenähten Häuten werden Wintermäntel, Hemden und Decken angefertigt, und sowohl Mutterschafe wie Ziegen werden gemolken. Nach Tsosangs Meinung waren jedoch die Milchprodukte, die sie lieferten, weniger gut als die der Yaks. Ganz besonders negativ äußerte er sich über gesäuerte Ziegenmilch, von deren Genuss einem die Zähne ausfielen, wie er behauptete." (S. 61)
Abb.: Bhotia-Mann (©Corbis)
"Das erste Tageslicht ließ die geriffelten Eiswände des Lamjung Himal und des Annapurna II erglühen, drang knapp 25 Kilometer weiter nördlich durch die tiefen Schatten eines natürlichen, von Bergen gebildeten Amphitheaters und erhellte die Wintersiedlung Kyang. Dort begann sich Tashi Hrita auf dem Dach seines Hauses unter der Yakhaardecke zu regen. Obwohl die Nächte in 3700 Meter Höhe selbst im Mai noch bitterkalt waren, schlief Tashi von April an meist nackt im Freien. Das Dach war sauberer und angenehmer als das Innere des Hauses, und außerdem zog er es vor, in Hörweite seiner Schafe und Ziegen zu nächtigen -- eine Gewohnheit, die aus seiner ein halbes Jahrhundert zurückliegenden Kindheit stammte, als noch tibetische Räuber über die Grenze kamen, um Vieh zu stehlen. Doch heutzutage machten einem nur Raubtiere Sorgen; mitten in der Nacht war Tashi durch das Husten eines Luchses geweckt worden, der um die Siedlung strich. Der Luchs hatte das Vieh gewittert, das jedoch in den Ställen vor ihm sicher war.
Auch andere Menschen begannen in Kyang zu erwachen, einer geschützten Ansammlung grober Steinhäuser, in denen die Bewohner von Phu im tiefen Winter Zuflucht suchten, wenn Schneestürme die Dörfer an den Wind und Wetter ausgesetzten Berghängen unbewohnbar machten. Mit Beginn des Frühlings waren jedoch die meisten Leute bereits nach Phu zurückgekehrt, das zwei Wegstunden entfernt und 100 Meter höher lag. Nur eine Handvoll Dorfbewohner hielten sich noch in Kyang auf, um ihre Schafe und Ziegen auf dem frischen Gras weiden zu lassen. ...
Mit steifen Bewegungen -- denn seine 64 Jahre machten ihm zu schaffen -- zog er [Tashi] Hosen aus selbstgesponnener Wolle und Stiefel mit Ledersohlen an und streifte ein Unterhemd aus Ziegenhaut über. Zuletzt schlüpfte er in seine arg geflickte und ausgeblichene chuba aus beigefarbener Wolle.
Abb.: Bhotia-Mädchen (©Corbis)
Es war fünf Uhr früh. Tashi rief leise, um seine 17jährige Tochter Dorje zu wecken. Sie kroch widerwillig unter der Decke hervor, die sie mit der zwölfjährigen Pemba Yangze in der gegenüberliegenden Ecke des Daches teilte. Pemba war die Tochter von Nachbarn, die schon heim nach Phu gegangen waren und sie in Tashis Obhut zurückgelassen hatten, damit sie die Herden ihrer Familie hütete. ...
Diejenigen, die noch in Kyang waren, würden sich bald ihren Familien in Phu anschließen. Dorje und Pemba sollten am nächsten Morgen in aller Frühe aufbrechen, und Tashi wollte ihnen zwei Wochen später folgen, da der Dorfrat bestimmt hatte, dass nach Ende Mai kein Vieh mehr die Weiden von Kyang benutzen durfte.
Abb.: Phu, Nepal (©Corbis)
Tashi verbrachte meist vier bis fünf Monate des Jahres in der Wintersiedlung. Da die meisten seiner Kinder inzwischen verheiratet waren, gab es für ihn in Phu nicht mehr viel zu tun. Bei der Hochzeit hatte er seinen Söhnen jeweils acht Felder und seiner Tochter zwei gegeben; er selbst besaß nur noch sieben Felder, und diese konnten seine Frau und die jüngste Tochter mit Unterstützung der Söhne, die ihm beim Pflügen halfen, mühelos bestellen. Die Familie teilte die anfallenden Arbeiten nach Möglichkeit unter sich auf, und da Tashi mittlerweile zu alt wurde für die anstrengende Tätigkeit, die Yaks auf den hoch gelegenen Weiden zu betreuen, bestand seine Hauptaufgabe darin, die Schafe und Ziegen der ganzen Familie zu hüten: In der ersten Jahreshälfte in Kyang und danach auf den Weiden bei Phu. Dafür versorgten die Söhne Tashis Yaks.
Tashis erste Arbeit am Morgen war das Melken der Schafe und Ziegen. Er war für über hundert Tiere verantwortlich -- seine eigenen, die von Pemba und die seiner beiden Söhne. Nachts wurden die Herden in mehreren Steinhütten und Pferchen gehalten, die über die ganze Siedlung verstreut lagen; tagsüber ließ man sie frei grasen. Aus einer Ecke des Hauses holte Tashi einen Melkeimer, rief Dorje und ging mit ihr die Tiere melken. Inzwischen machte sich Pemba auf den Weg, um Wasser aus dem eisigen Rinnsal zu holen, das oberhalb der Siedlung spärlich plätscherte.
Durch die niedrige Tür eines angrenzenden Gebäudes, das nur wenig primitiver als ihre eigene Behausung war, betraten Tashi und Dorje einen Raum, in dem ihnen scharfer Ziegengeruch entgegenschlug. Dorje packte eine Ziege bei den Hörnern und machte sich an die Arbeit; dabei hielt sie den Kopf des Tieres zwischen ihren Schenkeln fest. Sie nahm der Ziege nur wenig Milch ab und wandte sich bald der nächsten zu: Um diese Jahreszeit können die Tiere, die Junge säugen müssen, nur gerade genug Milch für den täglichen Bedarf ihrer Besitzer erübrigen.
Als die in der ersten Hütte stehenden Ziegen gemolken waren, zog Tashi einen großen Stein aus der Mauer, die die Hütte vom nächsten Stall trennte. Ein Strom meckernder Zicklein stürzte hindurch und hängte sich gierig an die Euter der Muttertiere. Tashi überließ es seiner Tochter, die restlichen Ziegen und Schafe zu melken, und ging wieder ins Haus, um das Frühstück zu richten.
Er kauerte vor der Feuerstelle -- einer flachen Grube, die vor einer Wand ausgehoben war -- und blies in die noch vom Vorabend verbliebene Glut; dann legte er Wacholderzweige und getrockneten Dung nach. Er nahm einen Block Tee, der so grob und dunkel wie Pfeifentabak war, schnitt einen Brocken ab und warf ihn in einen Topf mit Wasser, den er über die Flammen stellte.
Während er den Tee zubereitete, kehrte Pemba zurück, gefolgt von Dorje, die noch drei Leute mitbrachte. Zwei davon waren Nachbarn ...
Als seine Gäste gegangen waren, ließ Tashi die ausgewachsenen Schafe und Ziegen aus ihren Ställen, damit seine Tochter sie alle zusammen auf die Weide treiben konnte, wo sie an diesem Tag grasen sollten. Er begleitete Dorje ein Stück des Weges und sah dann zu, wie sie die Tiere in die gähnende Schlucht des Phu hinab in Richtung einer steilen Weide auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses führte. Als sie außer Sicht war, ließ er die Zicklein und Lämmer frei. Im Gegensatz zu den ausgewachsenen Tieren grasten die Jungen stets nahe der Siedlung, wo sie zum einen vor Raubtieren geschützt waren und zum anderen während des Tages nicht die Milch ihrer Mütter wegtrinken konnten. Pemba hatte die Aufgabe, sie zu bewachen, und so scheuchte sie nun ihre Schutzbefohlenen auf die Wiese.
Gegen halb acht Uhr stand die Sonne hoch über den Bergen und schien direkt auf Kyang. Tashi kletterte wieder auf das Dach seines Hauses; in einem Yakhaar-Beutel hatte er frischen Ziegenkäse bei sich, der am Tag zuvor gemacht worden war, indem man die Molke von geronnener Buttermilch durch die Maschen des Beutels geseiht hatte. Er gab etwas Käse in einen Topf, nahm dann eine Handvoll der weichen, körnigen Masse und presste sie in seiner Faust zusammen, so dass sie in dünnen Strängen zwischen seinen Fingern herausgedrückt wurde. Diese Stränge legte er auf eine Decke, damit sie an der Sonne trockneten. Der auf diese Weise getrocknete Käse ist hart und zäh wie Sahnekaramellen und hält sich bis zu zwei Jahre; er wird in Eintopfgerichten mitgegart oder wie Bonbons gelutscht. ...
Als Dorje von der Weide zurückkehrte, auf der sie die Herden grasend zurückgelassen hatte, machte sie sich daran, die zweite Mahlzeit des Tages zuzubereiten. Sie kochte kurz etwas Buttermilch vom vergangenen Tag, um daraus Quark zu machen, schüttete den Quark in blaue chinesische Schalen und gab tsampa hinzu. Tashi setzte sich zu ihr, und dann aßen die beiden schweigend, wobei der Mann einen Holzlöffel benutzte und das Mädchen die Mischung mit den Fingern herausschöpfte. Nach dem Essen ging Dorje wie jeden Tag daran, Butter zu machen. Sie goss die Milch vom Morgen -- kaum mehr als einen Liter -- in ein hölzernes Butterfass, das einen Kolben besaß, und begann den Kolben regelmäßig auf und ab zu bewegen.
Tashi sah seiner Tochter nachdenklich zu. Sie war ein hübsches Mädchen, und es würde bald Zeit sein, ihre Heirat zu arrangieren. Er hatte noch keinen bestimmten Mann ausgesucht, und zweifellos hatte sie auch ihre eigenen Vorstellungen; aber da sie gesund und fleißig war, würde man sicher einen guten Partner für sie finden können, der der Familie Ehre machte. Dennoch betrachtete er diese Aussicht mit gemischten Gefühlen. Wenn Dorje heiratete, würde sie ihren eigenen Hausstand gründen, und das bedeutete für ihre Eltern eine Arbeitskraft weniger. Doch Tashi tröstete sich mit dem Gedanken an seine jüngere Tochter Nyima: Wenn es für sie Zeit wurde zu heiraten, wollte er alles so regeln, dass sie und ihr Mann in Tashis Haus lebten, um ihn und seine Frau im Alter zu versorgen. ...
Dann ging er hinunter, um den Holzsammlern zu helfen, die Zweige zu Bündeln schnürten und sie auf ihre Yaks luden. Als die Leute den Heimweg antraten, kehrte Tashi ins Haus zurück. Im Innern trennte Dorje gerade die Butter, die sie gemacht hatte, von der Buttermilch. Zuerst goss sie heißes Wasser in das Butterfass, damit die Butterflöckchen schmolzen und an die Oberfläche aufstiegen; danach gab sie kaltes Wasser hinzu, so dass sie zu Klümpchen erstarrten, die sie dann auf den Deckel des Butterfasses legte. Nachdem sie etwas Butter als Opfergabe an den Hausgott auf die Dachstütze gerieben hatte, knetete sie die Masse zu zwei Kugeln und ließ sie in einer Schüssel mit kaltem Wasser fest werden.
Inzwischen hatte Tashi das Feuer angefacht, um die im Butterfass zurückgebliebene dünne Buttermilch zu erhitzen und daraus Käse zu machen. Gerade als er den Topf auf die Flammen stellen wollte, hörte er auf dem Dach das Geräusch rennender Füße, und schon erschien Pembas verzweifeltes Gesicht in der Luke. Weinend erzählte sie Tashi, dass eines der Zicklein gestorben war.
Tashi ließ bei dieser Nachricht keine Gefühlsbewegung erkennen -- der Tod eines Tieres war etwas durchaus Alltägliches. Er hatte einmal miterlebt, wie seine gesamte Yakherde von einer Lawine fortgerissen wurde, und er musste damit rechnen, jedes Jahr ein Viertel seiner Schafe und Ziegen zu verlieren. Einige würden, wie dieses Tier, an einer Krankheit sterben, einige würden verhungern, und einige wenige, hauptsächlich Zicklein und Lämmer, würden von Raubtieren wie Luchsen, Wölfen, Schneeleoparden, Füchsen und Goldadlern getötet werden.
Kurz vor Mittag traf Tashis jüngerer Sohn, Kamsum, aus Phu ein. Er war gekommen, um beim Einsammeln des Holzes zu helfen, das Dorje während der letzten Tage auf den Weiden geschnitten hatte, wo die Herden grasten. Im Laufe des Tages wurden noch Dorjes verheiratete Schwester und ihr Mann erwartet. Das Ehepaar und Kamsum sollten Dorje und Pemba am nächsten Morgen zurück nach Phu begleiten, und jeder von ihnen würde bei dieser Gelegenheit eine Ladung Brennholz nach Hause tragen.
Als Dorje und Kamsum in Richtung des Flusses verschwunden waren, holte Tashi das tote Zicklein und enthäutete es auf dem Dach. Bedächtig arbeitend und ohne das Fleisch mit seinem Messer auch nur zu ritzen, hatte er die Haut in 15 Minuten abgezogen. Dabei murmelte er Om mani padme hum, um dem Tier zu einer besseren Wiedergeburt zu verhelfen. Danach breitete er die Haut zum Trocknen aus; er wollte das weiche Fell als Innenfutter für eine Winterchuba verwenden. Er behielt das Fleisch, um daraus eine Mahlzeit zuzubereiten, doch weil die Ziege nicht gesund gewesen war, warf er Leber, Herz und Eingeweide den wartenden Krähen vor. Anschließend spülte er sich mit Buttermilch das Blut von den Händen und scheuerte die Buttermilchschüssel mit einer Mischung aus Erde und getrocknetem Ziegenmist sauber.
Ein anderer Bewohner von Kyang schaute herein, und während der folgenden Stunden saßen die beiden alten Männer neben Tashis Haus in der Sonne, teilten sich eine Schale geronnener Milch und plauderten miteinander. Kurze Bemerkungen über ihre Familien und Herden wechselten mit langen, angenehmen Gesprächspausen ab. Als sich sein Freund zum Gehen wandte, kletterte Tashi wieder auf das Dach und holte eine Ziegenhaut, die er am Tag zuvor zum Trocknen ausgelegt hatte. Still betend, saß er mit übergeschlagenen Beinen da und walkte die Haut durch, um sie geschmeidig zu machen.
Langsam verstrich der Nachmittag. Dorje und ihr Bruder waren noch nicht zu sehen; Pemba war unter einem Wacholderbaum mit einem Hüpfspiel beschäftigt und hatte das Hüten der Herde vorübergehend vergessen. Weißköpfige Geier schwebten im großen, weiten Himmelsrund über Kyang, während ein Lämmergeier durch die Luft segelte, mit geneigten Schwingen kreiste und herabstieß, um sich einen Knochen zu schnappen.
Tashi registrierte das Vorrücken des Tages mit einem Zucken der Augenlider. Trotz des gleichmäßigen, monotonen Ablaufs seiner Tage war ihm nie langweilig: Den Begriff Langeweile kannte er nicht. Als junger Mann war er weit über das Tal hinausgekommen. Er war dreimal nach Katmandu gereist, um zu dem bedeutenden buddhistischen Heiligtum im nahen Bodhnath zu pilgern. Bodhnath hatte ihm ehrfürchtige Scheu eingeflößt, und seine frommen Reisen hatten ihm sicher Verdienste eingebracht. Aber Katmandu selbst mit seinen von Menschen wimmelnden Gassen und Märkten hatte ihn nur verwirrt.
Zweimal war Tashi in die große nördliche Ebene von Tibet gewandert, um Salz zu holen, und hatte dabei in ständiger Angst vor Räubern gelebt und Staub- und Schneestürme ertragen. Früher ging er jeden Winter hinunter nach Lamjung, um Handel zu treiben und Reis zu kaufen, und im Sommer pflegte er nach Nar zu ziehen, um getrockneten Käse gegen Buchweizen einzutauschen, der aus Manang kam. Doch nun tätigten seine Söhne alle Handelsgeschäfte für ihn. Die Zeiten, in denen Tashi reiste, waren vorüber. Außerhalb von Kyang und Phu hatte die Welt keinen Reiz und keine Bedeutung mehr für ihn, und er war es zufrieden, für den Rest seines Lebens die Schafe und Ziegen der Familie zu hüten und mehr Zeit für religiöse Übungen aufzuwenden, die ihm, wie er hoffte, nach seinem Tode zu einer guten Wiedergeburt verhelfen würden.
Kleine Wölkchen zogen sich über Kyang zusammen, und die Temperatur fiel abrupt um fünf Grad. Es begann zu graupeln. Am späten Nachmittag verließ Tashi das Haus und ging zum Rand der Schlucht oberhalb des Phu. Er warf den Kopf zurück und stieß einen langgezogenen, heulenden Schrei aus, der hohl von den Felswänden widerhallte -- ein Signal für seine Kinder, dass es Zeit war, die Herden heimzutreiben. Als Antwort schallte der Ruf seines Sohnes und seiner Tochter durch das Tal.
Einige Minuten später sprangen die ersten Tiere von Tashis Herde die Bergweide herab, sammelten sich zu Gruppen, und schließlich bewegte sich ein ganzer Strom drängelnder, blökender und meckernder Tiere zu Tal, denen zwei menschliche Gestalten folgten. Ohne auf sie zu warten, wandte sich Tashi heimwärts. Unterwegs entdeckte er einen großen, flachen Felsbrocken, der sich als Bedachung eignete. Nachdem er vergebens versucht hatte, ihn mit einem Stein zu zerkleinern, wuchtete er ihn auf den Rücken und trug ihn als Ganzes nach Hause.Die Sonne war bereits hinter den Bergen verschwunden, als Dorje und Kamsum aus der Schlucht auftauchten. Tashi wies Pemba an, ihnen entgegenzugehen und mitzuhelfen, die Zicklein und Lämmer einzusperren, bevor sie zu ihren Müttern eilen konnten. Tatsächlich galt es, keine Zeit zu verlieren, denn schon kamen die Schafe und Ziegen gelaufen, die kläglich nach ihren Jungen riefen, und es gab eine regelrechte Verfolgungsjagd, als Tashi und seine Kinder die Tiere zum abendlichen Melken zusammentrieben. Eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit trafen Tashis älteste Tochter, ihr Mann und ihre Kinder aus Phu ein, die den vertrauten Pfad zwischen den beiden Dörfern im Schein des aufgehenden Mondes zurückgelegt hatten und Reis und selbstgebrautes Bier für das Abendessen mitbrachten -- eine willkommene Abwechslung von Tashis üblicher Kost aus tsampa und Milchprodukten. Schon bald war das Haus vom Rauch des Feuers erfüllt, auf dem Tashis Töchter den Reis zubereiteten.
Nach dem Abendessen lachten und schwatzten die Frauen, während die Männer beim Bier zusammensaßen. ... Gegen zehn Uhr, als alle anderen bereits unter ihren Decken lagen, kletterte auch er über die Leiter auf das vom Mond beschienene Dach, zog seine Decke aus Yakhaar über sich und schlief ein."
[Chorlton, Windsor <1948 - >: Felsbewohner des Himalaya : die Bhotia. -- Amsterdam : Time-Life, ©1982. -- (Völker der Wildnis). -- ISBN 9061826179. -- S. 5.61.136 - 143]

Abb.: Lage von Nepal und Katmandu (Quelle: CIA)
"In die Zeit der Feste Pisach Chaturdasi und Ghora Jatra im März/April fallen auch Pahachare, das Zusammentreffen der drei göttlichen Schwestern, sowie Neta Madhu Ajima, der nächtliche Auftritt von zwölf Gottheiten in Nar Devi, einem Stadtteil Kathmandus, und ihre Verehrung durch die Bevölkerung. Bei diesem Opferfest für die große göttliche Mutter Neta Madhu Ajima werden zwölf männliche Mitglieder aus der Kaste der Blumenpflücker im Innern eines Dyochen, eines Hauses, in dem die Götter des betreffenden Stadtteils wohnen, in dem Masken und rituelle Gerätschaften gelagert werden, auf ihren Auftritt vorbereitet. Ihre Masken werden in stundenlangen rituellen Opferhandlungen geweiht, und zu diesen Zeremonien erhält niemand außer den Priestern Zutritt. Gegen Mitternacht treten die Männer dann einzeln aus dem Haus. Sie sind in kostbare Gewänder gehüllt, haben die Masken übergezogen und sind mit Silberreifen, Halsketten und Blumen geschmückt. Mit den aufgesetzten Masken gelten sie als heilig, werden als Götter angesehen, werden angefleht und verehrt. In einer langen Prozession bewegen sie sich zentimeterweise durch die engen Gassen. Vor jedem Hauseingang findet ihnen zu Ehren eine kleine Opferzeremonie statt.
Verschiedentlich machen uns Gläubige durch Gesten auf Besonderheiten aufmerksam. Sind sie besorgt, ob die Götter uns akzeptieren oder ob unsere Anwesenheit sie nicht verärgert und dieser Ärger dann auf die Bewohner zurückfällt? Sie wirken unsicher, sind ängstlich, aber auch tolerant. Und sie freuen sich, bedanken sich mit einem Lächeln bei uns, wenn alles gut gegangen ist. ...Die Prozession muss am Tempel der Muttergottheit Neta Madhu Ajima, der Herrscherin über den Stadtteil Nar Devi, vorbeiziehen. Dort steht ein Lichterbaum mit 108 brennenden Öllampen. Aus einigen Häusern ertönt Musik. Harmonium, Zimbeln und Trommeln, dazu religiöse Gesänge, laut und inbrünstig von Männern vorgetragen. Musik und Lieder waren schon seit Stunden zu hören und werden auch für den Rest der Nacht nicht verstummen.
Auf einem winzigen Platz tanzen die Götter gemeinsam in der Menge. Es herrscht ein unglaubliches Gedränge, alle sind unterwegs, die Alten genauso wie die Kinder; niemand will sich ausschließen, jeder sich den Göttern zeigen und sie verehren. Dann plötzlich tauchen die Göttermasken weg, verschwinden irgendwo, scheinen sich aufzulösen. Auch die Menge löst sich auf, verteilt sich. Aus Tausenden werden Hunderte, aber allein wird man in dieser Nacht nie sein, denn mit frommen Liedern werden die Götter weiter besungen, bis der Morgen graut.
In aller Frühe erscheinen die zwölf göttlichen Maskenträger wieder auf dem kleinen Platz, in dessen Mitte aus Stein ein kleiner Schrein der Muttergottheit, die hier herrscht, in den Boden eingelassen ist. Dorthin werden nacheinander drei junge Büffel, mehrere Ziegen und ein paar Schafe geführt, deren Blut hier der großen Muttergottheit geopfert werden soll.
Der Kopf der Tiere wird nach hinten gebogen und die Halsschlagader angeritzt, bis ein Blutstrahl in die Menge schießt. Einzeln werden die zwölf Gottheiten zu den Opfertieren geleitet, lüften ihre Masken und trinken vom warmen Blut des Opfers. Priester beobachten den Vorgang genau und wachen darüber, dass jeder reichlich Opferblut zu sich nimmt. Wer genug getrunken hat, wird wie ohnmächtig von Helfern weggetragen, macht der nächsten Gottheit Platz. Man wischt ihm das Blut aus dem Gesicht und reinigt seine Hände. Nun kann er die Trankopfer der anderen Gottheiten mitverfolgen, bis er beim nächsten geschächteten Tier selbst wieder an die Reihe kommt.
Nur derjenige Maskenträger, der alles Opferblut, das er getrunken hat, bei sich behält, beweist damit, dass der Gott, den er darstellt, auch wirklich in ihm wohnt. Für ein weiteres Jahr wird er diesen Gott verkörpern und von den Bewohnern des Stadtteils Nar Devi, die das Trankopfer gespannt verfolgt haben, höchste Verehrung empfangen."
[Koch, Pitt <1934 - > ; Stegmüller, Henning <1951 - >: Geheimnisvolles Nepal : buddhistische und hinduistische Feste. -- München : List, ©1983. -- ISBN 3471779604. -- S. 26f.]
ILRI -- International Livestock Research Institute. -- http://www.cgiar.org/ilri/. -- Zugriff am 2001-02-07 -- ["The International Livestock Research Institute works to improve the well-being of people in developing countries by enhancing the diverse and essential contributions livestock make to smallholder farming."]
DAD-IS Breed Database / FAO. -- URL: http://dad.fao.org/en/Home.htm.
-- Zugriff am 2001-02-07. -- [Datenbank fast aller Viehrassen der Welt, mit
Beschreibungen und teilweise Abbildungen. -- "DAD-IS is the key
communication and information tool for implementing the Global Strategy for
the Management of Farm Animal Genetic Resources (AnGR). It is being developed
first to assist countries and country networks, and also serves as the virtual
structure for the Strategy. It will increasingly provide extensive searchable
databases, tools, guidelines, a library, links and contacts.".
-- Sehr empfehlenswert!]
Nutztiere der Tropen und Subtropen / Hrsg. Siegfried Legel. -- Leipzig : Hirzel.. -- Bd. 2: Büffel, Kamele, Schafe, Ziegen, Wildtiere. -- ©1990. -- ISBN 3740101768. -- S. 206 - 479
Pagot, Jean: Animal production in the Tropics. -- London [u.a.] : Macmillan Education, 1992. -- 517 S. : Ill. -- ISBN 0333538188. --
Sambraus, Hans Hinrich: Atlas der Nutztierrassen : 250 Rassen in Wort und Bild. -- 5. Aufl. -- Stuttgart : Ulmer, 1996. -- 304 S. : Ill. -- ISBN 3800173484.
Sambraus, Hans Hinrich: Nutztierkunde : Biologie, Verhalten, Leistung und Tierschutz. -- Stuttgart : Ulmer, ©1991. -- S. 192 - 257. -- (UTB ; 1622). -- ISBN 3825216225.
Zu Kapitel 8.2.1.: Ziegen