

Fachliche Korrespondenz: mailto:
hausarzt@payer.de
Anfragen zur Website: mailto: payer@payer.de
Zitierweise / cite as:
Blessing, Susanne <1957 - >: Bürokratie. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- Fassung vom 2006-02-12. -- URL: http://www.payer.de/arztpatient/buerokratie.htm
Erstmals publiziert: 2006-02-12
Überarbeitungen:
Anlass: Gesundheits"reform"
Copyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Verfasserin. Für zitierte Texte liegt das Copyright bei den jeweiligen Urhebern.

Dieser Inhalt ist unter einer
Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Arzt und Patient von Tüpfli's Global Village Library

Abb.: Wir ersaufen in Bürokratie! —
Deshalb fehlt die Zeit für unsere Patienten.
Ärzteprotest 2006
[Bildquelle.
http://www.aerztezeitung.de/galerie/alben/6/DSC_1391.jpg. -- Zugriff am
2006-01-27]

Abb.: Facharzt für Formularwesen klagt: Kranke stören beim Verwalten!
Ärzteprotest 2006
[Bildquelle:
http://www.aerztezeitung.de/galerie/alben/6/010a0701-2.jpg. -- Zugriff am
2006-01-27]
"Die meisten Menschen in diesem Lande sind gar keine Menschen, sondern Gehaltsempfänger. Sie sehen alle Dinge vom Standpunkt ihres Amtes aus und haben für die Nöte anderer wenig Verständnis. Schwer lastet auf diesem Volke die wirtschaftliche Not; schwerer seine Bureaukratie. Seit Jahrhunderten ist in Deutschland auf dem Papier alles in Ordnung."
Kurt Tucholsky (alias Ignaz Wrobel) (1890 - 1935): Gehaltsempfänger. -- In: Freiheit. -- Nr. 476 (1920-11-11). -- S. 7.
"VPK richtet Burn-Out-Hotline für ÄrztInnen ein
Die Vereinigung psychotherapeutisch tätiger Kassenärzte e.V. (VPK) richtet ab dem 1. Juli eine Burnout-Hotline für ÄrztInnen ein. Auch und gerade MedizinerInnen sind gefährdet, an Depressionen und Suchterkrankungen zu leiden, suizidal zu werden oder ein Burn-Out-Syndrom zu erleiden. Dabei sind sie selbst wenig geübt, Hilfe für sich in Anspruch zu nehmen. Die Belastungen, denen ÄrztInnen in ihrem Beruf ausgesetzt sind, fördern die Gefahr der Krise: zum Beispiel das branchenübliche Übermaß an Arbeitsstunden, vielfältige psychische und physische Belastungsfaktoren oder die abnehmende Zeit für PatientInnen durch die Zunahme der Dokumentationspflichten.
Bei der VPK-Geschäftsstelle (089-58 92 99 30, Di und Do 9.30 - 12.30 Uhr) oder per E-Mail (vpk@psychotherapie.org) erfahren betroffene ÄrztInnen, wo in ihrer Nähe individuelle Beratung durch psychotherapeutisch kompetente KollegInnen finden."[Quelle: Dr. med. Mabuse. -- ISSN 0173-430X. -- Nr. 156 (2005-07/08). -- S. 13.]
"Zwei Stunden dauert der tägliche Kleinkrieg mit Formularen KV Baden-Württemberg hat Niedergelassene einen Tag lang ein Bürokratie-Protokoll führen lassen / Praxisgebühr verursacht den meisten Aufwand
STUTTGART (fst). Fast zwei Stunden seines im Mittel über zehnstündigen Arbeitstags in der Praxis verbringt ein niedergelassener Arzt mit Bürokratie.
Das ist das Ergebnis einer Umfrage der KV Baden-Württemberg im Herbst vergangenen Jahres unter ihren Mitgliedern. Teilgenommen haben insgesamt 3353 Ärzte und Psychotherapeuten (davon etwa 50 Prozent Hausärzte).
Von den im Durchschnitt 10,16 Stunden, die die Ärzte am Erfassungstag (20. Oktober 2005) in der Praxis verbracht haben, waren sie durchschnittlich 110 Minuten mit Papierkram beschäftigt. Kein Wunder, dass sich über 81 Prozent der teilnehmenden Ärzte "stark" oder "sehr stark" durch Bürokratie in ihrer Arbeit beeinträchtigt sehen.
Verwaltung kostet bis zu zwei Stunden täglich Wie viel Zeit haben Sie heute persönlich mit administrativen Tätigkeiten verbracht? Die Belastung der Ärzte durch Bürokratie variiert beträchtlich: Ein Viertel benötigt bis zu einer Stunde täglich, ein weiteres Vierte der Ärzte mehr als zwei Stunden. "Wir wollten die Diskussion über Bürokratie endlich auf eine solide Datenbasis stellen", sagte Tobias Binder, Grundsatzreferent bei der Südwest-KV, zu den Gründen für die Befragung. Nach der Praxisgebühr (26 Prozent) erzeugen Anfragen der Krankenkassen (fast 24 Prozent) den meisten bürokratischen Aufwand.
Praxisgebühr und Kassenanfragen sind Zeitfresser Welche administrative Tätigkeit verursacht in der Arztpraxis den größten bürokratischen Aufwand? Die Verwaltung der Praxisgebühr sowie Anfragen der Kassen machen allein die Hälfte der Zeit aus, die Ärzte täglich für Schreibarbeit opfern müssen. An diesem Punkt will die KV ansetzen und Ärzten noch im ersten Quartal einen Leitfaden an die Hand geben. Wie soll der Niedergelassene umgehen mit Anfragen von Kassen oder Versicherungen, die auf Schmierzetteln daherkommen? Mit Vordruck-Faxen, auf den die Kassen beispielsweise gebeten werden, die Rechtsgrundlage ihrer Anfrage zu erläutern, soll Ärzten der Umgang mit Papierkram zumindest etwas erleichtert werden.
Hoffnung auf einen großen Entbürokratisierungsschub kann KV-Mitarbeiter Binder den Ärzten allerdings nicht machen. Grund dafür ist aus seiner Sicht vor allem der Kassenwettbewerb: Durch Satzungsleistungen oder Modellvorhaben versuchen Kassen gezielt, neue Versicherte zu gewinnen, ähnlich sieht es bei Modellvorhaben aus.
Im Ergebnis gibt es in der Arztpraxis neue Formulare - extra nur für eine Kasse. Ähnlich sieht es mit der immer unüberschaubarer werdenden Vertragslandschaft aus: Formulare aus DMP- und IV-Verträgen [Disease-Management- und Integrierte-Versorgungs-Verträgen] machen bereits zusammen etwa 15 Prozent des bürokratischen Aufwands aus. Und ein Ende ist angesichts der etwa 260 Krankenkassen noch längst nicht in Sicht."
[Quelle: Ärzte Zeitung. -- 2006-01-27. -- http://www.aerztezeitung.de/docs/2006/01/27/015a0602.asp?cat=/politik/gesundheitssystem_uns. -- Zugriff am 2006-02-27]
"Ärzten verleidet die Formularflut immer mehr den Beruf / KV-Chef Heckemann: Bürokratie ist eine absichtsvolle Hürde KÖLN/DRESDEN. Unerträgliche Bürokratie macht Ärzte mindestens genau so zornig wie unzureichende Honorierung. Sie treibt Mediziner auf die Straße, verleidet ihnen den Beruf, raubt ihnen immer mehr Zeit. Abhilfe ist bislang nicht in Sicht. Alle Bemühungen, gegen den Papierkrieg anzugehen, sind bisher gescheitert.
Von Brigitte Düring
Was, wollte die "Ärzte Zeitung" kurz vor der Bundestagswahl im vergangenen Herbst von ihren Lesern wissen, sind "die drängendsten Probleme in der Gesundheitspolitik".
Von den über 2000 Ärzten, die sich an der Umfrage beteiligt haben, hielten 85 Prozent den täglichen Papierkrieg für das am meisten drängende Problem. Auf Platz 2 setzten die Leser die wachsenden Einschnitte in die Therapiefreiheit (69 Prozent) und das finanzielle Ausbluten der niedergelassenen Ärzte (64 Prozent). Das Ergebnis ist kein Einzelfall.
Verwaltungsarbeit - für viele Ärzte ein Grund auszusteigen
Eine Studie der Unternehmensberatung Ramboll Management im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums ergab, dass 63,5 Prozent der Ärzte, die in Deutschland nicht mehr kurativ tätig sind, als Grund für den Ausstieg das Ausmaß an Verwaltungsarbeit genannt haben.
Die Forderung nach Entbürokratisierung war bereits Diskussionsthema bei den Ärztetagen in Bremen (2004) und in Berlin (2005). Konsequenzen: keine. Ein ähnliches Schicksal war Arbeitsgruppen zum Thema Bürokratieabbau beschieden. Eine Chronologie des Scheiterns:
- KBV: Bereits im Juli 2004 hatte der Länderausschuss ein Gremium zum Bürokratieabbau eingerichtet. Den Vorsitz hatte Mecklenburg-Vorpommerns KV-Vize Ingolf Otto übernommen. Von Mai bis Juli 2005 befragte die Arbeitsgruppe per Internet-Umfrage Ärzte zur Bürokratie, an der sich 324 Ärzte, davon 43,5 Prozent Hausärzte, beteiligten. Die Ergebnisse veröffentlichte die KBV im September 2005. Den größten Aufwand verursachen danach Praxisgebühr, DMP sowie Kassenanfragen. Bei den Befragten ergab sich eine wöchentliche Arbeitszeit in der Praxis von 60 Stunden. Davon entfallen 14 Stunden auf administrative Tätigkeiten und 46 Stunden auf Sprechstunde für Patienten. Hochgerechnet auf die knapp 117 000 Vertragsärzte ergibt das eine zeitliche Belastung von etwa 75 Millionen Stunden für Bürokratie im Jahr, so die KBV-Befragung. Ob die KBV-Arbeitsgruppe über eine Zustandsbeschreibung hinauskommt, wird selbst von Teilnehmern, etwa dem sächsischen KV-Vorsitzenden Dr. Klaus Heckemann, bezweifelt.
- Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder: Im Juni 2004 hatte die GMK beschlossen, eine Arbeitsgruppe (AG) zur "Verbesserung der medizinischen Versorgung durch Deregulierung - Abbau von Dokumentationsaufwand" einzurichten. Anfang Juli 2005 legte die AG ihren Abschlußbericht vor, doch der ergeht sich nur in Wortblasen. So begrüßen die Ministerialen die "inzwischen von den Beteiligten gestarteten Aktivitäten zum Abbau des Dokumentationsaufwandes in der medizinischen Versorgung". Welche das sind, sagt der Bericht nicht. Große Chancen für weniger Verwaltungsaufwand sehen die Verfasser in der Entwicklung der Telematik im Gesundheitswesen. Über Details schweigen sich die Autoren aus.
Acht Bundesländer hatten für den GMK-Bericht Zuarbeit geleistet - und mussten mit Entsetzen feststellen, dass die meisten "Dokumentationsbestimmungen ausschließlich Bundesbezug haben, da die entsprechenden Vorgaben aus dem Bundesrecht stammen oder auf Verträgen der Bundesebene beruhen". Weiter heißt es, dass Sachleistungsprinzip, Wirtschaftlichkeitsgebot und das Prinzip, erbrachte Leistungen nachzuweisen, ein höheres Maß an Dokumentation erfordern als in Ländern mit Kostenerstattung.
Detaillierte Vorschläge - in Amtsstuben sauber abgelegt
Diese Erkenntnis hätten die Ländervertreter auch durch einen Anruf bei niedergelassenen Ärzten gewinnen können. Insgesamt sind der GMK 130 Hinweise und Verbesserungsvorschläge übergeben worden. Umgesetzt davon ist bisher kein einziger.
- Landesärztekammer und KV Sachsen: Die Ärztekammer war im Sommer 2004 von Landesgesundheitsministerin Helma Orosz (CDU) gebeten worden, Vorschläge zur Entbürokratisierung zu erarbeiten. Bereits im September reichte die Kammer eine Sammlung mit 100 aus ihrer Sicht überflüssigen oder zu umfangreichen Formularen ein. Im Oktober übersandte auch die KV Sachsen dem Ministerium detaillierte Vorschläge. Auf den Inhalt der Vorlagen reagierte Orosz aber nicht. Die rügte die "dürftige Zuarbeit" und sah KV und Kammer verantwortlich für den Papierdschungel.
INTERVIEW "Das Gremium ist eigentlich sinnlos"
Ärzte Zeitung: Hat sich der KBV-Arbeitskreis Bürokratieabbau vorgenommen, Ärzte wirksam zu entlasten?
Klaus Heckemann [Sachsens KV-Chef ]: Die Arbeitsgruppe wird nicht viel bewegen können. Sie ist eigentlich sinnlos, weil bürokratische Hürden im Gesundheitswesen oft absichtlich aufgestellt werden. Ein großer Teil der Bürokratie hat das Ziel, wachsende Ansprüche der Versicherten mit dem nicht vorhandenen Geld im Gesundheitswesen in Übereinstimmung zu bringen. Es soll uns Ärzten schwer gemacht werden, Krankentransporte, Physiotherapie oder Kuren zu verordnen und dem Patienten, sie zu beanspruchen. Für eine Kur beispielsweise muss der Arzt dem Patienten einen Antrag ausfüllen, damit geht dieser dann zur Krankenkasse, um sich dort einen Kurantrag abzuholen. Den muss der Arzt erneut ausfüllen. Dafür muss er neuerdings auch Fortbildungen nachweisen. Diese absichtsvollen Hürden kann ein KBV-Gremium nicht einreißen.
Ärzte Zeitung: Wie kann man Abhilfe schaffen?
Heckemann: Genau so wie für ein anständiges Honorar: Nötig ist eine Mengensteuerung, die über Geld funktioniert. Der Gesetzgeber muss Versicherte in die Mengensteuerung einbinden, um so die Ansprüche der Versicherten auf ein vertretbares Maß zurückschrauben. Eine Alternative wäre nur der Boykott. (dür)
[Quelle: Ärzte Zeitung. -- 2006-01-27. -- http://www.aerztezeitung.de/docs/2006/01/27/015a0601.asp?cat=/politik/gesundheitssystem_uns. -- Zugriff am 2006-01-27]
Für Formulare ist die jeweils gültige Fassung der "Vereinbarung über Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung" maßgeblich.
Online ist diese Vordruckvereinbarung z.B. zugänglich unter:
http://www.kvwl.de/arzt/recht/kbv/bmv-ae/bmvae-2.pdf. -- Zugriff am 2006-01-28. -- Anschauenswert!!!
In der Fassung vom 2005-04-01 (ist kein Aprilscherz!) sind folgend Formulare verbindlich:
Vordruck-Muster
- Muster 1: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
- Muster 2: Verordnung von Krankenhausbehandlung
- Muster 3: Bescheinigung über den mutmaßlichen Tag der Entbindung
- Muster 4: Verordnung einer Krankenbeförderung
- Muster 5: Abrechnungsschein ambulante Behandlung, belegärztliche Behandlung, Abklärung somatischer Ursachen vor Aufnahme einer Psychotherapie, anerkannte Psychotherapie
- Muster 6: Überweisungs-/Abrechnungsschein
- Muster 7: Überweisung vor Aufnahme einer Psychotherapie zur Abklärung somatischer Ursachen
- Muster 8: Sehhilfenverordnung
- Muster 8a: Verordnung von vergrößernden Sehhilfen
- Muster 9: Ärztliche Bescheinigung für die Gewährung von Mutterschaftsgeld bei Frühgeburten
- Muster 10: Überweisungs-/Abrechnungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung
- Muster 11: Bericht für den Medizinischen Dienst
- Muster 12: Verordnung häuslicher Krankenpflege
- Muster 13: Heilmittelverordnung (Maßnahmen der Physikalischen Therapie/Podologischen Therapie)
- Muster 14: Heilmittelverordnung (Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie)
- Muster 15: Ohrenärztliche Verordnung einer Hörhilfe
- Muster 16: Arzneiverordnungsblatt
- Muster 17: Ärztliche Bescheinigung zur Erlangung von Krankengeld
- Muster 18: Heilmittelverordnung (Maßnahmen der Ergotherapie)
- Muster 19: Notfall-/Vertretungsschein
- Muster 20: Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (Wiedereingliederungsplan)
- Muster 21: Ärztliche Bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes
- Muster 22: Konsiliarbericht vor Aufnahme einer Psychotherapie
- Muster 25: Anregung einer ambulanten Vorsorgeleistung in anerkannten Kurorten gemäß § 23 Abs. 2 SGB V
- Muster 26: Verordnung Soziotherapie gem. § 37a SGB V
- Muster 27: Soziotherapeutischer Betreuungsplan gem. § 37a SGB V
- Muster 28: Verordnung bei Überweisung zur Indikationsstellung für Soziotherapie
- Muster 30: Berichtsvordruck Gesundheitsuntersuchung
- Muster 38: Dokumentationsbogen zur Früherkennungs-Koloskopie
- Muster 39: Überweisungsschein zur präventiven zytologischen Untersuchung
- Muster 39 a bis 39 c: Dokumentationsvordruck für Krebsfrüherkennungsuntersuchung Frauen
- Muster 40: Dokumentationsvordruck für Krebsfrüherkennungsuntersuchung Männer
- Muster 41: Arztanfrage
- Muster 50: Anfrage zur Zuständigkeit einer anderen Krankenkasse
- Muster 51: Anfrage zur Zuständigkeit eines sonstigen Kostenträgers
- Muster 52: Anfrage bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit
- Muster 53: Anfrage zum Zusammenhang von Arbeitsunfähigkeitszeiten
- Muster 55: Bescheinigung zur Feststellung einer schwerwiegenden chronischen Krankheit gemäß § 62 SGB V
- Muster 56: Antrag auf Kostenübernahme für Rehabilitationssport
- Muster 57: Antrag auf Kostenübernahme für Funktionstraining
- Muster 58: Bescheinigung zur ärztlichen Folgeverordnung von Rehabilitationssport/Funktionstraining
- Muster 60: Einleitung von Leistungen zur Rehabilitation oder alternativen Angeboten
- Muster 61: Verordnung von medizinischer Rehabilitation
- Muster 70: Behandlungsplan für Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung gemäß § 27a SGB V sowie der „Richtlinien über künstliche Befruchtung“ des Gemeinsamen Bundesausschusses für die hier genannten Ehegatten
- Muster 80: Dokumentation des Behandlungsanspruchs von im Ausland Versicherten
- Muster 81: Erklärung des im EU- bzw. EWR-Ausland oder der Schweiz versicherten Patienten bei Inanspruchnahme von Sachleistungen während eines vorübergehenden Aufenthaltes in Deutschland
- Muster 99: Beleg über die Zuzahlung gemäß § 28 Absatz 4 SGB V
- Muster 99a: Beleg über die Zuzahlung im Notfall gemäß § 28 Absatz 4 SGB V
Im Folgenden werden einige Formulare beispielhaft vorgestellt.
Alle ambulanten Fahrten müssen zuvor von der Krankenkasse genehmigt werden, also z.B. alle Besuche von Pflegeheimbewohnern beim Zahnarzt oder Augenarzt. Dies ist ein Riesenaufwand, der eindeutig Krankenbeförderung verhindern soll. Die Nennung des Notarztwagens ist überflüssig, da ein solcher im Bedarfsfall sowieso auch ohne Formular eingesetzt werden muss.
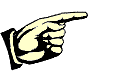
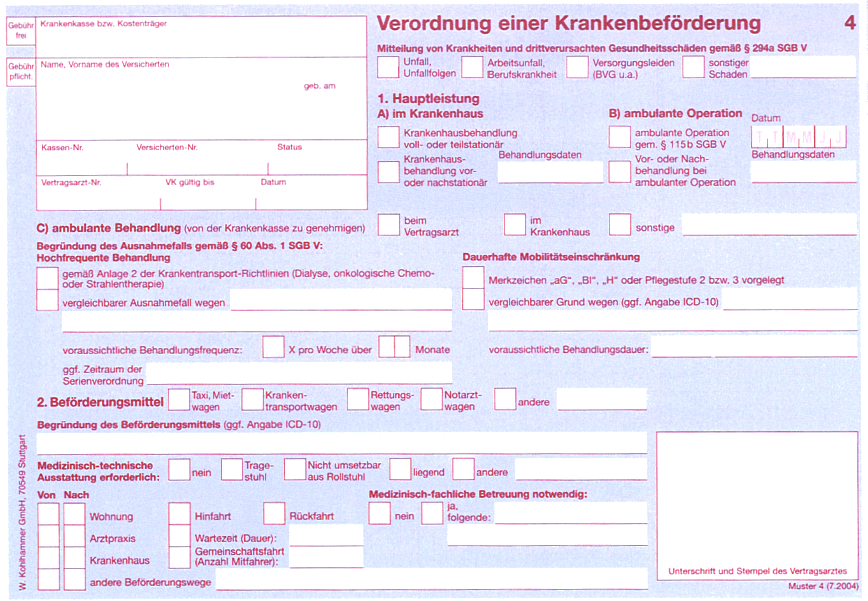
Abb.: Vorderseite

Abb.: Rückseite
C) Ambulante Behandlung Fahrten zur ambulanten Behandlung können nur in besonderen Ausnahmefällen verordnet werden. Der Versicherte muss die Kostenübernahme von der Krankenkasse genehmigen lassen.
Zur Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Krankenfahrten zu einer ambulanten Behandlung ist die Art des Ausnahmefalls im Sinne des § 8 der Richtlinie unter C) anzugeben:
- Hochfrequente Behandlung (Anlage 2 der Krankentransport-Richtlinien)
Liegt eine Indikation gemäß Anlage 2 der Richtlinie (Dialyse, onkologischen Strahlen- oder Chemotherapie) vor, so ist das entsprechende Feld anzukreuzen, die Behandlungsfrequenz und -dauer sowie der Zeitraum der Serienfahrt anzugeben. Es gilt die jeweils aktuelle Version der Anlage 2.
Liegt eine vergleichbare Therapie (Kriterien: vorgegebenes Therapieschema, hohe Behandlungsfrequenz über längeren Zeitraum; schwerwiegende gesund-heitliche Beeinträchtigung durch die Behandlung oder den Krankheitsverlauf, die eine Beförderung unerlässlich macht) vor, so ist dieser Ausnahmefall im Freitextfeld entsprechend zu begründen. In diesem Fall ist neben der Angabe der voraussichtlichen Behandlungsfrequenz und -dauer ebenfalls die Angabe des Zeitraums der Serienverordnung erforderlich.Dauerhafte Mobilitätseinschränkung
Bedarf der Versicherte aufgrund einer dauerhaften Mobilitätseinschränkung (Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen „aG“, „Bl“, „H“ oder Pflegestufe 2 bzw. 3) einer Krankenfahrt, ist das entsprechende Feld anzukreuzen.
In vergleichbaren Fällen der dauerhaften Mobilitätseinschränkung, die den vorgenannten Merkzeichen entsprechen, kommt eine Verordnung nur in Betracht, wenn der Patient einer ambulanten Behandlung über einen längeren Zeitraum bedarf. In diesem Fall ist die voraussichtliche Behandlungsdauer und –frequenz anzugeben und die Vergleichbarkeit der Mobilitätsseinschränkung, ggf. unter Angabe der maßgeblichen ICD-10-Schlüsselnummer, zu begründen."
[Quelle: Vordruckvereinbarung einschl. Erläuterungen BMV, Anlage 2. -- http://www.kvwl.de/arzt/recht/kbv/bmv-ae/bmvae-2.pdf. -- Zugriff am 2006-01-31]
Hier ist es wichtig, die Heilmittelrichtlinien zu beachten. Der unten zitierte Ausschnitt aus diesen gibt einen Eindruck, wie sehr die Verordnungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.
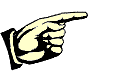
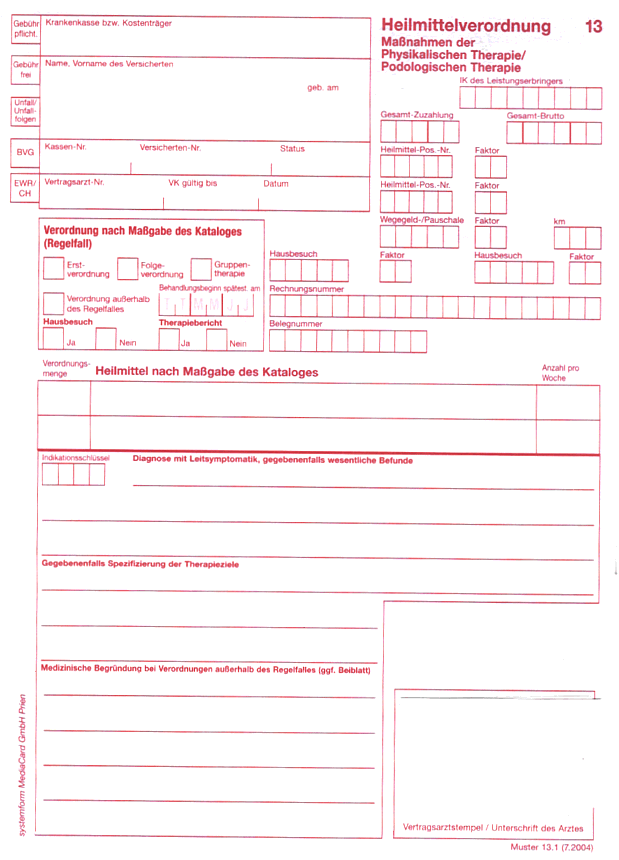
Abb.: Vorderseite
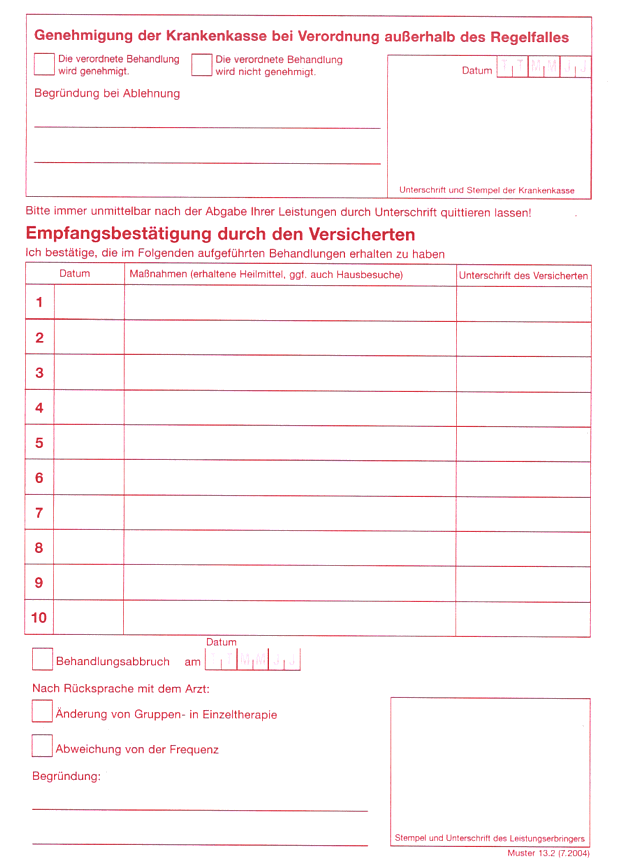
Abb.: Rückseite
Muster 13: Heilmittelverordnung A. Verordnung von Maßnahmen der Physikalischen Therapie
- Die Verordnung erfolgt ausschließlich auf dem vereinbarten Vordruck. Die Vordrucke müssen vollständig ausgefüllt werden. Hierzu zählt auch die Angabe der Behandlungsfrequenz. Die Therapieziele sind nur anzugeben, wenn diese sich nicht aus der Angabe der Diagnose und der Leitsymptomatik ergeben. Verordnungsfähig sind ausschließlich jene Maßnahmen, die in den Heilmittelrichtlinien genannt werden. In der Verordnung sind die Maßnahmen der Physikalischen Therapie eindeutig zu bezeichnen.
Die Indikation für die Verordnung von Maßnahmen der Physikalischen Therapie ergibt sich nicht aus der Diagnose allein, sondern nur dann, wenn die Schädigung/Funktionsstörung eine Anwendung von Physikalischer Therapie notwendig macht.
- Basiert der Behandlungsanspruch eines im Ausland Versicherten auf der Vorlage einer Europäischen Krankenversichertenkarte, einer Ersatzbescheinigung oder einer Bescheinigung über den Leistungsanspruch während eines Aufenthaltes in einem anderen Mitgliedstaat (Formular E 111), so ist das Feld EWR/CH zu kennzeichnen.
- Vor der Erstverordnung einer Maßnahme der Physikalischen Therapie ist eine Eingangsdiagnostik notwendig. Bei der Eingangsdiagnostik sind störungsbildabhängig diagnostische Maßnahmen durchzuführen, zu veranlassen und zu dokumentieren.
Insbesondere bei Nichterreichen des individuell angestrebten Therapieziels ist eine weiterführende Diagnostik erforderlich, die maßgebend ist für die ggf. notwendige Einleitung anderer ärztlicher oder rehabilitativer Maßnahmen bzw. für die mögliche Beendigung oder Fortsetzung einer Maßnahme der Physikalischen Therapie.
Vordruckvereinbarung einschl. Erläuterungen BMV-Anlage 2
- Maßnahmen der Physikalischen Therapie dürfen bei Kindern nicht verordnet werden, wenn an sich störungsbildspezifische heilpädagogische / sonder-pädagogische Maßnahmen zur Beeinflussung von Schädigungen geboten sind. Sind heilpädagogische / sonderpädagogische Maßnahmen nicht durchführbar, dürfen Maßnahmen der Physikalischen Therapie nicht an deren Stelle verordnet werden. Neben heilpädagogischen / sonderpädagogischen Maßnahmen dürfen Maßnahmen der Physikalischen Therapie nur bei entsprechender medizinischer Indikation außerhalb dieser heilpädagogischen / sonderpädagogischen Maßnahmen verordnet werden.
Maßnahmen der Physikalischen Therapie dürfen nicht verordnet werden, soweit diese im Rahmen der Frühförderung nach §§ 30 ff SGB IX in Verbindung mit der Frühförderverordnung vom 24. Juni 2003 als therapeutische Leistungen bereits erbracht werden.
- Nach einer Erstverordnung gilt jede Verordnung zur Behandlung derselben Erkrankung (desselben Regelfalls) als Folgeverordnung. Dies gilt auch, wenn sich unter der Behandlung die Leitsymptomatik ändert und unterschiedliche Maßnahmen der Physikalischen Therapie zum Einsatz kommen. Sofern ein neuer Regelfall beginnt (vgl. Nr. 7 ff), ist wieder mit einer Erstverordnung zu beginnen.
- Das Feld „Behandlungsbeginn spätest. am“ ist nur auszufüllen, wenn die Behandlung nicht innerhalb von zehn Tagen nach Ausstellung der Verordnung begonnen werden soll.
- Soweit entsprechend der medizinischen Indikation nach Maßgabe des Heilmittel-Kataloges (LY1 - LY3) die Manuelle Lymphdrainage als Heilmittel zu verordnen ist, hat in dem Verordnungsfeld „Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges“ neben dem Heilmittel „Manuelle Lymphdrainage“ auch die Minutenangabe in Höhe von 30, 45 oder 60 Minuten zu erfolgen. Alternativ ist hier auch die Angabe des Heilmittels zusammen mit der Minutenzahl in Kurzform entsprechend dem Heilmittel-Katalog möglich (MLD-30, MLD-45 oder MLD-60).
Bei einer im Einzelfall erforderlichen Kompressionsbandagierung (Lymphologischer Kompressionsverband) im Zusammenhang mit der Manuellen Lymphdrainage – sofern keine Hilfsmittel zur Kompressionstherapie vorhanden sind – ist diese zusätzlich in der gleichen Zeile anzugeben (z. B. „MLD-45 mit Kompressionsbandagierung“). Ggf. erforderliche Kompressionsbinden sind gesondert als Verbandmittel zu verordnen.
- Die Verordnung der Heilmittelerbringung außerhalb der Praxis des Therapeuten, ist nur dann zulässig, wenn der Patient aus medizinischen Gründen den Therapeuten nicht aufsuchen kann oder wenn sie aus medizinischen Gründen zwingend notwendig ist.
- Im Heilmittelkatalog sind Einzeldiagnosen zu Diagnosengruppen zusammengefasst. Eine Verordnung von Maßnahmen der Physikalischen Therapie im Regelfall liegt dann vor, wenn die Auswahl zwischen der im jeweiligen Abschnitt des Heilmittelkataloges angegebenen Heilmitteln getroffen wird und die dort festgelegten Gesamtverordnungsmengen je Diagnosengruppe nicht überschritten werden. Dabei sind gegenseitige Anrechnungen einzelner Diagnosengruppen zu beachten. Treten im zeitlichen Zusammenhang mehrere voneinander unabhängige Erkrankungen derselben Diagnosengruppe auf, kann dies weitere Regelfälle auslösen.
- Rezidive oder neue Erkrankungsphasen können die Verordnung von Maßnahmen der Physikalischen Therapie als erneuten Regelfall auslösen, wenn nach einer kontinuierlichen Heilmittelanwendung ein behandlungsfreies Intervall von zwölf Wochen abgelaufen ist.
Heilmittel im Regelfall in der Physikalischen Therapie können verordnet werden als
- vorrangiges Heilmittel,
- optionales Heilmittel,
- ergänzendes Heilmittel und
- standardisierte Heilmittelkombination.
- Verordnungen, die über den Regelfall hinausgehen:
- Lässt sich mit der nach Maßgabe des Heilmittelkataloges bestimmten Gesamtverordnungsmenge im Regelfall die Behandlung nicht abschließen, sind weitere Verordnungen möglich (Verordnungen außerhalb des Regelfalls, insbesondere längerfristige Verordnungen). Solche Verordnungen bedürfen einer besonderen Begründung mit prognostischer Einschätzung. Dabei sind die Grundsätze der Verordnung im Regelfall anzuwenden. Bei längerfristigen Verordnungen ist die Verordnungsmenge abhängig von der Behandlungsfrequenz so zu bemessen, dass mindestens eine ärztliche Untersuchung innerhalb einer Zeitspanne von 12 Wochen nach der Verordnung gewährleistet ist.
- Begründungspflichtige Verordnungen sind der zuständigen Krankenkasse vor Fortsetzung der Therapie zur Genehmigung vorzulegen. Verzichtet eine Krankenkasse auf die Vorlage, informiert sie darüber schriftlich die Kassen-ärztlichen Vereinigungen.
- Die gleichzeitige Verordnung mehrerer Maßnahmen der Physikalischen Therapie ist nur dann ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich, wenn durch sie ein therapeutisch erforderlicher Synergismus erreicht wird.
- Bei gegebener Indikation richtet sich die Auswahl der zu verordnenden Maßnahmen der Physikalischen Therapie nach dem jeweils therapeutisch im Vordergrund stehenden Behandlungsziel.
- Vorrangig soll eine im Heilmittelkatalog als „vorrangiges Heilmittel“ (A) ge-nannte Maßnahme zur Anwendung kommen.
- Ist dies aus in der Person des Patienten liegenden Gründen nicht möglich, kann alternativ ein im Heilmittelkatalog genanntes „optionales Heilmittel“ (B) verordnet werden.
- Soweit medizinisch erforderlich kann zu einem „vorrangigen Heilmittel“ (A) oder „optionalen Heilmittel“ (B) nur ein weiteres im Heilmittelkatalog genanntes „ergänzendes Heilmittel“ (C) verordnet werden. Abweichend hiervon können Maßnahmen der Elektrotherapie/-stimulation sowie die Ultraschall-Wärmetherapie auch isoliert verordnet werden, soweit der Heilmittelkatalog diese Maßnahmen indikationsbezogen als ergänzende Heilmittel vorsieht.
- „Standardisierte Heilmittelkombinationen“ (D) dürfen nur verordnet werden, wenn der Patient bei komplexen Schädigungsbildern einer intensiveren Heilmittelbehandlung bedarf und die therapeutisch erforderliche Kombination von drei oder mehr Maßnahmen synergistisch sinnvoll ist, wenn die Erbringung dieser Maßnahmen in einem direkten zeitlichen und örtlichen Zusammenhang erfolgt und der Patient aus medizinischer Sicht geeignet ist.
- Die gleichzeitige Verordnung einer „standardisierten Heilmittelkombination“ (D) der Physikalischen Therapie mit einem weiteren Einzelheilmittel der Physikalischen Therapie ist nicht zulässig.
- Die gleichzeitige Verordnung eines „vorrangigen Heilmittels“ (A) und eines „optionalen Heilmittels“ (B) bei derselben Schädigung ist nicht zulässig.
- Die gleichzeitige Verordnung von Heilmitteln der Physikalischen Therapie, der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und der Ergotherapie ist bei entsprechender Indikation zulässig.
- Sofern Einzeltherapie medizinisch nicht zwingend geboten ist, ist wegen gruppendynamisch gewünschter Effekte oder im Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebots Gruppentherapie zu verordnen.
- Es ist der vollständige Indikationsschlüssel anzugeben. Dieser setzt sich aus der Bezeichnung der Diagnosengruppe und dem Buchstaben der vorrangigen Leitsymptomatik im Katalog zusammen (z. B. ZN2a).
[...]"
[Quelle: Vordruckvereinbarung einschl. Erläuterungen BMV, Anlage 2. -- http://www.kvwl.de/arzt/recht/kbv/bmv-ae/bmvae-2.pdf. -- Zugriff am 2006-01-31]
"Heilmittel-Richtlinien Zweiter Teil
I. Maßnahmen der Physikalischen Therapie
1. Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane
Indikation Ziel der Physikalischen Therapie
Heilmittelverordnung im Regelfall Diagnose Leitsymptomatik:
Schädigung,
FunktionsstörungA. vorrangige Heilmittel
B. optionale Heilmittel
C. ergänzende Heilmittel
D. standardisierte HeilmittelkombinationenVerordnungsmengen je Diagnose
-----------------
weitere HinweiseWS1 Wirbelsäulenerkrankungen
- mit prognostisch kurzzeitigem Behandlungsbedarf
z.B.
- Discopathien
- Myotendopathien
- Blockierungen
- Osteochondrosen
- Spondyl- oder Uncover-
- tebralarthrosen
- reflektorische Störungen
- Osteoporose
- Skoliosen / Kyphosen
- behandlungsbedürftige
- Haltungsstörungen (obligat positiver Mathiaß-Test)
- statischen Störungen
a
Funktionsstörungen / Schmerzen durch Gelenkfunktionsstörung, Gelenkblockierung (auch ISG oder Kopfgelenke)Funktionsverbesserung, Schmerzreduktion durch Verringern o. Beseitigen der Gelenkfunktionsstörung A. KG / MT C. Traktion / Wärme- / Kältetherapie
Erst-VO:
- bis zu 6x/VO
Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:
- bis zu 6 Einheiten
Frequenzempfehlung:
- mind. 2x wöchentlich
Ziel:
- Erlernen eines Eigenübungsprogrammes
b
Funktionsstörungen / Schmerzen durch Fehl- oder Überbelastung discoligamentärer StrukturenFunktionsverbesserung, Verringerung, Beseitigung der Fehl- oder Überbelastung discoligamentärer Strukturen A. KG C. Traktion
c
Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzungWiederherstellung, Besserung der gestörten Muskelfunktion A. KG / KG-Gerät B. Übungsbehandlung / Chirogymnastik
d
segmentale BewegungsstörungenWiederherstellung, Besserung der gestörten Beweglichkeit A. KG / MT B. Übungsbehandlung / Chirogymnastik
C. Wärmetherapie / Kältetherapie
e
Schmerzen / Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen; Verkürzung elastischer und kontraktiler Strukturen, Gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungenRegulierung der schmerzhaften Muskelspannung, der Durchblutung, des Stoffwechsels, Beseitigung der Gewebequellungen, -verhärtungen und -verklebungen A. KMT B. UWM / SM / PM / BGM
C. Elektrotherapie / Wärmetherapie / Kältetherapie / hydroelektrische Bäder
Indikation Ziel der Physikalischen Therapie
Heilmittelverordnung im Regelfall Diagnose Leitsymptomatik:
Schädigung,
FunktionsstörungA. vorrangige Heilmittel
B. optionale Heilmittel
C. ergänzende Heilmittel
D. standardisierte HeilmittelkombinationenVerordnungsmengen je Diagnose
-----------------
weitere HinweiseWS2 Wirbelsäulenerkrankungen
- mit prognostisch längerdauerndem Behandlungsbedarf (insbesondere Einschränkungen von relevanten Aktivitäten des täglichen Lebens, multistrukturelle oder funktionelle Schädigung)
z.B.:
- - Bandscheibenprolaps insbesondere mit radiculären Syndromen
- Spondylolisthesis
- Foramenstenosen
- Korsettversorgte Skoliosen / Kyphosen
- Floride juvenile Hyperkyphosen
- Seronegative Spondarthritis / M. Bechterew
- Entzündlich-rheumatische WS-Erkrankungen
a
Funktionsstörungen / Schmerzen durch Gelenkfunktionsstörung, Gelenkblockierung (auch ISG oder Kopfgelenke)Funktionsverbesserung, Schmerzreduktion durch Verringern o. Beseitigen der Gelenkfunktionsstörung A. KG / MT C. Traktion / Wärmetherapie / Kältetherapie
Erst-VO:
- bis zu 6x/VO
Folge-VO:
- bis zu 6x/VO
Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:
- bis zu 18 Einheiten
davon für Massagetechniken
- bis zu 10 Einheiten
davon für standardisierte Heilmittelkombination
- bis zu 10 Einheiten
Frequenzempfehlung:
- mind. 2x wöchentlich
Ziel:
Erlernen eines Eigenübungsprogrammes
Hinweise:
Sofern im Einzelfall verlaufsabhängig unmittelbar ein Wechsel von WS1 zu WS2 medizinisch begründet ist, ist die bereits zu WS1 erfolgte Verordnungsmenge auf die Gesamtverordnungsmenge von WS2 anzurechnen.
Ein Wechsel von WS2 zu WS1 ist nicht möglich.
b
Funktionsstörungen / Schmerzen durch Fehl- oder Überbelastung discoligamentärer StrukturenFunktionsverbesserung Verringerung, Beseitigung der Fehl- oder Überbelastung discoligamentärer Strukturen A. KG C. Traktion
c
Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzungWiederherstellung, Besserung der gestörten Muskelfunktion A. KG / KG-Gerät B. Übungsbehandlung / Chirogymnastik
d
segmentale BewegungsstörungenWiederherstellung; Besserung der gestörten Beweglichkeit A. KG / MT B. Übungsbehandlung / Chirogymnastik
C. Wärmetherapie / Kältetherapie
e
motorische Parese von Extremitätenmuskeln / sensomotorische DefiziteErhalt der kontraktilen Strukturen, Verbesserung der Kraft der paretischen Muskulatur bei prognostisch reversibler Denervierung A. KG / KG-Gerät B. Übungsbehandlung
C. Elektrostimulation
f
Schmerzen / Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen; Verkürzung elastischer und kontraktiler Strukturen, Gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungenRegulierung der schmerzhaften Muskelspannung, der Durchblutung, des Stoffwechsels, Beseitigung der Gewebequellungen, -verhärtungen und -verklebungen A. KMT B. UWM / SM / PM / BGM
C. Elektrotherapie / Wärmetherapie / Kältetherapie / hydroelektrische Bäder
g
D1 komplexe Schädigungen / Funktionsstörungen
- bei zwei führenden Schädigungen / Funktionsstörungen
a bis d neben fsiehe a bis f D1. KG + KG-Gerät + MT
+ KMT
+ Wärme-/ Kältetherapie
+ Elektrotherapie
zusätzlich:
- ggf. hydroelektrische Bäder
- ggf. Elektrostimulation
- ggf. Traktion
- ggf. Peloid-Vollbäder
Indikation Ziel der Physikalischen Therapie
Heilmittelverordnung im Regelfall Diagnose Leitsymptomatik:
Schädigung,
FunktionsstörungA. vorrangige Heilmittel
B. optionale Heilmittel
C. ergänzende Heilmittel
D. standardisierte HeilmittelkombinationenVerordnungsmengen je Diagnose
-----------------
weitere HinweiseEX1
Verletzungen/ Operationen und Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens
- mit prognostisch kurzzeitigem Behandlungsbedarf
z.B.:
- Distorsionen, Kontusionen
- Arthrosen entzündlich-rheumatische
- Gelenkerkrankung (ohne akut entzündlichen Schub)
- Periarthropathien
- Bursitis
- Fußfehlhaltungen (wie nicht fixierte Klump-, Spitz- und Sichelfußhaltungen)
a
Gelenkfunktionsstörungen, Bewegungsstörungen, KontrakturenWiederherstellung, Besserung der gestörten Beweglichkeit A. KG / MT
B. Übungsbehandlung
C Wärmetherapie / Kältetherapie / ElektrotherapieErst-VO:
- bis zu 6x/VO
Gesamtverordnungsmenge
des Regelfalls:
- bis zu 6 Einheiten
Frequenzempfehlung:
- mind. 2x wöchentlich
Ziel:
- Erlernen eines Eigenübungsprogrammes, Gelenkschulung
b
Funktionsstörungen durch Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzungWiederherstellung, Besserung der gestörten Muskelfunktion A. KG / KG-Gerät
B. Übungsbehandlungc
Schmerzen/ Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen; Verkürzung elastischer und kontraktiler Strukturen, Gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungenRegulierung der schmerzhaften Muskelspannung, der Durchblu-tung, des Stoffwechsels, Beseiti-gung der Gewebequellungen, -verhärtungen und -verklebungen A. KMT
B. UWM / SM / PM / BGM
C. Elektrotherapie / Wärmetherapie / Kältetherapie / hydroelektrische Bäder
Indikation Ziel der Physikalischen Therapie
Heilmittelverordnung im Regelfall Diagnose Leitsymptomatik:
Schädigung,
FunktionsstörungA. vorrangige Heilmittel
B. optionale Heilmittel
C. ergänzende Heilmittel
D. standardisierte HeilmittelkombinationenVerordnungsmengen je Diagnose
-----------------
weitere HinweiseEX2
Verletzungen / Operationen und Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens
- mit prognostisch mittelfristigem Behandlungsbedarf (insbesondere Einschränkungen von relevanten Aktivitäten des täglichen Lebens, multistrukturelle funktionelle Schädigungen)
z.B.:
- Frakturen
- Sehnenrupturen
- Kreuzbandersatz, Arthrodesen, Materialentfernung nach Osteosynthesen
- Erkrankungen mit Gefäß-, Muskel- und / oder Bindegewebsbeteiligung, insbesondere entzündlichrheumatische Gelenkerkrankung mit akut entzündlichen Schub und systemische Erkrankungen
- Sympathische Reflexdystrophie - Stadium I bis II
a
Gelenkfunktionsstörungen, Bewegungsstörungen, KontrakturenWiederherstellung, Besserung der gestörten Beweglichkeit A. KG / MT
B. Übungsbehandlung
C. Wärme- / Kältetherapie / ElektrotherapieErst-VO:
- bis zu 6x/VO
Folge-VO:
- bis zu 6x/VO
Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:
- 18 Einheiten
davon für Massagetechniken insgesamt bis zu 10 Einheiten
davon für standardisierte Heilmittelkombinationen bis zu 10 EinheitenFrequenzempfehlung:
- mind. 2x wöchentlich
Ziel:
Erlernen eines EigenübungsprogrammesHinweise:
Sofern im Einzelfall verlaufsabhängig unmittelbar ein Wechsel von EX1 zu EX2 medizinisch begründet ist, ist die bereits zu EX1 erfolgte Verordnungsmenge auf die Gesamtverordnungsmenge von EX2 anzurechnen.
Ein Wechsel von EX2 zu EX1 ist nicht möglich.
Störungen des Lymphabflusses siehe LY1 Trophische Störungen siehe SO4b
Funktionsstörungen durch Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzungWiederherstellung, Besserung der gestörten Muskelfunktion A. KG / KG-Gerät
B. Übungsbehandlungc
Schmerzen / Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen; Verkürzung elastischer und kontraktiler Strukturen, Gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungenRegulierung der schmerzhaften Muskelspannung, der Durchblutung, des Stoffwechsels, Beseitigung der Gewebequellungen, -verhärtungen und -verklebungen A. KMT
B. UWM / SM / PM / BGM
C. Elektrotherapie / Wärmetherapie / Kältetherapie / hydroelektrische Bäderd
D1 komplexe Schädigungen / Funktionsstörungen
- bei zwei führenden Schädigungen / Funktionsstörungen
a und b neben csiehe a bis c D1 KG + KG-Gerät + MT
+ KMT
+ Wärme-/ Kältetherapie
+ Elektrotherapie
zusätzlich:
- ggf. hydroelektrische Bäder
Indikation Ziel der Physikalischen Therapie
Heilmittelverordnung im Regelfall Diagnose Leitsymptomatik:
Schädigung,
FunktionsstörungA. vorrangige Heilmittel
B. optionale Heilmittel
C. ergänzende Heilmittel
D. standardisierte HeilmittelkombinationenVerordnungsmengen je Diagnose
-----------------
weitere HinweiseEX3
Verletzungen/ Operationen und Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens
- mit prognostisch längerem Behandlungsbedarf (insbesondere Einschränkungen von relevanten Aktivitäten des täglichen Lebens, multistrukturelle funktionelle Schädigungen)
z.B.:
- - Beckenfrakturen, Gelenk- /gelenksnahe Frakturen,
- Stück- / Trümmerfrakturen
- komplexe Sehnen-, Band-, Gelenkschäden
- Osteotomien großer Röhrenknochen, Endoprothesen, Girdlestone Hüfte, Amputationen, Exartikulationen
- Erkrankungen mit Gefäß-, Muskel- und / oder Bindegewebsbeteiligung, insbesondere entzündlichrheumatische Gelenkerkrankung mit akut entzündlichen Schub und systemische Erkrankungen
- Sympathische Reflexdystrophie Stadium III
a
Gelenkfunktionsstörungen, Bewegungsstörungen, KontrakturenWiederherstellung, Besserung der gestörten Beweglichkeit A. KG / MT B. Übungsbehandlung
C. Wärme- / Kältetherapie/ Elektro-
therapie
Erst-VO:
- bis zu 6x/VO
Folge-VO:
- bis zu 6x/VO
Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:
- 30 Einheiten
davon für Massagetechniken insgesamt bis zu 10 Einheiten
davon für standardisierte Heilmittelkombinationen bis zu 10 EinheitenFrequenzempfehlung:
- mind. 2x wöchentlich
Ziel:
- Erlernen eines Eigenübungsprogrammes
Hinweise:
Sofern im Einzelfall verlaufsabhängig unmittelbar ein Wechsel von EX1 bzw. EX2 zu EX3 medizinisch begründet ist, ist die bereits zu EX1 bzw. EX2 erfolgte Verordnungsmenge auf die Gesamtverordnungsmenge von EX3 anzurechnen.
Ein Wechsel von EX3 zu EX1 oder EX2 ist nicht möglich.
Störungen des Lymphabflusses siehe LY1
Trophische Störungen siehe SO4b
Funktionsstörungen durch Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzungWiederherstellung, Besserung der gestörten Muskelfunktion A. KG / KG-Gerät B. Übungsbehandlung
c
Schmerzen / Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen; Verkürzung elastischer und kontraktiler Strukturen, Gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungenRegulierung der schmerzhaften Muskelspannung, der Durchblutung, des Stoffwechsels, Beseitigung der Gewebequellungen, -verhärtungen und -verklebungen A. KMT B. UWM / SM / PM / BGM
C. Elektrotherapie / Wärmetherapie /
Kältetherapie / hydroelektrische
Bäder
d
D1 komplexe Schädigungen / Funktionsstörungen
- bei zwei führenden Schädigungen / Funktionsstörungen
a und b neben csiehe a bis c D1 KG + KG-Gerät + MT + KMT
+ Wärme-/Kältetherapie
+ Elektrotherapie
zusätzlich:
- ggf. hydroelektrische Bäder
[...]
2. Erkrankungen des Nervensystems
[...]
Indikation Ziel der Physikalischen Therapie
Heilmittelverordnung im Regelfall Diagnose Leitsymptomatik:
Schädigung,
FunktionsstörungA. vorrangige Heilmittel
B. optionale Heilmittel
C. ergänzende Heilmittel
D. standardisierte HeilmittelkombinationenVerordnungsmengen je Diagnose
-----------------
weitere HinweiseZN2
ZNS-Erkrankungen einschließlich des Rückenmarks
- nach Vollendung des 18. Lebensjahrs
z.B.:
- prä-, peri-, postnatale Schädigungen (z.B. Meningomyelocele, infantile Cerebralparese, Spina bifida)
- zerebrale Blutung, Tumor,
- Hypoxie
- Schädelhirn- und Rückenmarkverletzungen
- Meningoencephalitis, Poliomyelitis
- Querschnittssyndrome
- M. Parkinson
- Multipe Sklerose
- Syringomyelie
- Amyotrophe Lateralsklerose
- Spinalis anterior Syndrom
- Vorderhornerkrankungen des Rückenmarks
a
Bewegungsstörungen von Extremitäten, Rumpf- und Kopfmuskulatur z.B. mit Hemi-, Tetra-, Paraplegie/ -pareseFörderung und Besserung der Motorik und Sensomotorik A. KG-ZNS / KG
C. Wärmetherapie / KältetherapieErst-VO:
- bis zu 10x/VO
Folge-VO:
- bis zu 10x/VO
Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:
- bis zu 30 Einheiten
Frequenzempfehlung:
- mind. 1x wöchentlich
Hinweise:
Störungen der Atmung, des Darmes und der Ausscheidung siehe AT oder SO
Störungen des Lymphabflusses siehe LY1
Trophische Störungen siehe SO4b
Funktionsstörungen durch Muskeltonusstörungen, z.B. Spastik, auch mit Folgeerscheinungen wie Kontrakturen, zentral bedingte Muskel-HypotonieRegulierung des Muskeltonus, Vermeidung von Kontrakturen A. KG-ZNS / KG
C. Wärmetherapie / Kältetherapiec
zentrale Koordinationsstörungen und Störungen der Grob- und Feinmotorik wie z. B. Dystonie, choreatisch-athetotische Störungen, ataktische StörungenFörderung und Besserung der Koordination und der Grob- und Feinmotorik, Sicherung der Mobilität A. KG-ZNS / KG
C. Wärmetherapie / Kältetherapie[Quelle: Heilmittelrichtlinien (HMR). -- http://www.physio.de/zulassung/HMR-IK-PT2.htm. -- Zugriff am 2006-01-31]
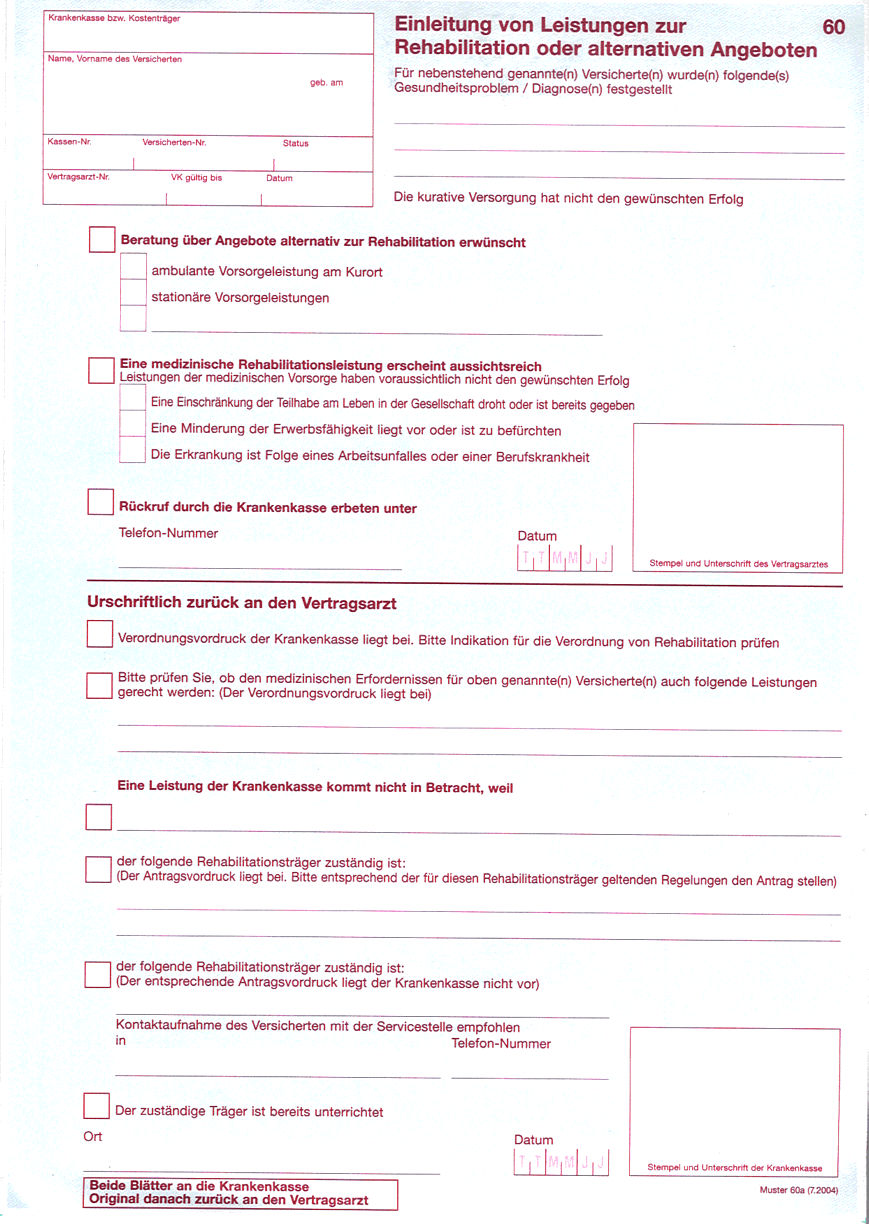
Abb.: Muster 60: Einleitung von Leistungen zur Rehabilitation oder alternativen
Angeboten
"Muster 60: Einleitung von Leistungen zur Rehabilitation oder alternativen Angeboten
- Ab dem 01. April 2004 gelten die neuen Rehabilitations-Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 SGB V des Gemeinsamen Bundesausschusses. Diese Richtlinien regeln auch die Verfahren zur Einleitung und Verordnung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Mit dem in der Praxis des Vertragsarzt zukünftig vorliegenden Muster 60 kann jeder Vertragsarzt Leistungen zur Rehabilitation einleiten.
- Sofern die kurative Versorgung bei einem Patienten nicht den gewünschten Erfolg hat und eine medizinische Rehabilitationsleistung aussichtsreich erscheint, um dieses Ziel zu erreichen, füllt er das Muster 60 aus und leitet dies an die zuständigen Krankenkasse des Versicherten weiter. Hierbei kann er explizit auch die Beratung der Krankenkasse zu Angeboten alternativ zur Rehabilitation erwünschen und den Rückruf der Krankenkasse erbitten.
- Nach entsprechender Prüfung durch die Krankenkasse (u.a. Zuständigkeit) erhält der Vertragsarzt das Muster 60 urschriftlich mit den erforderlichen Informationen und Anregungen von der Krankenkasse zurück. Hierbei ergeben sich folgende Möglichkeiten:
- Der Vertragsarzt erhält den Verordnungsvordruck Muster 61A-D zur Verordnung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation.
- Er wird gebeten zu prüfen, ob auch ggf. andere Leistungen (z. B. bisher noch nicht erfolgte Psychotherapie) den medizinischen Erfordernissen des Versicherten gerecht werden.
- Er erhält klare Aussagen der Krankenkasse, sofern eine Leistung zur Rehabilitation durch die Krankenkasse nicht in Betracht kommt."
[Quelle: Vordruckvereinbarung einschl. Erläuterungen BMV, Anlage 2. -- http://www.kvwl.de/arzt/recht/kbv/bmv-ae/bmvae-2.pdf. -- Zugriff am 2006-01-31]
Muster 60 ist nur die Einleitung. Nach positivem Bescheid erhält der Arzt folgenden Verordnungsvordruck (Muster 61A-D). Die 4 Formulare sind unten zusammengeklebt ("Bitte vor der Beschriftung der Formulare diese Fußleiste abreißen und die 4 Einzelsätze voneinander trennen"). Es gibt jeweils einen Durchschlag zum Verbleib beim Vertragsarzt; der Patient hat noch mehrere Seiten "freiwillige" Selbstauskunftsbögen.
Ab 2006-04-01 (kein Aprilscherz!) darf nur ein Arzt mit Qualifikation dieses Formular ausfüllen. Die Qualifikation zum Ausfüllen des Formulars kann man durch Teilnahme an einem kostenpflichtigen "16-stündigen Fortbildungskurs zur Verordnung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gemäß den Rehabilitations-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses" erwerben, Kosten 150 Euro (incl. Verpflegung), dafür bekommt man dann auch noch 21 Fortbildungspunkte.
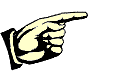
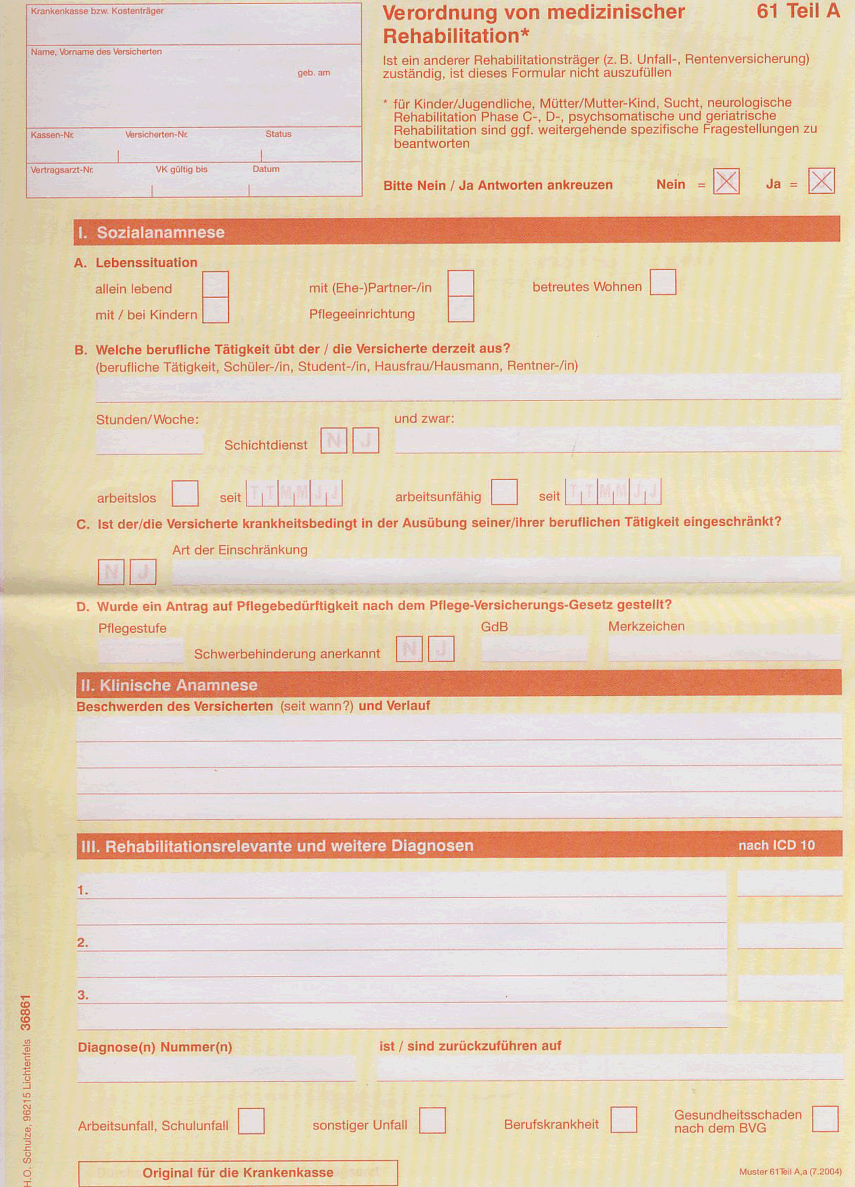
Abb.: Muster 61: Verordnung von medizinischer Rehabilitation, Teil A, Original
für die Krankenkasse

Abb.: Muster 61: Verordnung von medizinischer Rehabilitation, Teil B, Original
für die Krankenkasse

Abb.: Muster 61: Verordnung von medizinischer Rehabilitation, Teil C, Original
für die Krankenkasse
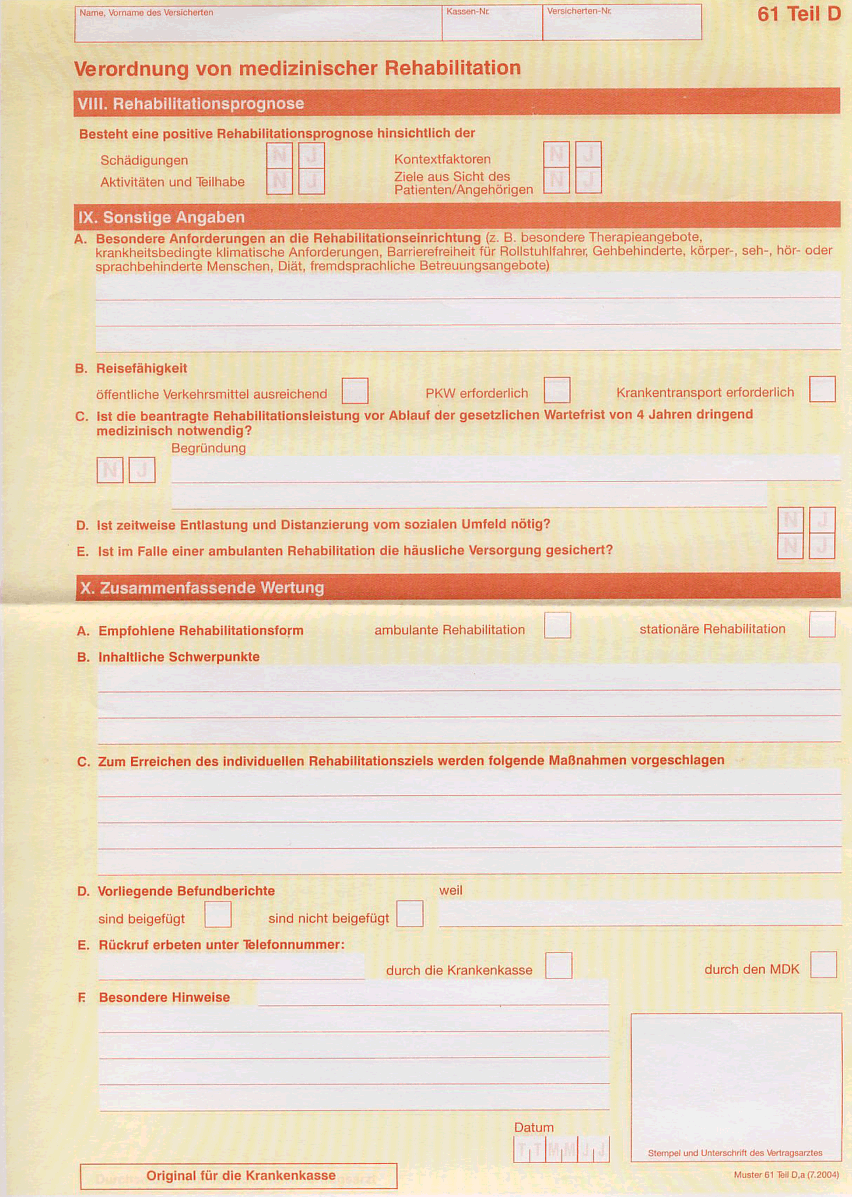
Abb.: Muster 61: Verordnung von medizinischer Rehabilitation, Teil D, Original
für die Krankenkasse
Muster 61 ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die Krankenkassen mit höchstem bürokratischen Aufwand die Leistungen für Versicherte immer unerreichbarer gestalten. Dabei betrifft diese Form der Rehabilitation nur Nicht-Arbeitnehmer. Für die Rehabilitation von Arbeitnehmern sind nämlich die Rentenversicherungsträger - mit eigenen Formularen! - zuständig.
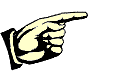
Eine besondere Belastung für Nicht-Hausärzte im Notfalldienst ist das - für sie ungewohnte - Ausfüllen von Todesbescheinigungen. Das korrekte Ausfüllen dieses Formulars benötigt mit Sicherheit einen mehrstündigen Einführungskurs. Ein solcher nützt aber wenig, wenn man die dabei gewonnenen Erkenntnisse - hoffentlich - nicht laufend anwenden muss.
Todesbescheinigung für Baden-Württemberg:

Abb.: Umschlag, Vorderseite

Abb.: Umschlag, Rückseite

Abb.: Umschläge und Obduktionsschein

Abb.: Todesbescheinigung, nicht-vertraulicher Teil, Blatt A Standesamt
Blatt B Ortspolizeibehörde (Feuerbestattung) sieht gleich aus

Abb.: Todesbescheinigung, vertraulicher Teil, Blatt 1 Gesundheitsamt
|
|
|
|
|
|
"Information für die Ärztin/den Arzt
Die Feststellung des Todes und die Durchführung der Leichenschau stellen häufig die letzte ärztliche Maßnahme an der verstorbenen Person dar. Hierfür gelten dieselben Sorgfaltspflichten wie bei lebenden Personen. Bei etwaigen Kollisionen mit den Interessen anderer Personen - seien dies Angehörige, andere Ärztinnen oder Ärzte oder Polizeibeamte - hat die Ärztin oder der Arzt grundsätzlich die Interessen der verstorbenen Person an einer sorgfältigen und objektiven Leichenschau wahrzunehmen. Mit der Ausstellung der Todesbescheinigung werden die Weichen gestellt, ob die Leiche zur Bestattung freigegeben wird oder ob weitere Ermittlungen im Hinblick auf einen nicht natürlichen Tod oder eine ungeklärte Todesart erforderlich sind. Von der sorgfältigen Todesbescheinigung hängt auch die Qualität der Todesursachen-Statistik ab.
Durchführung der Leichenschau
Wenn nicht von vornherein Anhaltspunkte für eine nicht natürliche Todesart vorliegen, hat die Ärztin oder der Arzt die unbekleidete Leiche von allen Seiten und bei ausreichender Beleuchtung in Augenschein zu nehmen. Eine Leichenschau im Freien sollte nicht erfolgen. Eine Teilbesichtigung der Leiche ist auf keinen Fall zulässig. Stellt die Ärztin oder der Arzt Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod fest oder handelt es sich um die Leiche einer unbekannten Person, hat sie/er jede (weitere) Veränderung an der Leiche zu unterlassen, insbesondere von der (weiteren) Entkleidung der Leiche zunächst abzusehen. Dabei handelt es sich nicht um eine unbekannte Person, wenn diese identifizierbar verstorben ist.
Die Qualifizierung der Todesart als natürlich, nicht natürlich oder ungeklärt entscheidet über weitere erforderliche Maßnahmen, insbesondere über die Meldepflicht bei der Polizei.
Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod
Hat die Ärztin oder der Arzt Zweifel, dass die Person eines natürlichen Todes gestorben ist, dann hat sie/er die Kategorie "Anhaltspunkte für nicht natürlichen Tod" anzukreuzen, wenn der Tod durch Unfall, Selbsttötung, durch strafbare Handlung, sonstige Gewalteinwirkung (z.B. Sturz), Vergiftung und bei Verdachtsfällen der vorgenannten Kategorien oder unerwartet während oder kurz nach ärztlichen Eingriffen eingetreten ist. Für den nicht natürlichen Todesfall nach ärztlichem Eingriff muss mindestens ein entfernter Anhaltspunkt für einen ärztlichen Kunstfehler oder ein sonstiges Verschulden des behandelnden Personals vorliegen.
Todesart ungeklärt
Eine ungeklärte Todesart wird dann angenommen, wenn keine Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod erkennbar sind, die Todesursache nicht bekannt ist und trotz sorgfältiger Untersuchung und Einbeziehung der Vorgeschichte keine konkreten Befunde einer lebensbedrohlichen Krankheit vorliegen, die einen Tod aus krankhafter natürlicher Ursache und völlig unabhängig von rechtlich bedeutsamen Faktoren (z.B. Unfall) plausibel erklären.
Obduktion
Wird eine natürliche Todesart attestiert, so kann bei Vorliegen berechtigter Interessen und der rechtlichen Voraussetzungen (Zustimmung der oder des Verstorbenen zu Lebzeiten oder der Hinterbliebenen nach Aufklärung) von den totensorgeberechtigten Hinterbliebenen, von behandelnden oder aus wissenschaftlichen Gründen interessierten Ärztinnen und Ärzten oder von Versicherungsgesellschaften eine Obduktion in Auftrag gegeben werden. Dieselben Voraussetzungen gelten für eine Obduktion in Fällen mit Anhaltspunkten für einen nicht natürlichen Tod oder bei ungeklärter Todesart, wenn die Staatsanwaltschaft keine gerichtliche Obduktion angeordnet hat und die Leiche freigegeben ist.
Dokumentation
Bei der Feststellung eines natürlichen Todes ist der konkrete Befund in der vorgesehenen Spalte der Todesbescheinigung -vertraulicher Teil- zu dokumentieren, bei Anhaltspunkten für einen nicht natürlichen Tod sind diese ebenso dort anzuführen.
Verständigung der Polizei
Ergeben sich Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod oder ist die Todesart ungeklärt oder handelt es sich um die Leiche einer unbekannten Person, so hat die Ärztin oder der Arzt unverzüglich die nächste Polizeidienststelle zu verständigen
Hinweise zur Todesbescheinigung
Der Formularsatz für die Todesbescheinigung umfasst:
- einen nicht vertraulichen Teil (Blatt A und B)
- einen vertraulichen Teil (Blatt 1 bis 5)
- zwei Obduktionsscheine
- drei Umschläge
Es wird gebeten, die Formulare in Blockschrift und mit Kugelschreiber auszufüllen.
Todesbescheinigung - nicht vertraulicher Teil -
Beim Ausfüllen des nicht vertraulichen Teils ist zu beachten, dass nach Ausfüllen des Feldes für Personalangaben Blatt A und B des nicht vertraulichen Teils vom vertraulichen abgetrennt wird. Die restlichen Rubriken des nicht vertraulichen Teils sind daraufhin vollständig auszufüllen. Der nicht vertrauliche Teil der Todesbescheinigung wird nach dem Ausfüllen den Angehörigen zur Vorlage beim Standesamt (Blatt A) und zur Übermittlung an die Ortspolizeibehörde im Falle einer Feuerbestattung (Blatt B) übergeben.
Todesbescheinigung - vertraulicher Teil -
Die amtliche Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgeführt. Im diesem Zusammenhang ist es erforderlich, dass der Krankheitsablauf unter "Todesursache/Klinischer Befund" (Nummer 4) in seiner Kausalkette angegeben wird.
Für die Qualität der Todesursachen-Statistik ist das Ausfüllen der Spalte "Zeitdauer zwischen Beginn der Krankheit und Tod" von großer Bedeutung.
Weitere Angaben zu der "Unvermeidbar zum Tode führenden Krankheit" sowie den "Anderen wesentlichen Krankheiten" im Sinn einer Multi-Morbidität können unter Nummer 5 "Weitere Angaben zur Klassifikation der Todesursache" genannt werden.
Nachdem alle Exemplare des vertraulichen Teils (Blatt 1 bis 5) ausgefüllt und unterzeichnet sind, werden Blatt 1 und 2 abgetrennt, einmal in der Mitte gefaltet und so in den anhängenden Fensterbriefumschlag 1 eingelegt, dass die Personalangaben sichtbar sind. Dieser Umschlag wird von der Ärztin oder dem Arzt persönlich verschlossen. Die Ärztin oder der Arzt übergibt den Umschlag 1 einem Angehörigen der oder des Verstorbenen, der Polizei oder belässt ihn bei der Leiche. Die oder der Angehörige, die Polizei oder das beauftragte Bestattungsunternehmen hat diesen Umschlag 1 zusammen mit dem nicht vertraulichen Teil der Todesbescheinigung unverzüglich dem Standesamt vorzulegen. Dieses trägt die notwendigen Daten in das hierfür vorgesehene Feld ein und bestätigt die Eintragungen durch Stempel und Unterschrift des Standesbeamten unterhalb des auszufüllenden Feldes auf dem Umschlag. Blatt 3 (Doppel für die Feuerbestattung für die Ärztin oder den Arzt, welche/r die Bescheinigung nach § 17 BestattVO ausstellt) wird im Umschlag 2 verschlossen und bei der Leiche belassen.Das Doppel für die Obduktion (Blatt 4) wird zusammen mit den beiden nicht ausgefüllten Obduktionsscheinen in Umschlag 3 gelegt. Dieser Umschlag wird ebenfalls von der Ärztin oder dem Arzt persönlich verschlossen und verbleibt bei der Leiche. Auch bei Anhaltspunkten für einen nicht natürlichen Tod bzw. ungeklärter Todesart wird das noch unvollständig ausgefüllte Doppel für die Obdukion (Blatt 4) zusammen mit den beiden nicht ausgefüllten Obduktionsscheinen in Umschlag 3 verschlossen, da Blatt 4 der Information der Obduzentin oder des Obduzenten dient.
Blatt 5 des vertraulichen Teils ist für die Unterlagen der Ärztin oder des Arztes bestimmt."[Bestandteil des oben abgebildeten Formularsatzes]
"Todesursachen in der Todesbescheinigung - Eine kurze Anleitung -
Die Todesursachenstatistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Durch diese Statistik ist eine fundierte Todesursachenforschung möglich, die die Einflussfaktoren der Gesundheitsindikatoren, die regionalen Besonderheiten der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die epidemiologische Forschung, den Bereich Prävention und die Gesundheitspolitik abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann. Aussagekräftige und vergleichbare Daten sind dafür unerlässlich.
Zu diesem Zweck werden die Todesursachen aller Verstorbenen in den Statistischen Landesämtern erfasst und fließen anschließend in die Todesursachenstatistik des Bundes und der Länder ein. Durch das einheitliche methodische Vorgehen (Vollerhebung, einheitliche Systematik der ICD) und die Kontinuität der Erhebung wird sichergestellt, dass diese Daten zuverlässig der Forschung zur Verfügung gestellt werden können.
Todesursachen - wie?
Ein Totenschein besteht aus mehreren Abschnitten, die je nach Bundesland leicht unterschiedlich ausgeführt sind. Einheitlichkeit besteht jedoch im Abschnitt zu den Todesursachen, in dem entsprechende Angaben zu Krankheiten und zu Todesursachen zu machen sind. Dieser Abschnitt gliedert sich in zwei Teile:
Teil I
Der erste Teil ist zur Auswahl der zugrunde liegenden Todesursache am wichtigsten. Hier soll die Kausalkette eingetragen werden, die vom Grundleiden zur unmittelbaren Todesursache führte.
Es ist wichtig, dass in der untersten Zeile dieses Abschnittes (Ic) das Grundleiden genannt wird. Von dort aus nach oben folgt dann die Kette der Ereignisse, die schließlich in der obersten Zeile (la) mit der direkt zum Tode führenden Krankheit endet (vgl. umseitige Übersicht).
Im Idealfall wird pro Zeile in Teil I höchstens eine Krankheit angegeben. Sofern zwei voneinander unabhängige Krankheiten gleichrangig an der zum Tode führenden Sequenz beteiligt waren, können sie in derselben Zeile eingetragen werden.
Ist nichts Genaues bekannt, so ist die Angabe „Todesursache unbekannt" einer vagen Spekulation vorzuziehen. Der Eintrag von Spekulationen in den Totenschein „nur damit dort etwas steht" verfälscht letztlich nur die Statistik.
Andererseits besteht natürlich bezüglich einzelner Diagnosen oft eine gewisse Unsicherheit, was zu Angaben wie „Verdacht auf" oder „möglicherweise" führt. Solche Angaben zur Diagnosesicherheit werden bei der Auswertung ignoriert.
Statt „Zustand nach" ist es eindeutiger, nur den Originalzustand und den spezifischen Folgezustand mit zeitlichem Abstand zum Tod einzutragen.
Der Zeitraum zwischen Krankheitsbeginn (nicht Krankheitsfeststellung!) und Tod ist notfalls zu schätzen. Dieser Zeitraum sollte von Zeile la bis zur Zeile Ic zunehmen.
Teil II
Im zweiten Teil des Totenscheins steht dann genügend Raum zur Verfügung für den Eintrag von Krankheiten, die am Tod beteiligt waren, jedoch nicht unmittelbar Teil der zum Tode führenden Kausalkette sind.
Drei Zeilen können recht knapp sein, um eine zum Tode führende Sequenz einzutragen. Umso wichtiger ist es, durch überflüssige Angaben wie „Herz- und Atemstillstand" keinen Platz zu vergeben. Eine Reihe von typischen unscharfen Begriffen aus dem klinischen Sprachgebrauch lassen sich durch genauere Angaben besser klassifizieren (vgl. umseitige Übersicht).
Todesursachen - Schritt für Schritt
- Klären Sie, welche Krankheit oder welcher Umstand die unmittelbare Todesursache war und tragen Sie dies in Zeile Ia ein.
- War die Todesursache die Folge einer Erkrankung? Dann sollten Sie diese in Zeile Ib eintragen.
- Liegt dieser Erkrankung eine Grundkrankheit zugrunde? Diese Grundkrankheit sollte in Zeile Ic eingetragen werden.
- In Zeilen Ia, b, und c sollten nur die Diagnosen stehen, die unmittelbar zum Tode geführt haben.
- Tragen Sie nun jeweils den Zeitraum ein. Ausgangspunkt ist hier der (geschätzte) Krankheitsbeginn und nicht der Zeitpunkt der Feststellung.
- In Zeile II werden alle am Tode beteiligten Erkrankungen eingetragen, die nicht mit der Kausalkette aus Spalte I in Zusammenhang stehen (in unserem Beispiel unten
„Hypertonie" und „Diabetes").Beispiel für den Abschnitt zur Todesursache:
I Direkt zum Tode führende Krankheit a) Direkt zum Tode führende Krankheit Hirnblutung
Zeitraum 4 Std.
b) bedingt durch Hirnmetastasen
4 Monate c) Grundleiden Mamma-CA
5 Jahre II Andere wesentliche Krankheitszustände Hypertonie
Diabetes10 Jahre
3 Jahre
- Füllen Sie den Totenschein leserlich aus. Unleserliche Angaben bereiten die größten Probleme bei der Auswertung von Totenscheinen.
- Achten Sie darauf, dass alle Angaben vollständig sind.
- Tragen Sie keine Spekulationen ein, besser „Todesursache ungeklärt".
- In den Todesursachenbereich (Teil I und II) gehören keine Laborwerte und keine anamnestischen Angaben.
- Versuchen Sie so genau wie möglich, die zeitliche Abfolge zu schätzen.
- Ein Eintrag pro Zeile sollte reichen.
Spezielle Antworten auf Fragen zum Ausfüllen des Totenscheins erhalten Sie per E-Mail von totenschein@destatis.de
Todesursachen - Beispiele und wichtige Aspekte
Pneumonie Primär, hypostatisch, Aspiration, zugrunde liegende Ursache
Erreger
Sofern Folge von Immobilität oder Debilität, die Ursache für die Immobilität oder DebilitätInfektion Primär oder sekundär, Erreger
Sofern primär - bakteriell oder viral
Sofern sekundär - nähere Angaben zum primären InfektHWI Lokalisation im Harntrakt, Erreger, zugrunde liegende Ursache
Sofern Folge von Immobilität oder Debilität, die Ursache für die Immobilität oder DebilitätNierenversagen Akut, chronisch oder terminal, zugrunde liegende Ursache, z. B. Hypertonie, Arteriosklerose, Herzerkrankung
Sofern Folge von Immobilität oder Debilität, die Ursache für die Immobilität oder DebilitätHepatitis Akut oder chronisch, alkoholbedingt
Sofern viral -Typ (A, B, C, D oder E]Infarkt Arteriosklerotisch, durch Thrombose oder Embolie Thrombose Arteriell oder venös - nenne das Gefäß
Intrakranieller Sinus - eitrig, nicht eitrig, venös (welche Vene)
Postoperativ oder bei Immobilisierung - Krankheit, die Anlass für die OP oder die Immobilisierung warLungenembolie Sofern jünger als 75 Jahre - Ursache
Postoperativ - Krankheit, die Anlass für die OP oder die Immobilisierung warLeukämie Akut/subakut/chronisch,
Lymphatisch/myeloisch/monozytärAlkohol/Arzneimittel/Betäubungsmittel Längerer Abusus oder einfach Gebrauch
AbhängigkeitKomplikation eines operativen Eingriffes Krankheit, die der Anlass für die Operation war Demenz Ursache (z. B. senil, Alzheimer, Multiinfarkt) Unfalltod Nähere Umstände (z.B. Radfahrer von Auto erfasst)
Unfall, suizidal, tätlicher Angriff oder Umstände unbestimmt,
Unfallort (z. B. Straße, Wohnhaus...) und ggf. Tätigkeit zum Zeitpunkt des Todes (Golf, Kinobesuch, Berufsausübung...)Tumor Benigne, maligne, Lokalisation, Metastasen [Quelle. Faltblatt von DIMDI/Statistisches Bundesamt, o.J.]
Zum Vergleich: Todesbescheinigung im Kanton Schwyz, Schweiz:
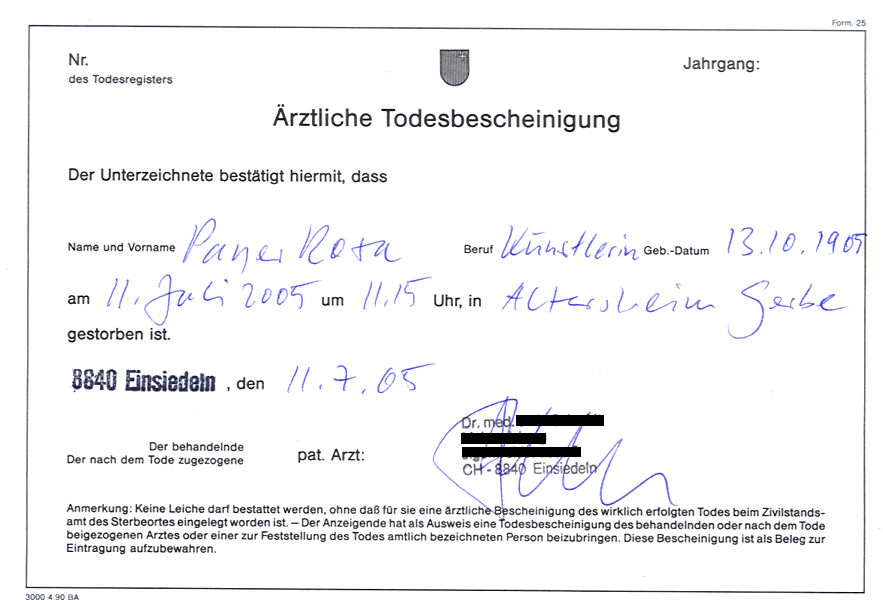
Das ist alles!
Es gibt keinerlei Hinweise, dass es im Kanton Schwyz prozentual mehr unentdeckte Mordfälle gibt als in Baden Württemberg.
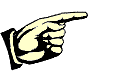
Trotz "mangelhafter" Todesursachenstatistik ist die Lebenserwartung bei Geburt in der Schweiz höher (80,39 Jahre) als in Deutschland (78,65 Jahre).
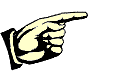
Nebenbei bemerkt:
"Polizisten : Notärzte sollen „natürlicher Tod" ankreuzen
Beeinflussung beim TotenscheinÄrzte klagen darüber, dass sie von Polizisten dazu gedrängt werden, als Todesursache „natürlicher Tod" auf dem Totenschein anzukreuzen — auch wenn die genaue Todesursache nicht direkt festzustellen ist. Besonders NotärztInnen klagen über Beeinflussungsversuche, wenn sie zu ihnen unbekannten Toten gerufen werden. Rechtsmediziner in Münster dokumentierten solche Fälle bereits in einer Studie: Von 1000 zufällig ausgewählten Ärzten berichteten 47 Prozent der Notärzte und 41 Prozent der niedergelassenen Arzte über solche Erlebnisse (DMW 126, 2001, 712). Da wird die Todesursache bei einem tot im Wohnheim aufgefundenen Asylbewerber als „nicht so wichtig" bezeichnet. Ein Anästhesist aus Lemgo wird genötigt, einen Suizid bei einer Person festzustellen, die bei dem Versuch zu Tode gekommen war, sich der Verhaftung zu entziehen. Oder ein Chirurg in einer Großstadt wird von Polizisten erst einmal aufgeklärt, „wie wir das mit Ihren Kollegen in der Regel handhaben." Beliebt scheint es auch zu sein, einen „ungeklärten" Totenschein einfach durch einen „natürlichen" neuen von einem anderen Arzt ersetzen zu lassen. Abgesehen davon, dass diese Vorgänge oft den Tatbestand der Nötigung erfüllen, bleibt die Frage nach den Ursachen dieses Verhaltens. Personeller und zeitlicher Aufwand für die Polizei bei unklarer Todesursache, der für vermeintlich Wichtigeres verloren geht? Unwille, sich mit medizinisch unklaren Fällen, die aber scheinbar ohne Fremdverschulden stattgefunden haben, auseinanderzusetzen? Rassismus und Ignoranz?
Rechtsmediziner fordern nun, dass — wie zum Beispiel in Osterreich — Pathologen unabhängig entscheiden können sollen, ob sie einen Toten mit unklarer Todesursache genauer untersuchen oder nicht. Dies würde Arzte von dem beschriebenen Druck entlasten.
Quelle: Ärzte-Zeitung, 4. März 2004"[Quelle: Dr. med. Mabuse. -- ISSN 0173-430X. -- Nr. 149 (2004-05/06). -- S. 13]

Abb.: Hausärztin, Samstag 23:00 Uhr
(®MS Office)
Der größte bürokratische Zeitfresser.
Siehe:
Blessing, Susanne <1957 - >: Praxisgebühr. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- URL: http://www.payer.de/arztpatient/praxisgebuehr.htm
Siehe:
Blessing, Susanne <1957 - >: Gesundheitskarte. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- URL: http://www.payer.de/arztpatient/gesundheitskarte.htm
Siehe
Blessing, Susanne <1957 - >: Tabu Ärztegehälter. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- In Vorbereitung
Siehe:
Blessing, Susanne <1957 - >: ICD-10. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- URL: http://www.payer.de/arztpatient/ICD10.htm
Siehe:
Blessing, Susanne <1957 - >: Krankenkassen. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- In Vorbereitung
Siehe:
Blessing, Susanne <1957 - >: Gesundheitsökonomie. -- 4. Managed Care. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- URL: http://www.payer.de/arztpatient/gesundheitsoekonomie04.htm
Siehe:
Blessing, Susanne <1957 - >: Gesundheitsökonomie. -- 4. Managed Care. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- URL: http://www.payer.de/arztpatient/gesundheitsoekonomie04.htm
Siehe:
Blessing, Susanne <1957 - >: Gesundheitsökonomie. -- 3. Qualitätsmanagement. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- URL: http://www.payer.de/arztpatient/gesundheitsoekonomie03.htm
Zum Beispiel:
Siehe:
Blessing, Susanne <1957 - >: Krankenkassen. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- In Vorbereitung
Diese nehmen ständig zu, auch die Dokumentationsanforderungen an das Pflegepersonal. Auch einfache pflegerische Maßnahmen wie die Gabe von Abführmitteln müssen ärztlicherseits schriftlich angeordnet werden, ebenso wie kurzfristige Bedarfsmedikation nach telefonischer Rücksprache. Pflegeheime versinken im Morast der juristisch absichernden Bürokratie. So wie der Hilferuf "Rettet den Hausarzt!" ist ein Hilferuf "Rettet das Pflegepersonal!" dringend.
Die Vorschriften für Lohnsteuer, Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft der Praxismitarbeiter sind inzwischen so umfangreich und unübersichtlich, dass es sich empfiehlt, diese Arbeiten einer darauf spezialisierten Firma zu übergeben. Dass diese Mehrkosten notwendig sind, ist ein Symptom für die allgemein bekannte Gesetzes- und Verordnungsflut, somit für eines der Grundübel in der EU und Deutschland: dass man alles bürokratisch regeln will.
Hier ist vor allem die seit 2006-01-01 für viele Ärzte geltende Verpflichtung zur Führung eines Fahrtenbuchs, falls sie den PKW auch privat benutzen. Dies bedeutet für einen Arzt, der viele Haus- und Heimbesuche macht, zusätzliche Verwaltungsarbeit und ist außerdem noch problematisch in Bezug auf die ärztliche Schweigepflicht:
"Das gleiche Problem stellt sich beim Führen eines Fahrtenbuches. Ärzte, die sich zur ertragssteuerlichen Erfassung der Nutzung ihres Kraftfahrzeugs für Privatfahrten entschieden haben, haben das Verhältnis der Privatfahrten zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch nachzuweisen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 Einkommensteuergesetz-EStG). Das Bundesfinanzministerium verlangt hierzu bei Hausbesuchen neben der Angabe "Patientenbesuch" die genaue Bezeichnung des aufgesuchten Patienten mit Namen und Anschrift. Das Bundesfinanzministerium gestattet dem Arzt allerdings, um letztlich auch der Gefahr der missbräuchlichen Verwendung des Fahrtenbuches vorzubeugen, die Besuchsfahrten im Fahrtenbuch fortlaufend zu nummerieren und Name und Anschrift seiner Patienten in einem vom Fahrtenbuch getrennten Verzeichnis zu führen. Diese "Erleichterungen" beim Führen eines Fahrtenbuches können aber die dargestellten Bedenken zur Verletzung der Schweigepflicht nicht ausräumen." [Quelle: http://www.aerztekammer-bw.de/20/merkblaetter/schweigepflicht.pdf.-- Zugriff am 2006-02-03]
Obwohl die diesbezüglichen Vorschriften sinnvoll sind, tragen sie doch zur Belastung durch Verwaltungsaufgaben bei.
Siehe:
Blessing, Susanne <1957 - >: Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung. -- (Aktion "Rettet den Hausarzt"). -- In Vorbereitung

Abb.: Dr. med. Susanne Blessing, geb. 1957, Fachärztin für Allgemeinmedizin
Die Aufzählung von zeitaufwändigen Verwaltungsarbeiten zeigt
eindrücklich, warum ich mich manchmal frage, ob ich Hausärztin oder
Verwaltungsangestellte bin. Dass diese Flut von Verwaltungsarbeiten, die
teils schlicht unsinnig sind, teils zur Hemmung bzw. Verhinderung ärztlicher
Leistungen geschaffen wurden, sehr negativ auf die Lust am Beruf wirken,
dürfte einleuchten. Wenn es mein Lebenswunsch gewesen wäre, hätte ich ja
Verwaltungsbeamtin werden können. Sehr ärgerlich ist es auch, wenn man nur unter
größtem Verwaltungsaufwand sinnvolle und gebotene Heilmittel und andere
Hilfeleistungen verschreiben kann. Viele Kassen teilen nach dem "Schwarzer-Peter-Prinzp"
dem Versicherten mit: "Wenn Ihr Arzt es Ihnen verschreibt ..."
Die Todesbescheinigung ist ein weiteres Beispiel für den deutschen
Statistikwahn, der eigentlich eine epidemische Krankheit ist (Statisticistis
perniciosa). Dank der illusorischen Vorgaben ist schon die Erfassung der
Todesursachen alles andere als optimal. Im Statistischen Landesamt werden
diese Diagnosen nach ICD-10 kodiert und mit diesen Daten eine vermeintlich
stimmige Todesursachenstatistik erstellt. Trotz des riesigen Aufwands werden
aber daraus wie aus den meisten teueren Statistiken keine Folgen gezogen.
Das ganze ist also bestens eine Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme für
Medizinstatistiker.
Was könnte mit den Versichertengeldern, mit denen all diese
Formulare entwickelt, beraten, gedruckt und wieder - bei Neuauflage
obligatorisch - vernichtet werden, Gutes für die direkte Patientenversorgung
geleistet werden!
Für viele Formulare, deren Fragen immer ausgeklügelter
erscheinen, gibt es sogar schon Broschüren als Ausfüllhilfe. Auch dies ist eine
Verschwendung von Geldern, die dann der Allgemeinheit fehlen.
Ein Grundübel der Bürokratie ist, dass man Missstände mit bürokratischen Maßnahmen verhindern will. Hier ein paar Unterschriften mehr, dort ein paar Angaben mehr, hier fünf Formulare mehr, dort ein Antrag mehr ... Missstände werden dadurch keineswegs beseitigt: man vergleiche nur die Berichte der Rechnungshöfe mit den uferlosen Haushaltsvorschriften der öffentlichen Einrichtungen! Wann zieht man also daraus die Konsequenzen und hört mit diesem Wahnsinn auf?
Zur Darstellung samt Kommentar aus Sicht einer Hausärztin zu "Gesundheitsökonomie" gehören auch folgende Kapitel:
Zu: ICD-10
Zurück zur Übersicht Arzt und Patient