

mailto: payer@hbi-stuttgart.de
Zitierweise / cite as:
Materialien zur Forstwissenschaft. -- Kapitel 2: Das Ökosystem Wald. -- Fassung vom 22. November 1997. -- URL: http://www.payer.de/cifor/cif02.htm. -- [Stichwort].Payer, Margarete <1942 -- >:
Letzte Überarbeitung: 22. November 1997
Anlaß:
Lehrveranstaltung 1997/98 an der HBI Stuttgart: Informationsnetze, Projekt CIFORUnterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)
©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Verfasserin.
Zur Inhaltsübersicht von Margarete Payer: Materialien zur Forstwissenschaft.
"Unter Ökologie verstehen wir die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen der Organismen zur umgebenden Außenwelt .. theils organischer, theils anorganischer Natur." Ernst Haeckel <1834 - 1919> (1866) |
Das Ökosystem ist ein kompliziertes Wirkungsgefüge zwischen
den
|

Abb.: Stark vereinfachtes Schema der Stoffkreisläufe in einem Ökosystem
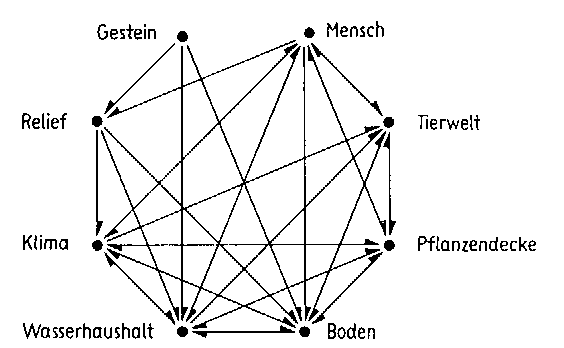
Abb.: Ökologisches Beziehungsgefüge der Faktoren an einem Standort
[Quelle der Abb.: Kleine Enzyklopädie Natur. -- Thun [u.a.] : Deutsch, ©1987. -- ISBN 3-87144-853-2. -- S. 227]
*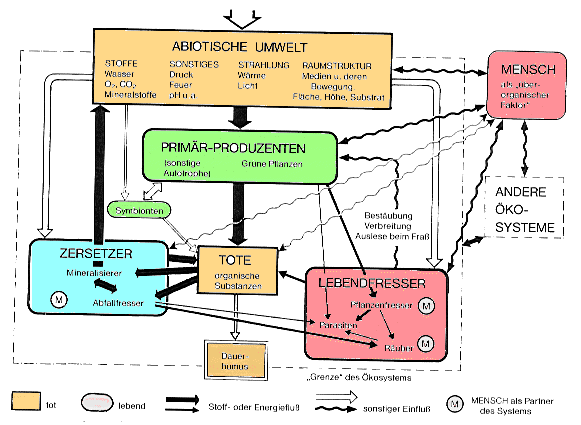
Abb.: Vereinfachtes Schema eines vollständigen Ökosystems
Quelle der Abb.: Ellenberg, Heinz <1913 - >: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. -- 5., stark veränd. und verb. Aufl. -- Stuttgart : Ulmer, ©1996. -- ISBN 3-8252-8104-3. -- S.103.
Beispiel für Nahrungsbeziehungen in einem Waldökosystem:
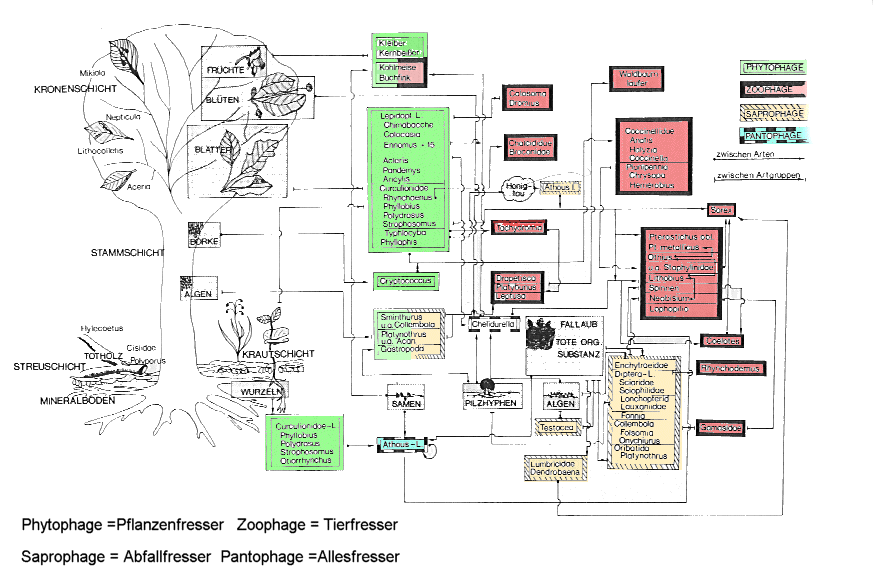
Abb.: Quantitativ bedeutsame Nahrungsbeziehungen von Tieren im Hainsimsen-Buchenwald des Sollings (Deutschland)
[Quelle der Abb.: Ellenberg, Heinz <1913 - >: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. -- 5., stark veränd. und verb. Aufl. -- Stuttgart : Ulmer, ©1996. -- ISBN 3-8252-8104-3. -- S.238]
Vegetation und Klimazonen : Grundriß der globalen Ökologie. -- 6., verb. Aufl. -- Stuttgart : Ulmer, ©1990. -- (UTB ; 14). -- ISBN 3-8252-0014-0. -- S. 12 -31Walter, Heinrich <1898 - 1989>:
nennt folgende Faktoren für die Gliederung ökologischer Systeme:
Die Grundeinheiten sind Biome, d.h. Lebensräume, die einer einheitlichen Landschaft entsprechen.
Man muß sich bei einer großräumlichen Betrachtung immer bewußt sein, daß eine solche Gliederung viele Probleme eher verdeckt:
[Schultz, Jürgen: Die Ökozonen der Erde : die ökologische Gliederung der Geosphäre. -- 2., überarb. Aufl. -- Stuttgart : Ulmer, ©1995. -- (UTB ; 1514). -- ISBN 3-8252-1514-8. -- S. 12.]
Zu örtlichen Klimadiagrammen nach HEINRICH WALTER als Hilfsmittel sehe:
Materialien zur Forstwissenschaft. -- Kapitel 2: Das Ökosystem Wald. -- Anhang 2: Klimadiagramme nach Walter. -- URL: http://www.payer.de/cifor/cif0202.htmPayer, Margarete <1942 -- >:
Großklima:
Walter definiert 9 Klimazonen, die er ökologisch als Zonobiome (ZB) bezeichnet. Diesen Zonobiomen entsprechen weitgehend, wenn auch nicht immer, bestimmte zonale Bodentypen und zonale Vegetationstypen: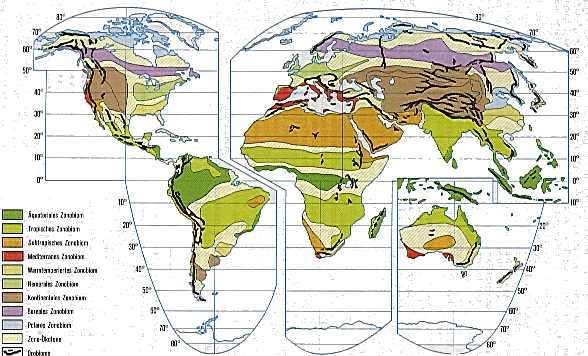
Abb.: Karte der Zonobiome
[Quelle der Abbildung: Heinrich, Dieter ; Hergt, Manfred: dtv-Atlas zur Ökologie : Tafeln und Texte. -- München : dtv, ©1990. -- ISBN 3-423-03228-6. -- S.28]
Zonobiom |
Klima |
Zonale Bodentypen |
Zonale Vegetationstypen |
| ZB I: Äquatoriales Zonobiom | Äquatoriales mit Tageszeitenklima, humides | Äquatoriale Braunlehme (ferrallitische Böden, Latosole)
Abb.: Bodenhorizont Latosol |
Immergrüner tropischer Regenwald ohne Jahreszeitenwechsel |
| ZB II: Tropisches Zonobiom | Tropisches mit Sommerregen, humido-arides | Rotlehme oder Roterden (ferrsialitische Savannenböden)
Abb.: Bodenhorizont Roterden, Rotlehme |
Tropischer laubabwerfender Wald oder Savannen |
| ZB III: Subtropisches Zonobiom | Subtropisches Wüstenklima, arides | Seroseme oder Syroseme (d.h. rohe Wüstenböden), d.h. Grau- oder Roherden, auch Salzböden | Subtropische Wüstenvegetation |
| ZB IV: Mediterranes Zonobiom | Mit Sommerdürre und Winterregen, arido-humides | Mediterrane Braunerden, oft fossile Terra rossa
Abb.: Bodenhorizont Braunerden |
Hartlaubgehölze, frostempfindlich |
| ZB V: Warmtemperiertes Zonobiom | Warmtemperiertes (ozeanisches), humides | Gelbe oder rote, leicht podsolige Waldböden | Temperierter immergrüner Wald, etwas frostempfindlich |
| ZB VI: Nemorales Zonobiom | Typisch gemäßigtes mit kurzer Frostperiode, nemorales | Wald-Braunerden und Graue Waldböden (oft lessiviert)
Abb.: Bodenhorizont Wald-Braunerde |
Nemoraler winterkahler Laubwald, frostresistent |
| ZB VII: Kontinentales Zonobiom | Arid-gemäßigtes mit kalten Wintern, kontinentales | Tschernoseme, Kastanoseme, Buroseme bis Seroseme
Abb.: Bodenhorizont Tschernosem (Schwarzerde) |
Steppen bis Wüsten mit kalten Wintern, frostresistent |
| ZB VIII: Boreales Zonobiom | Kalt gemäßigtes mit kühlen Sommern, boreales | Podsole oder Rohhumus-Bleicherden
Abb.: Bodenhorizont Podsol |
Boreale Nadelwälder (Taiga), sehr frostresistent |
| ZB IX: Polares Zonobiom | Arktisches einschließlich antarktisches, polares | Humusreiche Tundraböden mit starker Solifluktion | Tundravegetation (baumfrei), meist über Permafrostböden |
Quelle der dreidimensionalen Bodenhorizonte: Das große Buch des Allgemeinwissens Natur. -- Stuttgart [u.a.] : Das Beste, ©1966. -- ISBN 3-87070-613-9. -- S.68.
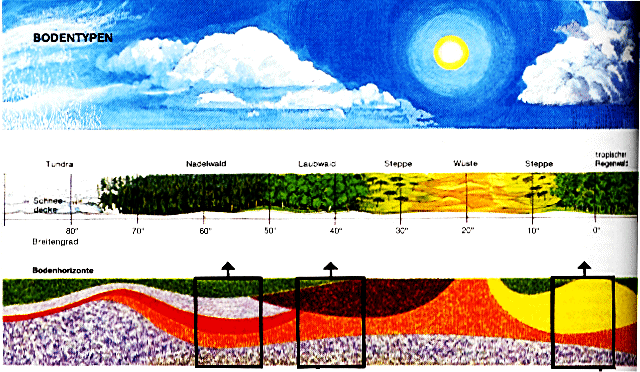
Abb.: Klima -- Zonobiom -- Bodentyp
Quelle der Abb.: Herder-Lexikon der Biologie. -- Heidelberg [u.a.] : Spektrum. ISBN 3-86025-156-2. -- Bd. 2. -- 1994. -- S. 100.
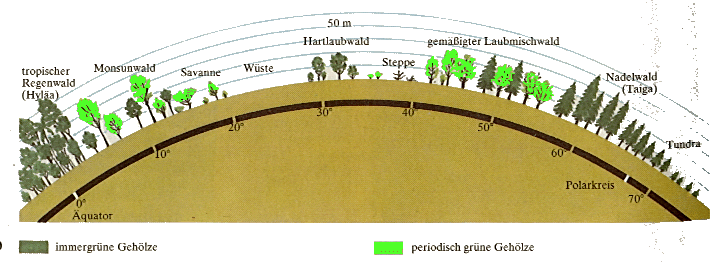
Abb.: Wichtigste Vegetationsgürtel der Erde
[Quelle der Abb.: Die Erde : Sphären, Zonen und Regionen, Territorien / Johannes F. Gellert und Autoren. -- Leipzig [u.a.] : Urania, ©1982. -- ISBN 3-570-0912-4. -- S.190.]
Oft werden die Zonobiome noch in Subzonobiome (sZB) unterteilt.
Die Klimazonen und Zonobiome sind nicht scharf abgegrenzt, sondern laufen über sehr breite Übergangszonen ineinander über. Diese Übergangszonen nennt Walter Zono-Ökotone. Zono-Ökotone definiert Walter als:
"ökologische Spannungsräume, in denen ein Vegetationstyp durch einen anderen abgelöst wird, z.B. der Laubwald durch die Steppe. In Zono-Ökotonen kommen beide Typen nebeneinander unter gleichen großklimatischen Verhältnissen vor und stehen miteinander in scharfem Wettbewerb." [S. 15]
Zonoökotone werden nach den Zonobiomen bezeichnet, die sie verbinden, also z.B.
usw.ZÖ I/II, ZÖ II/III, ZÖ III/IV, ZÖ IV/V
Da die Erde dreidimensional ist, sind nicht nur die flächenmäßigen Zonobiome entscheidend, sondern auch die ökologischen Gebirgshöhenstufen, die Orobiome (OB). Mit der Höhe nimmt die mittlere Jahrestemperatur ab: 100 m Höhenunterschied bedeuten ungefähr den gleichen Unterschied in der mittleren Jahrestemperatur wie 100 km in Nord-Südrichtung in der euro-nordasiatischen Ebene. Die Vegetationszonen in der Höhe sind also ca. 1000mal schmaler als die Vegetationszonen in der Ebene von Süden nach Norden. Die Vegetationszonen im Gebirge sind aber keine Wiederholung der Vegetationszonen in der Ebene! Die Höhenstufen im Gebirge sind unterschiedlich in Abhängigkeit von den Zonobiomen in denen die Gebirge stehen. Je nachdem ob sich das Gebirge über ein oder mehrere Zonobiome erstreckt spricht man von unizonalen, interzonalen und multizonalen Orobiomen.
Allgemeine Bezeichnungen für Höhenstufenlagen sind:
|
Ungefähre Höhengrenzen in Zentraleuropa |
planar (Ebenenstufe) |
bis 100 m ü. M. |
kollin (Hügellandstufe) |
100 - 300 m. ü. M. |
montan (Bergwaldstufe) |
300 - 1600 m |
subalpin (Gebirgsstufe) |
1600 - 2000 m |
alpin |
2000 - 2500 m |
nival (Schneestufe) |
oberhalb klimatischer Schneegrenze |
Höhenstufenlage |
Mitteleuropa |
Andenostseite (Tropen) |
nival |
Schneestufe | Schneestufe |
subnival |
Polsterpflanzen-Vegetation | Polsterpflanzen-Vegetation |
alpin |
Grasheide-Vegetation Zwergstrauch-Vegetation |
Paramo |
subalpin |
Krummholz (Waldgrenze) | Nebelwald |
montan |
Buchen-Tannen-Fichtenwald | Bergregenwald |
submontan |
Buchenwald | |
collin planar |
Eichenmischwald | Tropischer Regenwald |
Vorlage: Müller, Gerd K. <1929 - > ; Müller, Christa <1928 - >: Geheimnisse der Pflanzenwelt. -- Leipzig [u.a.] : Urania, ©1994. -- ISBN 3-332-00542-1. -- S.296f.
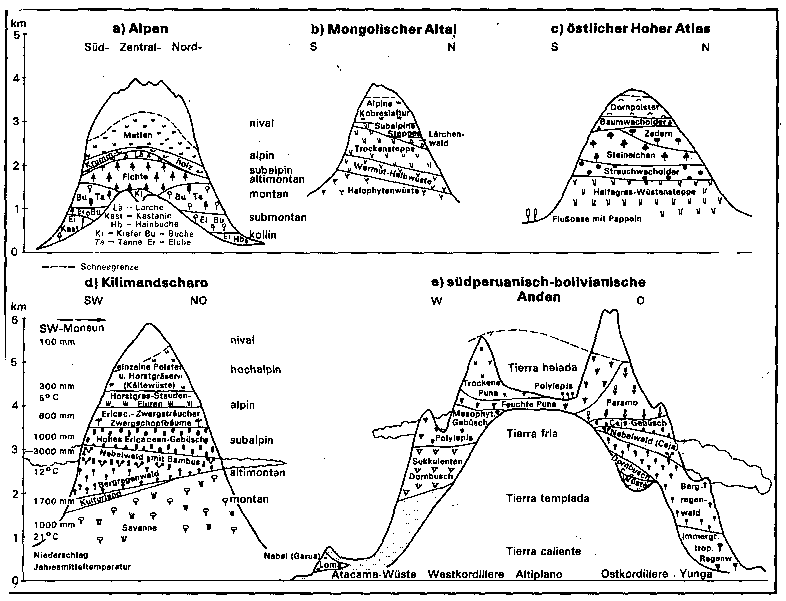
Flächen mit extremen Böden und einer dadurch bedingten azonalen Vegetation nennt Walter Pedobiome (PB), d.h. an bestimmte Böden gebundene Lebensräume. Nach den Böden unterscheidet man u.a. folgende Pedobiome:
Lithobiome |
Steinböden |
Psammobiome |
Sandböden |
Halobiome |
Salzböden
Abb.: Bodenhorizont Salzböden |
Helobiome |
Moor- oder Sumpfböden |
Hydrobiome |
mit Wasser bedeckte Böden |
Peinobiome |
Mangelböden oder nährstoffarme Böden |
Amphibiome |
wechselfeuchte Böden |
Pedobiome können oft riesige Flächen einnehmen, z.B. umfaßt das Moorgebiet Westsibiriens über 1 Million km².
Die Lebensformen und Lebensgemeinschaften an bestimmten Orten sind ganz wesentlich durch ihre Geschichte mit all ihren Zufällen bestimmt, und zwar durch ihre Geschichte in geologischen Zeiträumen als auch durch ihre Geschichte im humangeschichtlichen Zeiträumen.
Durch Geschichte in paläontologisch-geologischen Zeiträumen haben sich bei den Pflanzen sieben Florenreiche ausgebildet (ebenso haben sich bei den Tieren entsprechende Reiche herausgebildet):
Florenreich |
Verbreitungsgebiet |
Kennzeichnende Sippen (Auswahl) |
Vegetationsformen (Auswahl) |
Holarktis |
Europa, Nordasien, Nordamerika |
|
|
Palaeotropis |
Tropisches Asien, Afrika |
|
|
Neotropis |
Mittelamerika, Südamerika |
|
|
Australis |
Australien |
|
|
Capensis |
Südwestecke Afrikas |
|
|
Antarktis |
Südlichstes Südamerika, Antarktis |
|
|
Ozeanis |
Ozeane |
|
|
Vorlage: Müller, Gerd K. <1929 - > ; Müller, Christa <1928 - >: Geheimnisse der Pflanzenwelt. -- Leipzig [u.a.] : Urania, ©1994. -- ISBN3-332-00542-1. -- S.279. -- [Ein sehr lesenswertes Buch]
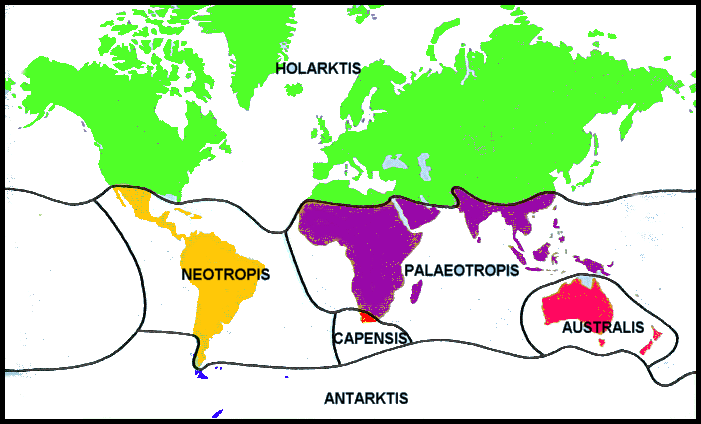
Abb.: Die Florenreiche der Erde
Für das Vorkommen von Pflanzen in einem bestimmten Biotop spielen vielerlei Faktoren eine Rolle. Dabei darf man nicht vergessen, daß der Lebensraum der Einzelpflanze oft sehr klein ist, daß also Vorgänge und Zustände im Klein- bis Kleinstbereich entscheidend sind. Siehe dazu die sehr empfehlenswerten Bücher:
Lebensraum Bergwald : Alpenpflanzen in Bergwald, Baumgrenze und Zwergstrauchheide ; vegetationsökologische Informationen für Studien, Exkursionen und Wanderungen. -- Stuttgart [u.a.] : Fischer, ©1989. -- 144 S. : Ill. -- ISBN 3-437-20451-3Reisigl, Herbert <1929 - > ; Keller, Richard <1923 - >:
Alpenpflanzen im Lebensraum : alpine Rasen, Schutt- und Felsvegetation ; vegetationsökologische Informationen für Studien, Exkursionen und Wanderungen. -- Stuttgart [u.a.] : Fischer, ©1987. -- 149 S. : Ill. -- ISBN 3-437-20397-5Reisigl, Herbert <1929 - > ; Keller, Richard <1923 - >:
Wichtige Faktoren der Standortverhältnisse sind:
Ausführlicher, besonders zu Bodenklassifikation, Ionenaustausch und Ton-Humus-Komplexen s.:
Materialien zur Forstwissenschaft. -- Kapitel 2: Das Ökosystem Wald. -- Anhang 1: Zur Bodenkunde. -- URL: http://www.payer.de/cifor/cif0201.htmPayer, Margarete <1942 -- >:
fest |
anorganische | Steine, Kies, Sand, Schluff, Ton | |
| Nährstoffe | |||
| organische | lebende | Bestanteile der oberirdischen Pflanzen (Wurzeln usw.) | |
| Bodenorganismen | |||
| tote: Humus | |||
flüssig |
Wasser | ||
gasförmig |
Luft | ||
Anteil und räumliche Verteilung der drei Bodenphasen (fest, flüssig, gasförmig) prägen alle wichtigen Prozesse.
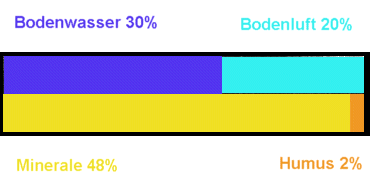
Abb.: Durchschnittlicher Anteil der toten Bestandteile an einem mitteleuropäischen Boden
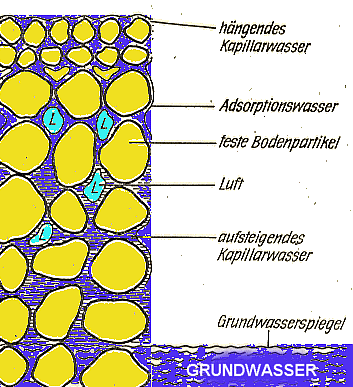
Abb.: Schema der Verteilung von festen, flüssigen und gasförmigen Bodenbestandteilen
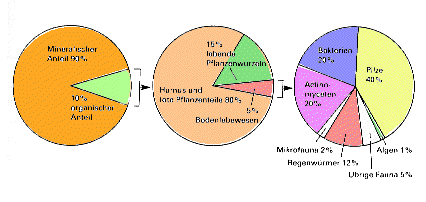
Abb.: Ungefähre durchschnittliche Anteile der Bestandteile der festen Bodenphase
Lebende Bodenbestandteile:
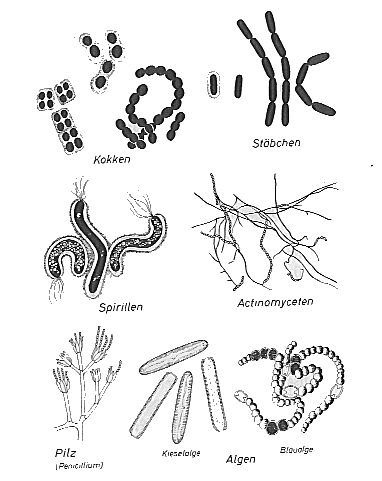
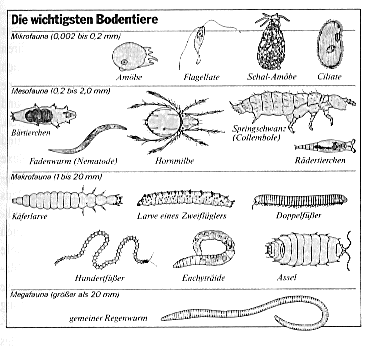
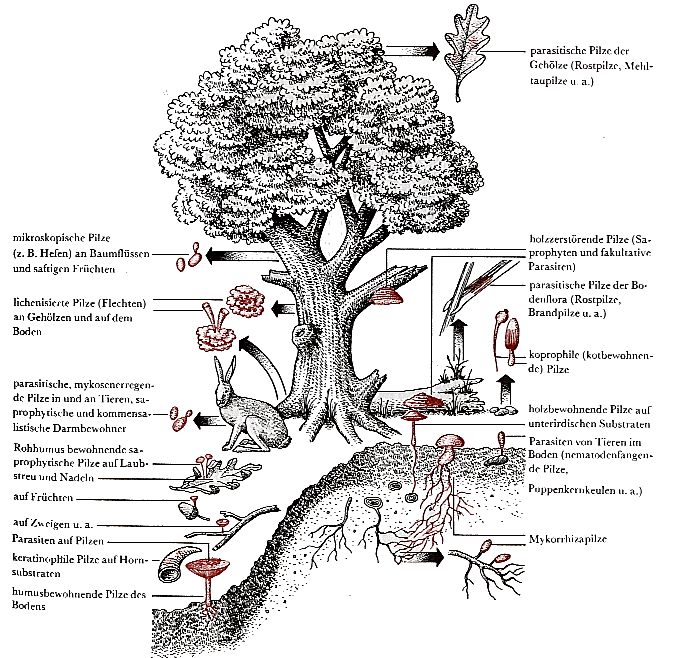
Abb.: Die wichtigsten ökologischen Nischen von Pilzen im Ökosystem Wald
[Quelle der Abb.: Dörfelt, Heinrich ; Görner, Herbert: Die Welt der Pilze. -- Berlin [u.a.] : Urania, ©1989. -- ISBN 3-332-00276-7. -- S.131]
Jedem Pilzsammler ist bekannt, daß bestimmte Pilze nur unter bestimmten Baumarten wachsen. Das zeigen auch viele deutsche Pilznamen, wie Birkenpilz, Lärchenröhrling, Pappelritterling, Erlengrübling, Eichenrotkappe, Fichtenblutreizker.

Abb.: Baumwurzel mit Mykorrhiza
"Gräbt man z.B. in einem pilzreichen Gebirgsfichtenwald oder in einer Kiefernschonung ein Stück der feinen Wurzelverzweigungen aus, so findet man viele Wurzelspitzen, meist zwischen 20 und 90 Prozent, die, mit der Lupe betrachtet, etwas aufgetrieben und auffallend hell erscheinen. Bei mikroskopischer Betrachtung zeigt sich an diesen Wurzelspitzen ein Mantel von Pilzhyphen [Pilzfäden, die die Basisstruktur der Geflechte (Myzel) sind]. Außerdem finden wir eine charakteristische Rindenstruktur der Wurzelspitzen mit großen Zellen, die von Pilzhyphen umgeben sind. Pilz und Pflanze traten an dieser Stelle miteinander in Kontakt. Wir haben eine verbreitete Symbiose vor Augen, die sich in einer lange währenden Entwicklung herausgebildet und zu einem unauflöslichen Bündnis zwischen Pilz und Pflanze, zur Mykorrhiza, geführt hat.
Mit ihr ist eine sehr zweckmäßig erscheinende und funktionstüchtige Partnerschaft entstanden. Der Pilz unterstützt in dieser Lebensgemeinschaft die Pflanze bei ihrer Wasser- und Nährstoffversorgung. Sein Myzel fungiert als 'verlängerter Arm' der Pflanzenwurzel; es vermag viel effektiver als die kurzen Saugwurzeln der Pflanze große Räume des Bodens zu durchdringen und als Nahrungsquelle zu erschließen; denn die aufnahmefähige Oberfläche des feinen und weit verzweigten Myzels ist um ein Vielfaches größer. Der heterotrophe Pilz hingegen erhält durch das Bündnis die lebensnotwendigen organischen Stoffe, die Quelle seines Energie- und Stoffhaushaltes. ... Im Mykorrhiza-Bündnis eröffnet sich den Pilzen eine völlig neue Dimension -- der direkte Anschluß an Primärproduzenten organischer Stoffe. .. Fest steht jedenfalls, daß viel mehr Pflanzen -- auch Kulturpflanzen -- mit Pilzen zusammenleben, als man noch vor wenigen Jahrzehnten glaubte. ...
Die verpilzten Wurzelspitzen der Pflanzen, die Kontaktstellen zwischen Pflanze und Pilz darstellen, sind, wie auch experimentell nachgewiesen wurde, in besonderer Weise gegenüber Infektionen durch Schaderreger geschützt. Bei dem gegenwärtig in Mitteleuropa feststellbaren Waldsterben liegt in einem wahrscheinlich nicht unwesentlichen Maße zunächst eine Schädigung der Mykorrhiza vor."
[Dörfelt, Heinrich ; Görner, Herbert: Die Welt der Pilze. -- Berlin [u.a.] : Urania, ©1989. -- ISBN 3-332-00276-7. -- S.75 - 77]
Es gibt folgende Formen von Mykorrhiza:
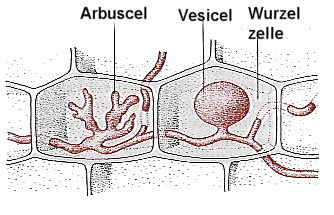
Abb.: VA-Mykorrhiza
[Quelle der Abb.: Dörfelt, Heinrich ; Görner, Herbert: Die Welt der Pilze. -- Berlin [u.a.] : Urania, ©1989. -- ISBN 3-332-00276-7. -- S.77]
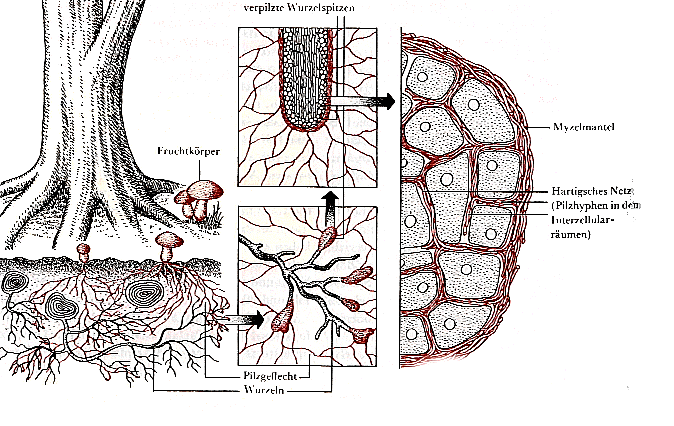
Abb.: Ektomykorrhiza von Waldbäumen
[Quelle der Abb.: Dörfelt, Heinrich ; Görner, Herbert: Die Welt der Pilze. -- Berlin [u.a.] : Urania, ©1989. -- ISBN 3-332-00276-7. -- S.76]
Bei Ektomykorrhiza sind die verpilzten Wurzelspitzen länger funktionstüchtig als unverpilzte, sie werden in Mitteleuropa ein bis zwei Jahre alt; Wurzelhaare von unverpilzten Kurzwurzeln leben dagegen nur wenige Wochen. Bäume gedeihen durch Mykorrhiza eindeutig besser als unverpilzte Bäume:
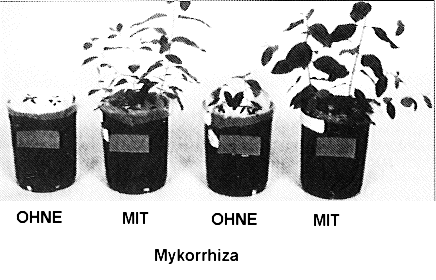
Abb.: Wachstum von Eukalyptusbäumchen mit und ohne Mykorrhiza
"Die häufig gemachte Annahme, daß die Verbreitung der Pflanzenarten direkt durch die verschiedenen Standortsfaktoren bedingt wird, ist nicht richtig. Diese sind nur von indirekter Bedeutung, indem sie die Wettbewerbsfähigkeit der Arten verändern. Nur an den absoluten Verbreitungsgrenzen in den Trocken- und Kältewüsten, am Rande der Salzwüste und dort, wo der tote Waldschatten beginnt, also überall, wo der Wettbewerb fehlt, sind die Standortsfaktoren (meist ein extremer Faktor) direkt bestimmend. Sieht man von diesen Ausnahmefällen und den Pionierpflanzen auf von der Vegetation entblößten Böden ab, so stehen unter natürlichen Bedingungen alle Pflanzen im Wettbewerb miteinander. ... Der Ökologe ... muß integrierend forschen und sowohl die stets wechselnden Außenbedingungen der natürlichen Umwelt der Pflanzen als auch den Konkurrenzdruck der benachbarten Arten berücksichtigen.
ohne daß Parasitismus vorliegt. Sie machen sich gegenseitig das Licht, das Wasser im Boden oder die Nährstoffe streitig. Es handelt sich also um rein physikalisch-chemische Beziehungen."Unter Wettbewerb oder Konkurrenz verstehen wir ganz allgemein den hemmenden Einfluß, den die auf einem engen Raum miteinander wachsenden Pflanzen aufeinander ausüben,
[Walter, Heinrich <1898 - 1989> ; Breckle, Siegmar-W.: Ökologische Grundlagen in globaler Sicht. -- 2., bearb. Aufl. -- Stuttgart : Fischer, ©1991. -- (Ökologie der Erde ; Bd 1). -- ISBN 3-437-10454-8. -- S. 110]
"Die natürliche Verbreitungsgrenze einer Art ist dort erreicht, wo durch die sich ändernden Umweltbedingungen ihre Wettbewerbsfähigkeit oder Konkurrenzkraft so stark herabgesetzt ist, daß sie von anderen Arten verdrängt werden kann. Sie hängt also auch von dem Vorhandensein bestimmter Konkurrenten oder einer bestimmten Fauna ab."
[Walter, Heinrich <1898 - 1989>: Vegetation und Klimazonen : Grundriß der globalen Ökologie. -- 6., verb. Aufl. -- Stuttgart : Ulmer, ©1990. -- (UTB ; 14). -- ISBN 3-8252-0014-0. -- S. 43f.]
"Wenn wie als ökologisches Optimum die Bedingungen bezeichnen, unter denen eine Art in der Natur am häufigsten vorkommt, und als physiologisches Optimum die Bedingungen, unter denen sie im Laboratorium (Klimakammer) oder in Einzelkultur am besten gedeiht, so entsprechen sich diese Optima meistens nicht. Aus der Verbreitung einer Art kann man somit nicht ihre physiologischen Ansprüche erkennen. ... Andererseits gibt uns die Kenntnis der in Klimakammern ermittelten physiologischen Ansprüche einer Art noch nicht die Möglichkeit, ihre Verbreitung in der Natur vorauszusagen oder im einzelnen zu erklären. Ob sie den ihren physiologischen Ansprüchen nach besiedelbaren Standort einnimmt, darüber entscheiden neben dem historischen Faktor meist die Mitbewerber." [Walter, a.a.O., S. 44f.]
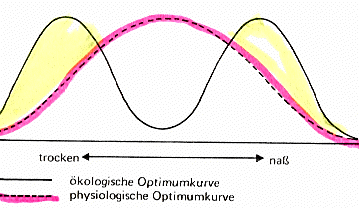 |
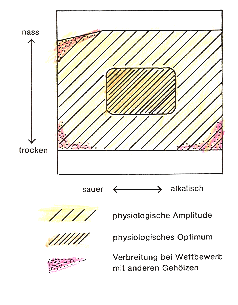 |
Abbildungen: Physiologisches und ökologisches Optimum der Föhre (Pinus sylvestris)
Die Abbildungen zeigen, daß die Föhre sich an den für sie bestgeeigneten Standorten nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, sondern nur an für sie extremen Standorten einen Wettbewerbsvorteil hat!
Quelle der Abb.: Hofmeister, Heinrich: Lebensraum Wald : ein Weg zum Kennenlernen von Pflanzengesellschaften und ihrer Ökologie. -- 2., rev. Aufl. -- Hamburg [u.a.] : Parey, ©1987. -- ISBN 3-490-16818-6. -- S.156f.
"Aus diesem Beispiel wird verständlich, daß man äußerst vorsichtig mit einer Charakterisierung der physiologischen Ansprüche sein sollte. Aus der Tatsache, daß eine Pflanze vorwiegend oder ausschließlich auf sauren Böden vorkommt, darf noch nicht geschlossen werden, daß sie säureliebend (azidophil) ist. Es ist richtiger zu sagen, diese Pflanze ist »säureertragend, säurebevorzugend, säuretolerant«, oder sie ist auf »sauren Böden verbreitet«. Entsprechendes gilt für die Bezeichnungen stickstoffliebend (nitrophil), wärmeliebend (xerophil) oder feuchteliebend (hygrophil)." [Hofmeister, a.a.O., S. 156]
Beim Standort einer Pflanze ist zu unterscheiden:
Beim Wettbewerb unterscheidet man:
"Der innerartliche oder intraspezifische Wettbewerb spielt bei Monokulturen in der Land- und Forstwirtschaft eine große Rolle. ... Der Forstmann bevorzugt zunächst einen engen Stand, um das Höhenwachstum von astfreien Stämmen zu begünstigen, und verhindert späterhin die Schwächung des Bestandes im gegenseitigen Wettbewerb der einzelnen Stämme durch rechtzeitige Pflegehiebe." [Walter, Heinrich <1898 - 1989> ; Breckle, Siegmar-W.: Ökologische Grundlagen in globaler Sicht. -- 2., bearb. Aufl. -- Stuttgart : Fischer, ©1991. -- (Ökologie der Erde ; Bd 1). -- ISBN 3-437-10454-8. -- S. 110]
Wichtige Wettbewerbsfaktoren im Konkurrenzkampf sind u.a.:
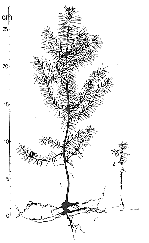
Für die interspezifische Konkurrenzkraft von Bäumen sind u.a. folgende Faktoren bestimmend:
"Was Synusien sind, kann man am besten an einem Beispiel erläutern. Wir wählen zu diesem Zweck einen Laubwald .. mit einem gemäßigten, nemoralen Klima: Als große Synusien kann man die Baumschicht und auch die Strauchschicht auffassen, weitere kleinere Synusien findet man in der Krautschicht, wie z.B. die Frühlingsgeophyten mit sehr kurzer Vegetationszeit vor der Belaubung des Waldes, sowie die Frühsommerkräuter des Waldbodens und die Spätsommerarten oder die immergrünen Arten. Dazu kommen Synusien von Niederen Pflanzen, wie die Synusie der Flechten an den Baumstämmen und die Moos-Synusie an der Basis der Stämme oder auf Baumstümpfen."
"Die Synusien sind nicht etwa Mikro-Ökosysteme, sondern nur Teilsysteme; denn sie besitzen keinen eigenen Stoffkreislauf oder Energiefluß. Vielmehr ist ihr Stoffumsatz in den Stoffkreislauf des Gesamtökosystems eingebettet, dessen Primärproduktion der Summe der Produktion der einzelnen Synusien entspricht." [Walter ; Breckle, Bd 1, S. 28]
"Wir wollen von einem Laubwald-Ökosystem ausgehen, das aus zwei oder mehreren Schichten aufgebaut ist, die man als Synusien betrachten kann. Die Arten einer Synusie stehen miteinander im Wettbewerb, wobei die konkurrenzkräftigeren im Endresultat, wenn ein Gleichgewicht eingetreten ist, zahlreicher vertreten sein werden als die schwächeren. Mischbestände sind in der Natur die Regel, Schichten, die nur aus einer Art bestehen, sind eine Folge der Florenarmut, wie z.B. im europäischen Raum, oder von extremen Bedingungen, z.B. in den Rocky Mountains ...
Mischbestände sind die Regel. Sie werden schon durch die Schwankungen der Umweltbedingungen von Jahr zu Jahr begünstigt. In Trockenjahren wird die eine Art gefördert, in feuchten Jahren eine andere. In den Tropen hat man außerdem beobachtet, daß die Samen der Baumarten unter dem Schirm der eigenen Art schlechter keimen als unter anderen, d.h. daß von Generation zu Generation ein Platzwechsel stattfindet, somit eine 'Rotation' erfolgt, was zur Erhaltung von Mischbeständen beiträgt. Ähnliches wurde auch bei unseren Wiesen festgestellt. Man muß stets unterscheiden zwischen dominanten Synusien (Schichten) innerhalb eines Bestandes und dominanten Arten innerhalb einer Synusie!
In Europa wird die Ansicht vertreten, daß die Baumart, die den meisten Schatten ertragen kann und deren Keimlinge im Schatten aufwachsen können, z.B. die Buche, sich absolut durchsetzen muß und alle anderen mehr Licht verlangenden Arten verdrängen wird. Aber in natürlichen, von der Forstwirtschaft nicht beeinflußten Urwäldern sind die Verhältnisse viel komplizierter.
Bei uns sind Waldbestände mit Eiche in der oberen Schicht und Hainbuche in der unteren, die sogenannten Querco-Carpineten, vom Menschen künstlich geschaffene Bestände (frühere Mittelwald), weil die Eichenkeimlinge im Schatten der Hainbuche absterben. Aber im Kaukasus gibt es entsprechende natürliche Bestände aus der lichtliebenden Eichenart Quercus iberica und der Schattenholzart Carpinus caucasica, die unseren Arten sehr nahe stehen.
Auch im Kaukasus steht die Eiche im scharfen Wettbewerb mit der Hainbuche: viele Eichenstämme sterben ab, einige wachsen jedoch über die niedrigerwüchsige Hainbuche hinaus, so daß der Wettbewerb aufhört. Die Eichen werden sehr alt und erreichen mit 180 Jahren einen Stammdurchmesser von 50 - 100 cm; auf sie entfällt der Hauptanteil des Holzvorrats. Die Hainbuche mit ihrem Jungwuchs wächst zwischen den mächtigen Eichen, unter denen sich am Boden lockere Eichenblattstreu ansammelt, die als Keimbett für Hainbuchen ungünstig, für Eicheln dagegen günstig ist. Infolgedessen findet man unter den Eichen viele Eichensämlinge, die jedoch infolge der Beschattung nach einigen Jahren absterben. Eichenjungwuchs fehlt somit ganz und man erhält den Eindruck, daß die Eiche aussterben muß. Wenn jedoch ein alter Eichenbaum umstürzt, dann entsteht im Kronendach eine große Lücke. Nun können einige der 1 - 4jährigen Eichen rasch eine größere Höhe erreichen und über die gleichzeitig heranwachsenden Hainbuchenkeimlinge hinauswachsen und mit der Zeit die obere Baumschicht bilden, d.h. der zweischichtige Mischwaldbestand ohne Eichenjungwuchs bleibt dauernd erhalten. Man sieht, daß nur genaue und langfristige Beobachtungen zur Lösung der verschiedenen Fragen beitragen."
"Von den einzelnen Schichten sind allgemein die oberen Schichten, somit die Baumschicht gegenüber der Krautschicht dominant, die Arten der Baumschicht sind die aufbauenden Arten der ganzen Gemeinschaft und bestimmen die Lichtverhältnisse, unter denen die abhängigen Arten der Krautschicht wachsen, ebenso wie die viel ausgeglicheneren Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse der Krautschicht am Waldboden. Durch das abfallende Laub bildet sich über dem mineralischen Boden die Streu- und Humusschicht, in der krautige Arten wurzeln. Daß diese Krautschicht aus mehreren Synusien bestehen kann, wurde bereits erwähnt. Auch diese Krautsynusien sind fast immer Mischbestände, schon weil durch die Lichtflecken am Boden und geringe Unebenheiten mit größerer Feuchtigkeit in den kleinen Senken ein Mikromosaik der Umweltbedingungen besteht. Ganz homogene Flächen gibt es im Wald nicht, insbesondere nicht in natürlichen Wäldern.
Neben den dominanten und abhängigen Arten kommen in einem Bestand auch komplementäre Arten und Synusien vor. Sie ergänzen die Pflanzengemeinschaft, indem sie noch vorhandene freie Nischen im Bestand ausfüllen.
Ein typisches Beispiel für solche komplementäre Arten sind die Frühlingsgeophyten der Laubwälder ...."
"Komplementäre Synusien der Laubwälder sind auch die der Flechten an den Baumstämmen oder die der Moose an der Stammbasis. Sie füllen Nischen aus, die für Blütenpflanzen nicht besiedelbar sind." [Walter ; Breckle, Bd 1, S. 124f.]
Grabherr, Georg:
Farbatlas Ökosysteme der Erde : natürliche, naturnahe und künstliche Land-Ökosysteme aus geobotanischer Sicht. -- Stuttgart : Ulmer, ©1997. -- 364 S. : Ill. -- ISBN 3-8001-3489-6. -- [Anschauliche Einführung]Schultz, Jürgen:
Die Ökozonen der Erde : die ökologische Gliederung der Geosphäre. -- 2., überarb. Aufl. -- Stuttgart : Ulmer, ©1995. -- 535 S. : Ill. -- (UTB ; 1514). -- ISBN 3-8252-1514-8. -- [Aus der Sicht eines Geographen]Walter, Heinrich <1898 - 1989>:
Vegetation und Klimazonen : Grundriß der globalen Ökologie. -- 6., verb. Aufl. -- Stuttgart : Ulmer, ©1990. -- 382 S. : Ill. -- (UTB ; 14). -- ISBN 3-8252-0014-0. -- [Standardwerk]Walter, Heinrich <1898 - 1989> ; Breckle, Siegmar-Walter:
Ökologie der Erde. -- Stuttgart : Fischer. -- (UTB : Große Reihe)
Bd. 1. -- Ökologische Grundlagen in globaler Sicht. -- 2., bearb. Aufl. -- ©1991. -- 238 S. : Ill. -- ISBN 3-437-20454-8
Bd. 2. -- Spezielle Ökologie der tropischen und subtropischen Zonen. -- 2. Aufl. -- ©1990. -- 461 S. : Ill. -- ISBN 3-437-20473-4
Bd. 3. -- Spezielle Ökologie der gemäßigten und arktischen Zonen Euro-Nordasiens. -- 2., überarb. Aufl. -- ©1994. -- 726 S. : Ill. -- ISBN 3-8252-8022-5
Bd. 4. -- Spezielle Ökologie der gemäßigten und arktischen Zonen außerhalb Euro-Nordasiens. -- ©1991. -- 586 S. : Ill. -- ISBN 3-437-20371-1
[Materialreiches Standardwerk]