

mailto: payer@payer.de
Zitierweise / cite as:
Payer, Margarete <1942 - >: Kulturen von Arbeit und Kapital. -- Teil 2: Kapital und Arbeit. -- Fassung vom 2005-11-01. -- URL: http://www.payer.de/arbeitkapital/arbeitkapital02.htm
Erstmals publiziert: 2005-10-18
Überarbeitungen: 2005-11-01 [Ergänzungen]; 2005-10-27 [Aufteilung des Kapitels; Ergänzungen]; 2005-10-26 [Ergänzungen]; 2005-10-21 [Ergänzungen]
Anlass: Lehrveranstaltung an der Hochschule der Medien Stuttgart, Wintersemester 2005/06
Copyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Verfassers.

Diese Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Dieser Text ist Teil der Abteilung Länder und Kulturen von Tüpfli's Global Village Library
Bestandteil dieses Kapitels ist auch:
Payer, Margarete <1942 - >: Internationale Kommunikationskulturen. -- 7. Kulturelle Faktoren: Betriebskulturen und Entscheidungsfindung. 3. Teil III: Arbeitnehmerkoalitionen, Mitbestimmung und Solidaritätsgruppen. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur073.htm
- 7. 1. Betriebskulturen. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur071.htm
- 7.2. Entscheidungsfindung. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur072.htm
- 7.3. Arbeitnehmerkoalitionen, Mitbestimmung und Solidaritätsgruppen. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur073.htm
- 7.4.Beispiele. -- Fassung vom 2001-02-20. -- URL: http://www.payer.de/kommkulturen/kultur074.htm
Arbeit = labour, travail, trabajo, arbeid, praca, 劳动
Kapital = capital, kapitaal, kapitał, pääoma, капитал, 資本, 资本, הון

Abb.: Sinnbild des ungebremsten Kapitalismus: "Ziel dieses Wettrennens ist es,
arme Vorticellen zu verzehren". -- Aus: Grandville, Jean Ignace Isidore Gérard <1803 - 1847>:
Staats und Familienleben der Tiere (1842)

Abb.: Das Weltbild mancher Kapitalseigner
[Quelle der Abb.: Fünfundsiebzig Jahre Industriegewerkschaft : 1891 bis 1966. Vom Deutschen Metallarbeiter-Verband zur Industriegewerkschaft Metall. Ein Bericht in Wort und Bild / [Hrsg.: Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik Deutschland. Geleitw.: Otto Brenner. Red.: Fritz Opel, Dieter Schneider]. -- Frankfurt a. M. : Europäische Verl.-Anst., 1966. -- 493 S. : Ill. ; 30 cm. -- S. 145]
Abb.: "Ich bin ein Proletar". -- In: Süddeutscher Postillon. -- Nr. 6. -- 1902-03
Abb.: Kapital und Arbeit. -- In: Süddeutscher Postillon. -- Nr. 9. -- 1895
"Wenn die Einzelteile mehr wert sind als das gesamte Unternehmen, verdienen die Aktionäre an einer Zerschlagung am meisten. Das ist die Logik des Kapitalmarktes. Reitzle: Man muss mit den Erwartungen an Unternehmen und an Shareholder-Value auf dem Boden bleiben. Heute ist jede Art von Geldanlage, die über 3 Prozent bringt, mit gewissen Risiken verbunden. Wenn ein Unternehmen es schafft, jedes Jahr seinen Wert um 6, 7 oder 8 Prozent zu steigern - das ist doch nicht schlecht.
Es gibt Hedgefonds- und Private-Equity-Manager, die meinen, es wäre noch mehr drin.
Reitzle: Die Leute, die Linde zerschlagen sehen wollen, möchten an einem Tag 30 Prozent oder mehr mit uns verdienen. Dann wären wir im Nachhinein gesehen ein leuchtender Punkt auf dem Computerschirm eines Finanzinvestors, der sagt: Linde, nett, war ein prima Geschäft. Und einen Moment später wäre ein 126 Jahre altes Unternehmen vom Bildschirm verschwunden. Das ist doch kein unternehmerisches Konzept.
Franz Müntefering hätte seine Freude an Ihnen.
Reitzle: Ich habe überhaupt nichts gegen Finanzinvestoren, da gibt es viele vernünftige Leute, die ebenso langfristig denken wie wir. Ich sehe meine Aufgabe darin, nachhaltig Werte zu schaffen, über einen kurzfristigen Shareholder-Value hinaus. Wir wollen auch ein geachtetes Mitglied in der Gesellschaft sein, ein Unternehmen, das sich seiner Verantwortung voll stellt und einen positiven Beitrag leisten für die Gesellschaft."
[Quelle: Interview mit Linde-Chef Wolfgang Reitzle <1949 - >. -- In: Manager Magazin. -- ISSN 0047-5726. -- 35. Jg. (2005), Nr. 9. -- S. 52ff.]

Abb.: Demonstration zum 1. Mai 2005, Mannheim (Bildquelle. Pressefoto DGB)

Abb.: Henry Ford (1863-1947) mit Ford Quadricycle, 1896
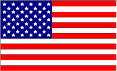
USA-Bezug
"Ford's labor philosophy Henry Ford had very specific thoughts on relations with his employees. On January 5, 1914 Ford announced his five-dollar a day program. The program called for a reduction in length of the workday from 9 to 8 hours and a raise in minimum daily pay from $2.34 to $5 for qualifying workers. Ford labeled the increased compensation as profit sharing rather than wages. The wage was offered to men over the age of 22, who had worked at the company for 6 months or more, and, importantly, conducted their lives in a manner of which Ford approved. The company established a Sociological Department complete with 150 investigators and support staff in order to verify this last point. Even with these requirements a large percentage of workers were able to qualify for the profit sharing.
In 1926, Ford instituted the five-day, forty-hour work-week, effectively inventing the modern weekend. In granting workers an extra day off, Ford ensured leisure time for the working class. The "short week," as Ford called it in a contemporary interview, was required so that the country could "absorb its production and stay prosperous."
Conversely, Ford was adamantly against labor unions in his plants. To forestall union activity, he promoted Harry Bennett, a former Navy boxer, to be the head of the Service Department. Bennett employed various intimidation tactics to squash union organizing. The most famous incident, in 1937, was a bloody brawl between company security men and organizers that became known as The Battle of the Overpass.
Ford was the last Detroit automaker to recognize the United Auto Workers union (UAW). A sit-down strike by the UAW union on April 2, 1941 closed the River Rouge Plant. Under pressure from Edsel and his wife, Clara, Henry Ford finally agreed to collective bargaining at Ford plants, and the first contract with the UAW was signed in June 1941."
[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford. -- Zugriff am 2005-10-03]
Henry Ford schreibt in seiner Autobiographie:
"VIII. KAPITEL: LÖHNE
Nichts ist im Geschäftsleben so weit verbreitet wie die Redensart: „Ich zahle auch die üblichen Löhne." Der gleiche Geschäftsmann würde sich schwer hüten, zu erklären: „Meine Waren sind nicht besser und nicht billiger als die der anderen." Kein Fabrikant würde bei gesundem Verstände behaupten, dass das billigste Rohmaterial gleichzeitig die besten Waren liefert. Warum dann das viele Gerede über die „Verbilligung der Arbeitskraft", über den Vorteil, den ein Sinken der Löhne bringen würde — wäre das nicht gleichbedeutend mit einem Herabdrücken der Kaufkraft und einem Sinken des inneren Marktes? Welchen Nutzen hat die Industrie, wenn sie so ungeschickt geleitet wird, dass sie nicht allen Beteiligten eine menschenwürdige Existenz zu schaffen vermag? Keine Frage ist so wichtig wie die Lohnfrage — die Mehrzahl der Bevölkerung lebt von Löhnen. Ihr Lebens- und Lohnstandard ist maßgebend für den Wohlstand des Landes.
In sämtlichen Fordbetrieben haben wir einen Mindestlohn von sechs Dollar pro Tag eingeführt, früher betrug er fünf Dollar, und zu Anfang zahlten wir, was eben verlangt wurde. Es wäre aber eine schlechte Moral und das schlechteste von allen Geschäftsprinzipien, wollten wir zu dem alten Prinzip des „üblichen Lohns" zurückkehren.
Nehmen wir zuerst die Beziehungen zwischen Arbeit und Kapital. Es ist nicht Sitte, den Angestellten als einen Partner zu bezeichnen, und doch ist er nichts anderes. Jeder Geschäftsmann, der die Leitung seines Geschäftes allein nicht bewältigen kann, nimmt sich einen Gesellschafter, mit dem er sich in die Geschäftsführung teilt. Warum soll der Produzent, der seine Produktion auch nicht allein mit seinen zwei Händen bewältigen kann, denen, die er heranholt, um ihm bei der Produktion zu helfen, den Titel „Gesellschafter" verweigern? Jedes Geschäft, das mehr als einen Menschen zu seiner Führung bedarf, ist eine Art Gesellschaftsverhältnis. In dem Augenblick, in dem ein Geschäftsmann Hilfe zu seinem Geschäft heranzieht — selbst wenn diese nur aus einem Laufjungen besteht — wählt er sich einen Partner. Er selbst mag zwar Alleinbesitzer der Arbeitsmittel und der alleinige Geschäftsführer sein, aber nur wenn er zugleich der alleinige Leiter und Produzent bleibt, kann er den Anspruch völliger Unabhängigkeit stellen. Niemand ist unabhängig, der von der Hilfe eines anderen abhängt. Das Verhältnis ist stets reziprok — der Chef ist der Gesellschafter seines Arbeiters, und der Arbeiter der Partner seines Chefs; daher ist es sinnlos von dem einen oder dem anderen zu behaupten, dass er der allein Unentbehrliche sei. Beide sind unentbehrlich. Wenn der eine sich vordrängt, muss der andere — und schließlich jeder Teil — darunter leiden. Es ist kompletter Unsinn, wenn Kapitel und Arbeit sich als getrennte Parteien betrachten — sie sind Gesellschafter. Arbeiten sie gegeneinander, ziehen sie an zwei verschiedenen Strängen — so schädigt das lediglich die Organisation, an der sie doch beide als Gesellschafter beteiligt sind, und der sie ihren Lebensunterhalt verdanken. Es müsste der Ehrgeiz eines jeden Arbeitgebers sein, höhere Löhne zu zahlen als seine sämtlichen Konkurrenten, und das Streben des Arbeitnehmers, diesen Ehrgeiz praktisch zu ermöglichen. Natürlich sind in jedem Betriebe Arbeiter zu finden, die scheinbar von der Voraussetzung ausgehen, dass jede Mehrleistung lediglich zum Vorteil des Unternehmers beiträgt. Schade, dass ein solcher Glaube überhaupt möglich ist. Aber er besteht tatsächlich und vielleicht sogar nicht ohne Berechtigung. Wenn der Unternehmer seine Leute dazu antreibt, ihr Bestes zu tun, und die Leute entdecken nach einer Weile, dass der Lohn ausbleibt, so werden sie ganz natürlich in ihren Schlendrian zurückfallen. Finden sie aber die Früchte ihrer Arbeit in ihrem Lohnbuch wieder — sehen sie dort den Beweis, dass Mehrleistung zugleich Mehrlohn bedeutet — dann lernen sie auch begreifen, dass sie zum Geschäft gehören, dass der Erfolg des Geschäfts von ihnen und ihr Fortkommen von dem Geschäft abhängt.
„Was soll der Arbeitgeber zahlen?" — „Wieviel der Arbeitnehmer bekommen?" Das sind alles sekundäre Fragen. Die Kernfrage lautet: „Wieviel vermag das Geschäft zu zahlen?" Eines ist klar: kein Geschäft kann höhere Ausgaben als Einnahmen vertragen. Wird der Brunnen rascher ausgepumpt als das Wasser wieder zufließt, so wird er bald ausgetrocknet sein. Und ist der Brunnen versiegt, so müssen die, die aus ihm schöpften, dursten. Wenn sie aber glauben, sie könnten den einen Brunnen ausschöpfen, um dann aus dem nächsten zu trinken, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis alle Brunnen versiegt sind. Die Forderung nach einer gerechteren Lohnausteilung ist zur Zeit allgemein, aber man darf nicht vergessen, dass auch Löhne ihre Grenzen haben. Es lassen sich bei einem Geschäft, dass nur 100.000 Dollar einbringt, nicht100.000 Dollar ausschütten. Das Unternehmen schreibt die Lohngrenzen vor. Aber braucht das Unternehmen selbst begrenzt zu sein? Es zieht sich selber Grenzen, indem es falschen Grundsätzen folgt.
Wenn die Arbeiter statt der Redensart: „Der Unternehmer müsste so und so viel zahlen", lieber erklären wollten: „das Unternehmen müsste auf diese oder jene Weise so geleitet und gefördert werden, dass es so und so viel abwirft," — würden sie weiter kommen. Denn nur das Unternehmen selbst vermag die Löhne auszuzahlen. Jedenfalls ist der Unternehmer dazu außerstande, wenn nicht das Unternehmen dafür bürgt. Weigert sich der Unternehmer jedoch, höhere Löhne zu zahlen, obgleich das Unternehmen dazu in der Lage wäre, was ist dann zu tun? Gewöhnlich ernährt ein Unternehmen zu viele Menschen, als dass man leichtfertig mit ihm umspringen dürfte. Es ist direkt verbrecherisch, ein Unternehmen zu gefährden, dem eine größere Anzahl Menschen ihre Dienste leihen, und das sie als die Quelle ihrer Tätigkeit und ihrer Existenz betrachten. Dadurch, dass man das Unternehmen durch Streik oder Aussperrung tot macht, ist keine Abhilfe geschaffen. Der Arbeitgeber wird niemals dadurch etwas gewinnen, dass eiserne Angestellten vor sich Revue passieren lässt und sich dabei die Frage stellt: „Wie weit vermag ich ihre Löhne zu drücken?" Genau so wenig hilft es dein Arbeitnehmer, wenn er den Unternehmer mit der Faust bedroht und fragt: „Wieviel kann ich aus ihm herauspressen?" Letzten Endes müssen sich beide Teile an das Unternehmen halten und sich die Frage stellen: „Wie kann man der betreffenden Industrie zu einem nutzbringenden und gesicherten Dasein verhelfen, so dass sie uns allen eine sichere und behagliche Existenz bietet?" Aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer denken durchaus nicht immer geradeaus. Die Gewohnheit, kurzsichtig zu handeln, ist schwer zu durchbrechen. Was lässt sich dagegen tun? Nichts! Gesetze und Vorschriften können keine Abhilfe schaffen, nur Aufklärung und das eigne Interesse sind dazu imstande. Es dauert zwar lange, bis die Aufklärung wirkt, aber wirken muss sie ja endlich doch, da das Unternehmen, an dem beide, Arbeitgeber wie -nehmer mit dem gleichen Ziel der Dienstleistung arbeiten, letzten Endes gebieterisch sein Recht verlangt.
Was verstehen wir denn überhaupt unter hohen Löhnen?
Wir verstehen darunter höhere Löhne als vor zehn Monaten oder vor zehn Jahren gezahlt wurden, keineswegs aber einen höheren Lohn, als er von rechtswegen gezahlt
werden müsste. Die hohen Löhne von heute können in zehn Jahren niedrig sein.
Wenn es richtig ist, dass der Leiter eines Unternehmens sich bemüht, die Dividende zu erhöhen, so ist er genau so im Recht, wenn er die Löhne erhöht. Nur ist es nicht der Geschäftsleiter, der die höheren Löhne zahlt. Ist er dazu imstande und tut er es nicht, so liegt die Schuld natürlich an ihm. Er allein jedoch ist niemals imstande, die Löhne zu erhöhen. Hohe Löhne lassen sich nicht zahlen, wenn die Arbeiter sie sich nicht verdienen. Ihre Arbeit ist das produktive Element. Sie ist nicht der alleinige produktive Faktor — eine schlechte Geschäftsführung wird Arbeit und Material vergeuden und die Früchte der Arbeit zuschanden machen. Die Arbeiter vermögen wiederum die Früchte einer guten Geschäftsführung zu vernichten. Wo jedoch geschickte Geschäftsführung und ehrliche Arbeit Gesellschafter sind, ist es der Arbeiter, der die hohen Löhne möglich macht. Er zahlt seine Kraft und sein Können ein, und wenn er die Einlage ehrlich einzahlt, hat er auch Anspruch auf ehrliche Entlohnung. Er hat sie sich nicht nur verdient, er hat sogar viel dazu beigetragen, sie zu schaffen.
Zuvor muss jedoch klar erkannt werden, dass die Voraussetzung zu hohen Löhnen in den Fabrikräumen selbst geschaffen wird. Ist das nicht der Fall, dann kann der hohe Lohn auch nicht in die Lohnbücher wandern. Ein System, die Arbeit zu umgehen, lässt sich nicht erfinden. Dafür hat die Natur gesorgt. Müßige Hände und Füße waren uns nicht zugedacht. Die Arbeit ist in unserm Dasein Grundbedingung für Gesundheit, Selbstachtung und Glück. Statt ein Fluch ist sie der größte Segen. Strenge soziale Gerechtigkeit entspringt nur aus ehrlicher Arbeit. Wer viel schafft, soll viel nach Hause tragen. Wohltätigkeit hat in der Lohnfrage keinen Raum. Der Arbeiter, der dem Unternehmen sein Bestes gibt, ist auch für das Unternehmen der Beste. Eine Qualitätsleistung kann man von ihm aber auf die Dauer ohne entsprechende Anerkennung nicht verlangen. Der Arbeiter, der mit dem Gefühl an sein Tagewerk herangeht, dass es ihm trotz aller Anstrengung niemals genug einbringen wird, um den Mangel von ihm fernzuhalten, ist nicht in der Verfassung, sein Tagewerk gut zu leisten. Er ist von Angst und Sorge erfüllt, die seiner Arbeit schaden.
Fühlt der Arbeiter dagegen, dass sein Tagewerk ihm nicht nur die Lebensnotdurft, sondern darüber hinaus noch die Möglichkeit gewährt, seine Jungens und Mädels etwas lernen zu lassen und seiner Frau Vergnügen zu verschaffen, dann ist ihm die Arbeit ein guter Freund, und er wird sein Bestes hergeben. Und das ist für ihn und für das Geschäft gut. Dem Arbeiter, der seinem Tagewerk nicht eine gewisse Befriedigung abgewinnt, geht der beste Teil seines Lohnes verloren.
Denn es ist etwas Großes um unser Tagewerk — etwas ganz Großes! Die Arbeit ist der Eckstein, auf dem die Welt ruht, sie ist die Wurzel unserer Selbstachtung. Und der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein noch größeres Tagewerk zu leisten als seine Leute. Der Unternehmer, der seine Pflicht der Welt gegenüber ernst nimmt, muss auch ein tüchtiger Arbeiter sein. Er darf nicht sagen: „Ich lasse so und so viele tausend Menschen für mich arbeiten." In Wahrheit liegen die Dinge so, dass er für die Tausende von Menschen arbeitet — und je bessere Arbeit die Tausende wiederum leisten, um so mehr wird er sich rühren müssen, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Löhne und Gehälter werden auf eine bestimmte Summe festgesetzt — und das muss auch so sein, um eine feste Kalkulationsbasis zu schaffen. Löhne und Gehälter sind also eigentlich weiter nichts, als ein bestimmter, im voraus bezahlter Gewinnanteil; häufig stellt sich jedoch bei Jahresschluss heraus, dass ein größerer Gewinn ausbezahlt werden kann. Und dann müsste er ausbezahlt werden! Wer an einem Geschäfte mitarbeitet, hat auch Anspruch auf einen Teil des Gewinnes, sei es in Form eines anständigen Lohnes oder Gehaltes oder einer Extravergütung. Dieser Grundsatz beginnt ja auch ganz allgemein Anerkennung zu finden.
Heute stellen wir bereits die bestimmte Forderung, dass der menschlichen Seite des Geschäftslebens die gleiche Bedeutung wie der materiellen einzuräumen ist. Und wir sind auf dem besten Wege, diese Forderung zu erfüllen. Fraglich ist nur, ob wir hierzu auch den richtigen Weg beschreiten werden — einen Weg, der uns die materielle Seite, die heute unsere Stütze ist, erhält — oder einen Irrweg, der uns alle Früchte der Arbeit vergangener Jahre entreißen wird. Unser Geschäftsleben repräsentiert unser Dasein als Nation, es ist der Spiegel unseres wirtschaftlichen Fortschritts und schafft uns unsere Stellung unter den Völkern. Wir dürfen es nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Was uns fehlt, ist die Rücksicht auf das menschliche Element in unserm Geschäftsleben. Sicherlich werden wir aber auch ohne gewaltsame Umgruppierung, ohne Schädigung des Einzelnen, ja zum wachsenden Vorteil von jedermann unser Ziel erreichen. Und die Lösung des Ganzen liegt in der Anerkennung des Gesellschafterverhältnisses der Menschen untereinander. Bis nicht jedermann sich selbst völlig genug ist und jeder menschlichen Hilfe entraten kann, können wir ohne dieses Gesellschaftsverhältnis nicht auskommen.
Das sind die grundlegenden Wahrheiten der Lohnfrage. Alles ist nur eine Frage der Gewinnverteilung unter Gesellschaftern.
Wie hoch muss ein Durchschnittslohn eigentlich sein? Welche Art von Lebensführung kann man billigerweise als Entgelt für die Tagesarbeit beanspruchen? Habt ihr euch jemals überlegt, was ein Lohn von rechtswegen alles bestreiten muss? Die Antwort: den Lebensunterhalt, will gar nichts besagen. Die Kosten des Lebensunterhaltes sind zum großen Teil von der Leistungsfähigkeit des Produklions- und Transportwesens abhängig, und die Leistungsfähigkeit des Produktions- und Transportwesens wiederum von der gesunden Geschäftsführung und den Leistungen der Arbeiter. Gute, tüchtig geleistete Arbeit müsste von rechtswegen hohe Löhne und niedrige Kosten des Lebensunterhaltes zeitigen. Der Versuch, die Löhne nach den Lebensunterhaltskosten zu regulieren, führt zu nichts. Die Kosten des Lebensunterhalts stellen nur ein Resultat dar, und wir können nicht erwarten, ein Resultat konstant zu erhalten, wenn wir die Faktoren, von denen es abhängig ist, ständig verändern. Wenn wir die Löhne den Lebensunterhaltskosten anzupassen versuchen, gleichen wir dem Hunde, der sich selbst in den Schwanz beißt. Wer wäre außerdem kompetent, zu bestimmen, welche Art von Lebensstandard als Grundlage dienen soll? Lieber wollen wir unsern Gesichtskreis erweitern und erst einmal untersuchen, was der Durchschnittslohn für den Arbeiter bedeutet — und was er eigentlich bedeuten müsste.
Der Lohn muss sämtliche Verpflichtungen des Arbeiters außerhalb der Fabrik decken; innerhalb der Fabrik deckt er alles, was der Arbeiter an Arbeit und Denken leistet. Das produktive Tagewerk ist die unerschöpflichste Goldmine, die jemals erschlossen wurde. Daher sollte der Lohn zum mindesten die äußeren Verpflichtungen des Arbeiters decken. Nicht minder aber muss es ihn der Sorge um seinen Lebensabend entheben, wenn er nicht mehr arbeiten kann — und von Rechts wegen auch nicht mehr arbeiten dürfte. Aber selbst um dieses Wenige zu erreichen, muss die Industrie nach einem neuen Schema der Produktion, der Verteilung und der Entlohnung umorganisiert werden, um auch die Löcher in den Taschen derer zuzustopfen, die keine produktive Arbeit leisten. Es gilt ein System zu schaffen, das sowohl von dem guten Willen wohlmeinender wie von der Böswilligkeit egoistischer Arbeitgeber unabhängig ist. Dazu ist aber erste Voraussetzung, die Basis der Wirklichkeit zu finden.
Ein Tag Arbeit erfordert die gleiche Menge Kraft, ob nun der Scheffel Weizen einen Dollar oder 2½ Dollar, das Dutzend Eier 12 oder 90 Cents kostet. Welche Wirkung haben diese auf die Kräfteeinheiten, die ein Mann zu einem Tag produktiver Arbeit braucht?
Handelte es sich hierbei lediglich um den Mann selbst, um die Kosten seines eigenen Unterhalts und den ihm rechtmäßig zustehenden Gewinn, so wäre das ganze eine recht einfache Sache. Aber er ist ja kein Individuum für sich. Er ist zugleich ein Staatsbürger, der seinen Teil zum Gedeihen der Nation beiträgt. Er ist ein Haushaltungsvorstand, vielleicht der Vater von Kindern, die er von seinem Verdienst etwas Nützliches lernen lassen muss. Wir müssen alle diese Tatsachen mit in Betracht ziehen. Wie sollen wir die Leistungen bewerten und berechnen, die das Heim, die Familie zum Tagewerk beitragen? Wir bezahlen den Mann für seine Arbeit; wieviel ist die Arbeit indes dem Heim, der Familie schuldig? Wieviel seiner Stellung als Staatsbürger? Wieviel seiner Eigenschaft als Vater? Der Mann leistet seine Arbeit in der Fabrik, die Frau ihre Arbeit zu Hause. Die Fabrik muss beide bezahlen. Nach welchem Prinzip sollen die Leistungen von Heim und Familie ihren Platz auf der Ausgabenseite unseres Tagewerkkontos zugewiesen erhalten? Sollen des Mannes eigne Unterhaltskosten als „Ausgaben" und die Tätigkeit, ein Heim und eine Familie zu unterhalten, als „Überschuss", als „Gewinn" gebucht werden? Oder soll der Gewinn aus seinem Tagewerk streng nach dem Bargeldbestand berechnet werden, nach dem, was übrig bleibt, nachdem der Mann seine und seiner Familie Bedürfnisse befriedigt hat? Oder sind alle diese privaten Verpflichtungen ausschließlich auf der Ausgabenseite und der Gewinn gänzlich losgelöst von ihnen zu berechnen? Das heißt, hat der arbeitende Mensch nach der Erfüllung seiner Verpflichtungen gegen sich selbst und seine Familie, nachdem er sie und sich selbst gekleidet, versorgt, erzogen und mit den seinem Lebensstandard angemessenen Vorrechten versehen hat, noch Anspruch auf einen Überschuss in Gestalt von Gewinnersparnissen? Und hat all dies dem Konto unseres Tagewerks zur Last zu fallen? Ich glaube, ja! denn sonst hätten wir den grauenvollen Anblick von Kindern und Müttern, die zum Frondienst außerhalb des Hauses gezwungen werden.
Alle diese Fragen erfordern eine genaue Untersuchung und Berechnung. Vielleicht bringt kein einziger Faktor unseres Wirtschaftslebens mehr Überraschungen als die exakte Berechnung der Kosten, die unser Tagewerk zu tragen hat.
Vielleicht lässt sich der Energieverbrauch des Mannes bei der Verrichtung seines Tagewerks — wenn auch nicht ohne beträchtliche Störungen — genau berechnen. Aber es dürfte unmöglich sein, den Aufwand zu berechnen, der dazu nötig ist, ihn für die Forderungen des nächsten Tages zu stählen; und ebensowenig lässt sich die natürliche und unersetzliche Kraftabnutzung jemals bestimmen. Die nationalökonomische Wissenschaft hat bisher noch keinen Entschädigungsfond für die schwindenden Kräfte des von seinem Tagewerk erschöpften arbeitenden Mannes geschaffen. Zwar lässt sich eine Art Fond in der Form von Altersrenten gründen. Aber Renten und Pensionen nehmen keinerlei Rücksicht auf den Überschuss, der sich aus dem Tagewerk ergeben müsste, um die besonderen Bedürfnisse, die physischen Einbußen und die unvermeidliche Kräfteverminderung des manuellen Arbeiters zu tragen.
Der höchste, bisher gezahlte Lohn ist immer noch lange nicht hoch genug. Unsere Volkswirtschaft ist noch nicht genügend durchorganisiert, und ihre Ziele sind noch zu unklar, um mehr als nur einen Bruchteil der Löhne zahlen zu können, die eigentlich gezahlt werden müssten. Hier gibt es noch viel Arbeit zu verrichten. Mit dem Gerede über Abschaffung der Löhne und Aufrichtung des Kommunismus rücken wir der Lösung nicht näher. Das Lohnsystem bietet bisher die einzige Möglichkeit, um Produktionsbeiträge nach ihrem Werte zu entlohnen. Nehmt den Lohnstandard fort, und die Ungerechtigkeit wird herrschen. Vervollkommnet das Lohnsystem, und wir ebnen der Gerechtigkeit die Wege.
Im Laufe der Jahre habe ich ziemlich viel in der Lohnfrage gelernt. Vor allem glaube ich, dass, abgesehen von allem andern, unser eigner Absatz bis zu einem gewissen Grade von den Löhnen, die wir zahlen, abhängig ist. Sind wir imstande, hohe Löhne auszuschütten, wird auch wieder mehr Geld ausgegeben, das dazu beiträgt, Ladeninhaber, Zwischenhändler, Fabrikanten und Arbeiter anderer Industriezweige wohlhabender zu machen, und ihre Wohlhabenheit wird auch auf unsern Absatz Einfluss haben. Hohe Löhne aller Orten sind gleichbedeutend mit allgemeinem Wohlstand, vorausgesetzt natürlich, dass die hohen Löhne eine Folge erhöhter Produktion sind. Eine Erhöhung der Löhne und Herabsetzung der Produktionsmenge wäre der Anfang zu einem Rückgang des Wirtschaftslebens.
Wir brauchen einige Zeit, um uns in der Lohnfrage zurechtzufinden. Erst als auf Grund unseres ,,T-Modells" die eigentliche Produktion begonnen hatte, hatten wir Gelegenheit auszurechnen, wie hoch die Löhne eigentlich sein müssten. Vordem hatten wir aber bereits eine bestimmte „Gewinnbeteiligung" eingeführt. Wir hatten nach jedem Jahresabschluss einen gewissen Prozentsatz unseres Reingewinnes unter die Arbeiter verteilt. So waren z. B. bereits im Jahre 1909 80.000 Dollar auf Grund der Arbeitsjahre der Arbeitnehmer zur Austeilung gelangt. Wer ein Jahr in unseren Diensten stand, erhielt 5% seines Jahreseinkommens; bei zweijähriger Arbeitszeit wurden 7½% und bei dreijähriger 10% auf das Jahreseinkommen aufgeschlagen. Der einzige Einwand gegen diesen Verteilungsplan war, dass er in keinerlei Beziehungen zu dem Tagewerk des Einzelnen stand. Die Arbeiter erhielten ihren Anteil erst lange, nachdem ihr Tagewerk vorüber war, und zwar als eine Art von Geschenk. Es ist aber stets unerwünscht, Wohltätigkeit mit der Lohnfrage zu verquicken.
Außerdem waren die Löhne hierbei in keinerlei Weise den Leistungen angepasst. Der Arbeiter, der Verrichtung „A" zu erfüllen hatte, konnte einen niedrigeren Lohn erhalten, als sein Genosse bei Verrichtung „B", während in Wahrheit „A" vielleicht vielmehr Geschick und Kraft beanspruchte als „B". Ungleichheit schleicht sich nur zu leicht in die Lohnfrage ein, wenn nicht Arbeitgeber wie Arbeitnehmer wissen, dass der Lohn auf etwas Bestimmterem als auf bloßer Schätzung beruht. So fingen wir denn 1913 an, über die vielen Tausende von Verrichtungen in unseren Betrieben Zeitmessungen anzustellen. Durch Zeitmessungen dürfte es theoretisch möglich sein, zu bestimmen, wie groß die Produktionsmenge des Einzelnen sein muss. Bei weitherziger Abschätzung lässt sich auch eine bestimmte Produktionsmenge für den Tag festsetzen und bei genügender Berücksichtigung der Geschicklichkeitsanforderungen ein Wertmesser bestimmen, der mit einiger Genauigkeit den Aufwand an Geschicklichkeit und Kraft anzeigt, den die einzelnen Verrichtungen beanspruchen, um danach die Leistung zu errechnen, die als Entgelt für die Löhnung billigerweise von dem Arbeiter verlangt werden darf. Ohne sachgemäßes Studium weiß weder der Arbeitgeber, weshalb er die Löhnung bezahlt, noch der Arbeitnehmer, weshalb er sie erhält. Auf Grund dieser Zeitlabellen wurden sämtliche Verrichtungen unseres Betriebes normalisiert und die Löhne bestimmt.
Stückarbeit gibt es bei uns nicht. Zum Teil werden die Leute stunden-, zum Teil tageweise bezahlt, in fast allen Fällen wird aber eine bestimmte Produktionsnorm verlangt, von der man erwartet, dass der Arbeiter sie einhalten wird. Andernfalls würde weder der Arbeiter noch wir wissen ob die Löhnung wirklich verdient wird. Eine bestimmte Arbeitsmenge muss täglich geleistet werden, bevor ein richtiger Lohn gezahlt werden kann. Wachleute werden für ihre Gegenwart gezahlt, Arbeiter für ihre Arbeit.
An Hand dieser feststehenden Tatsachen wurde im Januar 1914 eine Art Gewinnbeteiligungsplan angekündigt und in die Tat umgesetzt. Der Mindestlohn wurde für jede Art von Arbeit unter gewissen Bedingungen auf 5 Dollar pro Tag fixiert. Gleichzeitig setzten wir den Arbeitstag von neun auf acht Stunden und die Arbeitswoche auf achtundvierzig Arbeitsstunden herab. Das alles geschah aus freien Stücken. Alle unsere Lohnsätze sind freiwillig von uns eingeführt worden. Unserer Meinung nach entsprach dies der Gerechtigkeit, letzten Endes gebot es aber auch unser eigener Vorteil. Das Gefühl, andere glücklich zu machen — bis zu einem gewissen Grade die Lasten seiner Mitmenschen zu erleichtern, einen Überschuss schaffen zu können, aus dem sich Freude und Ersparnis schöpfen lassen, — ist stets beglückend. Guter Wille gehört zu den wenigen wirklich wichtigen Dingen des Lebens. Der zielbewusste Mensch vermag fast alles zu erreichen, was er sich vorgenommen hat, versteht er dabei aber nicht auch guten Willen zu erzeugen, so wird er nicht viel gewonnen haben.
Bei all dem war jedoch keinerlei Wohltätigkeit im Spiele. Das war nicht allen ganz klar. Viele Unternehmen glaubten, wir hätten die Ankündigung nur erlassen, weil wir gute Geschäfte gemacht hätten und weitere Reklame brauchten, und verurteilten uns scharf, weil wir die Sitte über den Haufen warfen, den üblen Brauch, dem Arbeiter gerade nur so viel, oder vielmehr so wenig zu zahlen, als er zu, nehmen bereit war. Derartige Sitten und Gebräuche taugen nichts; sie müssen und werden auch einmal überwunden weiden. Sonst werden wir die Armut nicht aus der Welt schaffen. Wir führten die Änderung nicht nur ein, weil wir höhere Löhne zahlen wollten und zahlen zu können glaubten, wir wollten die hohen Löhne zahlen, um unser Unternehmen auf eine bleibende Basis zu stellen. Das Ganze war keine Verteilung — wir bauten nur für die Zukunft vor. Ein schlechtzahlendes Unternehmen ist stets ein unsicheres Geschäft.
Wenig industrielle Ankündigungen haben wohl so viele Kommentare in allen Teilen der Welt hervorgerufen wie die unsere; dennoch wurde sie kaum von jemand richtig verstanden. Die Arbeiter glaubten ganz allgemein, sie würden 5 Dollar Tageslohn erhalten, ganz gleich, welche Arbeit sie leisteten.
Die Tatsachen entsprachen nicht ganz dem allgemeinen Eindruck. Der Gedanke war, den Gewinn zu verteilen. Statt aber zu warten, bis der Gewinn eingekommen war, berechneten wir ihn, so gut es ging, im voraus, um ihn unter gewissen Voraussetzungen dem Lohn derer zuzuschlagen, die mindestens seit einem halben Jahr im Dienste der Gesellschaft standen. Die Beteiligung erfolgte in drei Klassen und war in jeder verschieden. Diese Klassen bestanden aus:
- Verheirateten Leuten, die mit ihrer Familie zusammen lebten und sie gut versorgten.
- Ledigen Männern über zweiundzwanzig mit nachweislich haushälterischen Gewohnheiten.
- Jungen Männern unter zweiundzwanzig und Frauen, die die einzige Stütze irgendwelcher Angehörigen waren.
Vorerst erhielt der Arbeiter seinen gerechten Lohn ausgezahlt, — der damals durchschnittlich 15% höher war als der übliche Tagelohn. Daneben hatte er Anspruch auf einen gewissen Gewinnanteil. Lohn plus Gewinnanteil waren so berechnet, dass er einen Mindestlohn von 5 Dollar pro Tag erhielt. Der Gewinnanteil wurde auf einer Stundenbasis berechnet und dem Stundenlohn akkreditiert, so dass die, die den niedrigsten Stundenlohn erhielten, den größten Gewinnanteil empfingen, der ihnen vierzehntägig zusammen mit der Löhnung ausbezahlt wurde. So erhielt z.B. ein Arbeiter, der 34 Cent die Stunde verdiente, einen Gewinnanteil von 28½ Cent die Stunde, also einen Tagesverdienst von 5 Dollar. Wer 54 Cent die Stunde verdiente, erhielt einen Stundengewinn von 21 Cent — sein Tageseinkommen betrug 6 Dollar.
Das Ganze war eine Art von Wohlstandsbeteiligungsplan, an den sich bestimmte Bedingungen knüpften. Der Arbeiter und sein Heim mussten einem gewissen Standard von Sauberkeit und Staatsbürgertum genügen. Patriarchalische Absichten lagen uns fern! Trotzdem entwickelte sich eine Art patriarchalischen Verhältnisses; und das ist der Grund, weswegen der ganze Plan und unsere Abteilung für soziale Fürsorge umorganisiert wurden. Die ursprüngliche Idee war jedoch, einen direkten Ansporn zu besserer Lebensführung zu schaffen, und der beste Ansporn lag nach unserer Ansicht in einer Geldprämie. Wer richtig lebt, leistet auch richtige Arbeit. Außerdem wollten wir verhindern, dass der Standard der Arbeitsleistung durch eine Erhöhung der Löhne herabgeschraubt würde. Der Krieg hat den Beweis dafür geliefert, dass eine allzu rasche Lohnerhöhung mitunter nur die Habgier der Menschen weckt, seine Leistungsfähigkeit jedoch mindert. Hätten wir daher anfänglich den Mehrverdienst einfach in das Zahlkuvert hineingesteckt, wäre der Leistungsstandard aller Wahrscheinlichkeit nach zusammengebrochen. Bei ungefähr der Hälfte der Arbeiter wurde der Lohn auf Grund des neuen Planes verdoppelt; die Gefahr bestand, diese Mehreinnahme als „leichtverdientes Geld" zu betrachten. Ein solcher Gedanke untergräbt aber unweigerlich die Arbeitsleistung. Es ist gefährlich, Löhne allzu rasch zu erhöhen — ganz gleich, ob der betreffende bisher einen oder hundert Dollar pro Tag verdient hat. Im Gegenteil, steigt das Gehalt des Hundertdollarmannes über Nacht auf dreihundert Dollar, so ist zehn gegen eins zu wetten, dass er größere Dummheiten begehen wird, als der Arbeiter,
dessen Verdienst von einem auf drei Dollar die Stunde erhöht wird.
Die vorgeschriebenen Arbeitsnormen waren nicht kleinlich — wenn sie mitunter vielleicht auch auf eine kleinliche Weise angewendet wurden. In der Abteilung für soziale Fürsorge waren rund fünfzig Inspizienten beschäftigt, alle durchschnittlich mit ungewöhnlich starkem, gesunden Menschenverstand begabt. Zwar machten auch sie mitunter Missgriffe — es sind immer die Missgriffe, die einem zu Ohren kommen. Vorschrift war, dass die verheirateten Leute, um die Prämie zu erhalten, bei ihren Familien wohnen und für sie sorgen mussten. Es galt erst einmal, gegen die bei den Ausländern weitverbreitete Sitte, Mieter und Kostgänger ins Haus zu nehmen, Front zu machen. — Sie betrachteten ihr Heim als eine Art Institution, aus der sich Kapital schlagen ließ, nicht als Stätte zum wohnen. Junge Leute unter achtzehn Jahren, die Angehörige unterhielten, empfingen gleichfalls eine Prämie, ebenso ledige Männer mit gesundem Lebenswandel. Den besten Beweis für den heilsamen Einfluss unseres Systems liefert die Statistik. Bei der Inkraftsetzung unseres Planes wurden sofort 60% der Männer als anteilsberechtigt befunden; der Prozentsatz erhöhte sich nach sechs Monaten auf 78% und nach einem Jahre auf 87%; während nach anderthalb Jahren nur ein Bruchteil von einem Prozent die Prämie nicht erhielt.
Die Lohnerhöhung erzielte andere Resultate. 1914, als der erste Plan in Kraft trat, hatten wir i/jooo Angestellte, und es war notwendig gewesen, jährlich 53.000 Mann einzustellen, um das Arbeiterkontingent auf der Höhe von 14.000 Mann zu halten. 1915 mussten wir nur 6.508 Mann einstellen, und die meisten wurden engagiert, weil unser Unternehmen gewachsen war. Bei dem alten Arbeiterumsatz und unserm gegenwärtigen Bedarf würden wir heute gezwungen sein, jährlich rund 200.000 Mann einzustellen — was so gut wie unmöglich wäre. Selbst bei der verschwindend geringen Lehrzeit, die zum Erlernen fast unserer sämtlichen Verrichtungen notwendig ist, wäre es doch unmöglich, allmorgendlich, wöchentlich oder monatlich neues Personal einzustellen; denn obgleich unsere Arbeiter meist nach zwei, drei Tagen bereits annehmbare Arbeit in einem annehmbaren Tempo zu verrichten imstande sind, leisten sie nach einjähriger Übung doch Besseres als zu Anfang. Die Frage des Arbeiterumsatzes hat uns seither denn auch kein Kopfzerbrechen bereitet; genaue Angaben lassen sich hier nur schwer machen, da wir einen Teil der Arbeiter ihre Posten wechseln lassen, um die Arbeit unter einer möglichst großen Anzahl zu verteilen. Daher ist es schwer, zwischen freiwilligem und unfreiwilligem Abgang zu unterscheiden. Heute führen wir auf diesem Gebiete überhaupt keine Statistik mehr, da uns die Personalwechselfrage so wenig interessiert. So viel wir wissen, beträgt der Personalwechsel monatlich etwa 3 bis 6%.
Wir haben an dem System zwar einiges geändert, aber das Prinzip ist das gleiche geblieben:„Wird von jemandem verlangt, dass er seine Zeit und Energie für eine Sache hergibt, so sorge man dafür, dass er keine finanziellen Schwierigkeiten hat. Es wird sich lohnen. Unsere Gewinne beweisen, dass trotz anständiger Löhne und einer Prämienzahlung, die sich vor Änderung unseres Systems auf rund zehn Millionen Dollar jährlich belief, hohe Löhne das Einträglichste aller Geschäftsprinzipien sind."
Gegen die Methode der Lebensführungsprämie in der Lohnzahlung lässt sich vieles einwenden. Sie führt zu einer gewissen patriarchalischen Bevormundung. Und für Patriarchentum ist in der Industrie kein Platz. Fürsorge, die darin besteht, dass man sich in die intimsten Angelegenheiten des Arbeiters einmischt, ist gleichfalls unmodern geworden. Die Arbeiter brauchen Rat und Hilfe, sogar häufig eine ganz besondere Hilfe, und sie sollte ihnen schon aus Anstandspflicht gegeben werden. Der praktisch auf breiter Basis durchgeführte Plan der Investierung und Beteiligung wird jedoch mehr dazu beitragen, die Industrie zu konsolidieren und die Organisation zu stärken, als jede soziale Arbeit von außen her.
Ohne Änderung des Prinzips haben wir doch die Zahlungsmethode geändert."[Quelle: Ford, Henry <1863-1947>: Mein Leben und Werk. -- Leipzig : List, 1923. -- VIII, 328 S. ; 25 cm. -- Originaltitel: My life and work (1922). -- S. 135 - 152.]
Dieser Teil umfasst folgende Kapitel:
Zu Kapitel 1: Mitbestimmung